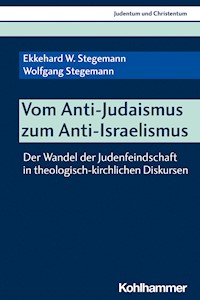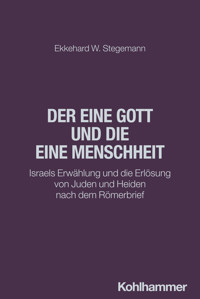
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ekkehard W. Stegemann hat in seiner bislang unveröffentlichten Heidelberger Habilitationsschrift aus dem Jahr 1981 Grundlagen zum Verständnis des Römerbriefs, der Theologie des Paulus und des theologischen Denkens im Hinblick auf das Verhältnis von Judentum und Christentum erarbeitet - Themen, die bis heute für die wissenschaftliche Diskussion und den gesellschaftlichen Diskurs von hoher Relevanz sind. Paulus ringt damit, wie die unwiderrufliche Erwählung Israels angesichts dessen zu verstehen ist, dass die meisten seiner jüdischen ZeitgenossInnen in Jesus nicht den Messias aus dem Haus David sahen. Was bedeutet das für das Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Menschen in der Nachfolge Jesu? Wie verhalten sich "Kirche" und "Israel" zueinander? Stegemann zeigt, wie sich die Antworten des Paulus vom Antijudaismus der christlichen Rezeption unterscheiden. Durch seine Lehre, seine Veröffentlichungen sowie sein Engagement im christlich-jüdischen Dialog prägte Stegemann nicht nur die Theologie, sondern beeinflusste auch eine ganze Generation von Pfarrerinnen und Theologen. Unter dem Titel "Exegese im Angesicht Israels" ordnet Prof. Dr. Esther Kobel (Mainz) die Habilitationsschrift sowohl forschungsgeschichtlich als auch in das Lebenswerk Stegemanns ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Judentum und Christentum
Herausgegeben von
Kathy EhrenspergerSoham Al-Suadi
Band 33
Ekkehard W. Stegemann
Der eine Gott und die eine Menschheit
Israels Erwählung und die Erlösung von Juden und Heiden nach dem Römerbriefmit einer Einführung von Esther Kobel
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-045751-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-045752-2
epub: ISBN 978-3-17-045753-9
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Ekkehard W. Stegemann hat in seiner bislang unveröffentlichten Heidelberger Habilitationsschrift aus dem Jahr 1981 Grundlagen zum Verständnis des Römerbriefs, der Theologie des Paulus und des theologischen Denkens im Hinblick auf das Verhältnis von Judentum und Christentum erarbeitet & Themen, die bis heute für die wissenschaftliche Diskussion und den gesellschaftlichen Diskurs von hoher Relevanz sind.
Paulus ringt damit, wie die unwiderrufliche Erwählung Israels angesichts dessen zu verstehen ist, dass die meisten seiner jüdischen ZeitgenossInnen in Jesus nicht den Messias aus dem Haus David sahen. Was bedeutet das für das Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Menschen in der Nachfolge Jesu? Wie verhalten sich »Kirche« und »Israel« zueinander? Stegemann zeigt, wie sich die Antworten des Paulus vom Antijudaismus der christlichen Rezeption unterscheiden.
Durch seine Lehre, seine Veröffentlichungen sowie sein Engagement im christlich-jüdischen Dialog prägte Stegemann nicht nur die Theologie, sondern beeinflusste auch eine ganze Generation von Pfarrerinnen und Theologen.
Unter dem Titel »Exegese im Angesicht Israels« ordnet Prof. Dr. Esther Kobel (Mainz) die Habilitationsschrift sowohl forschungsgeschichtlich als auch in das Lebenswerk Stegemanns ein.
Prof. Dr. Ekkehard W. Stegemann (1945-2021), zuletzt Professor für Neues Testament an der Universität Basel.
Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
Zu dieser Ausgabe
Mit der Veröffentlichung von Ekkehard W. Stegemanns bisher unveröffentlichter Habilitationsschrift wird diese wichtige Arbeit einer breiten interessierten Leserschaft zugänglich gemacht. Obschon sie vor beinahe einem halben Jahrhundert fertiggestellt wurde, spricht hier Stegemanns Stimme mit erstaunlicher Aktualität in den gegenwärtigen Paulus-Diskurs hinein. Dass diese Veröffentlichung möglich wurde, ist vielen zu verdanken.
Ursula Stegemann, Ekkehards Witwe, sowie seine Söhne Oliver und Benjamin, haben nicht nur ihre Zustimmung zum Projekt gegeben, sondern dieses während der ganzen Monate der Vorbereitung dieser Ausgabe in jeder Hinsicht unterstützt.
Dr. Sebastian Weigert erkannte weitsichtig, dass dieses Werk nicht nur von historischem Interesse ist, sondern auch in Bezug auf aktuelle Debatten in der Paulusforschung, insbesondere der Römerbriefforschung, einen wichtigen Beitrag leistet. Andrea Häuser hat die Retrodigitalisierung des Manuskripts betreut und in hochqualifizierter Detailarbeit sichergestellt, dass die Druckfassung nun so originalgetreu wie möglich vorliegt. Dabei wurde das maschinengeschriebene Manuskript an die üblichen typografischen Standards angepasst, aber nicht an die neue Rechtschreibung angeglichen. Es wurden nur offensichtliche Fehler in der Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik korrigiert, von denen einige auf handschriftliche Änderungen von Stegemann selbst zurückgehen. Aus technischen Gründen wurde außerdem die Überschrift »1 Forschungsgeschichtlicher Überblick« in § 1 eingefügt. Die Literatur wurde im Rahmen dieser Ausgabe nicht eigens überprüft, jedoch in einzelnen Fällen vergessene Einträge im Literaturverzeichnis ergänzt. Um einen Eindruck vom Original zu vermitteln, hat Patricia Nüssle Fotografien angefertigt und für den Band zur Verfügung gestellt.
Prof. Dr. Esther Kobel gibt in ihrer Einführung einen Einblick in die Motivation Stegemanns, den Römerbrief mit Blick auf das Judentum zu lesen und die exegetischen »Wahrheiten« seiner Zeit, deren zufolge dem Brief eine Abwertung des Judentums als bloßer Gesetzesreligion inhärent ist, infrage zu stellen. Sie zeichnet den Verlauf des Habilitationsverfahrens nach, bettet das Werk in seinen forschungsgeschichtlichen Kontext ein und verortet die Arbeit Rahmen der gegenwärtigen Paulusforschung.
Die Veröffentlichung dieser Arbeit wurde durch den großzügigen finanziellen Beitrag der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft beider Basel, der Ekkehard W. Stegemann über viele Jahre als Präsident vorstand, ermöglicht.
Allen Beteiligten sei hiermit ein großer Dank ausgesprochen!
Die Reihenherausgeberinnen
Prof. Dr. Kathy Ehrensperger
Prof. Dr. Soham Al-Suadi
Inhalt
Zu dieser Ausgabe
Vorwort
Exegese im Angesicht Israels: Ekkehard W. Stegemanns Habilitationsschrift
Esther Kobel
Einleitung
§ 1 Der Zweck des Römerbriefes
1 Forschungsgeschichtlicher Überblick
1.1 Die konsequent historische Interpretation des Römerbriefes durch F. Chr. Baur
1.2 Die Umkehrung der historischen Thesen Baurs durch W. Lütgert
1.3 Neuere historische Forschung zum Abfassungszweck des Römerbriefes
2 Die Spannung zwischen Verkündigungsabsicht und Nichteinmischungsprinzip im brieflichen Rahmen
2.1 Die Hypothese von G. Klein und ihre literarkritische Variation bei W. Schmithals
2.2 Die Hypothese von P. von der Osten-Sacken
3 Der Römerbrief als Dialog des Völkerapostels mit der Gemeinde in Rom über das Evangelium angesichts seiner geschichtlichen Wirksamkeit
3.1 Der Zweck des Rombesuches und des ihm vorangehenden Briefes nach Präskript und Proömium (Röm 1,1–16)
3.2 Der Zweck des Rombesuches und des ihm vorausgehenden Briefes nach den Angaben des Postskripts (Röm 15,14–33)
3.3 Der Abfassungszweck des Römerbriefes nach Röm 1–16
§ 2 Das Thema des Römerbriefes
1 Das Evangelium vom Gottessohn (Röm 1,3f.)
2 Die Vereinigung von Juden und Heiden in der Doxologie (Röm 15,7–13)
3 Das Evangelium von der Erlösung aller Menschen und der Vorrang der Juden (Röm 1,16)
§ 3 Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium (Röm 1,17; 3,21–31)
1 Aspekte der jüdischen Traditionsgeschichte für das paulinische Verständnis von Gottes Gerechtigkeit
1.1 Gerechtigkeit Gottes bei Deutero- und Tritojesaja
1.2 Gerechtigkeit Gottes in apokalyptischen Texten
2 Das paulinische Verständnis von δικαιοσύνη θεου̃ in Röm 1–3
2.1 Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes und der Glaube (Röm 1,17)
2.2 Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes und die Gerechtigkeit der Tora (Röm 3,21–31)
§ 4 Die Solidargemeinschaft von Juden und Heiden in der Sünde (Röm 1,18–3,20)
1 Das Gericht über die gottlosen Heiden (Röm 1,19–32)
2 Das Gericht über die ungerechten Juden (Röm 2,1–24)
3 Die eschatologische Erfüllung der Tora (Röm 2,25–29)
4 Theologie als Blasphemie (Röm 3,1–9)
5 Der Schuldspruch des Richters und das rechtfertigungstheologische Résume (Röm 3,10–20)
§ 5 Abraham – Vater der erlösten Menschheit (Röm 4)
1 Abraham und die Rechtfertigung aus Glauben (Röm 4,1–8)
2 Abraham – der »Beschneidungsvater« (Röm 4,9–12)
3 Die Abrahamsverheißung und die Tora (Röm 4,13–17)
4 Der Erlösungsglaube Abrahams und der Glaube an Jesus Christus (Röm 4,18–25)
§ 6 Die Geschichte der Menschheit zwischen Adam und Christus – und die Tora (Röm 5–8)
1 Rechtfertigung und Erlösung (Röm 5,1–11)
2 Adam und Christus (Röm 5,12–21)
3 Rechtfertigung und neues Leben in der Gerechtigkeit (Röm 6)
4 Das Gesetz zwischen Fleisch und Geist (Röm 7f.)
§ 7 Die Rolle Israels für die Erlösung der Menschheit (Röm 9–11)
1 Der unbegreifliche Unglaube in Israel und die unbegreiflichen Wege Gottes (Röm 9)
2 Das greifbar nahe Ziel Israels und dessen Verfehlung (Röm 10)
3 Israels Umweg und das Ziel aller Wege Gottes mit ihm: Die Erlösung des Menschengeschlechtes (Röm 11)
Literatur
1 Kommentare zum Römerbrief
2 Übrige Literatur
Register
Bibelstellen
Genesis
Exodus
Levitikus
Numeri
Deuteronomium
Richter
2 Samuel
1 Könige
2 Könige
1 Makkabäer
Psalmen
Weisheit
Jesaja
Jeremia
Daniel
Hosea
Habakuk
Matthäus
Apostelgeschichte
Römer
1 Korinther
2 Korinther
Galater
Philipper
Kolosser
1 Thessalonicher
Jakobus
Vormoderne Quellen
Vorwort
Mit dem Tod unseres Vaters Ekkehard Stegemann Ende 2021 und dem seines Zwillingsbruders Wolfgang Stegemann keine zwei Jahre später endet auch unsere Nähe zur Theologie. Keiner von uns Söhnen hat den Weg in die Wissenschaft unseres Vaters gefunden.
Umso dankbarer sind wir, mit Frau Prof. Dr. Kathy Ehrensperger und Frau Prof. Dr. Esther Kobel zwei Schülerinnen unseres Vaters an der Seite zu haben, die ihm und seinem wissenschaftlichen Werk die Treue halten. Von ihnen kam nicht nur der Impuls, die Habilitationsschrift unseres Vaters, deren Manuskript wir in seinem Nachlass gefunden hatten, zu publizieren. Sie haben auch den Text für eine Publikation vorbereitet und eingeordnet, Kontakt zum Verlag aufgenommen und finanzielle Unterstützung für die Veröffentlichung organsiert. Kurz gesagt: Ohne Kathy Ehrensperger und Esther Kobel wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Ihnen gilt unser großer Dank!
Für unseren Vater bedeutete die Habilitation 1982 das Ende der Zeit an seiner Alma Mater in Heidelberg. Von einer zunächst befristeten Professur in Bayreuth aus wurde er zum Sommersemester 1985 als Ordinarius für Neues Testament an die Theologische Fakultät der Universität Basel berufen, an der er bis kurz vor seinem Tod lehrte und forschte. Sein wissenschaftliches Arbeiten war mit dem Kampf gegen Antisemitismus in Lehre und Gesellschaft und der Aussöhnung mit dem Judentum verbunden. Im Schatten von Auschwitz gab es für ihn keine bequemen Antworten.
Die Jahre in Heidelberg stellten hierfür die Weichen. Hier lernten er, Hermann Lichtenberger und einige wenige weitere bei Max Majer Sprecher den Reichtum der rabbinischen Theologie und Kultur kennen, den wir Deutsche fast zerstört hätten. Max Majer Sprecher stammte aus einer polnisch-orthodoxen Rabbinerfamilie in Warschau, war Holocaustüberlebender und lehrte an der Universität Heidelberg Judaistik. Seine Seminare waren von großem Einfluss auf die weitere theologische und persönliche Verortung unseres Vaters und prägten sein gesamtes Leben.
Die Beschäftigung mit der jüdischen Tradition und die daraus resultierende Nähe zur jüdischen Gemeinde in Heidelberg hatten auch ganz privat Auswirkungen für uns. Es hatten sich persönliche Beziehungen und Freundschaften entwickelt und so kamen unsere Eltern über die jüdische Gemeinde in Kontakt mit einem 15-jährigen Jungen, den seine Familiengeschichte nach dem Tod des Vaters ins Waisenhaus gebracht hatte. 1977 nahmen unsere Eltern Elieser bei uns als Pflegekind auf. Sie sorgten dafür, dass er Bar-Mitzwa machte, und begleiteten ihn über die Alija und Familiengründung hinaus; bis zum heutigen Tag sind er, seine Frau Smaddar und seine vier Kinder Teil und Bereicherung unserer Familie und waren eng mit Ekkehard verbunden.
Auch heute, drei Jahre nach dem Tod unseres Vaters, sind wir traurig, wenn wir diese Zeilen schreiben, und er fehlt uns. Gleichzeitig wissen wir, dass der Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 und vor allem die sich anschließenden gesellschaftlichen Debatten, in deren Verlauf sich zum Teil schlimmste antisemitische Stereotype und Propaganda – offen wie seit 80 Jahren nicht mehr – zeigten, unserem Vater das Herz gebrochen hätten. Umso tröstlicher ist es zu wissen, dass sein Vermächtnis von Schülerinnen und Schülern weitergeführt wird.
Wir freuen uns, mit dem vorliegenden Buch eine Lücke in der Geschichte unseres Vaters zu schließen und im Jahr seines 80. Geburtstages seine Habilitationsschrift 44 Jahre nach deren Annahme zu veröffentlichen.
Im Januar 2025
Oliver Stegemann
Benjamin Stegemann
Exegese im Angesicht Israels: Ekkehard W. Stegemanns Habilitationsschrift
Esther Kobel
Eine Habilitationsschrift gut 40 Jahre nach Abschluss des Verfahrens zu veröffentlichen, ist ungewöhnlich und entsprechend erklärungsbedürftig. In ihrer Eigenschaft als universitäre Qualifikationsschrift hat eine Habilitationsschrift einen aktuellen Forschungsbeitrag zu leisten und spiegelt somit den wissenschaftlichen Diskurs ihrer Zeit wider. Manche Studien veralten schneller als andere, ausnahmsweise bleibt eine Habilitationsschrift – wie im vorliegenden Fall – auch äußerst aktuell und verdient es darum, auch später noch und sogar posthum publiziert zu werden.
Ekkehard W. Stegemann hat mit seiner Habilitationsschrift einen frühen Beitrag zur Neuperspektivierung der Paulusforschung geleistet. Er liest den Römerbrief mit konsequentem Blick auf dessen Bezug zum Judentum und setzt damit einen dezidierten Kontrapunkt zur vermeintlichen und inhärent antijüdisch geprägten Fundamentalkritik an der jüdischen »Gesetzesreligion«. Die Arbeit ist heute immer noch relevant, weil sie einen bedeutenden Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Judentum und Christentum nach der Schoah leistet – ein Thema, das Stegemanns gesamtes weiteres wissenschaftliches Arbeiten, aber auch sein Engagement in der Öffentlichkeit bestimmt hat. Dafür ist er unter anderem vom europäischen Ableger der weltweit tätigen B’nai B’rith-Loge mit der Goldmedaille »For Distinguished Leadership and Service for Humanity« ausgezeichnet worden.
Begründet ist Stegemanns Engagement in seiner Biografie. Geboren Ende 1945, wuchs er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Wolfgang in der unmittelbaren Nachkriegszeit unter dem Eindruck des Zivilisationsbruchs der Schoah auf, was zunehmend sein gesamtes Denken und Wirken beeinflussen sollte. Nachdem er zunächst an der Kirchlichen Hochschule in Bethel und Heidelberg (1965–1970) evangelische Theologie studiert hatte, verfasste er seine Dissertationsarbeit »Das Markusevangelium als Ruf in die Nachfolge«, aufgrund derer er 1974 an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg promoviert wurde. Die Dissertationsschrift bewegt sich methodisch im Bereich der Form-, Traditions- und Redaktionsgeschichtlichen Auslegung.1 Davon hebt sich die Habilitationsschrift deutlich ab. Nicht zuletzt durch den Einfluss von und die Freundschaft zum Heidelberger Alttestamentler Rolf Rendtorff machte der damalige wissenschaftliche Assistent Stegemann in den darauffolgenden Jahren zunehmend und konsequent ernst mit dem Ansatz, dass jegliche Theologie eine Theologie nach Auschwitz ist. Um als Theologe einen theologischen Beitrag gegen den Antisemitismus auch nach der Schoah zu leisten, benannte er antijüdische Auslegungen des Neuen Testaments und fing an, ihnen andere Auslegungen entgegenzusetzen und sie auch öffentlich zu vertreten, beispielsweise in einer wegweisenden Vortragsreihe unter dem Titel »Auschwitz – Krise der christlichen Theologie«, die er gemeinsam mit Rolf Rendtorff organisierte. 1980 wurden die Beiträge im Verlag Christian Kaiser veröffentlicht.2 Stegemanns eigener Beitrag darin trägt den Titel »Der Jude Paulus und seine antijüdische Auslegung«.3 Hierin formuliert Stegemann die »bittere Erkenntnis« aus, dass auch das Neue Testament, das er als »Gründungsurkunde« des Christentums bezeichnet, keineswegs frei von antijüdischen bzw. judenfeindlichen Aussagen sei.4 Daraus dürfe aber keinesfalls eine theologisch sanktionierte Judenfeindschaft resultieren, wie sie sich bereits in den Fünfzigerjahren in apologetischen Auseinandersetzungen anfing zu entwickeln und dazu führte, dass in der Auslegungsgeschichte das Neue Testament und speziell Paulus nachträglich massiv antijudaisiert wurden.5 In seinem wegweisenden Vortrag legte Stegemann die Prinzipien dar, die er im Rahmen seiner zweiten großen Studie, diesmal zum Römerbrief, umsetzte: »Der eine Gott und die eine Menschheit. Israels Erwählung und die Erlösung von Juden und Heiden nach dem Römerbrief« (Habilitationsschrift 1981, 325 S. + XIX).
Mit seiner Habilitationsschrift war Stegemann bestrebt, einen wissenschaftlichen und dezidiert theologischen Beitrag zum Verhältnis zwischen Judentum und Christentum in der Gegenwart zu leisten. Nach seinem Verständnis hing der Zivilisationsbruch der Schoah direkt mit der latenten oder auch offenen Verunglimpfung und Bekämpfung des jüdischen Volks und Glaubens zusammen. Solche Verunglimpfungen ziehen sich mit großer Selbstverständlichkeit von der Alten Kirche bis in die Gegenwart durch die Geschichte. Dieser langen Tradition stellte Stegemann mit seiner Habilitationsschrift die These entgegen, dass Jüdinnen und Juden sowie Christinnen und Christen zusammen als das eine Volk des einen Gottes anzusehen seien. Sie seien eine Einheit und diese Tatsache erfordere gegenseitigen Respekt.
Abbildung 1: Die Habilitationsschrift © Patricia Nüssle
Die Habilitationsschrift
Im Heidelberger Geschäft Carl Knoblauch6 hat Stegemann sein Manuskript zu einem wuchtigen roten Buch mit einem Umfang von 30 x 22 x 5 cm binden lassen. Die 325 Blätter haben das Format DIN A4 und sind einseitig bedruckt. Der Text ist mit einer großen und schweren IBM Kugelkopfschreibmaschine geschrieben, die Stegemann von der Theologischen Fakultät ausleihen konnte. Den ersten Teil der Arbeit hat seine Frau Ursula Stegemann von handschriftlichen Versionen abgetippt, bis sie diese Aufgabe auf Grund familiärer Verpflichtungen in andere Hände gab. Sie erinnert sich, dass die Kugelkopfschreibmaschine gegenüber der Maschine, mit der sie die ganze Dissertationsschrift ihres Gatten abgetippt hatte, einen großen Komfortgewinn darstellte: Wenn griechischer7 Text einzuflechten war, konnte man jeweils den Kugelkopf auswechseln, griechische Schriftzeichen setzen und nach erneutem Wechsel des Kugelkopfs mit lateinischen Lettern weitertippen.8 Hier muss
Abbildung 2: Seite 103 des Originalmanuskripts © Patricia Nüssle
ten gleichwohl immer noch sämtliche Akzente von Hand nachgetragen werden. Während in der Einleitung nur wenige Korrekturen angebracht wurden, nimmt deren Dichte bereits ab dem § 1 deutlich zu. Nicht selten finden sich bis zum Schluss Seiten, auf denen entweder einzelne Wörter mit einem weißen Korrekturstreifen abgedeckt oder solche mit Stellen, die mit Tipp-Ex übermalt und neu geschrieben wurden. Nicht selten sind ganze Abschnitte auf separatem Papier getippt und dann eingeklebt.
Titel sowie Untertitel der Habilitationsschrift »Der eine Gott und die eine Menschheit. Israels Erwählung und die Erlösung von Juden und Heiden nach dem Römerbrief« mögen zwar etwas sperrig empfunden werden, dürften aber sehr sorgfältig und bewusst gewählt sein. Der Titel »Der eine Gott« begegnet schon in einer früheren Publikation im Arbeitsbuch Christen und Juden.9
Dieses ist die Frucht der von der EKD eingesetzten Studienkommission »Kirche und Judentum«, deren Vorsitz Rolf Rendtorff innehatte. Es versteht sich als wissenschaftlich fundierte Ergänzung und Weiterführung der 1975 von der EKD veröffentlichten Studie »Christen und Juden« und ist als Kommentar zu derselben angelegt.10
Im ersten Kapitel des ersten von drei Hauptteilen »Gemeinsame Wurzeln« verantwortet Stegemann drei Abschnitte, die das Thema »Der eine Gott« mit folgenden Variationen in den jeweiligen Zwischenüberschriften behandeln:
• Seine Bewährung gegenüber dem Hellenismus (S. 35–36)11
• Seine Aufnahme im Neuen Testament (S. 36–37)12
• Seine Aufnahme im Judentum und Christentum (S. 45–49)13
Der für die Habilitationsschrift gewählte Titel »Der eine Gott« – ergänzt um »die eine Menschheit« – enthält in Kombination mit dem Untertitel »Israels Erwählung und die Erlösung von Juden und Heiden nach dem Römerbrief« in nur 19 Wörtern im Grunde das gesamte Programm der Arbeit.
Wie sich noch zeigen wird, liest sich der Titel im Nachhinein auch geradezu »wie ein visionäres Programm heutiger Forschungsansätze, die Paulus konsequent als jüdischen Menschen und Theologen seiner Zeit verstehen.«14 Doch zunächst zu Stegemanns Arbeit selbst.
Die Einleitung ist im Originalmanusrkipt überschrieben mit dem griechischen Vers: εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. (Röm 15,10=Dtn 32,43 LXX).15 Das unübersetzt belassene Deuteronomiumzitat (»Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk«) aus Röm 15,10 steht programmatisch über der Einleitung und der gesamten Untersuchung. Darin klingt bereits auch ein zentrales Anliegen Stegemanns an, nämlich die Idee oder Vision einer »brüderlich geeinten Menschheit, die alle ihre objektiven Unterschiede und schmerzlich trennenden Gegensätze hinter sich läßt«,16 die über und hinter Stegemanns Untersuchung zum Römerbrief steht. Seine Hauptthese, auf die sich Stegemann durch die Arbeit hindurch immer wieder bezieht, besagt, dass »die paulinische Hoffnung auf die Erneuerung der Menschheit in brüderlicher Einheit nicht von einer prinzipiellen Antithese zu Israel und dem Judentum begleitet« sei.17
Um diese These, die er antijüdischen Auslegungen entgegenhalten will, zu erhärten, identifiziert Stegemann zunächst einen historischen theologischen Antisemitismus. Diesen entfaltet er an Aussagen von Ferdinand Christian Baur (1792–1860, ab 1826 und bis zu seinem Tod lehrte er in Tübingen als Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte), der für die Einführung der historisch-kritischen Methode in die neutestamentliche Theologie steht und damit als Begründer der jüngeren Tübinger Schule gilt. Stegemann hebt hervor, dass Baur in Paulus den Bruch mit dem Judentum als vollzogen angesehen habe und dass damit bei ihm das Judentum »zum prinzipiellen Gegner des wahren, nämlich paulinisch-protestantischen Wesens des Christentums« geworden sei.18 Stegemann nimmt das paulinische Motiv der geeinten Menschheit positiv auf, bestreitet aber vehement den im Hauptstrom der Exegese seit Baur (und Semler) für Paulus behaupteten essentiellen Zusammenhang von Universalismus und Antijudaismus, demzufolge der Universalismus nur dann Wirklichkeit werden kann, wenn der jüdische Partikularismus mit dem Gesetz eliminiert werde. Stegemann widmet sich einer intensiven Auseinandersetzung mit der Forschung – insbesondere älterer (W. Bousset, A. Schweitzer, A. von Harnack, K. Barth, F.-W. Marquardt, H. Windisch, G. Schrenk) – und deren Einschätzung der Beziehung von Paulus zum Judentum und wo diese mit Antijudaismus einherging, insbesondere anhand von Röm 9–11. Er unterscheidet hier sorgfältig zwischen einem theologischen Antijudaismus und modernem Antijudaismus, wenn er festhält:
Wichtig ist aber allein, daß schon vor 1945 die traditionelle Festlegung des Apostels auf einen prinzipiellen Antijudaismus ebenso wie die Festlegung des Christentums auf dieses Prinzip Widerspruch gefunden hat, und zwar gerade von der Interpretation des Römerbriefes und zumal seiner Kapitel 9–11 her. Manches was heute aus der Distanz einer Generation nach Auschwitz an theologischen Texten aus der unmittelbaren Generation davor als unerträgliche Nähe zum Rassismus wahrgenommen wird, gehörte damals selbstverständlich zum weithin unbefragten, womöglich als wissenschaftlich gesichert geltenden Konsens, ohne damit schon mit dem Faschismus selbst zu sympathisieren.19
Entsprechend ist vom besagten historischen theologischen Antijudaismus der moderne politische Antisemitismus zu unterscheiden: »Für diesen waren nicht nur das Judentum als Religion, sondern auch die Juden als Bürger ein für allemal auf einen inferioren Status festgelegt.«20 Das große Problem ortet Stegemann darin, dass »im Unterschied zur Ächtung des politischen und weltanschaulichen Antisemitismus die Tradition des theologisch-christlichen Antijudaismus nahezu ungebrochen über 1945 hinaus Bestand hatte und heute noch hat.«21 Auch der zu seiner Zeit noch jüngeren Forschung (E. Gräßer, U. Wilckens, R. Ruether, F.-W. Marquardt, P. von der Osten-Sacken, K. Stendahl, M. Barth, H. Thyen, F. Mußner, O. Kuss) widmet Stegemann eine kürzere Auseinandersetzung. Während für die einen radikale Kritik an Paulus erforderlich ist, halten die anderen den postulierten paulinischen Antisemitismus für christlich-theologisch essenziell. Demgegenüber deklariert Stegemann sein Programm:
In der vorliegenden Untersuchung mache ich den Versuch, die zumal im Zusammenhang des Kirchenkampfes gewonnene neue Möglichkeit, das Verhältnis des Paulus zu Israel zu bestimmen, am Römerbrief zu überprüfen und auf eine breitere exegetische Basis zu stellen. Dabei knüpfe ich zugleich an ältere Auslegung, aber auch an neuere an. Meine Absicht ist, den Kontext von Röm 9–11 dem Gesamtzusammenhang der Argumentation von Röm 1–11 einzuordnen und diesen insgesamt als konsistent zu erweisen. Verbunden damit ist der Versuch, den gesamten Brief einer historischen Situation zuzuordnen, die sein Argumentationsgefälle verständlich macht. Leitend war nicht eine traditionsgeschichtliche Frage, sondern die, wie Paulus das ›objektive‹ Verhältnis der Kirche zu Israel und dem Judentum bestimmt.22
Dieses Verhältnis sieht Stegemann bei Paulus vom Zentrum seines Glaubens her bestimmt: Er sieht bei ihm die feste Überzeugung, dass durch Jesus Christus die Israel verheißene Erlösung der ganzen Menschheit in Kraft gesetzt wurde.23 Zwar stehen (die spätere) Kirche und Israel in Zeit und Geschichte nebeneinander, aber mit einem gemeinsamen Ziel, das in der künftigen Vollendung der Erlösung der gesamten Menschheit zur geschwisterlichen Einheit besteht.24 Einen eigentlichen theologischen Antijudaismus kann Stegemann im Römerbrief nicht ausmachen. Vielmehr erkennt er im Römerbrief den Versuch des Paulus, den in den pagan geprägten römischen Gruppen Christusgläubiger aufkommenden theologischen Antijudaismus zu überwinden. Die Situationsbedingtheit bzw. die situationsbedingten Unterschiede zwischen den paulinischen Briefen bleiben hier unbenommen. Sie sollen nicht harmonisiert werden.25 Stegemann ist sich bewusst, dass seine Auslegung des Römerbriefs sich auch an der Auslegung polemischer Äußerungen des Apostels in anderen Briefen zu bewähren hätte.26
Zentral für jegliche nachfolgende Auslegung ist für Stegemann die Frage nach dem Zweck des Römerbriefs, der er sich im ersten Kapitel der Arbeit (im Original nicht weniger als 39 Seiten) widmet. Gegenüber der weit verbreiteten Auffassung, beim Römerbrief handle es sich – im Gegensatz zu den übrigen von Paulus selbst verfassten Briefen – in allererster Linie um ein theologisches Traktat, betont Stegemann die Qualität des Schreibens als Brief und damit auch dessen Situationsbedingtheit. Er hebt zunächst die konkreten im Brief genannten Pläne hervor, die der Autor gegenüber seiner Adressatenschaft formuliert. Auch die konkreten Ermahnungen an sie werden deutlich ausgesprochen und sind nicht bloß als Vorwand für die Abfassung des Briefes anzusehen.27 Für Stegemann ist der Römerbrief ein »Dialog des Völkerapostels mit der Gemeinde in Rom über das Evangelium angesichts seiner geschichtlichen Wirksamkeit«.28 Als konkrete Situation und als Abfassungszweck des Briefes nimmt Stegemann Paulus’ missionarische Arbeit insgesamt in den Blick. Entsprechend den Abmachungen des Jerusalemer Treffens (Apostelkonvent) ist Paulus für die Verkündigung des Evangeliums unter den Völkern zuständig und ist dabei dem für die Verkündigung unter den Juden berechtigten Petrus gleichgestellt. Stegemann findet hier eine – soweit ich sehe – neue und plausible Auflösung der Spannung zwischen dem lang gehegten Wunsch eines Besuchs in Rom (Röm 1,10–12) und der »Nichteinmischungsklausel« (Röm 15,20): Zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs befindet sich Paulus in einer Umbruchsituation: Paulus hatte schon länger den Plan gehabt, in Rom zu missionieren. Zwischenzeitlich war dort ohne seine Mitwirkung eine christusgläubige Gemeinschaft entstanden, die er respektierte und gleichzeitig als in seinem Zuständigkeitsbereich und letztlich in seiner Verantwortung liegend betrachtete. Mit dieser Gemeinde tritt er in einen Dialog. Sobald die Kollekte nach Jerusalem gebracht ist, ist sein Wirken im Osten besiegelt und er kann sich seinem neuen Missionsgebiet im Westen, nämlich Spanien, widmen. Rom sollte eine wichtige Station auf diesem Weg werden. Der Gemeinschaft in Rom ist auf Grund ihrer geografischen und politischen Lage mit Sicherheit eine zentrale Rolle zuzuschreiben. Die Gemeinde in der Hauptstadt des Imperiums wird von ihm einerseits als anderweitig gegründete pagan geprägte Gemeinde anerkannt, soll ihn aber auch für seine Pläne der Evangeliumsverkündigung unterstützen. Die lange Liste der ihm bekannten Menschen in Rom lässt diese Hoffnung plausibel erscheinen. Mit dem Brief tritt er in einen Dialog mit den römischen Christusgläubigen ein. Paulus signalisiert einerseits die Anerkennung ihrer anderweitigen Gründung, hält andererseits aber sein Recht auf authentische Auslegung des Evangeliums und seine Verantwortung für eine evangeliumskonforme Existenz aller aus den Völkern stammenden Christusgläubigen hoch. Das Evangelium setzt Gottes eschatologisches Heil in Gang und darin sind alle Menschen eingeschlossen: Juden und Jüdinnen wie Menschen aus den Völkern. Die Erlösung der gesamten Menschheit liegt in der Erwählung Israels begründet und diese wiederum geschieht allein auf Grund der Gnade Gottes. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, werden Juden und Jüdinnen und Menschen aus den Völkern schon im Jetzt geschwisterlich vereint. Diese Geschwisterschaft sieht Paulus konkret in der pagan geprägten Gemeinschaft Christgläubiger in Rom gefährdet, sie steht aber pars pro toto für problematische Tendenzen unter den Christusgläubigen aus den Völkern überhaupt. Warum sich die Mehrheit der Jüdinnen und Juden dem Evangelium verweigern, bleibt ein Rätsel.
Die Stadt Rom hatte einen verhältnismäßig hohen jüdischen Bevölkerungsanteil und war traditionell von Antisemitismus geprägt, der durch mehr oder minder tolerante Gesetzgebung ausgeglichen wurde. Ein expliziter Antisemitismus kann aus dem Römerbrief nicht geschlossen werden, wohl aber eine überhebliche Einstellung und ein entsprechendes Verhalten gegenüber jüdischen Christusgläubigen vonseiten solcher, die aus den Völkern stammten. Die Einhaltung der Tora als geschichtliche Manifestation jüdischer Identität beurteilt Paulus nur insofern negativ, als er dem Tun der Tora das Erreichen des eschatologischen Ziels abspricht. Er tut dies aber in einigermaßen unpolemischer Weise und hält klar fest, dass die Tora zwar nicht der direkte Weg zum Heil ist, aber zugleich das Heil ihr Ziel ist. Die Tora wird von Paulus nicht nur positiv rekonstruiert, sondern in ihrer Bedeutung auch für die Menschen aus den Völkern ausgeweitet. Die Probleme in Rom stehen repräsentativ für die Herausforderungen der Christusgläubigen aus den Völkern überhaupt. Paulus erachtet deren Ausbreitung als sicher, ebenso wie den Misserfolg unter den jüdischen Menschen. Von daher ergibt sich:
Diese Differenz vom Evangelium her angemessen auszuhalten, ohne dabei dessen Wahrheit aufzugeben noch dem Antijudaismus nachzugeben, scheint mir der tiefste Zweck des Briefes nach Rom zu sein. Wie mit seiner Reise nach Jerusalem unterstreicht der Apostel mit dem Brief die Verbundenheit von Heiden und Juden, die in der Geschichte Gottes mit seinem Volk verheißungsvoll eröffnet, vom Evangelium aber in Kraft gesetzt wurde und zukünftig durch die Vollendung der Erlösung in der brüderlichen Gemeinschaft des neuen Menschengeschlechtes selbst vollendet werden wird. Die respektvolle Dankbarkeit, mit der die Kirche Gottes aus den Heiden mit der Kollekte der Kirche Gottes aus den Juden begegnet, weitet Paulus im Römerbrief auf ein respektvolles Verhältnis der Heidenkirche zu den Juden und zum Judentum überhaupt aus.29
Er folgt hierbei einigen Erkenntnissen von F. Chr. Baur und dessen konsequent historischer Auslegung: Als Gemeinde in der Hauptstadt des römischen Imperiums ist sie für die universalistische Botschaft des Paulus die empfänglichste. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Diskrepanz zwischen paulinisch-universalistischem Christentum und dem partikularistischen Juden(christen)tum drängte sich geradezu auf. Unter dieser Perspektive avancierte Röm 9–11 bei Baur vom einem nach verbreiteter Auffassung als Anhang zu den angeblich zentralen Kapiteln 1–8 zu charakterisierenden Abschnitt zum eigentlichen Kern des Römerbriefs.30
Im zweiten Kapitel formuliert Stegemann mit dem Thema des Römerbriefs These und Programm seiner Arbeit. Beginnend mit dem dritten Kapitel folgen Textauslegungen, die das Programm entlang des Römerbriefs plausibilisieren. Ab da ist die Studie als mehrheitlich fortlaufende, aber gleichwohl selektive Kommentierung des Römerbriefs angelegt – konsequent geleitet von der Frage nach dem Verhältnis zwischen Israel und den Völkern. So werden große Teile des Römerbriefs bis und mit Röm 11 in den Blick genommen.
Im Grunde geht es in Stegemanns Arbeit sehr konsequent um die Frage, wie die Formulierung Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι (Röm 1,16) zu verstehen sei. Die Frage steuert entsprechend auch den Argumentationsgang des Briefs. Wenn Stegemann zu Beginn seines zweiten Kapitels festhält, dass die Aussage von Röm 1,16 »Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen«31 das eigentliche Thema des Römerbriefs liege, ist das nicht bloß eine programmatische Ansage, sondern damit rüttelt er an einer der Grundfeste reformatorischer Überzeugung: Dieser zufolge wird Röm 1,16–17 (in Variationen 1,16b-17) als das zentrale Thema des Römerbriefs aufgefasst und mit der Rechtfertigungslehre geht die karikierende Auffassung von der jüdischen Lehre der Rechtfertigung aus Werken des Gesetzes einher. Dass Röm 1,16–17 das Thema des Römerbriefs enthalten, wird sehr verbreitet vertreten.32 Stegemann argumentiert, dass V. 17 besser als zu V. 16 zu V. 18 passt im Sinne einer Überschrift zum darauffolgenden langen Abschnitt Röm 1,18–3,31. Auch klingt das auf Röm 1,16 eingegrenzte Thema des Briefs schon in Röm 1,2ff. bereits proleptisch an, mit Paulus’ Betonung seines Willens, zu verkündigen »das Evangelium von seinem Sohn, der nach dem Fleisch aus dem Samen Davids stammt, nach dem Geist der Heiligkeit aber eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht, seit der Auferstehung von den Toten: das Evangelium von Jesus Christus, unseres Herrn«. Mit »nach dem Fleisch aus dem Samen Davids« betont er zugleich, dass Jesus nicht nur Jude, sondern spezifisch ein Davidide und damit der messianische Erlöser war, um dies dann in Vers 1,16 als soteriologisches Thema zu entfalten. Durch das Evangelium sind Juden und Heiden »unauflösbar, wenn auch unterscheidbar«33 miteinander verbunden, ja vereint. Auf diese Vereinigung von Juden und Heiden sieht Stegemann Paulus in Röm 15,7–13 nach der Konkretion seiner Paränese an die Menschen in Rom zurückkommen und damit die eigene Interpretation des Proömiums bestätigen. Die Paränese zielt auf solidarische Einmütigkeit im Gotteslob, worauf der eigentliche Zweck benannt wird, nämlich das Hinzukommen der Heiden zum Gotteslob Israels. Den Zweck von Jesu Sendung formuliert Paulus in Röm 15,9a: τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν. Zentral ist, dass die Heiden durch Christus am Heil partizipieren, aber ohne dass sie selbst ins Volk Israel aufgenommen werden. Gleichzeitig wird dadurch Israels besondere Rolle in Gottes Heilsökonomie nicht aufgehoben, sondern im Gegenteil gerade bestätigt.
Das eigentliche Thema des Römerbriefs, das für den ganzen Brief von Relevanz ist, wird also nach Stegemann in seinem Kern in Röm 1,16 benannt: Durch das Evangelium setzt Gott die eschatologische Erlösung in Kraft für jeden Glaubenden egal welcher Herkunft, wobei innerhalb dieser Gleichstellung aller Glaubenden den Juden vor den Heiden eine Priorität eingeräumt wird. Für ihn ist klar, dass V. 16 dem folgenden Vers nicht nur vor-, sondern auch übergeordnet ist.34 Zwar haben das vor Stegemann auch wenige andere gesagt,35 aber nicht in dieser Deutlichkeit und Vehemenz. Mit seiner These stellt sich Stegemann gegen die große Mehrheit der Exegese namentlich solcher protestantischer Provenienz. Er ist sich dieses radikalen und zugleich mutigen Schrittes durchaus bewusst, wenn er festhält: »So gesehen muß es aber geradezu als eine Verkehrung des Verhältnisses von Röm 1,16 zu 1,17 beurteilt werden, wenn KÄSEMANN den Römerbrief ›die gesamte Verkündigung und Theologie des Paulus unter das eine Thema der sich offenbarenden Gottesgerechtigkeit‹ ( ...) stellen sieht.«36 Und es mangelt auch nicht an Klarheit, wenn Stegemann in der Folge konstatiert:
Auch jede andere aus V. 17 gewonnene Systematik wird dann dem Thema des Briefes nicht gerecht. Offenkundig ziehen aber vor allem protestantische Ausleger unter dem Eindruck der rechtfertigungstheologischen Rezeption des Römerbriefes durch die Reformatoren eine thematische Bestimmung des Briefes von V. 17 her vor und blenden die heilsgeschichtliche bzw. verheißungsgeschichtliche Dimension von V. 16 zugleich ab.37
Wie auch in den folgenden Kapiteln bietet Stegemann im dritten Kapitel zur Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium (Röm 1,17; 3,21–31) zunächst einen Überblick über die Debatte zu den entsprechenden Passagen, hier zur Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, um dann seine eigene Auslegung zu entfalten. Neu ist hier die These, dass Paulus sich mit seiner Argumentation an einen fiktiven Glaubenden aus den Völkern richte. Die Sendung des Messias durch Gott ist Stegemann zufolge ein Rechtsakt. Durch ihn erhalten die Glaubenden ohne Rücksicht auf ihre Werke einen Unschuldsbeweis im eschatologischen Gericht. Gleichzeitig gilt, dass die Tora durch den Glauben nicht beseitigt wird, sondern eschatologisch zur Geltung kommt. In der Abweisung dieser Offenbarung liegt der Vorwurf gegenüber den Juden, die eigene Gerechtigkeit aufrichten zu wollen, statt sich der Gottesgerechtigkeit unterzuordnen.
Röm 1,17f. stehen als Überschrift zum folgenden Abschnitt Röm 1,19–3,31, den Stegemann in der Überschrift zum vierten Kapitel mit Die Solidargemeinschaft von Juden und Heiden in der Sünde (Röm 1,18–3,20) charakterisiert und wo er Paulus ab V. 18 sich selbst inszenieren sieht. In einer fingierten Gerichtsverhandlung, in der Juden und Heiden ohne Ausnahme als Sünder entlarvt werden, widerlegt er sämtliche möglichen Einwände gegen die doppelte rechtfertigungstheologische These. Paulus unterscheidet zwischen einem »Gericht über die gottlosen Heiden (Röm 1,19–32)«38 und einem »Gericht über die ungerechten Juden (Röm 2,1–24)«39. Entscheidend ist die paulinische Unterscheidung zwischen dem empirischen Juden als urteilendem Menschen (ἄνθρωπος κρίνων) gegenüber dem idealtypischen Juden. Es sind gerade Juden und nur Juden, die idealtypisch als Gerechte gelten können. Die Vorstellung des idealtypischen Juden konvergiert hier mit derjenigen des Gerechten. Allerdings geht es nicht um eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen Sein und Sollen per se, sondern darum, dass Paulus bei der Mehrheit der Juden eine Verfehlung sieht, vorab in der Übertretung bzw. im Nichterfüllen der Tora. Maßstab im Endgericht ist die Erfüllung der Tora, wodurch Paulus die Verurteilung sowohl von Juden wie auch von Heiden bestätigt sieht. Auch die Juden stehen – wie Heiden ohnehin – unter der Sünde und werden letztlich aus dem Glauben gerechtfertigt. Der Zweck der Tora liegt damit in der »gewissermaßen negativ-soteriologisch[en]«40 Vorbereitung der Rechtfertigung aller Menschen.
Die eschatologische Gleichstellung von Juden und Heiden impliziert, dass letztere keine Juden werden müssen, um am Heil Israels teilzuhaben, und dass es bei ersteren nicht ausreicht, dass sie jüdisch durch Geburt sind. Das Ganze hat mit Abraham eine Vorgeschichte, die in Röm 4 entfaltet wird.
Anhand von Röm 4, dem Thema des fünften Kapitels, das Stegemann mit Abraham – Vater der erlösten Menschheit überschreibt, verdeutlicht Paulus wiederum die in Röm 1,16 vorgestellte Priorität der Juden innerhalb der Erlösung, die allen Menschen gleichermaßen zugesprochen ist, indem er die rechtfertigungstheologische Argumentation mit einer verheißungsgeschichtlichen kombiniert. Die Teilhabe der Völker hängt an Gottes Verheißung an Abraham und diese Verheißung an Abraham begründet zugleich die Vorrangstellung der Juden in der Heilsökonomie. Ihre geschichtlichen Auszeichnungen und Vorzüge durch die Tora und die Abrahamskindschaft weisen über sich selbst hinaus auf die Teilhabe der Völker und begründen damit das πρῶτον der Juden sowie ihre eschatologische Gleichstellung mit den Völkern.
Bevor Stegemann zum eigentlichen Kern und Ziel seiner Arbeit vordringt, in dem er die Kapitel Röm 9–11 zum Zentrum des Briefes erklärt, bearbeitet er unter der Überschrift Die Geschichte der Menschheit zwischen Adam und Christus – und die Tora im sechsten Kapitel die Kapitel Röm 5–8, in denen Paulus sich mit der Spannung zwischen dem »Schon« und dem »Noch-nicht« der Erlösung auseinandersetzt. Durch den νόμος bekommen »Verhängnis und Verheißung der Geschichte der Menschheit ihre deutliche Gestalt«.41 Hierin zeigt er auf, inwiefern das Evangelium die Erlösung bereits realisiert, während Röm 9–11, dem das siebte und letzte Kapitel der Arbeit unter der Überschrift Die Rolle Israels für die Erlösung der Menschheit gewidmet ist, als andere Probe aufs Exempel aufzeigt, dass die Verheißung der Erlösung Israels durch das Evangelium in Kraft gesetzt wird.
Das Problem hinter diesem zentralen Abschnitt des Römerbriefs ist die für Paulus gegebene Tatsache, dass Israel großmehrheitlich den Glauben an Jesus Christus ablehnt, was in einem Widerspruch zu der von ihm verkündigten Universalität der Erlösung steht. Hat schon Röm 1,16 in eine andere Richtung gewiesen und wird es als Thema des Briefes anerkannt, tritt konsequenterweise Röm 9–11 aus seinem von vielen in den Schatten verbannten Dasein heraus und rückt als Durchführung des Themas ins Zentrum des Briefes. Die drei für seine Argumentation treffend gewählten Zwischenüberschriften zeigen deren Duktus an:
1. Der unbegreifliche Unglaube in Israel und die unbegreiflichen Wege Gottes (Röm 9)
2. Das greifbar nahe Ziel Israels und dessen Verfehlung (Röm 10)
3. Israels Umweg und das Ziel aller Wege Gottes mit ihm: die Erlösung des Menschengeschlechts (Röm 11).
Stegemann geht davon aus, dass die pagan geprägte Gruppe Christusgläubiger in Rom dazu neigt, aus der Ablehnung des Evangeliums durch die Juden auf Gottes Verwerfung des Volkes Israel schließen zu können. Paulus verteidigt hier leidenschaftlich Israel, obschon dessen Verhalten für ihn unbegreiflich und schmerzhaft bleibt: Die Juden verweigern trotz der ihnen gewährten Vorzüge den Glauben an den Christus. Aber auch die Verstockung der Juden und die Erwählung der Völker dienen dialektisch dem Erlösungsziel Gottes.
Was Stegemann in seinem Durchgang durch die für seine Frage entscheidenden Kapitel des Römerbriefs aufzuzeigen sucht, ist die paulinische Überzeugung, dass die Teilhabe an der Erlösung sowohl für Juden als auch für die Menschen aus den Völkern absolut zwingend an den Glauben an Christus gebunden ist. Der Unglaube Israels ist allerdings nicht Ursache seiner Verstockung, sondern vielmehr dessen Folge. Trotz des Ungehorsams und durch ihn hindurch setzt Gott seinen Heilsplan zur Erlösung für Israel wie die Völker durch.42 Damit ist auch klar, dass es nicht zwei separate Heilswege geben kann, sondern nur den einen Heilsweg des einen Gottes für die eine Menschheit durch das Evangelium. Der Großteil Israels, der nicht daran glaubt, muss für die Verwirklichung der Erlösung auf den Einzug der Völker warten. Die Glaubenden aus den Völkern müssen umgekehrt in begründeter Hoffnung warten, bis Israel umfassend an der Erlösung teilnimmt. In Stegemanns pointierten Worten: »Weder schließt Israels Heil das Heil der Heiden aus noch das Heil der Heiden Israels Heil. Ihm gilt Gottes Erlösung zuerst, aber auch zuletzt – und dazwischen kommen die Heiden herein.«43
Mit der Auslegung von Röm 11 endet die Habil. Die verbleibenden Kapitel werden nicht in den Blick genommen. Das lässt sich dadurch begründen, dass die Studie keine Gesamtauslegung des Römerbriefs zum Ziel hat, sondern vielmehr – wie ihr Untertitel besagt – das Verhältnis der Erwählung Israels und dessen Bezug zur endzeitlichen Erlösungshoffnung gemäß dem Römerbrief fokussiert.44
Paulus ohne Antijudaismus: Stegemanns wegweisende Römerbriefexegese
Zentral für Stegemanns Untersuchung war also die Frage nach einem Verhältnis von »Kirche« und Israel und dem Judentum, wie es sich nach dem Römerbrief des Paulus darstellt. Bei seinem Durchgang durch den Römerbrief kann Stegemanns Vorgehensweise wohl am ehesten als eine traditionsgeschichtliche in einem weit gefassten Sinn gelten, auch wenn nicht eine eigentliche traditionsgeschichtliche Frage leitend war, sondern die eben genannte. Stegemann arbeitet zwar weder religionsgeschichtlich noch in strengem Sinne historisch oder gar sozialgeschichtlich, behält aber mit seiner Einordnung des Briefs in dessen historischen Kontext denselben konsequent im Blick. Jedes Kapitel enthält eine Hinführung gefolgt von in Abschnitte unterteilten Exegesen. Besonders einschlägige Stellen erfahren eine detailliertere und kleinteilige philologische Analyse, weniger zentrale werden paraphrasiert. Es findet durchwegs ein engagierter Dialog mit älterer und jüngerer Forschungsliteratur statt. Der Römerbrief wurde seit bald zweitausend Jahren untersucht und es gibt entsprechend kaum Probleme, die nicht schon mehrfach angegangen worden wären. Es gibt also Erkenntnisse zum Römerbrief, die korrigiert werden müssen, andere profitieren von einer weiteren Ausarbeitung und Vertiefung. So gelingt es Stegemann, an einzelnen Stellen bereits diskutierte Fragen zu vertiefen oder neu zu beleuchten. Vor allem aber leistet die Arbeit in ihrem Gesamtentwurf einen bemerkenswerten Beitrag zum Verständnis der eigentlichen Theologie des Römerbriefs frei von Antijudaismen. Mit seiner Arbeit liefert Stegemann einen in seiner Zeit neuen Ansatz. Die große Mehrheit der Einzelargumente, die er für seine Gesamtthese in Anschlag bringt, sind bereits anderswo in der Forschungsliteratur zu finden, was Stegemann regelmäßig aufzeigt und belegt. So ist er auch nicht der erste, der Röm 1,16 anstelle von Röm 1,16f. als das Thema des Römerbriefs ansieht. Aber die Konsequenzen, die er daraus zieht, sind ein Novum: Niemand zuvor hat diese These so ernst genommen, Röm 1,16 tatsächlich als Überschrift für den ganzen Römerbrief anzusehen und entsprechend auch die darauffolgenden Ausführungen des Paulus daran zu bemessen. Das hat enorme Konsequenzen für die Lektüre des gesamten Briefs: ein als kohärent angesehenes und an eine überwiegend aus den Völkern stammende reale Adressatenschaft in Rom gerichtetes Schreiben, das in den Kapiteln 9–11 ihren Höhepunkt findet. Stegemann macht somit mit seiner Interpretation des Römerbriefs die Idee der einen Menschheit vor dem einen Gott stark. Mit seiner These eröffnet er auch das Desiderat, dass diese Idee von der einen Menschheit in einen größeren Rahmen gestellt wird. Wünschenswert wäre die von Stegemann als Notwendigkeit angezeigte Einordnung in ein Gesamtbild des paulinischen Wirkens.45
Obschon Stegemann schon zur Zeit der Abfassung seiner Habilitation stark im jüdisch-christlichen Gespräch engagiert war, erhebt er nirgends den Anspruch, direkt mit seiner Studie einen Beitrag zum jüdisch-christlichen Dialog zu leisten. Es ging Stegemann nicht zuvorderst darum, Antijudaismen in der Auslegungsgeschichte aufzuzeigen, obschon es deren viele gibt und er auch konsequent auf sie hinweist. Vielmehr strebte er danach, mit einer engagierten theologischen Fragestellung einen konstruktiven Beitrag zur Forschung am Römerbrief vorzulegen, um aufzuzeigen, dass und wie theologisches Arbeiten auch mit paulinischen Aussagen geschehen kann – dies alles mit dem Ziel der Erneuerung des Verhältnisses zwischen Christen und Juden.46 Es ist auch nirgends Stegemanns ausdrücklicher Anspruch, aber er leistet damit einen substanziellen bibelwissenschaftlichen Beitrag zum berühmten »Synodalbeschluß ›Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden‹ vom 11. Januar 1980« der Evangelischen Kirche im Rheinland.47 Es ist zugleich auch ein exegetisch begründetes Gesprächsangebot für die Systematische Theologie, die Frage nach dem Gegensatz von Universalismus und Partikularismus der Offenbarung zu diskutieren.
Stegemanns Argumentation setzt nach der forschungsgeschichtlichen Einordnung ein mit der ausführlich begründeten These, dass Röm 1,16(b) und nur Röm 1,16 das eigentliche Thema das Römerbriefs darstelle. Demgegenüber könne Röm 1,17 nur als Überschrift zum darauffolgenden Abschnitt gelten. Und Stegemann ordnet den Römerbrief historisch und in das Wirken des Apostels mit seiner Mission unter den Völkern ein. Nach einschlägigen Versuchen im 19. Jahrhundert, die Stegemann in seiner Einleitung diskutiert, herrschte über lange Zeit die Überzeugung, der Römerbrief sei des Apostels Niederschrift seiner »Dogmatik« mit dem Ziel einer Selbstdarstellung und er wurde komplett losgelöst von seinem historischen Kontext interpretiert.48 Mit sehr wenigen Ausnahmen wurde der historische Kontext schlicht ausgeblendet.49 Es wurden denn auch vornehmlich die Kapitel 1–8 in den Blick genommen, während Röm 9–11 und insbesondere 12–16 wesentlich weniger Beachtung fanden.50 Erst in den 1970er Jahren erwachte das Bewusstsein dafür, dass es sich beim Römerbrief um einen Brief handelt, und parallel dazu auch ein Interesse an Röm 9–11. Wichtige Impulse verschiedener Forscher (sic!) und um die Fragen nach Charakter, Ziel, Adressatenschaft, Anlass, Rhetorik im Römerbrief sind beispielsweise in dem von Karl P. Donfried herausgegebenen Band The Romans Debate versammelt.51 Donfried selbst verlangte dezidiert die Einhaltung zweier methodischer Prinzipien: 1. Paulus schrieb seinen Brief nach Rom in eine konkrete Situation hinein.52 2. Röm 16 ist integraler Bestandteil des Römerbriefs.53 Die Kontextbezogenheit des Römerbriefs war auch Programm bei Robert Jewett, dessen umfassende Forschungen über Jahrzehnte in seinem monumentalen Kommentar zum Römerbrief Niederschlag gefunden haben.54 Zu den frühen Stimmen in diesem kleinen Chor der kontextsensiblen Forscher zählt auch William Campbell, der zu sehr ähnlichen Fragen arbeitete wie Stegemann, lange bevor die beiden sich wissenschaftlich, aber auch persönlich kennenlernen sollten.55 Gemeinsam war ihnen das zentrale Anliegen, Paulus in seinem jüdischen Kontext zu lesen. Beide kamen unabhängig voneinander zum Schluss, dass Röm 9–11 nicht nur integraler Bestandteil des Römerbriefs sein muss, sondern gar dessen Zentrum bzw. Klimax.56 In Festlandeuropa war diesbezüglich (abgesehen von Ferdinand Christian Baur knapp hundert Jahre früher)57 der Däne Johannes Munck ein früher – und einsamer – Rufer in der Wüste gewesen.58 Eine wichtige Stimme, die diese Meinung prominent vertrat, war auch Krister Stendahl: »Rom. 9–11 is not an appendix to chs. 1–8, but the climax of the letter.«59 Sehr bezeichnend ist, dass der Aufsatz Stendahls, The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West, dem dieses Zitat entnommen ist, in der deutschen Übersetzung des entsprechenden Bandes Paul among Jews and Gentiles and other essays als einziger Aufsatz außen vor gelassen und nicht abgedruckt wurde.60 Auf Deutsch erschien der Aufsatz erst ein weiteres Jahrzehnt später in der von Ekkehard und Wolfgang Stegemann und anderen herausgegebenen Zeitschrift Kirche und Israel.61 Stendahl dekonstruierte mit seiner Paulusinterpretation die lutherisch geprägte Rechtfertigungslehre. Parallel dazu revolutionierte Ed Parish Sanders 1977 mit seiner bahnbrechenden Studie Paul and Palestinian Judaism das traditionelle Verständnis von Paulus und seiner Beziehung zum Judentum.62 Sanders kritisierte die traditionelle Darstellung des Judentums als legalistisch und stellte stattdessen das Konzept des Bundesnomismus vor, demzufolge das Judentum auf Gottes Gnade beruht und in der das Halten der Gesetze Ausdruck des Bundes mit Gott ist. Er setzte eine Strömung innerhalb der Paulusforschung in Gang, die seit dem berühmt gewordenen Aufsatz von James D. G. Dunn aus dem Jahr 1983, in dem dieser Sanders’ Arbeit würdigt, als New Perspective on Paul identifiziert wird.63 Bis zur Verbreitung der Bezeichnung dieser Art von Paulusauslegung als New Perspective hatte Stegemann seine Habilitationsschrift bereits eingereicht. Die New Perspective ist naturgemäß keine einheitliche Forschungsrichtung und entwickelte sich über die Jahre weiter.64 Zum Kern zählte jedenfalls, Paulus nicht mehr als Kritiker des Judentums anzusehen, sondern sein Jüdischsein ernst zu nehmen in seiner radikalen Proklamation der Heilsbedeutung des Glaubens an Jesus Christus. Über diesen Glauben an Christus wird der Bund Gottes auch für die Menschen aus den Völkern geöffnet. Die Frage nach der Rechtfertigung aus Glauben wird nicht mehr als zur individuellen Person gehörig angesehen, sondern dem Bereich der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft Gottes zugerechnet. Paulus ging es demzufolge auch nicht um die Bekämpfung von Werkgerechtigkeit und damit um die Frage nach individueller Erlösung, sondern um die Frage, wie alle Welt in die Gemeinschaft Gottes integriert werden konnte – oder eben mit Stegemanns Worten: Es ging um den einen Gott und die eine Menschheit.
Zunehmend partizipierten auch jüdische Forschende an der Diskussion und innerhalb der New Perspective entwickelte sich die »Radical New Perspective« bzw. die »Paul within Judaism«-Debatte. In dieser fingen die Themen, die Stegemann zu wesentlichen Teilen schon in den frühen 1980er Jahren intensiv behandelte, an, breiter diskutiert zu werden und auch über den Kreis dieser Forschenden hinaus Gehör zu finden.65 In der Zeit und im Kontext, in dem Stegemann seine Habilitation verfasste, waren seine Gedanken, Ideen und Ausführungen zu Paulus und zum Römerbrief im Speziellen zumindest im deutschsprachigen Raum hingegen noch geradezu revolutionär. Dies zeigt sich nicht zuletzt in den hitzig geführten Debatten im Rahmen des Habilitationsverfahrens.
Das Habilitationsverfahren66
Am 15. Juli 1981 reichte Stegemann seine Arbeit an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg als Habilitationsschrift ein.67 Bereits eine Woche später wurde das Habilitationsverfahren eröffnet und die Gutachter bestimmt.68 Die beiden Gutachten vom Oktober 1981 empfahlen der Habilitationskonferenz einhellig die Annahme der Arbeit. Kurz darauf gingen allerdings zwei kritische Voten ein, die die Habilitationswürdigkeit der Arbeit in Frage stellten. Zwei Repliken setzten sich wiederum kritisch mit den vorangegangenen Voten auseinander und empfahlen die Annahme der Arbeit erneut nachdrücklich.69 Ohne an dieser Stelle in Details gehen zu können, ist allein schon am Prozess und an der Ausführlichkeit der Gutachten und Voten abzulesen, dass die Auseinandersetzung um die Arbeit sehr kontrovers geführt wurde.
Am 16. Dezember 1981 beschloss die Habilitationskonferenz in einer fast zweistündigen Sitzung mit 20 positiven und 5 ablehnenden Stimmen in geheimer Abstimmung die Annahme der Arbeit. Als Thema des Habilitationsvortrags wählte sie von den drei von Stegemann vorgeschlagenen Themen »Christusbekenntnis und Bruderliebe im 1. Johannesbrief« aus.70 Der Vortrag fand am 20. Januar 1982 statt. Die Beschlussfassung über die Erteilung der Lehrbefähigung erschien weniger umstritten als zuvor die Annahme der Habilitationsschrift. Zur Zeit der Abstimmung waren 22 Stimmberechtigte anwesend: mit »ja« stimmten 19; mit »nein« stimmten 2; eine Stimme war ungültig.71
Noch am selben Tag wurde Stegemann mit der Habilitationsurkunde, »nachdem in einem Habilitationsverfahren die Lehrbefähigung für das Fach Neues Testament anerkannt wurde, das Recht zur Führung des akademischen Grades Dr. theol. habil verliehen«.72 In der gleichen Sitzung beschloss der erweiterte Fakultätsrat bei einer Enthaltung, dem Senat die Lehrbefugnis für E. Stegemann zu beantragen.73
Es bleibt die Frage, warum Stegemann seine Arbeit – wie es auch in den 1980ern üblich gewesen wäre – nie veröffentlicht hat.74 Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht, und mit Sicherheit wird sich die Frage abschließend nicht beantworten lassen. Gleichwohl gibt es Indizien und Zeitzeuginnen benennen unterschiedliche mögliche Gründe, die sich gegenseitig auch nicht ausschließen.
Laut seiner Frau Ursula war Stegemann nach Einreichung der Arbeit schlicht nicht motiviert, den Extraaufwand zu betreiben, der notwendig ist, um das maschinenschriftliche Manuskript einer Habilitationsschrift in ein gedrucktes Buch zu überführen. Dies sei schon bei der Dissertation der Fall gewesen. Er habe damals nicht einmal Interesse gehabt, die Ablieferung der Pflichtexemplare zu zelebrieren, sondern habe ihr den Botengang in Auftrag gegeben. Außerdem habe Stegemann ohnehin schon bei der Abfassung der Habilitationsschrift geplant, einen Kommentar zum Römerbrief zu schreiben und diesem wesentliche Teile aus der Habilitationsschrift zugrunde zu legen.75
Laut Kathy Ehrensperger, Stegemanns erster wissenschaftlicher Hilfskraft am Lehrstuhl für Neues Testament an der Theologischen Fakultät der Universität Basel und bald auch Freundin der Familie, hat Stegemann ihr gegenüber auch einmal ausgedrückt, dass er sich gesorgt habe, auf Grund der Thesen in seiner Habilitationsschrift keinen Ruf auf eine Professur mehr zu bekommen, wenn er diese veröffentlicht hätte.76
Dass diese Furcht nicht ganz unbegründet gewesen sein dürfte, belegt folgende Erinnerung von Ursula Stegemann: Unmittelbar nach der Habilitation (bzw. schon während des Verfahrens) bewarb sich Stegemann auf verschiedene Stellen. Nachdem er anderswo mindestens einen dritten und einen zweiten Platz erreicht hatte, stand er im Frühjahr 1984 an der Universität Oldenburg auf Platz 1 der Berufungsliste. Allerdings habe die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover seine Berufung verhindert. Daraufhin habe Stegemann beim zuständigen Verwaltungsgericht in Lüneburg Klage eingereicht und sei mit einem Anwalt aus Heidelberg dorthin gereist, um sich gegen diese Verweigerung zur Wehr zu setzen. Beim zweiten Gerichtstermin, an dem Stegemann nicht persönlich anwesend war, wurde seinem Anwalt mitgeteilt, dass die Neue Zürcher Zeitung kurz zuvor die Liste des Basler Berufungsverfahrens NT veröffentlicht habe und dass Stegemann dort auf dem 1. Platz stehe, weshalb die Gespräche in Lüneburg beendet werden könnten. Pikanterweise hatte Stegemann zu dem Zeitpunkt zumindest offiziell noch keine Kenntnis dieses ersten Listenplatzes in Basel. Tatsächlich kam es letztlich in Lüneburg nicht mehr zum Prozess, weil Stegemann den Ruf nach Basel bekam, im Herbst 1984 erfolgreich verhandelte, den Ruf annahm und die Stelle im Sommersemester 1985 antreten konnte.77
Wie eingangs gesagt, eine einfache Antwort auf die Frage, warum Stegemann seine Habilitationsschrift nie selbst veröffentlicht hat, gibt es nicht. Dass die Kontroverse um seine Thesen im Rahmen des Habilitationsverfahrens hier eine Rolle spielte, erscheint plausibel. Was heute in der Paulusexegese und in der Verhältnisbestimmung von Judentum und Christentum insbesondere in der anglo-amerikanischen Exegese weithin Konsens geworden ist, lag in der deutschsprachigen neutestamentlichen Forschung der 1980er Jahre noch deutlich außerhalb etablierter Diskurse.
Stegemann hat mit seiner Habilitationsschrift eine Arbeit vorgelegt, die sich nicht nur kohärent zu seinem Werdegang bis dahin verhielt, sondern auch »schon grundlegend und in vielen Details [enthielt], was dann theologisch und exegetisch sein Lebenswerk prägte«.78 In mancher Hinsicht war er dem Kontext, in dem er forschte und lehrte, weit voraus und eckte entsprechend auch an mit Thesen, die erst Jahrzehnte später in den aktuellen Diskursen salonfähig geworden sind und an Akzeptanz gewonnen haben. Stegemanns engagierter und dezidiert theologischer Versuch zeigt eindrücklich auf, dass und wie der berühmteste Brief des Apostels Paulus nach Rom frei von Antijudaismen gelesen werden kann. Stegemann tat dies in engagierter und mutiger Weise in Auseinandersetzung mit der Forschung aus seinem Umfeld, aber auch aus früheren Zeiten. Forschungsgeschichtlichen Größen räumt er Platz ein und tritt mit ihnen in einen fruchtbaren Dialog. Stegemann endete seinen in der Habilitationszeit verfassten und oben genannten Aufsatz Der Jude Paulus und seine antijüdische Auslegung mit Bezug auf den von ihm hoch geschätzten Albert Schweitzer: »Ich hoffe, daß wir in ein paar Jahrzehnten sagen können, daß wir Paulus aus dem Antijudaismus gerettet haben. Schweitzer – ich bin gewiß – freute sich mit uns.«79 Festzuhalten bleibt, dass Stegemann in seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit als Professor für Neues Testament maßgeblich dazu beigetragen hat.80
Einleitung
Mit dem Namen des Apostel Paulus verknüpft sich seit je her die Idee einer brüderlich geeinten Menschheit, die alle ihre objektiven Unterschiede und schmerzlich trennenden Gegensätze hinter sich läßt. Die folgende Untersuchung des Römerbriefes unterstreicht das Recht solcher Assoziation. Damit reiht sie sich ein in die Geschichte der Auslegung, die zumal seit der Aufklärung mit dem Stichwort »Universalismus« den entscheidenden Beitrag des Apostel Paulus zur Urchristentumsgeschichte bezeichnet. Zugleich unterscheidet sie sich jedoch von dem Hauptstrom dieser Auslegungstradition, da sie die paulinische Hoffnung auf die Erneuerung der Menschheit in brüderlicher Einheit nicht von einer prinzipiellen Antithese zu Israel und dem Judentum begleitet sieht.
»Universalismus« und »Antijudaismus« gelten schon in der (späten) Aufklärungstheologie als die einander korrespondierenden Prinzipien des paulinischen Christentums (vgl. dazu K. Aner 1921; K. Scholder 1971). Erst von F. Chr. Baur wird diese Paulusinterpretation jedoch einer Gesamtdeutung der Urchristentumsgeschichte integriert, ja, zum hermeneutischen Schlüssel der Religions- und Christentumsgeschichte insgesamt gemacht.
Für Baur kam bei Paulus das Christentum zum Bewußtsein seiner selbst und das heißt zum Bewußtsein des Prinzips des Universalismus. Zugleich erreichte für ihn damit die Dynamik der Religionsgeschichte der alten Welt ihren Höhepunkt. Denn einerseits habe Paulus nur konsequent weiterentwickelt, was der Intention nach schon bei Jesus selbst angelegt gewesen sei. Andererseits vollendete der Apostel nach Baurs Meinung, was die griechisch-römische Kultur, vor allem aber die jüdisch-hellenistische Symbiose der alexandrinischen Religionsphilosophie auch anstrebten. »Ihren innersten Mittelpunkt haben alle diese Erscheinungen in dem Drange des Geistes, alles Beschränkte, Nationale, Particuläre zur Universalität aufzuheben, und in eine freiere und weitere Sphäre einzutreten« (1866, 91f.).
Gleichwohl konnte für Baur dieser Drang des Geistes nur dann zum Bewußtsein seiner selbst kommen, als durch den Gott-Menschen Jesus Christus der eine Gott mit der einen Menschheit versöhnt war und zugleich gegen jede partikulare Vermittlung dieser Idee prinzipiell Widerspruch erhoben wurde. Da aber das Judentum diese Idee nach Baurs Überzeugung immer nur partikular vermitteln konnte, schloß das dem Paulus bewußt gewordene christliche Prinzip des reinen Universalismus den »Bruch mit dem Judenthum in sich« ein (1860, 46). Ihn vollzogen zu haben, und zwar auch und gerade gegen solche Anhänger Jesu, die das Christentum noch innerhalb der Grenzen des partikularen Judentums gefangenhielten, macht für Baur die eigentliche Bedeutung des Paulus aus. Aus dieser Perspektive kann er in seiner nachgelassenen Vorlesung zur Theologie des Neuen Testaments sogar formulieren, »daß das wesentliche Element seines (sc. des Apostel Paulus) Lehrbegriffs die Antithese gegen das Judenthum ist« (1864, 132).
Ähnlich wie die Theologie der späten Aufklärung hat auch Baur den Antijudaismus als ein Prinzip verstanden, das seine Funktion für die Befreiung des Christentums vom Judenthum immer wieder historisch zu erfüllen hatte. Schon bei J. S. Semler begegnet die Vorstellung, daß die Entstehung des Christentums ein allmählicher, durch Regressionen immer wieder unterbrochener Prozeß der Emanzipation vom Judentum gewesen sei. Mit dieser Theorie erklärte er sich die divergierenden theologischen Tendenzen innerhalb des urchristlichen Schrifttums und zumal die Widersprüche in den Evangelien. Zugleich versuchte er so, den Angriff auf die christliche Theologie zu parieren, der deren Konformität mit den Prinzipien einer »vernünftigen« Religion in Frage stellte. Alles, was im Neuen Testament mit der zeitgenössischen Forderung nach einer reinen Religion nicht übereinstimmte, wurde deshalb von Semler als noch nicht überwundene, menschlich verständliche Anhänglichkeit oder als Akkommodation an das Judentum erklärt (vgl. dazu H. Liebeschütz 1967, 133ff.).
Baur setzte zwar diesen bloß apologetischen Gebrauch der historischen Kritik nicht fort. Doch wendete seine konsequent historische Methode das primitive Akkommodations- und Regressionsschema Semlers dialektisch auf die gesamte Christentumsgeschichte an, bis hin zu der grotesken Behauptung, daß der Katholizismus des Mittelalters »die unendliche Entwicklungsfähigkeit des Judenchristenthtums« (1860, 76) unter Beweis gestellt habe. Das Judentum gerät so bei Baur zum prinzipiellen Gegner des wahren, nämlich paulinisch-protestantischen Wesens des Christentums. Das Prinzip des Antijudaismus erhält entsprechend die ideologische Funktion, das Christentum zu seinem wahren Wesen immer wieder zurückzurufen. In gewisser Weise figuriert das Judentum als Chiffre für alles Inferiore und Partikulare, von dem das Christentum sich zu emanzipieren hat, wenn anders es mit seinem Wesen historisch identisch werden oder bleiben will.
Baur hat dabei einer »marcionitischen« Konsequenz widerstanden (vgl. schon 1835, 656ff. gegen Schleiermacher). Und anders als Semler (vgl. H. Liebeschütz 1967, 15) hat er, zumal in seinen späten Schriften, die Sittlichkeit des Alten Testaments hoch eingeschätzt, und zwar im Zusammenhang einer Verschiebung des anfänglich spekulativ bestimmten Prinzips des Universalismus hin zu einem Prinzip des sittlichen Universalismus (vgl. dazu W. Geiger 1964, 81ff.). Gleichwohl reflektiert sich in Baurs Schema, was politisch für nicht wenige der liberalen Befürworter der »bürgerlichen Verbesserung« der Juden immer gegolten hat: Die Emanzipation der Juden sollte zwar deren Integration in die bürgerliche und mithin in die christliche Gesellschaft dienen, so aber gerade das Judentum selbst überwinden.
In gewisser Weise nimmt Baur so am Vorabend des modernen politischen Antisemitismus dessen Prinzip theologisch vorweg (vgl. dazu meine Kritik 1980, 122ff.). Er legt das Judentum a limine auf einen religiös inferioren Status gegenüber dem Christentum fest; ja, er erklärt das Judentum als diejenige Gefahr, die das Christentum an seiner Selbstverwirklichung hindert (vgl. zum Einfluß des politischen Parteienstreits auf Baurs Tendenzkritik W. Geiger 1964, 172ff.).
Allerdings muß der Unterschied dieses theologischen Antijudaismus zum modernen Antisemitismus beachtet werden. Für diesen waren nicht nur das Judentum als Religion, sondern auch die Juden als Bürger ein für allemal auf einen inferioren Status festgelegt. Der politische Antisemitismus strebte darum an, die soziale und politische Diskriminierung der jüdischen Minorität vor der Emanzipation festzuschreiben, wo sie noch vorhanden war, oder wiederherzustellen, wo sie durch die Gesetzgebung bereits überwunden worden war (vgl. dazu zuletzt J. Katz 1980, bes. 321). Verbunden mit den national-konservativen Tendenzen im Deutschen Reich nach 1870 (vgl. dazu G. Seebaß 1980, 177ff.) hat dieser Antisemitismus alle möglichen Elemente des Judenhasses angezogen, zumal in seiner vulgären Artikulation. Dabei kam es vereinzelt auch zu einer bemerkenswerten Wende in der Beurteilung des Paulus. Gerade der in der Tübinger Schule gerühmte Universalismus des Apostels wurde als ein der nationalen deutschen Einigung entgegenstehendes jüdisches Erbe verdächtigt. Wie das Judentum überhaupt nun nicht mehr wegen seiner Partikularität und sozialen Kohäsion, sondern wegen seiner Internationalität und demokratischen Liberalität zur Gefahr für die Einigung der deutschen Nation erklärt wurde, so galt auch Paulus als Verfechter einer antinationalen jüdischen Weltreligion im Gewande des Christentums. Für den Göttinger Orientalisten P. de Lagarde standen deshalb Protestantismus und Katholizismus ebenso wie natürlich das Judentum der Entstehung einer »deutschen Religion« im Wege. Denn auch das Christentum habe, wenn auch in den großen Konfessionen ganz unterschiedlich, durch Paulus, der als Pharisäer, der er war und immer geblieben ist, »gelehrt …, daß Israel die Blüthe der Menschheit sei, und die Menschheit nur in und durch Israel beglückt werden könnte« (51920, 66), die »jüdische Ansicht von der Geschichte« und andere Prinzipien jüdischer Religion aufgesogen. Mit seinem »raffinierten Israelitismus« habe Paulus das Alte Testament und dessen »pharisäische Exegese« dem Evangelium Jesu aufgezwungen und es dabei zerstört. Indem er sich zugleich mit der alttestamentlichen »Verstockungstheorie« – Lagarde spielt offenbar auf Röm 9–11 an – »gegen alle Einwürfe gepanzert« (51920, 62) habe, sei es ihm gelungen, das Evangelium Jesu zu verfälschen. Trotz der Ablehnung durch die wahren Anhänger Jesu, die von Paulus nach Meinung Baurs mit Recht bekämpften Judenchristen also, habe er seine Botschaft als das wahre Evangelium durchsetzen können.
Lagardes Antipaulinismus wäre trotz seines nachhaltigen Einflusses auf die Deutschen Christen und die Ideologen des Dritten Reiches nicht erwähnenswert, käme hier nicht etwas zum Ausdruck, was – freilich in anderer Weise – auch in der protestantischen Theologie erörtert worden ist. Ich meine jene Debatte um die jüdischen und nicht-jüdischen (d. h. hellenistischen) Anteile an der paulinischen Theologie. Auf der einen Seite, vertreten zumal durch R. Reitzenstein und W. Bousset, findet man »in der Weltanschauung des Apostels … die beiden Elemente des jüdisch-apokalyptischen und des hellenistisch-mystischen Dualismus zusammen« (W. Bousset 1913, 1291); auf der anderen Seite sieht man Paulus allein aus der jüdischen Eschatologie (so pointiert A. Schweitzer 1930) oder hauptsächlich aus der pharisäisch-rabbinischen Tradition (so E. Lohmeyer 1929) schöpfen. War für Bousset selbstverständlich, daß Paulus trotz seines durch den »Rabbinismus« und die Apokalyptik geprägten Denkens »›der‹ Führer des jungen Christentums bei seiner Befreiung von den Fesseln einer national bedingten Religion« (1918, 1280) war, so sah Schweitzer den Apostel eine im nachexilischen und zumal im apokalyptischen Judentum vorbereitete Entwicklung konsequent weiterführen. Aus der dort begründeten Aporie zwischen Eschatologie und Gesetz haben nach Schweitzer Paulus und das rabbinische Judentum unterschiedliche Konsequenzen gezogen: »Paulus opfert das Gesetz der Eschatologie. Das Judentum gibt die Eschatologie auf und behält das Gesetz« (1930, 190). Selbstverständlich ist sich Schweitzer bewußt, daß diese Alternative eine idealtypische ist. Wie sich bei Paulus eine positive Beziehung auf das Gesetz findet, so im rabbinischen Judentum eine Reminiszenz der Eschatologie. Gleichwohl sind es nicht nur diese grundsätzlich alternativen Tendenzen, die hier wie dort bestimmend sind. Vielmehr hat die Akkommodation des Paulus an das Gesetz ihren Grund darin, daß das messianische Reich, in dem es endgültig aufgehoben sein wird, noch nicht vollendet ist. Es hat mit der auf dieser eschatologischen Differenzerfahrung beruhenden »Theorie des status quo« zu tun, daß »der gläubig gewordene Jude als Jude