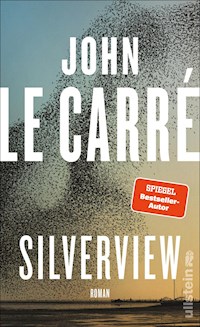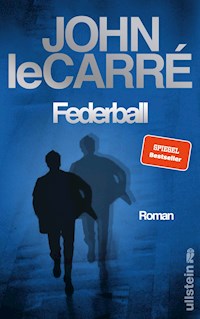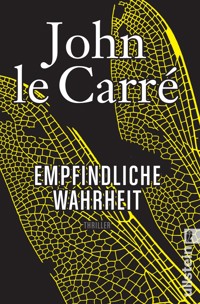14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - Justin Quayle, Diplomat im britischen Hochkommissariat in Nairobi und begeisterter Hobbygärtner, führt ein beschauliches Leben – bis zu dem Tag, an dem seine junge Frau Tessa ermordet aufgefunden wird. Justin macht sich auf die Suche nach dem Mörder und entdeckt, dass die rebellische Tessa einem Komplott auf der Spur war, in das nicht nur die mächtige Pharmaindustrie, sondern auch britische Regierungskreise verwickelt zu sein scheinen. Doch erst im Laufe seiner zunehmend brisanten Nachforschungen wird ihm klar, wie wenig er die Frau, die er zu lieben glaubte, wirklich kannte und wie viel er ihr schuldig geblieben ist. Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Mitten in der Wüste von Kenia, am Ufer des Turkanasees, wird die junge schöne Tessa Quayle ermordet aufgefunden. Ihr Begleiter und angeblicher Geliebter, der afrikanische Arzt Arnold Bluhm, ist spurlos verschwunden. Der Mord droht das britische Hochkommissariat in Nairobi in einen Skandal zu stürzen, denn Tessas Ehemann Justin ist Diplomat im britischen Dienst, und schon zu Lebzeiten hatte Tessa keine politischen Rücksichten genommen. Während sich im Hochkommissariat alle bemühen, den Fall zu vertuschen, begibt sich der leidenschaftliche Hobbygärtner Justin Quayle auf die Suche nach dem Mörder seiner Frau. Verfolgt und ganz auf sich gestellt, dringt er immer tiefer in das Dickicht einer groß angelegten Verschwörung ein, in die nicht nur die Pharmaindustrie und ein dubioses Handelsunternehmen verstrickt zu sein scheinen, sondern auch britische Regierungskreise.
Mit Hilfe alter Briefe und E-Mails von Tessa nimmt Justin die Spur auf. Seine Suche führt ihn quer durch Europa und Kanada und wird schon bald zu einer Odyssee voller Schrecken und Gewalt. Skrupellose Machenschaften und merkwürdige Allianzen tun sich auf. Und je mehr Justin über Tessas Engagement erfährt, desto klarer wird ihm das eigentliche Ziel seiner Reise: die Entdeckung, wer seine geliebte Frau wirklich war und wie sehr er sie verkannt hatte.
Der Autor
John le Carré, am 19. Oktober 1931 in Poole, Dorset, geboren, war nach seinem Studium in Bern und Oxford in den sechziger Jahren in diplomatischen Diensten u. a. in Bonn und Hamburg tätig. Mit Der Spion, der aus der Kälte kam begründete er 1963 seinen Weltruhm als Bestsellerautor, der durch die darauf folgende Smiley-Trilogie gefestigt wurde. Der ewige Gärtner ist John le Carrés achtzehnter Roman. Der Autor lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Von John le Carré sind in unserem Hause bereits erschienen:
Absolute Freunde · Agent in eigener Sache · Dame, König, As, Spion · Das Rußlandhaus · Der ewige Gärtner · Der heimliche Gefährte · Der Nachtmanager · Der Spion, der aus der Kälte kam · Der Schneider von Panama · Der wachsame Träumer · Die Libelle · Ein blendender Spion · Ein guter Soldat · Ein Mord erster Klasse · Eine Art Held · Eine kleine Stadt in Deutschland · Empfindliche Wahrheit · Geheime Melodie · Krieg im Spiegel · Marionetten · Schatten von gestern · Single & Single · Unser Spiel · Verräter wie wir
John le Carré
Der ewige Gärtner
Roman
Aus dem Englischen von Werner Schmitz unter Mitarbeit von Karsten Singelmann
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0181-5
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch
1. Auflage Oktober 2002 7. Auflage 2011 © für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005 © 2001 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München / List Verlag © 2001 by David Cornwell Titel der englischen Originalausgabe:The Constant Gardener (Hodder and Stoughton, London) Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: Mann, Wasser, Vögel: gettyimages Hintergrund: © Kappa/laif
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In Erinnerung an Yvette Pierpaoli,die sich weigerte, wegzusehen.
Trachte stets nach mehr als du erlangen kannst,Oder wozu gibt es einen Himmel?
»ANDREA DEL SARTO« VON ROBERT BROWNING
ERSTES KAPITEL
Die Nachricht erschütterte das Britische Hochkommissariat in Nairobi an einem Montagmorgen um neun Uhr dreißig. Sandy Woodrow empfing sie erhobenen Hauptes mit vorgerecktem Kinn, als wäre sie eine Gewehrkugel, die ihm mitten durch sein gespaltenes englisches Herz fuhr. Sie traf ihn im Stehen. Daran konnte er sich später genau erinnern. Er hatte am Schreibtisch gestanden, die Hand nach irgendetwas ausgestreckt, als das hausinterne Telefon klingelte. Er nahm Haltung an, als er das Klingeln hörte, und beugte sich vor, um den Hörer vom Tisch zu angeln und »Woodrow« zu sagen. Oder auch: »Hier Woodrow.« Auf jeden Fall kam sein Name recht barsch heraus, dessen war er sich sicher: Seine Stimme klang wie die eines anderen, und sie klang ungehalten. »Hier Woodrow«, sein durchaus annehmbarer Name, den er ohne das Mildernde seines Spitznamens Sandy herausbellte, als verabscheute er ihn. Doch in exakt dreißig Minuten sollte die übliche Gebetsversammlung des Hochkommissars stattfinden, und Woodrow würde als Leiter der Kanzlei, wie die politische Abteilung hieß, wieder einmal den Diskussionsleiter spielen müssen für einen Haufen Primadonnen, die jede danach verlangte, mit ihrem speziellen Anliegen den Hochkommissar ganz allein mit Beschlag zu belegen.
Kurzum, es war einer dieser unseligen Montage Ende Januar, dem heißesten Monat in Nairobi, eine Zeit des Staubes und der Wasserknappheit, eine Zeit, in der das Gras braun und die Augen wund waren und der Straßenbelag vor Hitze aufplatzte und in der die Jakarandabäume, wie jeder andere auch, auf den großen Regen warteten.
Warum er gestanden hatte, war eine Frage, die sich nie mehr wirklich klären ließ. Eigentlich hätte er am Schreibtisch sitzen, die Tastatur bearbeiten und begierig die eingehenden Direktiven aus London und Berichte aus den benachbarten afrikanischen Missionen durchgehen müssen. Stattdessen hatte er also vor dem Schreibtisch gestanden und irgendeine dieser unglaublich wichtigen Handlungen vollzogen – vielleicht das Foto von seiner Frau Gloria und den beiden kleinen Söhnen zurechtgerückt, das sie im letzten Sommer aufgenommen hatten, als die Familie auf Heimaturlaub war. Das Hochkommissariat lag an einem Abhang, der immer weiter absackte, so dass Bilder, die ein Wochenende lang unbeaufsichtigt blieben, im Rahmen verrutschten.
Vielleicht hatte er auch gerade Mückenspray auf eins dieser kenianischen Insekten gesprüht, gegen die nicht einmal Diplomaten immun waren. Erst vor wenigen Monaten hatten sie eine regelrechte Plage so genannter Nairobi-eyes gehabt, Fliegen, die Furunkel und Blasen verursachten und einen sogar erblinden lassen konnten, wenn man sie zerdrückte und versehentlich auf der Haut zerrieb. Er hatte also gerade gesprüht, als er das Telefon läuten hörte, hatte die Dose auf seinem Schreibtisch abgestellt und nach dem Hörer gegriffen: Gut möglich, dass es so gewesen war, denn sein Erinnerungsfilm zeigte ihm das Farbdia einer roten Insektenspraydose auf dem Ausgangskorb. Mit »Hier Woodrow«, hatte er sich den Telefonhörer ans Ohr gepresst.
»Oh, Sandy, hier ist Mike Mildren. Guten Morgen. Sind Sie allein, wenn ich fragen darf?«
Eitel, übergewichtig, vierundzwanzig Jahre alt: Mildren, der Privatsekretär des Hochkommissars, Arbeiterkind, war frisch aus England gekommen, auf seinem ersten Posten in Übersee – und bei den rangniederen Mitarbeitern, wie kaum anders zu erwarten, nur als Mildred bekannt.
Doch, bestätigte Woodrow, er sei allein. Warum?
»Es ist etwas passiert, fürchte ich. Ich wollte eigentlich fragen, ob ich mal kurz runterkommen könnte.«
»Hat das nicht Zeit bis nach der Sitzung?«
»Tja, ich glaube nicht – nein, keinesfalls«, erwiderte Mildren mit zunehmender Entschiedenheit. »Es geht um Tessa Quayle, Sandy.«
Mit einem Schlag war Woodrow wie ausgewechselt, die Nackenhaare sträubten sich, die Nerven lagen bloß. Tessa. »Was ist mit ihr?«, fragte er betont gleichgültig, während seine Gedanken sich überschlugen. Oh, Tessa. Mein Gott. Was hast du jetzt wieder angestellt?
»Die Polizei hier in Nairobi sagt, sie sei ermordet worden«, erklärte Mildren, als wäre es das Alltäglichste von der Welt.
»Ach, Unsinn«, fauchte Woodrow, ohne weiter nachzudenken. »Seien Sie nicht albern. Wo denn? Wann?«
»Dies Wochenende. Am Turkanasee. Ostufer. Über Einzelheiten schweigen sie sich aus. In ihrem Auto. Einen bedauerlichen Unfall haben sie es genannt«, fügte er fast kleinlaut hinzu. »Ich habe das Gefühl, dass man versucht, uns die Sache so schonend wie möglich beizubringen.«
»In was für einem Auto?«, fragte Woodrow heftig – alles in ihm wehrte sich gegen diesen Wahnsinn. Er verdrängte das Wer, Wie, Wo und all die anderen Fragen und Befürchtungen. Bloß weg damit – bewusst löschte er seine geheimen Gedanken an Tessa aus dem Gedächtnis und ersetzte sie durch das Bild der ausgedörrten Mondlandschaft am Turkanasee, wie er sie von einer Exkursion her in Erinnerung hatte, die er erst sechs Monate zuvor in der untadeligen Gesellschaft des Militärattachés unternommen hatte. »Bleiben Sie, wo Sie sind, ich komme hoch. Und sprechen Sie mit niemandem darüber, verstanden?«
Woodrow handelte jetzt mit Bedacht, legte den Hörer auf, ging um den Schreibtisch herum, nahm sein Jackett von der Rückenlehne des Stuhls und streifte es über, einen Ärmel nach dem anderen. Es war nicht etwa so, dass er gewohnheitsmäßig ein Jackett anzog, wenn er nach oben ging. Es herrschte kein Jackettzwang bei den montäglichen Sitzungen und erst recht nicht bei einem Gespräch mit dem dicken Mildren im Büro des Hochkommissars. Doch der Profi in Woodrow ahnte, dass ihm ein langer Weg bevorstand. Auf der Treppe nach oben gelang es ihm, sich zur Ordnung zu rufen und auf seine obersten Prinzipien im Fall einer drohenden Krise zu besinnen. Und so sagte er sich, wie er bereits Mildren versichert hatte, dass es sich bei der ganzen Sache nur um ausgemachten Unsinn handeln konnte. Zum Beweis führte er sich den sensationellen Fall jener jungen Engländerin vor Augen, die zehn Jahre zuvor im afrikanischen Busch zerstückelt aufgefunden worden war. Eine makabre Falschmeldung, ja natürlich, das musste es sein. Der kranken Phantasie irgendeines wild gewordenen afrikanischen Polizisten entsprungen, der halb wahnsinnig vom bangi in der Wüste festsitzt und sein kärgliches Gehalt aufbessern will, das seit sechs Monaten nicht mehr ausgezahlt worden ist.
Das gerade erst fertig gestellte Gebäude, in dem Woodrow nach oben stieg, war nüchtern und zweckmäßig. Ihm gefiel der Stil, vielleicht, weil er mit seinem eigenen übereinstimmte. Das klar abgegrenzte Gelände, die Kantine, der Laden, die Kraftstoffpumpe und die sauberen, gedämpften Flure strahlten etwas Selbstgenügsames, Robustes aus. Woodrow verfügte, jedenfalls nach außen, über dieselben bewährten Eigenschaften. Er war vierzig Jahre alt und mit seiner Frau Gloria glücklich verheiratet – oder falls nicht, ging er jedenfalls davon aus, dass er der Einzige war, der darüber Bescheid wusste. Als Leiter der Kanzlei durfte er ziemlich sicher sein, dass ihm die nächste Versetzung, wenn er nur seine Karten richtig ausspielte, seine eigene bescheidene Gesandtschaft bescheren würde. Von dort würde er dann über einige weniger bescheidene Gesandtschaften zur Ritterwürde fortschreiten – eine Aussicht, der er selber, versteht sich, keinerlei besondere Bedeutung beimaß, aber für Gloria würde es ihn denn doch freuen. Er hatte etwas von einem Soldaten, aber er war ja schließlich auch der Sohn eines Soldaten. In nunmehr siebzehn Jahren im diplomatischen Dienst Ihrer Majestät hatte er die Fahne in einem halben Dutzend der britischen Missionen in Übersee hochgehalten. Das gefährliche, im Verfall begriffene, ausgeplünderte, bankrotte, einstmals britische Kenia hatte sein Blut jedoch mehr in Wallung gebracht als die meisten anderen. Inwieweit dies auf Tessas Konto ging, wagte er sich allerdings nicht zu fragen.
»Also gut«, sagte er angriffslustig zu Mildren, kaum dass er die Tür hinter sich geschlossen und dann verriegelt hatte.
Mildren schmollte wie gewöhnlich. Er hockte an seinem Schreibtisch wie ein ungezogener dicker Junge, der sich weigert, seinen Brei aufzuessen.
»Sie hat in der Oase übernachtet«, gab er zurück.
»Welche Oase? Bitte genauer, wenn’s geht.«
Aber Mildren war nicht so leicht einzuschüchtern, wie Woodrow aufgrund seines Alters und Rangs vielleicht erwartet hätte. Mildren hatte sich stenografische Notizen gemacht und konsultierte sie, bevor er weitersprach. So was bringt man denen heutzutage wohl bei, dachte Woodrow verächtlich. Wie sonst sollte ein Londoner Emporkömmling wie Mildren Zeit finden, Stenografie zu lernen?
»Die Oase ist eine Art Hotel am Ostufer des Turkanasees, am südlichen Ende«, verkündete Mildren, die Augen auf seinen Block gerichtet. »Dort hat Tessa die Nacht verbracht und ist am nächsten Morgen mit einem vom Hotel bereitgestellten Jeep aufgebrochen. Ihren Angaben zufolge wollte sie zweihundert Meilen nördlich die Wiege der Zivilisation besichtigen. Die Leakey-Grabung.« Er korrigierte sich: »Die Stätte von Richard Leakeys Ausgrabungen. Im Sibiloi-Nationalpark.«
»Allein?«
»Wolfgang hatte einen Fahrer besorgt. Dessen Leiche war auch mit im Jeep.«
»Wolfgang?«
»Der Hotelbesitzer. Nachname folgt noch. Wird von allen Wolfgang genannt. Offenbar ein Deutscher. Ein Original. Der Polizei zufolge wurde der Fahrer brutal ermordet.«
»Wie denn?«
»Geköpft. Wird vermisst.«
»Wer wird vermisst? Sie sagten doch, er sei mit in dem Fahrzeug gewesen.«
»Der Kopf wird vermisst.«
Darauf hätte ich wohl selbst kommen können, wie? »Und wie soll Tessa umgekommen sein?«
»Sie haben nur was von einem Unfall gesagt.«
»Wurde sie ausgeraubt?«
»Laut Polizei nicht.«
Nichts geraubt, dazu der Mord an dem Fahrer – Woodrows Phantasie drohte mit ihm durchzugehen. »Ich will alle Fakten, und zwar exakt so, wie Sie sie haben«, befahl er.
Mildren stützte seine ausladenden Wangen in die Hände und zog erneut seine Notizen zu Rate. »Neun Uhr neunundzwanzig, Anruf aus dem Polizeipräsidium Nairobi. Die Einsatzleitung wünscht den Hochkommissar zu sprechen«, zitierte er. »Ich erklärte, dass Se. Exzellenz in der Stadt sei, bei den Ministerien, und spätestens um zehn Uhr zurückerwartet werde. Ein kompetent klingender Offizier vom Dienst, Name liegt vor, sagte, ihm würde aus Lodwar berichtet –«
»Lodwar? Das ist doch meilenweit weg vom Turkana!«
»Ist aber der nächste Polizeiposten«, erwiderte Mildren. »Ein Jeep, Eigentum des Hotels Oase am Turkanasee, wurde verlassen an der Ostseite des Sees aufgefunden, kurz vor Allia Bay, auf dem Weg zur Leakey-Grabungsstätte. Die Leichen waren mindestens sechsunddreißig Stunden alt. Eine tote weiße Person, Geschlecht weiblich, Todesursache ungeklärt, ein männlicher Afrikaner ohne Kopf, identifiziert als Noah, der Fahrer, verheiratet, vier Kinder. Ein Safaristiefel Marke Mephisto, Größe sieben. Eine blaue Safarijacke, Größe XL, mit Blutflecken, auf dem Boden des Fahrzeugs. Die Frau Mitte bis Ende zwanzig, dunkle Haare, goldener Reif am Ringfinger der linken Hand. Eine goldene Halskette auf dem Boden des Fahrzeugs.«
Diese Kette, die Sie da tragen. Woodrow hörte, wie er sie beim Tanzen geneckt hatte.
Meine Großmutter hat sie meiner Mutter zur Hochzeit geschenkt, antwortete sie. Ich trage sie zu allem, selbst wenn sie nicht zu sehen ist.
Sogar im Bett?
Kommt drauf an.
»Wer hat sie gefunden?«, fragte Woodrow.
»Dieser Wolfgang. Er hat die Polizei angefunkt und sein Büro hier in Nairobi verständigt. Ebenfalls über Funk. In der Oase gibt es kein Telefon.«
»Woher will man denn wissen, dass es der Fahrer war, wenn er keinen Kopf mehr hatte?«
»Er hatte einen kaputten Arm. Deswegen hat er als Fahrer gearbeitet. Wolfgang hat beobachtet, wie Tessa mit Noah am Samstag um fünf Uhr dreißig losgefahren ist, in Begleitung von Arnold Bluhm. Das war das letzte Mal, dass er sie lebend gesehen hat.«
Mildren zitierte immer noch aus seinen Notizen – oder zumindest tat er so. Die Wangen ruhten weiter in seinen Händen, und angesichts der starren Haltung seiner Schultern schien er fest entschlossen, sie dort zu lassen.
»Wiederholen Sie das noch mal«, unterbrach Woodrow die entstandene Stille.
»Tessa war in Begleitung von Arnold Bluhm. Sie kamen zusammen in der Oase an, verbrachten die Nacht zum Sonnabend dort und sind morgens um fünf Uhr dreißig in Noahs Jeep aufgebrochen«, wiederholte Mildren geduldig. »Man hat Bluhm nicht im Jeep gefunden, und auch sonst gibt es keine Spur von ihm. Jedenfalls soweit bisher bekannt. Die Polizei von Lodwar und das Einsatzteam sind vor Ort, und das Präsidium in Nairobi will wissen, ob wir den Hubschrauber bezahlen.«
»Wo sind die Leichen jetzt?« Woodrow war ganz der Sohn seines Vaters, militärisch kurz und zackig.
»Nicht bekannt. Die Polizei wollte, dass die Oase sie in Verwahrung nimmt, aber Wolfgang hat sich geweigert. Er meinte, sein Personal würde das Weite suchen und die Gäste ebenfalls.« Und nach kurzem Zögern. »Sie hat sich als Tessa Abbott eingetragen.«
»Abbott?«
»Ihr Mädchenname. Tessa Abbott, und als Anschrift ein Postfach in Nairobi. Unsers. Wir haben hier keine Abbotts, also habe ich den Namen in unseren Daten gesucht und Quayle gefunden. Mädchenname Abbott, Tessa. Wenn ich richtig informiert bin, hat sie den Namen bei ihren Hilfsaktivitäten benutzt.« Mildren studierte die letzte Seite seiner Aufzeichnungen. »Ich habe versucht, den Hochkommissar zu erreichen, aber er macht die Runde durch die Ministerien, und ich komme nicht durch.« Was soviel heißen sollte wie: Wir befinden uns in Präsident Mois modernem Nairobi, wo man bei einem Ortsgespräch manchmal eine halbe Stunde lang das »Entschuldigen Sie, alle Leitungen sind besetzt, versuchen Sie es bitte später noch einmal« zu hören bekommt, unermüdlich wiederholt von einer zufrieden klingenden Frau mittleren Alters.
Woodrow stand bereits an der Tür. »Und Sie haben niemandem was gesagt?«
»Keiner Menschenseele.«
»Und die Polizei?«
»Angeblich auch nicht. Aber für Lodwar übernehmen sie keine Verantwortung. Und wenn Sie mich fragen, wäre ich mir bei denen selbst auch nicht sicher.«
»Und ihr Mann? Soweit Sie wissen, hat Justin doch noch nichts davon erfahren, oder?«
»Richtig.«
»Wo ist er?«
»Ich nehme an, in seinem Büro.«
»Sorgen Sie dafür, dass er da bleibt.«
»Er ist heute früher als sonst gekommen. Wie immer, wenn Tessa unterwegs ist. Soll ich die Sitzung absagen?«
»Warten Sie noch.«
Woodrow, der nun ganz sicher war – falls er je Zweifel gehabt hatte –, dass er es nicht nur mit einer Tragödie, sondern mit einem Skandal der Windstärke zwölf zu tun hatte, stürmte die Hintertreppe hinauf, zu der Unbefugte keinen Zutritt hatten. Er trat in einen finsteren Gang, der zu einer verschlossenen Stahltür mit Guckloch und Klingelknopf führte. Eine Kamera nahm ihn ins Visier, während er auf den Knopf drückte. Die Tür wurde von einer gertenschlanken, rothaarigen Frau in Jeans und geblümter Bluse geöffnet. Sheila, dachte er automatisch, die Nummer zwei, spricht Kisuaheli.
»Wo ist Tim?«, fragte er.
Sheila drückte auf den Summer und sprach dann in einen Kasten. »Sandy ist da, er hat’s eilig.«
»Noch eine Minute Geduld bitte!«, rief eine kräftige männliche Stimme.
Sie geduldeten sich.
»Die Luft ist jetzt rein«, meldete dieselbe Stimme, und eine weitere Tür ging rülpsend auf.
Sheila trat zurück, und Woodrow schritt an ihr vorbei in das Zimmer. Tim Donohue, der zwei Meter große Leiter der Abteilung, hatte sich vor seinem Schreibtisch aufgebaut. Er musste ihn leer geräumt haben, denn es war kein einziges Blatt Papier darauf zu sehen. Donohue wirkte noch kränker als gewöhnlich. Woodrows Frau Gloria war fest davon überzeugt, dass er an ei ner tödlichen Krankheit litt. Die Wangen waren eingesunken und farblos, die Augen lagen tief in ihren Höhlen, und das Weiße war gelblich verfärbt. Die Haut am Lidrand schuppte sich. Der wuchernde Schnäuzer schien in komischer Verzweiflung nach unten ausgreifen zu wollen.
»Sandy. Seien Sie gegrüßt. Was liegt an?«, rief er und linste mit seinem Totenschädelgrinsen durch die Lesebrille auf Woodrow herab.
Er kommt einem zu nahe, rief sich Woodrow in Erinnerung. Er überfliegt dein Territorium und fängt deine Signale auf, noch bevor du sie ausgesendet hast. »Tessa Quayle soll irgendwo am Turkanasee ermordet worden sein«, sagte er mit dem rachsüchtigen Bedürfnis, die beiden zu schockieren. »Es gibt da eine Hotelanlage, die Oase. Ich muss mit dem Besitzer reden – über Funk.«
So werden sie ausgebildet, dachte er. Regel Nummer eins: Zeig niemals deine Gefühle, sofern du welche hast. Sheilas sommersprossiges Gesicht war starr wie immer, voller Nachdenklichkeit und Ablehnung. Tim Donohue zeigte weiter sein törichtes Grinsen – das allerdings von vornherein nichts zu bedeuten gehabt hatte.
»Tessa soll was, alter Junge? Sagen Sie das noch mal?«
»Sie soll getötet worden sein. Wie ist unbekannt, jedenfalls verrät die Polizei es nicht. Dem Fahrer ihres Jeeps wurde der Kopf abgehackt. Das ist alles.«
»Getötet und ausgeraubt?«
»Nur getötet.«
»In der Nähe des Turkanasees.«
»Ja.«
»Was zum Teufel hat sie da gewollt?«
»Ich habe keine Ahnung. Angeblich die Leaky-Grabungsstätte besuchen.«
»Weiß Justin es schon?«
»Noch nicht.«
»Ist sonst jemand beteiligt, den wir kennen?«
»Das ist eine der Fragen, die ich klären möchte.«
Donohue ging voraus zu einer schalldichten Kabine, die Woodrow noch nie gesehen hatte. Bunte Telefonapparate mit Schlitzen für Kodekarten; ein Faxgerät, das auf etwas stand, was wie ein Ölfass aussah; ein Funkgerät, aus grün gemaserten Metall kästen zusammengesetzt, obenauf ein frisch ausgedrucktes Nummernverzeichnis. So also flüstern sich unsere Spione von einem Gebäude zum anderen ihre Informationen zu, dachte er. Überwelt oder Unterwelt? Wer wusste das schon. Donohue setzte sich selbst ans Funkgerät, studierte das Verzeichnis und fummelte dann mit zitternden weißen Fingern an den Schaltern herum, während er wie der Held in einem Kriegsfilm laut wiederholte: »ZNB 85, ZNB 85 ruft TKA 60.– TKA 60, hören Sie mich, bitte? Over. Oase, hören Sie mich, Oase? Over.«
Das atmosphärische Rauschen wurde abgelöst von einem herausfordernden »Hier Oase. Laut und deutlich, Mister. Wer sind Sie? Over« – gesprochen mit starkem deutschen Akzent.
»Oase, hier ist das Britische Hochkommissariat in Nairobi, ich übergebe an Sandy Woodrow. Over.«
Woodrow stützte sich mit beiden Händen auf Donohues Schreibtisch, um näher ans Mikrofon zu gelangen.
»Hier Woodrow, Leiter der Kanzlei. Spreche ich mit Wolfgang? Over.«
»Privatkanzlei, so wie bei Hitler?«
»Die politische Abteilung. Over.«
»Okay, Mister Kanzler, ich bin Wolfgang. Was wollen Sie von mir wissen? Over.«
»Ich möchte Sie bitten, mir noch einmal die Frau zu beschreiben, die als Miss Tessa Abbott in Ihrem Hotel abgestiegen ist. Das ist doch soweit korrekt, oder? So hat sie sich doch eingetragen? Over.«
»Klar. Tessa.«
»Wie sah sie aus? Over.«
»Dunkle Haare, kein Make-up, groß, Ende zwanzig. Meiner Ansicht nach keine Britin. Eher aus Süddeutschland, Österreich oder Italien. Ich bin Hotelier. Ich hab einen Blick für Leute. Schöne Frau. Ich bin auch ein Mann. Sexy, ihre Bewegungen geschmeidig wie ein Tier. Und so dünne Fähnchen am Leib, dass man sie wegpusten konnte. Klingt das wie Ihre Abbott oder wie jemand anders? Over.«
Donohues Kopf war nur wenige Zentimeter von Woodrows entfernt, und Sheila stand auf seiner anderen Seite. Alle drei starrten auf das Mikrofon.
»Ja, das klingt nach Miss Abbott. Können Sie mir bitte sagen, wann und wie sie die Reservierung für Ihr Hotel vorgenommen hat? Sie haben auch ein Büro in Nairobi? Over.«
»Vergessen Sie’s.«
»Wie bitte?«
»Dr. Bluhm war’s, der reservier that. Zwei Personen, zwei Hütten in Poolnähe, für eine Nacht. Ist nur noch eine Hütte frei, habe ich ihm gesagt. Okay, die nimmt er. Das ist ein Bursche. Wow. Alle haben den beiden hinterhergestarrt. Die Gäste, das Personal. Eine schöne weiße Frau, ein umwerfend aussehender afrikanischer Arzt. War ’n netter Anblick. Over.«
»Wie viele Räume hat so eine Hütte?«, fragte Woodrow in der schwachen Hoffnung, den drohenden Skandal noch abwenden zu können.
»Ein Schlafzimmer, zwei Einzelbetten, nicht zu hart, gut gefedert. Ein Wohnzimmer. Und hier trägt sich jeder ins Empfangsbuch ein. Keine komischen Namen, sag ich immer. Menschen gehen verloren. Ich muss wissen, wer wer ist. Dann ist das also ihr Name, ja? Abbott? Over.«
»Ihr Mädchenname. Over. Das Postfach, das sie angegeben hat, ist das des Hochkommissariats.«
»Wo ist der Ehemann?«
»Hier in Nairobi.«
»Auweia!«
»Wann hat denn Bluhm die Reservierung vorgenommen? Over.«
»Am Donnerstag. Donnerstagabend. Von Loki aus über Funk. Sagte, sie wollten Freitag im Morgengrauen aufbrechen. Loki heißt Lokichoggio. An der Nordgrenze. Zentrum der Hilfsorganisationen, die den Südsudan betreuen. Over.«
»Ich weiß, wo Lokichoggio ist. Haben sie erwähnt, was sie da wollten?«
»Irgend so eine Hilfsaktion. Bluhm mischt doch bei den Helfern mit, oder? Anders kommt man auch gar nicht nach Loki. Arbeitet für irgendeine belgische Ärzteinitiative, hat er mir erzählt. Over.«
»Er hat also von Loki aus gebucht, und sie haben Loki am Freitag in aller Frühe verlassen. Over.«
»Er meinte, sie würden damit rechnen, die Westseite des Sees gegen Mittag zu erreichen. Wollte, dass ich ihm ein Boot organisiere, das sie über den See zur Oase bringt. ›Hören Sie‹, sag ich zu ihm. ›Lokichoggio nach Turkana, das ist eine haarige Strecke. Fahren Sie lieber mit einem Lebensmittelkonvoi. In den Bergen wimmelt es von Banditen; die Stämme klauen sich gegenseitig das Vieh weg, was ja nichts Ungewöhnliches ist, nur dass sie vor zehn Jahren noch Speere hatten, und jetzt haben sie alle ’ne AK 47.‹ Er hat nur gelacht. Meinte, damit wird er fertig. Und tatsächlich. Sie haben’s geschafft, ohne Probleme. Over.«
»Sie kommen also an, tragen sich an der Rezeption ein. Was dann? Over.«
»Bluhm sagt mir, dass sie einen Jeep möchten und einen Fahrer, der sie am nächsten Morgen bei Tagesanbruch zur Leakey-Grabung bringen kann. Fragen Sie mich nicht, warum er das nicht gleich beim Buchen erwähnt hat, ich hab ihn nicht gefragt. Vielleicht hatten sie sich spontan dazu entschlossen. Vielleicht hatten sie keine Lust, ihre Pläne über Funk auszubreiten. ›Okay‹, sag ich zu ihm. ›Sie haben Glück. Sie können Noah haben.‹ Bluhm freut sich. Miss Abbott freut sich. Sie gehen im Garten spazieren, schwimmen zusammen, sitzen zusammen an der Bar, essen zusammen, sagen allen Gute Nacht, gehen in ihre Hütte. Am nächsten Morgen fahren sie zusammen los. Ich hab sie beobachtet. Wollen Sie wissen, was sie zum Frühstück gegessen haben?«
»Wer außer Ihnen hat sie abfahren sehen? Over.«
»Jeder, der wach war, hat sie gesehen. Haben sich was zu essen eingepackt, ’nen Kanister Wasser, ’nen Kanister Benzin, Notrationen und ’ne Reiseapotheke. Alle drei auf dem Vordersitz, mit Abbott in der Mitte, wie eine glückliche Familie. Das hier ist eine Oase, okay? Ich hab zwanzig Gäste, die meisten schlafen noch. Ich hab vierzig Angestellte, die meisten von ihnen sind wach. Auf meinem Parkplatz lungern ungefähr hundert Typen rum, auf die ich gut verzichten könnte, und verkaufen Tierfelle, Gehstöcke und Jagdmesser. Jeder, der Bluhm und die Abbott wegfahren sieht, winkt zum Abschied. Ich winke, die Fellhändler winken, Noah winkt zurück, Bluhm und die Abbott winken zurück. Aber sie lächeln nicht. Sie machen ernste Gesichter. Als ob sie was Schweres vor sich haben, eine große Entscheidung, was weiß ich? Was soll ich also Ihrer Ansicht nach tun, Mister Kanzler? Die Zeugen umbringen? Hören Sie, ich bin Galileo. Stecken Sie mich ins Gefängnis, und ich schwöre, dass sie nie in die Oase gekommen ist. Over.«
Woodrow war einen Moment lang wie gelähmt. Ihm fielen zunächst keine weiteren Fragen ein. Oder vielleicht zu viele. Ich bin bereits im Gefängnis, dachte er. Lebenslänglich, seit fünf Minuten. Er fuhr sich mit der Hand über die Augen, und als er sie wieder sinken ließ, sah er, dass Donohue und Sheila ihn mit demselben leeren Gesichtsausdruck beobachteten, mit dem sie die Nachricht von Tessas Tod entgegengenommen hatten.
»Wann ist Ihnen zum ersten Mal der Gedanke gekommen, es könnte etwas schief gelaufen sein? Over«, fragte er lahm – wie: Leben Sie das ganze Jahr da oben? Over. Oder: Wie lange führen Sie Ihr schönes Hotel denn schon, over?
»Der Jeep hat Funk. Auf Fahrten mit Gästen soll Noah sich regelmäßig melden und sagen, dass es ihm gut geht. Noah hat sich nicht gemeldet. Okay, manchmal funktioniert der Funk nicht, oder die Fahrer vergessen es. Ist schließlich mühselig, die Verbindung herzustellen. Man muss anhalten, aussteigen, die Antenne ausfahren. Hören Sie mich noch? Over.«
»Laut und deutlich. Over.«
»Aber Noah vergisst es nie. Darum fährt er für mich. Trotzdem meldet er sich nicht. Nachmittags nicht, abends nicht. Okay, denke ich. Vielleicht haben sie irgendwo Halt gemacht, haben Noah zu viel zu trinken gegeben oder so. Spätabends, bevor ich dichtmache, funke ich noch alle Ranger im Bereich der Leakey-Grabung an. Keine Spur. Am nächsten Morgen fahr ich gleich nach Lodwar, Vermisstenmeldung machen. Ist schließlich mein Jeep, ja? Mein Fahrer. Sie gestatten mir nicht, die Meldung über Funk durchzugeben, ich muss es persönlich tun. Es ist eine Wahnsinnstour, aber so ist nun mal das Gesetz. Die Polizei in Lodwar ist geradezu versessen darauf, Bürgern in Nöten zu helfen. Mein Jeep wird vermisst? Na, so ein Pech. Es waren zwei von meinen Gästen und mein Fahrer drin? Warum ich dann nicht losfahre und sie suche? Es ist Sonntag, arbeiten ist heute nicht vorgesehen, sie müssen in die Kirche. ›Geben Sie uns Geld, leihen Sie uns ei nen Wagen, vielleicht helfen wir Ihnen‹, erklären sie mir. Sobald ich wieder zu Hause bin, stelle ich also einen Suchtrupp zusammen. Over.«
»Aus was für Leuten bestand der?« Woodrow fing sich langsam wieder.
»Zwei Gruppen. Meine eigenen Leute. Zwei Jeeps, Wasser, Reservebenzin, Medikamente, Proviant, Scotch zum Desinfizieren. Over.« Jemand funkte dazwischen. Wolfgang befahl dem Störer, sich verdammt noch mal aus dem Äther zu scheren. Überraschenderweise gehorchte man ihm. »Es ist ganz schön heiß hier zur Zeit, Mister Kanzler. Wir haben so um die 45 Grad Celsius und so viele Schakale und Hyänen, wie bei Ihnen Mäuse rumlaufen. Over.«
Er schwieg, offenbar erwartete er eine Reaktion.
»Ich höre«, sagte Woodrow.
»Der Jeep lag auf der Seite. Fragen Sie mich nicht, warum. Die Türen waren verschlossen. Fragen Sie mich nicht, warum. Eins der Fenster stand ungefähr fünf Zentimeter weit offen. Jemand hat die Türen zugemacht und abgeschlossen, den Schlüssel mitgenommen. Der Gestank war unbeschreiblich, selbst durch die kleine Öffnung. Überall Kratzer von den Hyänen, große Beulen, wo sie versucht haben, reinzukommen. Ringsherum Spuren davon, wie sie durchgedreht sind. Eine gute Hyäne riecht Blut auf zehn Kilometer. Wenn sie an die Leichen rangekommen wären, sie hätten sie mit einem Biss aufgebrochen, sich das Mark aus den Knochen geholt. Ging aber nicht. Jemand hat ihnen die Türen vor der Nase zugemacht und das Fenster ein kleines Stück offen gelassen. Also sind sie durchgedreht. Würden Sie auch tun. Over.«
Woodrow kämpfte um Worte. »Die Polizei sagt, Noah sei geköpft worden. Stimmt das? Over.«
»Ja. Er war ein großartiger Kerl. Die Familie ist verrückt vor Sorge. Sie haben Leute ausgeschickt, den Kopf zu suchen. Wenn sie den Kopf nicht finden, können sie ihn nicht anständig begraben, und dann wird sein Geist kommen und sie heimsuchen. Over.«
»Und Miss Abbott? Over –« Ein abscheuliches Bild: Tessa ohne Kopf, in seiner Phantasie.
»Haben die Ihnen das nicht gesagt?«
»Nein. Over.«
»Kehle durchgeschnitten. Over.«
Eine zweite Vision, diesmal die Faust des Mörders, wie er ihr die Kette abreißt, um dem Messer den Weg zu bahnen.
Wolfgang erzählte, was er als Nächstes unternommen hatte. »Erst einmal hab ich meinen Jungs gesagt, sie sollen die Türen zu lassen. Von denen da drin lebte sowieso keiner mehr. Wer eine Tür aufmacht, kriegt Mordsärger. Eine Gruppe hab ich dagelassen, um ein Feuer zu machen und Wache zu halten. Mit der anderen bin ich zur Oase zurück. Over.«
»Frage. Over.« Woodrow hatte große Mühe, sich zu beherrschen.
»Wie lautet Ihre Frage, Mister Kanzler? Bitte kommen. Over.«
»Wer hat den Jeep geöffnet? Over.«
»Die Polizei. Sobald die Polizei da war, haben sich meine Jungs verdrückt. Niemand mag die Polizei. Niemand möchte verhaftet werden. Schon gar nicht hier. Die Polizei aus Lodwar war zuerst da, dann kamen das Einsatzteam und noch ein paar Typen von Mois privater Gestapo. Meine Jungs haben die Kasse abgeschlossen und das Tafelsilber versteckt. Na ja, zum Glück hab ich gar kein Tafelsilber. Over.«
Eine weitere Pause, weil Woodrow um Fassung rang.
»Trug Bluhm eine Safarijacke, als sie zur Leakey-Grabung aufbrachen? Over.«
»Klar. Eine alte. Eher eine Weste. Blau. Over.«
»Hat man ein Messer am Tatort gefunden? Over.«
»Nein. Und das muss vielleicht ein Messer gewesen sein, kann ich Ihnen sagen. Ein Buschmesser mit ’ner Wilkinson-Klinge. Ist durch Noah durchgegangen wie durch Butter. Ein einziger Hieb. Das Gleiche bei ihr. Wusch. Die Frau war vollkommen nackt. Viele blaue Flecke. Hatte ich das schon gesagt? Over.«
Nein, das hattest du nicht, gab Woodrow lautlos zurück. Dass sie nackt war, hast du bisher ganz verschwiegen. Ebenso die blauen Flecken. »Hatten sie ein Buschmesser im Jeep, als sie von Ihnen losfuhren? Over.«
»Ich hab noch keinen Afrikaner kennen gelernt, der sein Buschmesser nicht mit auf Safari genommen hätte, Mister Kanzler.«
»Wo sind die Leichen jetzt?«
»Noah, oder was von ihm übrig ist, wurde seinem Stamm übergeben. Für Miss Abbott hat die Polizei ein Motorboot kommen lassen. Mussten das Dach vom Jeep abtrennen. Haben sich unser Schneidwerkzeug geliehen. Und sie dann aufs Deck gebunden. Unten war nicht genug Platz. Over.«
»Warum nicht?« Woodrow bereute sofort, die Frage gestellt zu haben.
»Wo bleibt Ihre Phantasie, Mister Kanzler. Wissen Sie, was bei dieser Hitze mit Leichen passiert? Sie müssen sie schon in Stücke schneiden, wenn Sie sie nach Nairobi fliegen lassen wollen, sonst passt sie nicht in den Laderaum.«
Woodrow war einen Augenblick wie betäubt, und als er wieder zu sich kam, hörte er Wolfgang sagen: Ja, er sei Bluhm zuvor bereits einmal begegnet. Woodrow musste ihm wohl die entsprechende Frage gestellt haben, obwohl er es nicht mitbekommen hatte.
»Vor neun Monaten. Hatte ’nen Trupp Entwicklungshelfer, allesamt hohe Tiere, zum Anschauungsunterricht durch den Busch geschleift. Welternährung, Weltgesundheit, Weltspesen. Die Scheißkerle haben mit dem Geld nur so um sich geworfen, wollten Quittungen über den doppelten Betrag haben. Ich hab’ sie abblitzen lassen. Das hat Bluhm gefallen. Over.«
»Wie wirkte er dieses Mal auf Sie? Over.«
»Wie meinen Sie?«
»War er irgendwie verändert? Leichter erregbar oder seltsam oder was auch immer?«
»Worauf wollen Sie hinaus, Mister Kanzler?«
»Ich meine – halten Sie es für möglich, dass er irgendwas genommen hatte. Dass er high war, meine ich.« Er geriet ins Schwimmen. »Also, von – ich weiß nicht – Kokain oder was. Over.«
»Aber Schätzchen«, sagte Wolfgang, und die Verbindung brach ab.
Woodrow wurde sich erneut bewusst, dass Donohue ihn mit seinem durchdringenden Blick musterte. Sheila war verschwunden. Woodrow hatte den Eindruck, sie war gegangen, um etwas Dringendes zu erledigen. Aber was konnte das sein? Warum sollte Tessas Tod ein dringendes Handeln der Spione erfordern? Ihn fröstelte. Er verspürte den Wunsch nach einer Strickjacke, und doch war er schweißgebadet.
»Sonst weiter nichts, was wir für Sie tun können, alter Junge?«, fragte Donohue auffällig besorgt und starrte ihn weiter mit seinen seltsamen kranken Augen an. »Einen kleinen Drink vielleicht?«
»Danke. Im Moment nicht.«
Sie wussten es, sagte sich Woodrow auf dem Weg nach unten. Sie wussten eher als ich, dass sie tot ist. Andererseits ist es das, was sie einen glauben machen wollen: Wir Spione wissen über alles besser Bescheid als du. Und eher.
»Ist der Hochkommissar schon zurück?« Mit dieser Frage steckte er den Kopf durch Mildrens Tür.
»Müsste jeden Augenblick –«
»Blasen Sie die Sitzung ab.«
Woodrow steuerte nicht direkt auf Justins Zimmer zu. Er schaute erst bei Ghita Pearson vorbei. Sie war die jüngste Mitarbeiterin der Kanzlei und Tessas Freundin und Vertraute. Ghita hatte dunkle Augen und helles Haar. Sie war Anglo-Inderin und trug ein Kastenzeichen auf der Stirn. Nur eine der vor Ort eingestellten Mitarbeiterinnen, sagte Woodrow sich, aber sie strebt eine Laufbahn im diplomatischen Dienst an.
Ghita runzelte misstrauisch die Stirn, als sie sah, dass er die Tür hinter sich schloss.
»Ghita, dies ist nur für Ihre Ohren bestimmt, okay?«
Sie sah ihn unverwandt an und wartete ab.
»Bluhm. Dr. Arnold Bluhm. Ja?«
»Was ist mit ihm?«
»Ein Freund von Ihnen.« Keine Reaktion. »Ich meine, Sie sind näher mit ihm bekannt.«
»Er ist eine Kontaktperson.« Ghitas Aufgabenbereich brachte tägliche Kontakte zu den Hilfsorganisationen mit sich.
»Und offensichtlich ein Kumpel von Tessa.« Ghitas dunkle Augen verrieten keine Regung. »Kennen Sie noch andere Leute aus Bluhms Umgebung?«
»Ich telefoniere von Zeit zu Zeit mit Charlotte. Sie ist praktisch sein Büro. Die anderen arbeiten alle vor Ort. Warum?« Da war wieder dieser anglo-indische Tonfall in ihrer Stimme, den er so verführerisch fand. Aber nein, nie wieder. Nie wieder eine andere.
»Bluhm war letzte Woche in Lokichoggio. In Begleitung.«
Sie nickte zögernd und senkte den Blick.
»Ich möchte wissen, was er dort wollte. Von Loki aus ist er zum Turkanasee gefahren. Ich muss wissen, ob er schon wieder in Nairobi ist. Oder ob er sich vielleicht auf den Weg zurück nach Loki gemacht hat. Können Sie das ermitteln, ohne allzu viele Hühner aufzuscheuchen?«
»Das bezweifle ich.«
»Nun, versuchen Sie es.« Plötzlich kam ihm eine Frage in den Sinn. In all den Monaten seiner Bekanntschaft mit Tessa hatte sie sich ihm nie gestellt. Bis jetzt. »Ist Bluhm verheiratet, wissen Sie das?«
»Würde ich doch denken. Irgendwann hat er bestimmt geheiratet. Haben sie ja meistens, oder?«
Sie, soll heißen: die Afrikaner? Oder sie, die Liebhaber? Alle Liebhaber?
»Aber hier hat er keine Frau. Hier in Nairobi. Jedenfalls nicht, soweit Sie gehört haben. Bluhm, meine ich.«
»Warum?«, kam es leise, hastig. »Ist Tessa was passiert?«
»Möglicherweise. Wir sind dabei, das herauszufinden.«
Als Woodrow schließlich vor Justins Zimmer anlangte, klopfte er und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten. Diesmal schloss er die Tür nicht hinter sich ab, sondern lehnte sich, die Hände in den Hosentaschen, mit seinen breiten Schultern dagegen. Was – solange er dort stehen blieb – auf dasselbe hinauslief. Justin stand ebenfalls, ihm den eleganten Rücken zugekehrt. Die Haare wie stets ordentlich frisiert, widmete er sich einem Schaubild an der Wand. Es war nur eines von mehreren, die rund ums Zimmer verteilt waren, jedes mit einer Überschrift in schwarzen Großbuchstaben, das Aufsteigen oder Abfallen der Kurve verschiedenfarbig markiert. Das Diagramm, das gerade seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, hatte den Titel INFRASTRUKTUREN IM VERGLEICH 2005–2010, und soweit Woodrow es von seinem Standort aus erkennen konnte, gab es vor, die konjunkturelle Entwicklung der afrikanischen Nationen vorhersagen zu können. Auf der Fensterbank links neben Justin stand eine Reihe von ihm persönlich gepflegter Topfpflanzen. Woodrow identifizierte Jasmin und Balsamine, allerdings nur, weil Justin Ableger dieser Pflanzen Gloria geschenkt hatte.
»Hi, Sandy«, sagte Justin, das Hi in die Länge ziehend.
»Hi.«
»Wie ich höre, versammeln wir uns heute Morgen nicht. Gibt’s Ärger?«
Die berühmte goldene Stimme, dachte Woodrow, der jede Einzelheit wahrnahm, als wäre sie ihm völlig neu. Nicht mehr jung, aber garantiert betörend, wenn man dem Ton mehr Bedeutung zumisst als dem Inhalt. Warum verachte ich dich, wo ich doch gleich dein Leben für immer verändern werde? Von nun an bis ans Ende deiner Tage wird es das Leben vor diesem Moment geben und das danach, und es wird für dich sein, als wären es verschiedene Zeitalter, ebenso wie für mich. Warum ziehst du dein blödes Jackett nicht aus? Du bist bestimmt der Einzige im diplomatischen Dienst, der noch zu seinem Schneider geht, um sich Tropenanzüge machen zu lassen. Da fiel Woodrow ein, dass er selbst auch noch sein Jackett anhatte.
»Und euch geht’s gut, hoffe ich?«, fragte Justin mit der ihm eigenen manieriert gedehnten Sprechweise. »Ich hoffe, Gloria leidet nicht unter dieser furchtbaren Hitze? Die Jungen machen sich bestens und so weiter?«
»Uns geht’s ausgezeichnet.« Eine kleine Pause, von Woodrow inszeniert. »Und Tessa ist auf dem Land«, sagte er beiläufig. Eine letzte Chance wollte er ihr noch geben zu beweisen, dass das Ganze nur ein schrecklicher Irrtum war.
Überschwänglich, wie immer, wenn er auf Tessa angesprochen wurde, antwortete Justin: »Ja, allerdings. Sie ist momentan nonstop im Einsatz.« Er hielt einen Wälzer der Vereinten Nationen im Arm, fast zehn Zentimeter dick. Er beugte sich vor und legte ihn auf einem Beistelltisch ab. »Wenn sie so weitermacht, hat sie ganz Afrika gerettet, bevor wir hier weggehen.«
»Weswegen ist sie eigentlich da hochgefahren?« Woodrow klammerte sich an jeden Strohhalm. »Ich dachte, sie hätte hier in Nairobi genug zu tun. In den Slums. Kibera, oder?«
»Und ob«, sagte Justin stolz. »Tag und Nacht, das arme Mädchen. Wie man mir erzählt, macht sie wirklich alles. Vom Babywickeln bis zu Einführungen in die Bürgerrechte für Rechtshelfer. Die meisten ihrer Schützlinge sind natürlich Frauen, was ihr sehr gefällt. Den Männern gefällt es allerdings weniger.« Sein wehmütiges Lächeln schien zu besagen: wenn doch nur. »Eigentumsrechte, Scheidung, Misshandlung, Vergewaltigung in der Ehe, Beschneidung, Safer Sex. Die ganze Palette, Tag für Tag. Man kann schon nachvollziehen, warum die Ehemänner leicht gereizt reagieren, nicht wahr? Ginge mir genauso, wenn ich meine Frau vergewaltigen würde.«
»Und was macht sie dann auf dem Land?« Woodrow blieb hartnäckig.
»Oh, weiß der Himmel. Fragen Sie Doc Arnold«, antwortete Justin etwas zu beiläufig. »Arnold ist da draußen ihr Führer und philosophischer Berater.«
So verkauft er es immer, erinnerte sich Woodrow. Der Schutzmantel, der alles bemänteln soll. Dr. med. Arnold Bluhm, ihr moralischer Beistand, der schwarze Ritter, Beschützer im Dschungel der Hilfsorganisationen. Alles, nur nicht ihr geduldeter Liebhaber. »Wo genau ist sie denn hin?«, fragte er.
»Loki. Lokichoggio.« Justin hatte sich auf die Kante seines Schreibtisches gestützt, vielleicht in unbewusster Nachahmung von Woodrows lässiger Haltung an der Tür. »Die Leute vom Welternährungsprogramm veranstalten da oben einen Workshop zum Thema Geschlechterrollen, ist das zu fassen? Die fliegen Dörflerinnen aus dem Südsudan ein, die sich ihrer Geschlechtsrolle nicht bewusst sind, verabreichen ihnen einen Intensivkurs John Stuart Mill und schicken sie mit Geschlechterrollenbewusstsein wieder zurück. Arnold und Tessa sind hingefahren, um sich den Spaß einmal anzusehen, die Glückspilze.«
»Wo ist sie jetzt?«
Justin nahm diese Frage ungnädig auf. Es schien, als sei ihm in diesem Moment klar geworden, dass Woodrow mit seinem Smalltalk etwas bezweckte. Oder vielleicht – überlegte Woodrow – mochte er es nicht, auf das Thema Tessa festgenagelt zu werden, wo er sie doch selbst nicht festnageln konnte.
»Auf dem Rückweg, möchte man annehmen. Warum?«
»Mit Arnold?«
»Vermutlich. Er würde sie nicht einfach dort zurücklassen.«
»Hat sie sich zwischendurch gemeldet?«
»Bei mir? Von Loki aus? Wie sollte sie? Da gibt’s kein Telefon.«
»Ich dachte, sie hätte vielleicht eine Funkverbindung der Entwicklungshelfer genutzt. Machen andere Leute das nicht so?«
»Tessa ist nicht andere Leute«, entgegnete Justin und runzelte die Stirn. »Sie hat feste Prinzipien. Dazu gehört zum Beispiel, das Geld von Spendern nicht unnötig zu verschwenden. Was ist eigentlich los, Sandy?«
Justin blickte ihn jetzt finster an, stieß sich vom Schreibtisch ab und baute sich in der Mitte des Zimmers auf, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Und Woodrow wurde – Justins aufmerksames, hübsches Gesicht vor Augen und das im Sonnenlicht aufleuchtende, ergrauende Haar – an Tessa erinnert. Ihr Haar hatte genau dieselbe Farbe, nur ohne die Spuren des Alters, und war ungebändigter. Er erinnerte sich, wie er sie das erste Mal zusammen gesehen hatte, Tessa und Justin, das strahlende, frisch verheiratete Paar, als Ehrengäste der vom Hochkommissar ausgerichteten Willkommensparty. Und wie er, als er zur Begrüßung auf sie zugegangen war, sich vorgestellt hatte, sie seien Vater und Tochter, und er halte um ihre Hand an.
»Seit wann haben Sie nichts mehr von ihr gehört?«, fragte er.
»Seit Dienstag. Da habe ich sie zum Flughafen gefahren. Was soll das, Sandy? Da Arnold bei ihr ist, wird schon alles in Ordnung sein. Sie tut, was er sagt.«
»Glauben Sie, dass sie zum Turkanasee weitergefahren sein könnten, sie und Bluhm – Arnold?«
»Wenn sie die Möglichkeit hatten und Ihnen der Sinn danach stand, warum nicht? Tessa liebt die Wildnis, sie hat große Achtung vor Richard Leakey, dem Archäologen genauso wie dem anständigen weißen Afrikaner, der er ist. Leakey hat doch auch eine Klinik dort? Arnold hatte wahrscheinlich da zu tun und hat sie mitgenommen. Sandy, was soll das?«, wiederholte er indigniert.
Während er ihm den Todesstoß versetzte, konnte Woodrow nicht umhin, die Wirkung seiner Worte auf Justin zu beobachten. Und er sah, wie die letzten Reste der vergangenen Jugend aus Justins Zügen schwanden und sich sein hübsches Gesicht verschloss und wie ein Meeresgeschöpf verhärtete, das in einen korallenähnlichen Zustand überging.
»Wir haben Berichte erhalten über eine weiße Frau und einen afrikanischen Fahrer, die am Ostufer des Turkanasees aufgefunden wurden. Tot«, begann Woodrow vorsichtig, das Wort »ermordet« vermeidend. »Der Wagen und der Fahrer waren im Hotel Oase gemietet worden. Der Besitzer der Anlage will die Frau als Tessa identifiziert haben. Er sagt, sie und Bluhm hätten die Nacht in der Oase verbracht, bevor sie zur Leakey-Ausgrabungsstätte aufbrachen. Bluhm wird noch vermisst. Man hat Tessas Halskette gefunden. Die, die sie immer getragen hat.«
Woher weiß ich das? Warum, in Gottes Namen, suche ich mir ausgerechnet diesen Moment aus, um mit meinem intimen Wissen über ihre Kette anzugeben?
Woodrow wandte den Blick nicht von Justin ab. Der Feigling in ihm wollte wegsehen, doch dem Sohn eines Soldaten wäre das vorgekommen, als würde man einen Mann zum Tode verurteilen und nicht zu seiner Hinrichtung erscheinen. Er beobachtete, wie Justins Augen sich weiteten, verletzt und enttäuscht, als hätte ein Freund ihn von hinten angefallen. Dann verengten sie sich, bis sie fast verschwanden, so als hätte derselbe Freund ihn bewusstlos geschlagen. Woodrow beobachtete, wie Justins wohlgeformte Lippen sich vor Schmerz öffneten und sich dann zusammenpressten, bis sie die Farbe verloren – eine feste Linie, die die Außenwelt ausschloss.
»Anständig von Ihnen, es mir zu sagen, Sandy. War sicher kein Vergnügen. Weiß Porter Bescheid?« Porter war der ungewöhnliche Vorname des Hochkommissars.
»Mildren ist dabei, ihn ausfindig zu machen. Man hat einen Mephisto-Stiefel gefunden. Könnte der zu ihr gehören?«
Justin hatte Schwierigkeiten mit der Koordination. Es dauerte einen Moment, bis der Klang von Woodrows Worten bei ihm ankam. Dann beeilte er sich zu antworten, in abgehackten Sätzen, die er sich mühsam abrang. »Da gibt’s einen Laden in der Nähe von Piccadilly. Sie hat drei Paar gekauft beim letzten Heimaturlaub. Sonst habe ich nie erlebt, dass ihr das Geld so locker in der Tasche saß. In der Regel gab sie wenig aus. Musste sich nie Gedanken darum machen. Und hat es deshalb auch nicht getan. Hat sich lieber bei der Heilsarmee eingekleidet. Wenn man sie ließ.«
»Und eine dieser längeren Safarijacken. In Blau.«
»Oh, diese scheußlichen Dinger hat sie absolut gehasst«, entgegnete Justin, der mit einem Wortschwall seine Sprechfähigkeit zurückgewann. »Sie sagte, wenn ich sie je in solchen Khakiklamotten mit Taschen auf den Schenkeln erwischen würde, sollte ich es verbrennen oder Mustafa schenken.«
Mustafa war ihr Hausdiener, erinnerte Woodrow sich. »Laut Polizei ist es blau.«
»Sie konnte Blau nicht ausstehen.« Justin war offenbar kurz davor, die Fassung zu verlieren. »Sie hat alles Paramilitärische gehasst.« Bereits in der Vergangenheitsform, vermerkte Woodrow. »Eine grüne Safarijacke hatte sie mal, zugegeben. Die hatte sie bei Farbelow’s in der Stanley Street gekauft. Ich war mit hingegangen, weiß nicht warum. Hatte mich wahrscheinlich drum gebeten. Konnte Einkaufen nicht ausstehen. Sie hat sie anprobiert und sofort Zustände gekriegt. ›Sieh dir das bloß an‹, meinte sie. ›Wie General Patton in Frauenklamotten.‹ Nein, Sportsfreund, hab ich zu ihr gesagt, nicht wie General Patton. Wie ein wunderhübsches Mädchen, das eine verdammt scheußliche grüne Jacke trägt.«
Er begann seinen Schreibtisch aufzuräumen. Gründlich. Endgültig. Öffnete Schubladen und schloss sie wieder. Packte die Ablagekörbe in den Stahlschrank und verschloss ihn. Und zwischendurch strich er sich immer wieder die Haare nach hinten, ein Tick, der Woodrow von jeher auf die Nerven gegangen war. Vorsichtig schaltete Justin den verhassten Computer aus – stieß mit dem Zeigefinger nach dem Knopf, als fürchtete er, gebissen zu werden. Es ging das Gerücht, dass Ghita Pearson ihm jeden Morgen das Gerät einschalten musste. Woodrow beobachtete, wie Justin sich ein letztes Mal blicklos im Zimmer umsah. Ende der Amtszeit. Ende des Lebens. Hinterlassen Sie Ihren Platz bitte so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen. An der Tür drehte Justin sich um und sah nachdenklich zu den Pflanzen auf der Fensterbank hinüber. Vielleicht überlegte er, ob er sie mitnehmen oder zumindest Anweisungen für ihre Pflege hinterlassen sollte. Doch er tat weder das eine noch das andere.
Woodrow, der Justin den Flur entlang begleitete, verspürte den Impuls, seinen Arm zu nehmen, gleichzeitig empfand er einen solchen Widerwillen, dass seine Hand zurückzuckte, noch bevor er Justin berührte. Dennoch hielt er sich bereit, ihm notfalls beizuspringen, falls er ins Taumeln geriet oder stolperte, denn Justin erweckte mittlerweile den Eindruck eines gut gekleideten Schlafwandlers, dem jegliches Richtungsgefühl abhanden gekommen ist. Sie bewegten sich langsam und einigermaßen geräuschlos vorwärts, aber Ghita musste sie trotzdem gehört haben, denn als sie an ihrer Tür vorbeikamen, trat sie heraus und ging auf Zehenspitzen ein paar Schritte neben Woodrow her. Die goldenen Haare zurückhaltend, damit sie ihn nicht streiften, flüsterte sie ihm ins Ohr: »Er ist verschwunden. Sie suchen überall nach ihm.«
Doch Justins Gehör war besser, als sie beide erwartet hätten. Vielleicht war auch seine Wahrnehmung durch die emotionale Ausnahmesituation geschärft.
»Sie machen sich Sorgen um Arnold, nehme ich an«, sagte er zu Ghita, im Ton eines hilfsbereiten Passanten, der einem den Weg zeigt.
* * *
Der Hochkommissar war ein hagerer, außergewöhnlich intelligenter Mann, der ständig irgendwelche Studien betrieb. Er hatte einen Sohn, der bei einer Handelsbank arbeitete, eine kleine Tochter namens Rosie, die einen schweren Hirnschaden hatte, und eine Frau, die, wenn sie in England weilte, als Friedensrichterin tätig war. Er liebte sie alle gleichermaßen, und an den Wochenenden verbrachte er jede Minute mit Rosie. Irgendwie war Coleridge selbst jedoch an der Schwelle zum Mann stehen geblieben. Er trug gern weite Oxford-Hosen mit Hosenträgern wie ein Jüngling. Das passende Jackett hing hinter der Tür auf einem Bügel mit seinem Namen: P. Coleridge, Balliol. Er verharrte in der Mitte seines großen Büros, den Kopf mit dem zerzausten Haar Woodrow zugeneigt, während er ihm zornig zuhörte. Tränen standen ihm in den Augen, liefen ihm über die Wangen.
»Scheiße«, stieß er so heftig hervor, als hätte er schon lange darauf gewartet, sich das Wort von der Seele zu schaffen.
»Ich weiß«, sagte Woodrow.
»Das arme Mädchen. Wie alt war sie denn? Zu jung.«
»Fünfundzwanzig.« Und woher weiß ich das? »Ungefähr«, ergänzte er.
»Sie sah aus wie achtzehn. Justin, der arme Kerl, mit seinen Blumen …«
»Ich weiß«, sagte Woodrow wieder.
»Weiß Ghita Bescheid?«
»Zum Teil.«
»Was zum Teufel wird er jetzt bloß machen? Er hat ja nicht mal beruflich Aussichten. Die wollten ihn doch rauswerfen, sobald der Dienst hier vorbei war. Hätte Tessa ihr Baby nicht verloren, hätten sie ihn längst vor die Tür gesetzt.« Des Stillstehens müde, stapfte Coleridge in einen anderen Teil des Zimmers. »Rosie hat letzten Samstag eine zwei Pfund schwere Forelle gefangen«, trompetete er vorwurfsvoll. »Was sagt man dazu?«
Coleridge hatte die Angewohnheit, mit überraschenden Wendungen Zeit zu schinden.
»Großartig«, murmelte Woodrow beflissen.
»Tessa wäre total begeistert gewesen. Hat immer gesagt, dass Rosie es schaffen würde. Und Rosie hat sie angebetet.«
»Ganz bestimmt.«
»Wollte den Fisch allerdings nicht essen. Das ganze Wochenende mussten wir das Ding am Leben halten. Haben es schließlich im Garten begraben.« Das Straffen der Schultern zeigte an, dass es jetzt wieder zur Sache ging. »Die Angelegenheit hat einen Hintergrund, Sandy. Einen verdammt schmutzigen.«
»Das ist mir völlig klar.«
»Dieser Scheißer Pellegrin hat schon angerufen und was von Schadensbegrenzung geblökt.« – Sir Bernard Pellegrin, Apparatschik im Außenministerium mit besonderer Zuständigkeit für Afrika, war Coleridges Erzfeind. »Wie zum Teufel sollen wir den Schaden begrenzen, wenn wir noch nicht mal wissen, was da für ein verdammter Schaden angerichtet wurde? Hat ihm seine Tennisstunde versaut, schätze ich.«
»Sie war vor ihrem Tod vier Tage und Nächte mit Bluhm zusammen.« Mit einem raschen Blick überzeugte sich Woodrow, dass die Tür richtig zu war. »Soweit zum möglichen Schaden. Die beiden waren in Loki, dann am Turkanasee. Sie haben eine Hütte und weiß der Himmel was noch miteinander geteilt. ’ne Menge Leute haben sie zusammen gesehen.«
»Danke. Vielen Dank. Genau das hatte mir noch gefehlt.« Coleridge stopfte die Hände tief in seine ausladenden Hosentaschen und schritt unruhig auf und ab. »Wo zum Teufel ist Bluhm überhaupt?«
»Es heißt, es wird überall nach ihm gesucht. Zuletzt gesehen wurde er an Tessas Seite im Jeep bei der Abfahrt zur Leakey-Grabung.«
Coleridge schritt zum Schreibtisch, ließ sich auf den Stuhl fallen und lehnte sich mit weit ausgebreiteten Armen zurück. »Dann war es also der Butler«, stellte er fest. »Bluhm hat seine gute Erziehung vergessen, ist durchgedreht, hat die beiden ’nen Kopf kürzer gemacht und Noahs gleich als Souvenir eingesteckt. Dann hat er den Jeep auf die Seite gekippt, ihn abgeschlossen und ist getürmt. Na sicher, würden wir doch alle tun. Scheiße.«
»Sie kennen ihn so gut wie ich.«
»Nein, tu ich nicht. Ich halte mich von ihm fern. Ich mag keine Filmstars bei Hilfsorganisationen. Wo zum Teufel ist er hin? Wo ist er jetzt?«
Vor Woodrows innerem Auge flackerten Bilder auf. Bluhm, der Vorzeigeafrikaner für die westliche Welt, der bärtige Apollon der Cocktailpartys von Nairobi, charismatisch, witzig, attraktiv. Bluhm und Tessa Seite an Seite, den Gästen die Hände schüttelnd, während Justin, der Schwarm aller alternden Debütantinnen, mit breitem Strahlen die Drinks verteilt. Dr. med. Arnold Bluhm, ehemaliger Held des Algerienkriegs, sitzt im Vortragssaal der Vereinten Nationen auf dem Podium und hält eine Rede über medizinische Sofortmaßnahmen in Katastrophensituationen. Bluhm, kurz vor Ende der Party zusammengesunken auf einem Stuhl; er wirkt verloren und erschöpft, hat alles, was es wert wäre über ihn zu wissen, klaftertief in sich vergraben.
»Ich konnte die beiden nicht nach Hause schicken, Sandy«, sagte Coleridge mit der festen Stimme eines Mannes, der sein Gewissen befragt und dort Bestätigung gefunden hat. »Ich habe es nie als meine Aufgabe angesehen, die Karriere eines Mannes zu zerstören, nur weil seine Frau gern die Beine breit macht. Wir haben ein neues Jahrtausend. Es muss den Leuten gestattet sein, ihr Leben zu ruinieren, wie sie es für richtig halten.«
»Selbstverständlich.«
»Sie hat verdammt gute Arbeit geleistet da draußen in den Slums, egal, was man im Muthaiga Club über sie sagt. Sie mag Mois Leuten ziemlich auf den Wecker gegangen sein, aber die Afrikaner, auf die es ankommt, haben sie geliebt. Alle.«
»Ohne Frage«, stimmte Woodrow zu.
»Gut, sie ist auf diesen ganzen feministischen Mist abgefahren. Recht so. Gebt Afrika den Frauen, und vielleicht läuft der Laden dann sogar.«
Mildren kam herein, ohne anzuklopfen.
»Anruf vom Protokoll, Sir. Tessas Leiche ist soeben in der Leichenhalle des Krankenhauses eingetroffen. Man bittet um sofortige Identifizierung. Und die Presseagenturen schreien nach einer offiziellen Erklärung.«
»Wie zum Teufel haben sie es geschafft, sie so schnell nach Nairobi zu bringen?«
»Geflogen.« Woodrow erinnerte sich an Wolfgangs abstoßende Bemerkung, man müsse die Leiche wohl in Stücke schneiden, um sie in einen Laderaum zu bekommen.
»Wir geben keine Erklärung ab, bevor sie nicht identifiziert ist«, schnauzte Coleridge.
* * *
Woodrow und Justin machten sich gemeinsam auf den Weg. Nebeneinander hockten sie auf der Holzbank des gesandschaftseigenen VW-Transporters mit den getönten Scheiben. Livingstone fuhr, sein wuchtiger Kikuyu-Partner Jackson hatte sich neben ihn auf den Vordersitz gezwängt, um gegebenenfalls seine Körperkraft zum Einsatz zu bringen. Der Verkehrswahnsinn befand sich auf dem Höhepunkt. Überfüllte Matutu-Kleinbusse preschten an beiden Seiten laut hupend an ihnen vorbei, stießen Abgaswolken aus und wirbelten Sand und Staub auf. Livingstone gelang die Durchfahrt durch einen Kreisverkehr, dann hielt er vor einem gemauerten Eingangstor, um das Gruppen von Männern und Frauen standen, die sich singend hin-und herwiegten. Woodrow hielt sie zunächst für Demonstranten und wollte schon seinem Ärger Luft machen, als ihm aufging, dass es sich um Trauernde handelte, die darauf warteten, die Leichen ihrer Angehörigen in Empfang nehmen zu können. Rostige Transporter und Autos mit roten Trauerbändern parkten erwartungsvoll am Straßenrand.
»Es ist wirklich nicht nötig, dass Sie mitkommen, Sandy«, sagte Justin.
»Selbstverständlich ist es das«, erwiderte der Soldatensohn edelmütig.
Ein Pulk von Polizisten und Männern in bespritzten weißen Overalls, denen der Arztberuf anzusehen war, wartete an der Tür, um sie zu begrüßen. Sie alle hatten nur ein einziges Ziel: einen guten Eindruck zu machen. Einer stellte sich als Inspektor Muramba vor und schüttelte entzückt lächelnd den beiden vornehmen Herren vom britischen Hochkommissariat die Hand. Ein Asiate im schwarzen Anzug erwies sich als der Stabsarzt Dr. Banda Singh, stets zu Ihren Diensten. Rohrleitungen an den Decken begleiteten sie auf ihrem Weg durch einen feuchten Betonkorridor, der von überquellenden Papierkörben gesäumt war. Über die Rohre werden die Kühlfächer mit Strom versorgt, überlegte Woodrow, aber die Kühlfächer funktionieren nicht, weil der Strom ausgefallen ist und die Leichenhalle keinen eigenen Generator hat. Dr. Banda ging voran, aber Woodrow hätte sich auch allein zurechtgefunden. Links abbiegen, und der Geruch verliert sich, rechts herum, und er wird stärker. Der gefühllose Teil von ihm hatte wieder die Oberhand gewonnen. Soldatenpflicht ist es, Flagge zu zeigen, nicht Gefühle. Pflicht. Warum hat sie mich immer an meine Pflicht erinnert? Woodrow fragte sich, was nach altem Aberglauben mit einem Möchtegern-Ehebrecher geschah, der die Leiche jener Frau betrachtet, die er begehrt hat. Dr. Banda führte sie eine kleine Treppe hinauf, und sie betraten eine unbelüftete Empfangshalle, wo der Geruch des Todes alles zu durchdringen schien.
Vor einer rostigen Stahltür blieben sie stehen. Dr. Banda klopfte gebieterisch. Vier-, fünfmal hämmerte er in regelmäßigen Abständen an die Tür, als müsse er sich an einen Code halten, und wippte dabei auf den Fersen. Mit lautem Quietschen öffnete sich die Tür ein Stück weit, und dahinter kamen die abgespannten, besorgten Gesichter dreier junger Männer zum Vorschein. Beim Anblick des Stabsarztes aber wichen sie zurück, so dass dieser an ihnen vorbeischlüpfen konnte. Woodrow, der noch in der stinkenden Halle stand, wurde die höllische Vision zuteil, man hätte den Schlafsaal seines Internats mit sämtlichen Aidstoten der Geschichte belegt. Ausgezehrte Leichen lagen paarweise auf den Betten und mehr noch auf dem Fußboden dazwischen, einige von ihnen bekleidet, andere nackt, manche auf dem Rücken, andere auf der Seite. Wieder andere hatten die Knie angezogen im vergeblichen Versuch, sich selbst zu schützen, oder den Kopf wie aus Protest zurückgeworfen. Über ihnen hingen in einem wabernden, trüben Nebel Trauben von Fliegen, alle in derselben Tonlage schnarchend.
In der Mitte des Schlafsaals, im Gang zwischen den Betten, stand allein für sich Hausmutters Bügelbrett auf Rädern. Und auf dem Bügelbrett türmte sich ein arktischer Block aus zerklüfteten Laken, unter dem zwei monströse, halb menschliche Füße hervorragten, die Woodrow an die entenfüßigen Hausschuhe denken ließen, die Gloria und er ihrem Sohn Harry zu Weihnachten geschenkt hatten. Eine einzelne aufgedunsene Hand hatte irgendwie der Umhüllung entschlüpfen können. Die Finger waren von schwarzem Blut verkrustet, das an den Gelenken am dicksten war. Die Fingerspitzen waren bläulich grün. Wo bleibt Ihre Phantasie, Mister Kanzler. Wissen Sie, was bei dieser Hitze mit Leichen passiert?
»Mr Justin Quayle, bitte«, rief Dr. Banda Singh mit dem Timbre des Ausrufers bei einem Empfang am königlichen Hof.
»Ich begleite Sie«, murmelte Woodrow und trat gerade rechtzeitig nach vorn an Justins Seite, um zu sehen, wie Dr. Banda das Laken zurückschlug und Tessas Kopf zum Vorschein kam. Eine grobe grobe Karikatur ihres Kopfes, um den sich vom Kinn bis zur Schädeldecke ein schmieriger Stoffstreifen wand, der auch um ihren Hals führte, wo sie einst die Kette getragen hatte. Wie ein Ertrinkender, der zum letzten Mal an die Oberfläche steigt, nahm Woodrow wild entschlossen alles in sich auf: ihre schwarzen, vom Kamm eines Leichenbestatters an den Schädel gekleisterten Haare. Die Wangen gebläht wie die einer Putte, die pustet um Wind zu erzeugen. Die Augen geschlossen, die Brauen hochgezogen, und der Mund in ungläubigem Staunen geöffnet. Darin verklumptes schwarzes Blut, als wären ihr alle Zähne gleichzeitig gezogen worden. Du?, keucht sie wie betäubt, als man sie umbringt, die Lippen zum U-Laut geformt. Du? Aber zu wem sagt sie es? Wen glotzt sie an durch ihre gedehnten weißen Augenlider?
»Kennen Sie diese Dame, Sir?«, erkundigte Inspektor Muramba sich behutsam bei Justin.
»Ja. Ja, danke«, antwortete Justin, jedes Wort sorgfältig abwägend. »Das ist meine Frau Tessa. Wir müssen uns um die Beerdigung kümmern, Sandy. Sie würde hier in Afrika begraben werden wollen, so schnell wie möglich. Sie ist ein Einzelkind. Sie hat keine Eltern mehr. Es gibt niemanden außer mir, der dazu befragt werden müsste. Also am besten so bald wie möglich.«
»Nun, vermutlich wird die Polizei da ein Wörtchen mitzureden haben«, brummte Woodrow und erreichte gerade noch rechtzeitig das gesprungene Waschbecken, wo er sich die Seele aus dem Leib kotzte, während der ewig ritterliche Justin ihm zur Seite stand, den Arm um ihn gelegt, und ihm leise Trost zusprach.
* * *
In dem mit Teppich ausgelegten Allerheiligsten des Gesandschaftsleiters las Mildren dem jungen Mann mit der ausdruckslosen Stimme am anderen Ende der Leitung langsam und deutlich Folgendes vor:
»Wann bringen Sie das?«
»Schon erledigt«, sagte der junge Mann.
ZWEITES KAPITEL
Die Woodrows wohnten in einer exklusiven Kolonie von Natursteinhäusern mit bleiverglasten Fenstern im Tudorstil und großen englischen Gärten, die sich über die Hügel des Vorortes Muthaiga erstreckt, nur einen Steinwurf entfernt vom Muthaiga Club und der Residenz des britischen Hochkommissars sowie den Wohnsitzen zahlreicher Botschafter aus Ländern, von denen man wahrscheinlich nie gehört hat, bis man einmal die streng bewachten Alleen entlanggefahren ist und die Namenstafeln neben den Hinweisschildern entdeckt hat, die auf Kisuaheli vor bissigen Hunden warnen. Nach dem Bombenattentat auf die US