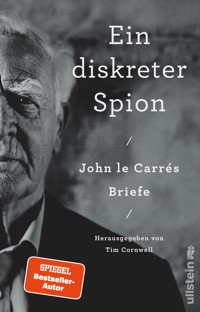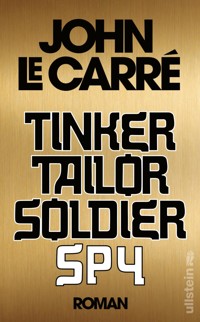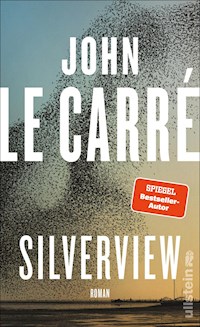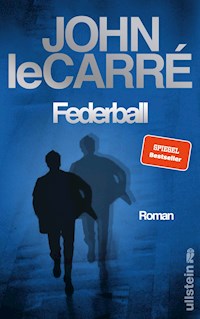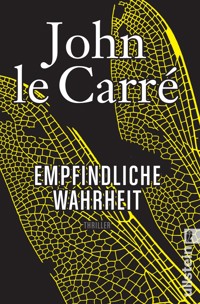8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - Ein junger Tschetschene reist illegal nach Deutschland ein. Dort gerät er sofort in das Fadenkreuz verschiedener Geheimdienste, die ihn verbissen jagen. Sein Schicksal scheint besiegelt, früher oder später wird man ihn verhaften und nach Russland abschieben. Doch dann bekommt er unerwartete Hilfe von einer jungen Anwältin und Bürgerrechtlerin. Es beginnt ein gnadenloser Wettlauf und ein Kampf zwischen Gewissenlosigkeit und Nächstenliebe, eiskaltem Kalkül und Gleichgültigkeit. »Der zornige Roman eines Schriftstellers, der realisiert, dass die Regierungen der westlichen Welt und ihre Geheimdienste nichts begriffen haben.« Der Spiegel Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Ein junger Moslem reist illegal über die Türkei und Dänemark nach Deutschland ein. Im Hamburger Stadtteil Altona bittet er eine türkische Familie um Hilfe. Nur langsam finden die verängstigten Gastgeber heraus, wer der Fremde ist und was er in der Hansestadt will. So beginnt John le Carrés meisterhaft komponierter Roman über unsere Gesellschaft des Verdachts nach dem 11. September 2001. In einem raffiniert gesponnenen Netz aus privaten und politischen Interessen bewegen sich seine Figuren zwischen Gewissenlosigkeit und Nächstenliebe, eiskaltem Kalkül und Gleichgültigkeit. Die Bedrohung durch den islamistischen Terror wird zur Kulisse für ein skrupelloses Spiel der Geheimdienste.
Der Autor
John le Carré, geboren 1931 in Poole, Dorset, studierte in Bern und Oxford Germanistik, bevor er in diplomatischen Diensten u.a. in Bonn und Hamburg tätig war. Der Spion, der aus der Kälte kam begründete seinen Weltruhm als Bestsellerautor. Der Autor lebt mit seiner Frau in Cornwall und London.
Von John le Carré sind in unserem Hause bereits erschienen:
Absolute Freunde · Agent in eigener Sache · Dame, König, As, Spion · Das Rußlandhaus · Der ewige Gärtner · Der heimliche Gefährte · Der Nachtmanager · Der Spion, der aus der Kälte kam · Der Schneider von Panama · Der wachsame Träumer · Die Libelle · Ein blendender Spion · Ein guter Soldat · Ein Mord erster Klasse · Eine Art Held · Eine kleine Stadt in Deutschland · Empfindliche Wahrheit · Geheime Melodie · Krieg im Spiegel · Marionetten · Schatten von gestern · Single & Single · Unser Spiel · Verräter wie wir
John le Carré
Marionetten
Roman
Aus dem Englischen vonSabine Roth und Regina Rawlinson
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0650-6
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage November 2009
2. Auflage 2009
© für die deutsche Ausgabe
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008/Ullstein Verlag
© 2008 by David Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: A Most Wanted Man
(Hodder & Stoughton, London 2008)
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Für meine Enkel,
Unsere goldene Regel muß sein, daß wir denen, die wir lieben, dabei helfen, von uns loszukommen.
1
Von einem türkischen Schwergewichtsmeister, der Arm in Arm mit seiner Mutter eine Hamburger Straße entlangspaziert, kann wohl niemand verlangen, daß er es bemerkt, wenn ihn ein klappriger junger Mann im schwarzen Mantel verfolgt.
Big Melik, wie er bei seinen zahlreichen Bewunderern hieß, war ein gutmütiger Riese, etwas zottelig, etwas zerzaust, mit einem breiten, von Herzen kommenden Grinsen, schwarzem Pferdeschwanz und einem unbeschwerten, wiegenden Gang, der auch ohne seine Mutter den halben Bürgersteig einnahm. Mit seinen zwanzig Jahren war er in seiner kleinen Welt eine Berühmtheit, und das nicht nur wegen seiner Verdienste im Boxring: er war Jugendsprecher seines islamischen Sportvereins, er war dreimaliger norddeutscher Vizemeister über hundert Meter Schmetterling, und samstags feierte er im Fußballtor Triumphe.
Wie die meisten sehr großen Menschen war er es außerdem eher gewohnt, Blicke auf sich zu ziehen, als um sich zu blicken: auch das ein Grund, warum der klapprige Junge ihm drei Tage am Stück unbemerkt folgen konnte.
Zum erstenmal wurde er auf ihn aufmerksam, als er mit seiner Mutter Leyla aus dem Al-Umma-Reisebüro kam, wo sie Flüge für die Hochzeit seiner Schwester in ihrem Heimatdorf in der Nähe von Ankara gebucht hatten. Melik spürte, daß ihn jemand anstarrte, sah sich um und fand sich Angesicht in Angesicht mit einem sehr großen, entsetzlich mageren jungen Mann mit struppigem Bart, geröteten, tief in den Höhlen liegenden Augen und einem langen schwarzen Mantel, in dem drei Zauberer Platz gehabt hätten. Er trug eine schwarzweiße Kefije um den Hals und über der Schulter eine Satteltasche aus Kamelleder, wie Touristen sie als Mitbringsel kaufen. Von Melik sah er zu Leyla, dann wieder zu Melik, immer mit dem gleichen unverwandt-flehenden Blick aus glühenden, eingesunkenen Augen.
Trotzdem hätte die Verzweiflung, die der Junge ausstrahlte, Melik nicht übermäßig nahegehen müssen, denn das Reisebüro lag am Vorplatz des Hamburger Hauptbahnhofs, der zu jeder Tages- und Nachtzeit von verlorenen Seelen aller Art bevölkert war: deutschen Obdachlosen, Asiaten, Arabern, Afrikanern oder auch Türken wie Melik, die es nur schlechter getroffen hatten als er – ganz zu schweigen von den Beinamputierten auf Elektrowägelchen, Dealern und ihren Kunden, Bettlern mit ihren Hunden oder dem siebzigjährigen Cowboy mit Stetson und silberbeschlagener Lederreithose. Wenige hier hatten Arbeit, und eine Handvoll hätten deutschen Boden gar nicht erst betreten dürfen und wurden im Zuge einer gezielten Verelendungspolitik bestenfalls geduldet, bis die Abschiebung sie ereilte, für gewöhnlich im ersten Morgengrauen. Nur Neuankömmlinge oder die ganz Verwegenen gingen das Risiko ein. Erfahrenere Illegale machten einen großen Bogen um den Bahnhof.
Ein zweiter guter Grund, den Jungen zu ignorieren, war die klassische Musik, mit der die Stadt über eine Batterie strategisch verteilter Lautsprecher diesen Teil des Bahnhofs beschallte: Musik, die nicht dazu gedacht war, unter den Zuhörern Wohlbehagen zu verbreiten, sondern, im Gegenteil, sie zu vertreiben.
Doch trotz alledem prägte sich das Gesicht des klapprigen Jungen Melik ein, und einen flüchtigen Moment lang schämte er sich für sein eigenes Glück. Aber warum eigentlich, verdammt? Etwas Phantastisches war geschehen, und er konnte es kaum erwarten, seine Schwester anzurufen und ihr zu erzählen, daß Leyla, die sechs Monate nicht vom Sterbebett ihres Mannes gewichen war und sich dann ein Jahr lang die Seele aus dem Leib getrauert hatte, jetzt plötzlich übersprudelte vor Vorfreude auf die Hochzeit ihrer Tochter und aufgeregt überlegte, welches Kleid sie anziehen sollte, ob die Mitgift auch üppig genug war und ob der Bräutigam wirklich so blendend aussah, wie jeder, allen voran Meliks Schwester, behauptete.
Was also sollte Melik davon abhalten, in die Fröhlichkeit seiner Mutter einzustimmen? – denn das tat er, aus vollem Herzen, den ganzen Weg bis nach Hause. Es war die Stille, die den Jungen umgab, entschied er später. Diese Falten, die sich in ein Gesicht gegraben hatten, das so jung wie sein eigenes war. Dieser Hauch von Winter an einem strahlenden Frühlingstag.
* * *
Das war am Donnerstag.
Und am Freitagabend, als Melik und Leyla zusammen aus der Moschee kamen, stand er wieder da, derselbe Junge mit seiner Kefije und dem überdimensionalen Mantel, in den Schatten eines schmuddeligen Hauseingangs gedrückt. Diesmal fiel Melik auf, daß der magere Körper leicht Schlagseite hatte, so als hätte ihm jemand einen Rippenstoß verpaßt, nach dem er sich lange nicht wieder hatte aufrichten können. Und seine Augen glühten noch beschwörender als am Vortag. Melik erwiderte seinen Blick, bereute es prompt und sah weg.
Und dieses zweite Zusammentreffen war um so unwahrscheinlicher, als Leyla und Melik so gut wie nie in die Moschee gingen, auch in keine gemäßigte, türkischsprachige. Seit den Anschlägen vom elften September waren die Hamburger Moscheen gefährliche Orte geworden. Ein einziger Besuch in der falschen – oder in der richtigen, aber beim falschen Imam –, und man landete mitsamt der ganzen Sippschaft für alle Zeit auf der Verdächtigenliste der Polizei. Niemand bezweifelte, daß in fast jeder Gebetsreihe ein vom Staat bezahlter Informant kniete. Niemand, sei er Muslim, Polizeispitzel oder beides, konnte vergessen, daß der Stadtstaat Hamburg, ohne es zu ahnen, drei der Attentäter vom elften September nebst weiteren Zellenmitgliedern und Mitverschwörern beherbergt hatte und daß Mohammed Atta, der mit dem ersten Flugzeug in die Zwillingstürme gekracht war, in einer bescheidenen Hamburger Moschee zu seinem grimmigen Gott gebetet hatte.
Ohnehin waren Melik und seine Mutter in Glaubensdingen etwas nachlässig geworden, seit sein Vater gestorben war. Sicher, der alte Herr war gläubiger Muslim gewesen, sogar Laienprediger. Vor allem jedoch war er ein militanter Kämpfer für die Rechte der Arbeiter, darum hatte er die Heimat ja verlassen müssen. In die Moschee waren sie einzig deshalb gegangen, weil es die impulsive Leyla plötzlich dazu gedrängt hatte. Sie war glücklich. Die Trauer lockerte ihren eisernen Griff. Aber der erste Todestag ihres Mannes stand bevor. Sie mußte Zwiesprache mit ihm halten und die frohe Nachricht mit ihm teilen. Das große Freitagsgebet hatten sie schon verpaßt, weshalb sie eigentlich auch zu Hause hätten beten können. Doch Leylas Laune war Gesetz. Mit dem unwiderlegbaren Argument, daß private Bittgebete größere Erfolgschancen haben, wenn sie am Abend dargebracht werden, hatte sie durchgesetzt, daß sie die letzte Gebetsstunde des Tages besuchten, was gleichzeitig hieß, daß die Moschee nahezu leer war.
Weswegen Meliks zweites Zusammentreffen mit dem Jungen, genau wie das erste, purer Zufall sein mußte. Was sollte es sonst sein? Das zumindest sagte sich, schlichten Gemüts, der gutherzige Melik.
* * *
Am nächsten Tag, Samstag, fuhr Melik seinen reichen Onkel väterlicherseits in dessen Kerzenfabrik am anderen Ende der Stadt besuchen. Zu Lebzeiten seines Vaters hatte es zwischen den Brüdern Spannungen gegeben, aber seit seinem Tod hatte er die Freundschaft des Onkels schätzengelernt. Er stieg in den Bus, und was sah er? Keinen anderen als den klapprigen Jungen, der unter ihm im Wartehäuschen saß und ihm hinterherschaute. Und als er sechs Stunden später an derselben Haltestelle wieder ausstieg, war der Kerl immer noch da, in seine Kefije und den Zauberermantel gehüllt, in dieselbe Ecke des Unterstands gekauert wie zuvor, wartend.
Bei seinem Anblick wurde Melik, den das Gebot Gottes dazu verpflichtete, alle Menschen gleichermaßen zu lieben, von einer ganz unfrommen Abneigung gepackt. Von dem Jungen schien ein Vorwurf auszugehen, und den nahm er ihm übel. Schlimmer noch, er hatte trotz seines erbärmlichen Zustands etwas Hochmütiges an sich. Was bezweckte er überhaupt mit diesem lächerlichen schwarzen Mantel? Hielt er sich damit für unsichtbar? Oder wollte er irgendwem weismachen, er wäre so unbeleckt von westlichen Gebräuchen, daß er nicht wußte, was für ein Bild er in dem Ding abgab?
Egal. Melik war entschlossen, ihn abzuschütteln. Statt ihn also anzusprechen und sich zu erkundigen, ob er Hilfe brauchte oder krank war, wie er es andernfalls sicher getan hätte, nahm er mit langen Schritten Kurs auf zu Hause, in der beruhigenden Gewißheit, daß diese halbe Portion nie mit ihm würde mithalten können.
Die Sonne schien ungewöhnlich heiß für einen Frühlingstag, das Pflaster glühte förmlich. Dennoch schaffte es der Junge auf wundersame Weise, auf dem belebten Gehsteig mit Melik Schritt zu halten: humpelnd und keuchend, röchelnd und schwitzend, mit vereinzelten ungelenken Hüpfern dazwischen, als litte er Schmerzen, schloß er an jeder Kreuzung wieder zu ihm auf.
Und als Melik das winzige Backsteinhaus betrat, das seine Mutter nach mehreren Jahrzehnten eisernen Sparens fast vollständig abbezahlt hatte, konnte er nur ein paarmal durchatmen, ehe die Türklingel ihren Dreiklang ertönen ließ. Und als er wieder nach unten ging, stand auf der Türschwelle der klapprige Junge mit seiner Satteltasche über der Schulter. Seine Augen loderten wild von der Anstrengung des Laufens, über sein Gesicht strömte der Schweiß wie ein Sommerregen, und in seiner zitternden Hand hielt er ein Stück braune Pappe, auf der in türkischer Sprache stand: Ich bin ein muslimischer Medizinstudent. Ich bin müde und ich möchte bei Ihnen wohnen. Issa. Und wie um die Botschaft noch zu unterstreichen, hing um sein Handgelenk ein schmales Goldkettchen, von dem ein winziger goldener Koran baumelte.
Aber Melik stank die Sache inzwischen gewaltig. Gut, er war vielleicht nicht die größte Leuchte, die seine Schule jemals hervorgebracht hatte – aber sollte er sich deshalb schuldig und minderwertig fühlen, nur weil ein Bettler mit Starallüren sich an seine Fersen heftete und ihn belästigte? Seit sein Vater tot war, fiel Melik die stolze Rolle des Hausherrn und Beschützers seiner Mutter zu, und zum krönenden Beweis hatte er weiterverfolgt, was sein Vater nicht mehr hatte zu Ende bringen können: als türkischer Einwanderer in der zweiten Generation hatte er gemeinsam mit seiner Mutter den langen, steinigen Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft angetreten, auf dem jede Facette ihres Lebenswandels unter die Lupe genommen werden würde und acht Jahre untadeligen Betragens die erste Bedingung waren. Das letzte, was seine Mutter oder er brauchen konnten, war ein geisteskranker Penner, der sich für einen Medizinstudenten hielt und an ihrer Haustür bettelte.
»Mach, daß du wegkommst«, befahl er dem Jungen barsch auf türkisch und pflanzte sich breit in die Tür. »Hau ab. Hör auf, uns hinterherzulaufen, und laß dich hier nicht mehr blicken.«
Die einzige Reaktion auf dem ausgemergelten Gesicht war ein Zucken, als hätte jemand ihn geschlagen. Melik wiederholte seine Aufforderung auf deutsch. Aber als er die Tür zuknallen wollte, stand hinter ihm auf der Treppe Leyla und sah über seine Schulter auf den Jungen und auf das Pappschild, das unkontrolliert in seiner Hand zitterte.
Und er sah, daß sie schon Tränen des Mitleids in den Augen hatte.
* * *
Der Sonntag verging, und am Montag erfand Melik eine Ausrede, um nicht in der Gemüsehandlung seines Cousins in Wellingsbüttel antreten zu müssen. Er wolle daheim bleiben und für die Boxmeisterschaften trainieren, sagte er seiner Mutter. Er müsse in den Kraftraum und ins Trainingsbad. Aber in Wirklichkeit war es ihm einfach nicht geheuer, sie mit einem baumlangen, größenwahnsinnigen Irren allein zu lassen, der, wenn er nicht betete oder die Wand anstarrte, im Haus herumstrich und liebevoll alle Gegenstände berührte, als erinnerte er sich noch von früher an sie. Melik ließ auf seine Mutter nichts kommen, aber seit dem Tod ihres Mannes verließ sie sich für seinen Geschmack etwas zu stark auf ihr Gefühl. All die Auserwählten, die sie einmal ins Herz geschlossen hatte, konnten für sie nichts verkehrt machen. Issas Sanftmut, seine Schüchternheit und das jähe Aufleuchten, das manchmal über seine Züge glitt, verschafften ihm sofortige Aufnahme in diesen illustren Kreis.
Den Montag und auch den Dienstag verbrachte Issa mit wenig anderem als Schlafen, Beten und Baden. Um sich mit ihnen zu verständigen, sprach er ein gebrochenes, sonderbar kehlig klingendes Türkisch, schwallweise, verstohlen, als sei ihm das Reden verboten, und dabei doch, nach Meliks Meinung zumindest, auf eine schwer greifbare Art belehrend. Ansonsten aß er. Wohin um Himmels willen steckte er nur all die Essensmengen? Melik konnte in die Küche kommen, zu welcher Tageszeit er wollte: immer saß Issa da, den Kopf über eine Schale mit Lammfleisch, Reis und Gemüse gebeugt, unermüdlich löffelnd, während seine Augen von einer Seite zur anderen huschten, damit ihm nur ja niemand einen Bissen wegnahm. Wenn er fertig war, wischte er die Schale mit einem Stück Brot aus und vertilgte es, worauf er mit einem gemurmelten »Gelobt sei Gott« und einem schwachen Grinsen auf dem Gesicht, als hätte er ein Geheimnis, das ihm für andere zu schade war, zur Spüle schlich und die Schale auswusch, ein Benehmen, das Leyla ihrem Sohn oder ihrem Mann nie und nimmer hätte durchgehen lassen. Die Küche war ihr Reich. Männer mußten draußen bleiben.
»Und wann fängst du mit deinem Medizinstudium an, Issa?« fragte Melik ihn beiläufig, so daß seine Mutter es hören konnte.
»Mit Gottes Willen wird es bald sein. Ich muß kräftig sein. Ich darf nicht Bettler sein.«
»Du brauchst eine Aufenthaltserlaubnis, das weißt du? Und einen Studentenausweis. Und dann noch ungefähr hunderttausend Euro für Wohnung und Essen. Und einen flotten kleinen Flitzer, um mit deinen Freundinnen spazierenzufahren.«
»Gott ist barmherzig. Wenn ich nicht Bettler mehr bin, er gibt mir.«
Solche Gelassenheit ging in Meliks Augen über bloßes Gottvertrauen hinaus.
»Der Kerl wird langsam richtig teuer, Mutter«, beschwerte er sich, als er Issa sicher auf dem Speicher wußte. »Dieses pausenlose Gemampfe! Das Wasser, das der verbraucht!«
»Nicht mehr als du, Melik.«
»Schon, aber er ist ja nicht ich, oder? Wir wissen nicht, wer er ist.«
»Issa ist unser Gast. Wenn er wieder bei Kräften ist, werden wir mit Allahs Hilfe seine Zukunft besprechen«, erwiderte seine Mutter pathetisch.
Issas glücklose Versuche, sich unsichtbar zu machen, trugen nur zu Meliks Verstimmung bei. Ob er die enge Diele entlanghuschte oder sich anschickte, die Leiter zum Speicher hinaufzuklettern, wo Leyla ihm sein Bett bereitet hatte, immer legte er diese übertriebene Rücksichtnahme an den Tag – machte demütige Rehaugen und drückte sich flach gegen die Wand, um Melik oder Leyla vorbeizulassen.
»Issa war im Gefängnis«, verkündete Leyla eines Morgens zufrieden.
Melik war entgeistert. »Weißt du das sicher? Der Mann ist ein Knacki? Weiß die Polizei davon? Hat er es dir erzählt?«
»Er hat gesagt, im Gefängnis in Istanbul gab es immer nur ein Stück Brot und eine Schale Reis am Tag«, sagte Leyla, und bevor Melik noch mehr einwenden konnte, schob sie einen Lieblingsspruch ihres Mannes hinterher: »Wir ehren unseren Gast und stehen all denen bei, die in Not sind. Kein Werk der Barmherzigkeit wird im Jenseits unbelohnt bleiben«, deklamierte sie. »War nicht auch dein Vater in der Türkei im Gefängnis, Melik? Nicht jeder, der ins Gefängnis kommt, ist ein Verbrecher. Für Menschen wie Issa und deinen Vater ist das Gefängnis eine Auszeichnung.«
Aber Melik wußte, daß sie noch andere Gedanken in ihrem Herzen bewegte, mit denen sie nicht so ohne weiteres herausrücken würde. Allah hatte ihre Gebete erhört. Er hatte ihr einen zweiten Sohn geschickt, als Ersatz für den Ehemann, der ihr genommen worden war. Die Tatsache, daß er ein illegaler, halbirrer Knastbruder mit krankhaft übersteigertem Selbstwertgefühl war, schien sie nur am Rande zu interessieren.
* * *
Er war aus Tschetschenien.
Soviel konnten sie am dritten Abend feststellen, als Leyla sie alle beide überraschte, indem sie ein paar Sätze auf tschetschenisch in den Raum warf, etwas, was Melik sein Lebtag nicht von ihr gehört hatte. Issas abgehärmtes Gesicht erstrahlte in einem verblüfften Lächeln, das ebenso schnell wieder verschwand, und dann verstummte er vollends. Dabei war die Erklärung für Leylas Sprachkünste denkbar harmlos. Als kleines Mädchen in ihrem türkischen Dorf hatte sie mit tschetschenischen Kindern gespielt und ein paar Brocken ihrer Sprache aufgeschnappt. Sie hatte gleich den Verdacht gehabt, daß Issa Tschetschene sein müsse, aber nichts gesagt, denn mit den Tschetschenen sei das so eine Sache.
Er war aus Tschetschenien, und seine Mutter war tot, und alles, was ihm von ihr geblieben war, war das goldene Kettchen mit dem Koran daran, das sie ihm umgelegt hatte, bevor sie starb. Aber wann und wie sie gestorben war und wie alt er gewesen war, als er das Kettchen geerbt hatte, waren Fragen, die er entweder nicht verstand oder nicht verstehen wollte.
»Die Tschetschenen werden von allen gehaßt«, erklärte Leyla Melik, während Issa gesenkten Hauptes seinen Teller leer schaufelte. »Aber nicht von uns. Hörst du, Melik?«
»Natürlich hör ich dich, Mutter.«
»Alle außer uns verfolgen die Tschetschenen«, fuhr sie fort. »In Rußland und überall sonst auf der Welt. Und nicht nur die Tschetschenen, sondern russische Muslime ganz gleich wo. Putin verfolgt sie, und Bush bestärkt ihn darin noch. Solange Putin das Krieg gegen den Terror nennt, kann er mit den Tschetschenen machen, was er will, und niemand hindert ihn daran. Hab ich recht, Issa?«
Aber Issas kurzer Glücksmoment war längst vorbei. Über seine hohlen Wangen hatten sich wieder die alten Schatten gelegt, in seine Rehaugen war das leidvolle Glänzen zurückgekehrt, und eine abgezehrte Hand schloß sich schützend um das Armband. Sag was, verdammt, fuhr Melik ihn wütend an, aber nur im Geiste. Wenn mich jemand plötzlich auf türkisch anredet, dann antworte ich auch auf türkisch, jeder anständige Mensch tut das! Also sag meiner Mutter gefälligst etwas Nettes auf tschetschenisch – oder bist du zu beschäftigt damit, dir auf ihre Kosten den Wanst vollzuschlagen?
Auch andere Sorgen plagten ihn. Bei einer Sicherheitsüberprüfung des Speichers, den Issa inzwischen als sein Hoheitsgebiet ansah – einer höchst verstohlenen Sicherheitsüberprüfung, während Issa unten in der Küche mit seiner Mutter plauderte wie üblich –, hatte er einige entlarvende Entdekkungen gemacht: gehortete Essensreste, als würde Issa die Flucht planen, eine kleine goldgerahmte Porträtaufnahme von Meliks verlobter Schwester mit achtzehn, die er aus Leylas heißgeliebter Sammlung von Familienphotos im Wohnzimmer entwendet hatte, und die Lupe seines Vaters, die auf den Hamburger Gelben Seiten lag, auf einer Doppelseite, die die zahlreichen Banken der Stadt auflistete.
»Gott hat deine Schwester mit einem lieblichen Lächeln gesegnet«, entgegnete Leyla gelassen auf Meliks aufgebrachte Meldung, daß sie es nicht nur mit einem illegalen Einwanderer zu tun hätten, sondern auch noch mit einem Perversen. »Ihr Lächeln wird Issa ins Herz scheinen.«
* * *
Issa war also aus Tschetschenien, ob er die Sprache beherrschte oder nicht. Seine Eltern waren beide tot – aber anderweitig nach ihnen befragt, war er um eine Antwort ebenso verlegen wie seine Gastgeber, zog die Brauen hoch und richtete milde Blicke in die Zimmerecke. Er war staatenlos, obdachlos, ein Exhäftling und illegaler Einwanderer, aber Allah in seiner Güte würde die Mittel bereitstellen, um ihn Medizin studieren zu lassen, sobald er kein Bettler mehr war.
Nun, Melik hatte selber einmal davon geträumt, Arzt zu werden; er hatte seinen Vater und seine Onkel sogar darauf eingeschworen, zusammenzulegen und ihm das Studium zu finanzieren, ein Unterfangen, das der Familie echte Opfer abverlangt hätte. Und wenn er nur ein bißchen mehr für die Schule gelernt und sich ein bißchen weniger um seinen Sport gekümmert hätte, dann hätte er jetzt im zweiten Semester sein können, ein Medizinstudent, der sich die Ohren heiß büffelte, um seiner Familie Ehre zu machen. Nicht unverständlich also, daß Issas nonchalantes Vertrauen auf Allahs Hilfe bei einem Unternehmen, das ihm selbst so grandios mißlungen war, Melik dazu trieb, Leylas Warnungen in den Wind zu schlagen und seinen unerwünschten Gast ins Kreuzverhör zu nehmen, so geschickt er das in seiner Gutmütigkeit vermochte.
Er hatte das Haus für sich. Leyla war zum Einkaufen gegangen und würde erst am Nachmitttag zurückkommen.
»Und du hast also schon Medizin studiert?« begann er, wobei er sich neben Issa setzte, um eine Vertrauensbasis zu schaffen, und kam sich dabei äußerst professionell vor. »Nicht schlecht.«
»Ich war in Krankenhäusern, Herr.«
»Als Student?«
»Ich war krank, Herr.«
Warum »Herr«? War das auch ein Überbleibsel aus dem Gefängnis?
»Aber Patient sein ist nicht dasselbe wie Arzt sein, oder? Ein Arzt muß wissen, was den Leuten fehlt. Als Patient sitzt du nur da und wartest, daß der Arzt dir hilft.«
Issa unterzog diese Aussage der umständlichen Betrachtung, der er Aussagen gleich welcher Größenordnung unterzog: griente ins Leere, kratzte sich mit den spinnendünnen Fingern den Bart und lächelte schließlich strahlend, ohne eine Antwort zu geben.
»Wie alt bist du?« fragte Melik, mit etwas weniger Raffinesse als geplant.
»Dreiundzwanzig, Herr.« Aber auch das erst nach einer ausgedehnten Denkpause.
»Also schon ziemlich alt. Selbst wenn du deine Aufenthaltsgenehmigung schon morgen in der Tasche hättest, wärst du fünfunddreißig oder so, bis du fertiger Arzt bist. Und Deutsch mußt du ja auch noch lernen. Und dafür zahlen.«
»Und ich werde heiraten gute Frau, so Gott will, und Kinder haben. Zwei Knaben, zwei Mädchen.«
»Aber nicht meine Schwester. Meine Schwester heiratet nämlich in einem Monat.«
»So Gott will, sie wird haben viel Söhne, Herr.«
Melik überlegte einen Moment und unternahm dann den nächsten Vorstoß. »Wie bist du eigentlich nach Hamburg gekommen?« fragte er.
»Es ist irrelevant.«
Irrelevant? Wie kam er auf so ein Wort? Und noch dazu auf türkisch?
»Wußtest du nicht, daß es Asylanten hier in Hamburg schwerer haben als sonstwo in Deutschland?«
»Hamburg wird mein Zuhause sein, Herr. Es ist der Platz, wo sie mich gebracht haben. Es ist Allahs göttlicher Wille.«
»Wer hat dich hierhergebracht? Wer sind sie?«
»Es war Kombination, Herr.«
»Eine Kombination aus was?«
»Vielleicht türkische Leute. Vielleicht tschetschenische Leute. Wir zahlen sie. Sie bringen uns zu ein Schiff. Packen uns in ein Container. Container mit fast kein Luft drin.«
Der Schweiß brach Issa aus, aber Melik war schon zu weit vorgeprescht, um noch einen Rückzieher zu machen.
»Wir? Wer ist wir?«
»War Gruppe, Herr. Von Istanbul. Schlechte Gruppe. Schlechte Männer. Ich habe kein Respekt für diese Männer.« Wieder dieser überhebliche Ton, selbst in stockendem Türkisch.
»Wie viele wart ihr?«
»Vielleicht zwanzig. Container war kalt. Nach paar Stunden sehr kalt. Diese Schiff ging nach Dänemark. Ich war glücklich.«
»Nach Kopenhagen, meinst du? Kopenhagen in Dänemark? Die Hauptstadt.«
»Ja« – munterer jetzt, so als sei Kopenhagen ein guter Einfall –, »nach Kopenhagen. In Kopenhagen soll kommen neuer Plan für mich. Plan, der mich wegholt von schlechten Männern. Aber dies Schiff ging nicht gleich nach Kopenhagen. Dies Schiff muß erst nach Schweden. Nach Göteborg. Ja?«
»Es gibt einen schwedischen Hafen, der Göteborg heißt, glaub ich«, räumte Melik ein.
»In Göteborg das Schiff soll Fracht mitnehmen, dann weiterfahren nach Kopenhagen. Als Göteborg kommt, sind wir alle krank, alle hungrig. In Schiff sie sagen uns: ›Kein Lärm machen. Schweden böse Leute. Schweden töten euch.‹ Wir machen kein Lärm. Aber Schweden gefallen nicht unser Container. Schweden haben Hund.« Er überlegte kurz. »›Wie ist dein Name, bitte?‹« donnerte er plötzlich, so laut, daß Melik hochfuhr. »›Wo hast du Papiere, bitte? Du bist von Gefängnis? Welche Verbrechen, bitte? Du bist geflohen von Gefängnis? In welcher Art, bitte?‹ Ärzte sind tüchtig. Ich bewundere diese Ärzte. Sie lassen uns schlafen. Ich bin dankbar zu diese Ärzte. Eines Tages werde ich ein Arzt wie sie sein. Aber so Gott will, muß ich fliehen. Nach Schweden fliehen geht nicht. Sie haben Natodraht. Viel Wachmänner. Aber auch Toilette. Toilette mit Fenster. Nach Fenster ist Tor zum Hafen. Mein Freund kann diese Tor öffnen. Mein Freund ist von Schiff. Ich komme zurück zum Schiff. Das Schiff bringt mich nach Kopenhagen. Endlich, sage ich. In Kopenhagen steht Laster nach Hamburg. Ich verehre Allah, Herr. Aber ich verehre auch den Westen. Im Westen ich kann frei sein, IHN anzubeten.«
»Du bist mit einem Laster nach Hamburg gekommen?«
»War arrangiert.«
»Ein tschetschenischer Laster?«
»Erst bringt mein Freund mich zu Straße.«
»Dein Freund aus der Besatzung? Dieser Freund? Der Typ vom Schiff?«
»Nein, Herr. War anderer Freund. War schwer, zu Straße zu kommen. Eine Nacht, wir schlafen in Wiese.« Er sah auf, und in seine ausgemergelten Züge trat momentlang ein Ausdruck reinen Glücks. »So viel Sterne. Gott ist barmherzig. Lob sei Gott.«
Melik, der so viel Aberwitziges erst einmal verdauen mußte, beschämt durch die Inbrunst der Erzählung und zugleich erbittert über ihre vielen Lücken und sein eigenes Unvermögen, sie zu schließen, merkte, wie es ihm in Armen und Fäusten zu kribbeln begann vor lauter Ohnmacht und wie seine Muskeln sich anspannten.
»Und wo hat er dich abgesetzt, dieser Zauberlaster, der da aus dem Nichts aufgetaucht ist? Wo hat er dich abgesetzt?«
Aber Issa hörte nicht mehr zu, wenn er denn überhaupt zugehört hatte. Urplötzlich – schien es zumindest dem braven, wenngleich begriffsstutzigen Melik – brach sich, was immer es war, das sich in ihm angestaut hatte, Bahn. Schwankend kam er auf die Füße und schleppte sich, die Hand vor den Mund gepreßt, zur Tür, kämpfte mit ihr, obwohl sie nicht abgesperrt war, und taumelte die Diele entlang ins Bad. Sekunden später hallte ein Würgen und Stöhnen durchs Haus, wie es Melik seit dem Tod seines Vaters nicht mehr vernommen hatte. Ganz langsam nur ließ es nach, dann hörte man Wasser platschen, die Badezimmertür öffnete und schloß sich, und die Leitersprossen knarzten leise, als Issa sich nach oben stahl. Woraufhin sich tiefes, unheilverkündendes Schweigen herabsenkte, alle Viertelstunde unterbrochen durch das Tschilpen von Leylas elektronischer Vogeluhr.
* * *
Nachmittags um vier kam Leyla mit Einkaufstüten beladen zurück, deutete die Stimmung im Haus sofort richtig und bezichtigte Melik, seine Gastgeberpflichten mit Füßen getreten und Schande über den Namen seines Vaters gebracht zu haben. Dann verschwand auch sie in ihrem Zimmer, wo sie in anschuldigender Abgeschiedenheit ausharrte, bis es Zeit war, das Abendessen zuzubereiten. Bald durchzogen Kochdüfte das Haus, aber Melik blieb auf seinem Bett liegen. Um halb neun schlug sie ihren Messinggong, ein vielgeliebtes Hochzeitsgeschenk, in dessen Klang für Melik immer ein Vorwurf mitschwang. In Momenten wie diesem duldete sie kein Trödeln, wie er gut wußte, deshalb schlurfte er hinunter in die Küche, wich ihrem Blick aber aus.
»Issa, Lieber, kommst du bitte herunter?« rief Leyla, und als die Antwort ausblieb, griff sie nach dem Spazierstock ihres Mannes, klopfte mit seiner Gummikappe an die Decke und sah dabei anklagend zu Melik, der unter ihrem frostigen Starren lostrottete, um zum Speicher hinaufzuklettern.
Issa lag in der Unterhose auf seiner Matratze zusammengerollt, verkrümmt, schweißgebadet. Das Kettchen seiner Mutter hatte er abgenommen und krampfte die verschwitzte Hand darum. Um seinen Hals hing ein angeschmuddelter Lederbeutel, der mit einem Riemen zugebunden war. Seine Augen standen weit offen, doch sie schienen Melik nicht zu sehen. Melik wollte ihn an der Schulter fassen – und fuhr entsetzt zurück. Issas Oberkörper war eine Buckellandschaft aus blauen und orangegelben Striemen. Manche mochten von Peitschenschlägen herrühren, andere eher von Knüppelhieben. An seinen Fußsohlen – denselben Fußsohlen, die die Hamburger Gehsteige entlanggelaufen waren – konnte Melik eiternde Brandwunden ausmachen, große, runde Zigarettenlöcher. Er richtete ihn ein Stück auf, schlang ihm eine Decke um die Mitte, damit er züchtig verhüllt war, und hob ihn dann behutsam hoch, um den teilnahmslosen Körper durch die Falltür in Leylas wartende Arme herabzulassen.
»Legen wir ihn in mein Bett«, flüsterte Melik unter Tränen. »Ich schlafe auf dem Boden. Das macht mir gar nichts. Ich geb ihm auch meine Schwester, damit sie für ihn lächelt«, fügte er hinzu, als ihm die gestohlene Miniatur auf dem Speicher einfiel, und stieg die Leiter wieder hoch, um sie zu holen.
* * *
Issas zerschundener Körper lag in Meliks Bademantel gepackt, seine striemenbedeckten Beine hingen über das Fußende von Meliks Bett, sein glasiger Blick ruhte stier auf Meliks Ruhmesgalerie: den Siegerphotos, den Meistergürteln, den Handschuhen, mit denen er sich den Titel erboxt hatte. Neben ihm auf dem Boden kauerte Melik selbst. Er hatte auf eigene Kosten einen Arzt holen wollen, aber Leyla hatte es ihm verboten. Zu gefährlich. Für Issa, aber für uns auch. Was wird sonst aus unserem Einbürgerungsverfahren? Bis morgen wird das Fieber gesunken sein, und es wird ihm bessergehen.
Aber das Fieber sank nicht.
Dichtverhüllt machte sich Leyla auf den Weg zu einer Moschee auf der anderen Seite der Stadt, in der ein neuer türkischer Arzt seine Gebete verrichten sollte. Sie fuhr sogar ein Stück mit dem Taxi, um ihre vermeintlichen Verfolger irrezuführen. Nach drei Stunden kam sie zurück, wutentbrannt. Der neue junge Arzt war ein Idiot und ein Scharlatan. Er begriff nichts. Es mangelte ihm an den elementarsten Qualifikationen. Ihm fehlte der Sinn für seine religiöse Verantwortung. Es hätte sie nicht gewundert, wenn er gar kein richtiger Arzt war.
Wenigstens war in ihrer Abwesenheit Issas Fieber ein wenig zurückgegangen, so daß sie nun wieder die Krankenschwester zu spielen wagte wie damals, als sie sich noch keinen Arzt leisten konnten oder sich nicht getrauten, einen aufzusuchen. Hätte Issa innere Verletzungen davongetragen, so befand sie, dann hätte er niemals solche Mengen in sich hineinfuttern können, darum konnte sie ihm jetzt ohne Bedenken Aspirin gegen sein nachlassendes Fieber geben und ihm eins ihrer Krankensüppchen kochen, Reiswasser, versetzt mit einem Schuß türkischen Kräutertranks.
Ihr selbst hätte Issa, ob gesund oder tot, nie und nimmer erlaubt, sich an seinem nackten Körper zu schaffen zu machen, darum drückte sie Melik Handtücher, eine Kompresse für Issas Stirn und eine Schüssel voll kaltem Wasser in die Hand, mit dem er ihn stündlich abreiben sollte. Um das zu bewerkstelligen, sah sich der reuegeplagte Melik gezwungen, den Lederbeutel um Issas Hals zu entfernen.
Nur nach langem Zögern (einzig im Interesse seines kranken Gastes, versicherte er sich, und nicht eher, als bis Issa das Gesicht zur Wand gedreht hatte und in einen Halbschlaf verfallen war, in dem er russisches Zeug vor sich hin murmelte) knotete er den Riemen auf und zog die Falten des Beutels auseinander.
Sein erster Fund war ein Bündel verblichener russischer Zeitungsausschnitte, zusammengerollt und mit einem Gummiband umwickelt. Er streifte das Gummi ab und breitete sie auf dem Fußboden aus. Auf allen war ein Offizier in einer Uniform der Roten Armee zu sehen, ein brutal wirkender Mittsechziger mit breiter Stirn und wuchtigen Kinnbacken. Zwei der Ausschnitte waren Todesanzeigen, verziert mit orthodoxen Kreuzen und Regimentsinsignien.
Sein zweiter Fund war ein Packen brandneuer Fünfzigdollarscheine, zehn an der Zahl, in einer Geldklammer. Bei dem Anblick stürmten all seine alten Befürchtungen wieder auf ihn ein. Ein halbverhungerter, bettelarmer, obdachloser, zerschundener Flüchtling mit fünfhundert druckfrischen US-Dollar in seinem Beutel? Hatte er sie gestohlen? Gefälscht? Hatte er deshalb im Gefängnis gesessen? War das der Rest der Summe, die er den Schleppern aus Istanbul bezahlt hatte, dem hilfsbereiten Seemann, der ihn versteckt, und dem Fernfahrer, der ihn von Kopenhagen nach Hamburg verfrachtet hatte? Wenn jetzt noch fünfhundert übrig waren, mit wieviel mochte er dann aufgebrochen sein? Womöglich waren seine Arztphantasien ja doch nicht so verfehlt.
Sein dritter Fund war ein abgegriffenes weißes Kuvert, zusammengeknüllt, als hätte jemand es wegwerfen wollen und sich dann eines Besseren besonnen: unfrankiert, unadressiert, die Umschlagklappe aufgerissen. Er strich es glatt und zog einen zerknitterten Brief heraus, eine einzelne maschinengeschriebene Seite in kyrillischer Schrift. Adresse, Datum und der Name des Absenders – oder was er dafür hielt – bildeten in großen schwarzen Druckbuchstaben den Briefkopf. Der unentzifferbare Text war von Hand unterschrieben, ein unleserlicher Krakel in blauer Tinte, gefolgt von einer sechsstelligen Zahl, auch sie handgeschrieben, aber mit größter Sorgfalt, jede Ziffer mehrmals mit Tinte nachgezogen, wie um zu sagen: Präg sie dir ein.
Sein letzter Fund war ein kleiner Hohlschlüssel, nicht größer als ein Knöchel an Meliks Boxerhand. Er war maschinengefertigt und mit komplizierten gezahnten Bärten nach drei Seiten versehen: zu klein für eine Gefängnistür, schätzte Melik; zu klein auch für das Tor, das in Göteborg zurück aufs Schiff geführt hatte. Aber genau richtig für Handschellen.
Er packte Issas Habseligkeiten wieder in ihren Beutel und schob ihn ihm unter das schweißdurchtränkte Kopfkissen: mochte er ihn beim Aufwachen finden! Aber am nächsten Morgen waren die Schuldgefühle, die sich seiner bemächtigt hatten, doch zu groß. Seine ganze nächtliche Wache hindurch, vor seinem eigenen Bett am Boden ausgestreckt, hatten ihn nicht nur Bilder von Issas gemarterten Gliedmaßen gequält, sondern auch das Bewußtsein seiner eigenen Unbedarftheit.
Als Kämpfer kannte er sich aus mit Schmerzen, jedenfalls hatte er das immer gedacht. Allein schon die Straßenprügeleien, in die er als Halbwüchsiger verwickelt gewesen war! Bei einem Meisterschaftskampf vor nicht langer Zeit hatte ihn ein Hagel von Schlägen in das gefürchtete rote Dunkel torkeln lassen, aus dem nicht jeder Boxer den Weg zurückfindet. Beim Schwimmen gegen seine deutschen Konkurrenten war er an die äußersten Grenzen seines Ausdauervermögens gestoßen – oder was er bisher dafür gehalten hatte.
Doch verglichen mit Issa war er unerprobt.
Issa ist ein Mann, und ich bin noch ein Junge. Ich habe mir immer einen Bruder gewünscht, und jetzt wird mir einer frei Haus geliefert, und ich habe ihn zurückgewiesen. Er hat gelitten wie ein wahrer Glaubensheld, während ich mich im billigen Glanz des Boxrings gesonnt habe.
* * *
Kurz nach Tagesanbruch gingen die flattrigen Atemzüge, die Melik die ganze Nacht in Sorge gehalten hatten, in ein stetiges Rasseln über. Als er die Kompresse wechselte, stellte er voll Erleichterung fest, daß Issas Stirn nicht mehr glühte. Am Vormittag lagerte er schon wie ein Pascha auf einem goldsamtenen Berg aus Leylas quastengeschmückten Wohnzimmerkissen, Leyla fütterte ihn mit einem kräftigenden Brei, dessen Rezeptur nur sie allein kannte, und das Kettchen von seiner Mutter hing um sein Handgelenk, wo es hingehörte.
Melik, von Scham zerfressen, wartete ab, bis die Tür sich hinter Leyla geschlossen hatte. Dann kniete er mit gesenktem Kopf an Issas Seite nieder.
»Ich habe in deinen Beutel gesehen«, sagte er. »Ich schäme mich zutiefst, daß ich das getan habe. Möge Allah in seiner Barmherzigkeit mir vergeben.«
Issa versank einmal wieder in ein nicht enden wollendes Schweigen, dann legte er Melik die abgezehrte Hand auf die Schulter.
»Niemals gestehen, mein Freund«, riet er ihm schläfrig, indem er seine Hand nahm und sie drückte. »Wenn du gestehst, sie lassen dich nie wieder raus.«
2
Am Freitag darauf, achtzehn Uhr, begab sich das private Bankhaus Brue Frères AG (vormals Glasgow, Rio de Janeiro und Wien, derzeit Hamburg) fürs Wochenende zur Ruhe.
Schlag halb sechs hatte ein muskulöser Hausmeister die Eingangstür des schmucken Stadthauses an der Binnenalster geschlossen. Minuten später hatte die Hauptkassiererin den Tresorraum abgesperrt und die Alarmanlage eingeschaltet, die Bürovorsteherin hatte das letzte ihrer Mädels nach Hause geschickt und noch einmal sämtliche Computer und Papierkörbe überprüft, und die dienstälteste Angestellte der Bank, Frau Ellenberger, hatte die Telefone umgestellt, sich ihre Baskenmütze auf den Kopf gesetzt, ihr Fahrrad von seiner Eisenstange im Hof losgekettet und war von dannen geradelt, um ihre Großnichte vom Tanzkurs abzuholen.
Allerdings nicht, ohne zuvor ihren Arbeitgeber, Mr. Tommy Brue, den einzigen noch lebenden Partner der Bank und Träger ihres ruhmreichen Namens, mit gespielter Strenge zurechtgewiesen zu haben: »Ich muß schon sagen, Mr. Tommy, Sie sind noch schlimmer als wir Deutschen«, erklärte sie in ihrem lupenreinen Englisch, indem sie den Kopf durch den Türspalt seines Büros steckte. »Warum tun Sie sich diese Plackerei an? Der Frühling ist eingezogen! Sehen Sie nicht die Krokusse und die Magnolien blühen? Sie sind jetzt sechzig, vergessen Sie das nicht. Sie sollten heimfahren und mit Mrs.Brue in Ihrem schönen Garten ein Glas Wein trinken! Ansonsten sind Ihre Nerven über kurz oder lang «, warnte sie, mehr um ihre Liebe zu Beatrix Potter zur Schau zu stellen als in der Erwartung, ihren Arbeitgeber von seinen Unarten zu kurieren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!