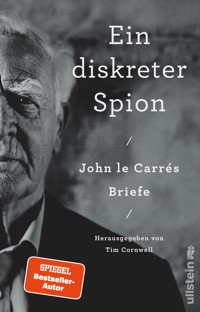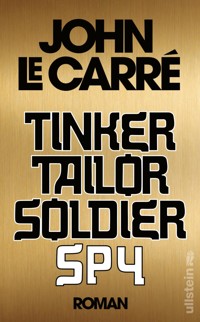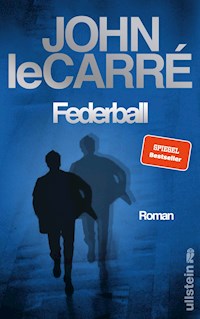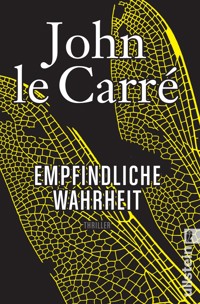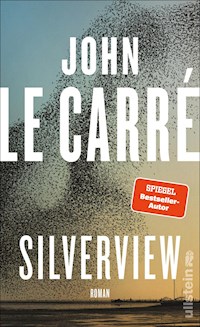
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum 90. Geburtstag des großen Schriftstellers und Bestsellerautors John le Carré Julian Lawndsley hat seinen Überflieger-Job in London drangegeben für ein einfacheres Leben als Buchhändler in einem kleinen englischen Küstenort. Kaum ist er ein paar Monate dort, stört ein abendlicher Besucher seine Ruhe. Edward, ein polnischer Emigrant, der auf Silverview lebt, dem großen Anwesen am Ortsrand, scheint viel über Julians Familie zu wissen und zeigt großes Interesse an den Details seines neuen kleinen Unternehmens. Gleichzeitig erhält in London ein Agentenführer des britischen Geheimdienstes einen Brief, der ihn vor einer undichten Stelle im Dienst warnt, und die Ermittlungen führen ihn in einen kleinen Ort an der englischen Küste … Silverview ist die faszinierende Geschichte einer Begegnung, Erfahrung trifft auf Unschuld, Integrität auf Loyalität. John le Carré, einer der großen Chronisten unserer Zeit, konfrontiert uns mit der Frage, was wir den Menschen, die wir lieben, wirklich schuldig sind. In Silverview betrachtet John le Carré sein Lebensthema wie unter einem Brennglas – die Welt der Geheimdienste. Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Silverview
Der Autor
John le Carré, 1931 geboren, schrieb über sechs Jahrzehnte lang Romane, die unsere Epoche ausloten. Als Sohn eines Hochstaplers verbrachte er seine Kindheit zwischen Internat und Londoner Unterwelt. Mit sechzehn ging er an die Universität Bern (Schweiz), später dann nach Oxford. Nach einer kurzen Zeit als Lehrkraft in Eton schloss er sich dem britischen Geheimdienst an. Während seiner Dienstzeit veröffentlichte er 1961 seinen Erstlingsroman Schatten von Gestern. Der Spion, der aus der Kälte kam, sein dritter Roman, brachte ihm weltweite Anerkennung ein, die sich durch den Erfolg seiner Trilogie Dame, König, As, Spion, Eine Art Held und Agent in eigener Sache festigte. Nach dem Ende des Kalten Krieges weitete le Carré sein Themenspektrum auf eine internationale Landschaft aus, die den Waffenhandel ebenso umfasste wie den Kampf gegen den Terrorismus. Seine Autobiografie Der Taubentunnel erschien 2016, Das Vermächtnis der Spione, der abschließende Roman um George Smiley, 2017. John le Carré verstarb am 12. Dezember 2020.
Das Buch
»ES GIBT MENSCHEN, DIE WIR NIEMALS VERRATEN DÜRFEN, UM WELCHEN PREIS AUCH IMMER. ICH FALLE NICHT IN DIESE KATEGORIE.«
Julian Lawndsley hat seinen Überflieger-Job in London drangegeben für ein einfacheres Leben als Buchhändler in einem kleinen englischen Küstenort. Kaum ist er ein paar Monate dort, stört ein abendlicher Besucher seine Ruhe. Edward, ein polnischer Emigrant, der auf Silverview lebt, dem großen Anwesen am Ortsrand, scheint viel über Julians Familie zu wissen und zeigt großes Interesse an den Details seines neuen kleinen Unternehmens.Gleichzeitig erhält in London ein hochrangiger Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes einen Brief, der ihn vor einer undichten Stelle im Dienst warnt, und die Ermittlungen führen ihn in einen kleinen Ort an der englischen Küste …Silverview ist die faszinierende Geschichte einer Begegnung, Erfahrung trifft auf Unschuld, Integrität auf Loyalität.John le Carré, einer der großen Chronisten unserer Zeit, konfrontiert uns mit der aktuellen und brisanten Frage, was wir unserem Land noch schuldig sind, wenn wir es kaum noch wiedererkennen.
John le Carré
Silverview
Roman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2021unter dem Titel Silverviewbei Viking, PRH, London.
© 2021 The Literary Estate of David Cornwell© der deutschsprachigen Ausgabe2021 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: zero-media.net, Münchennach einer Vorlage von www.wearesuperfantastic.comUmschlagmotiv: Menahem Kahana / Kontributor /© Getty Images und Johan from Friesland / shutterstockAutorenfoto: © White HareE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 9783843726351
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
Widmung
In Erinnerung an Klaus Konrad-Leder
1
An einem regengepeitschten Vormittag gegen zehn Uhr im Londoner West End trat eine junge Frau mit um den Kopf gewickeltem Tuch und in einem weiten Anorak entschlossen in den Sturm, der über die South Audley Street fegte. Sie hieß Lily und befand sich in einem Zustand innerer Unruhe, der dann und wann in ein Gefühl der Empörung umschlug. Mit einer behandschuhten Hand beschirmte sie ihre Augen vor dem Regen, während sie mit finsterer Miene die Hausnummern studierte. Mit der anderen Hand schob sie einen mit einer Plastikhaube geschützten Buggy vor sich her, in dem ihr zweijähriger Sohn Sam saß. Manche Häuser waren so stattlich, dass sie gar keine Hausnummern hatten. Andere wiederum trugen zwar Hausnummern, gehörten aber zur falschen Straße.
Sie kam an einen protzigen Hauseingang, bei dem die ungewöhnlich gut erkennbare Hausnummer auf eine der Säulen gemalt war, stieg rückwärts die Stufen hinauf, den Buggy hinter sich herzerrend, blickte mürrisch auf das Namensschild neben den Klingeln und streckte den Finger nach dem untersten Knopf aus.
»Einfach fest drücken, meine Liebe«, erklärte eine freundliche Frauenstimme aus der Gegensprechanlage.
»Ich muss mit Proctor reden. Mit Proctor oder mit niemandem«, sagte Lily ohne Umschweife.
»Stewart ist schon auf dem Weg zu Ihnen, meine Liebe«, verkündete die freundliche Stimme; Sekunden später öffnete sich die Haustür, und ein schlaksiger Mann Mitte fünfzig mit Brille stand leicht nach links geneigt da und legte den langgezogenen Kopf mit der Höckernase halb scherzhaft fragend zur Seite. Neben ihm erschien eine matronenhafte weißhaarige Dame in Strickjacke.
»Ich bin Proctor. Kann ich Ihnen damit behilflich sein?«, fragte er mit einem Blick in den Buggy.
»Und woher weiß ich, dass Sie das sind?«, entgegnete Lily.
»Nun, weil Ihre verehrte Frau Mutter mich gestern Abend auf meinem Privattelefon angerufen und mich eindringlich darum gebeten hat, hier zu sein.«
»Allein, sagte sie«, wandte Lily ein und blickte die matronenhafte Frau düster an.
»Marie kümmert sich um das Haus. Sie hilft auch gern anderweitig, wenn nötig«, sagte Proctor.
Die ältere Frau trat vor, doch Lily wies sie mit einem Achselzucken ab, und Proctor schloss die Tür. In dem stillen Hausflur schob Lily die Plastikhaube hoch, sodass der Kopf des schlafenden Jungen auftauchte. Sein krauses Haar war schwarz, seine Gesichtszüge strahlten eine beneidenswerte Zufriedenheit aus.
»Er war die ganze Nacht wach«, sagte Lily und legte dem Kind eine Hand auf die Stirn.
»Ein hübscher Junge«, sagte Marie.
Lily schob den Buggy unter die Treppe, wo es am dunkelsten war, wühlte in dem Ablagefach unter dem Sitz herum, zog einen großen, unbeschrifteten weißen Umschlag hervor und baute sich vor Proctor auf. Sein angedeutetes Lächeln erinnerte sie an den ältlichen Priester, bei dem sie zu Internatszeiten ihre Sünden hatte beichten sollen. Sie konnte die Schule nicht leiden, sie konnte den Priester nicht leiden, und sie hatte jetzt nicht vor, Proctor leiden zu können.
»Ich soll warten, bis Sie das gelesen haben«, teilte sie ihm mit.
»Aber natürlich«, sagte Proctor freundlich und blickte durch die Brillengläser schräg auf sie herab. »Und darf ich noch sagen, wie leid mir das alles tut?«
»Wenn Sie eine Nachricht haben, dann soll ich sie mündlich überbringen«, sagte sie. »Sie wünscht keine Anrufe, keine Textnachrichten, keine E-Mails. Weder vom Dienst noch von sonst wem. Sie eingeschlossen.«
»Das ist auch alles sehr bedauerlich«, bemerkte Proctor nach einem kurzen Augenblick trüben Nachdenkens, dann drückte er prüfend mit den knochigen Fingern auf den Umschlag, als würde er ihn jetzt erst wahrnehmen: »Ein ziemliches Werk, das muss ich schon sagen. Wie viele Seiten sind das wohl?«
»Keine Ahnung.«
»Eigenes Briefpapier?«, noch immer tastete er den Umschlag ab, »das kann nicht sein. Niemand hat privates Briefpapier von diesem Format. Ganz normales Schreibmaschinenpapier, nehme ich an?«
»Ich habe nicht hineingeschaut. Hab ich doch schon gesagt.«
»Haben Sie, haben Sie. Nun«, fügte er mit einem komischen kleinen Lächeln an, das sie kurzzeitig entwaffnete, »an die Arbeit. Sieht so aus, als hätte ich da ganz schön was zu lesen vor mir. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich zurückziehe?«
In einem kargen Wohnzimmer am anderen Ende des Hausflurs saßen sich Lily und Marie auf klobigen, schottengemusterten Sesseln mit Armlehnen aus Holz gegenüber. Auf dem verkratzten Glastisch zwischen ihnen stand ein Blechtablett mit einer Thermoskanne Kaffee und Schokoladenkeksen. Lily hatte beides abgelehnt.
»Wie geht es ihr?«, fragte Marie.
»Den Umständen entsprechend, danke. Wenn man im Sterben liegt.«
»Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich. Ist es ja immer. Aber wie ist ihre geistige Verfassung?«
»Sie hat noch alle Murmeln beisammen, falls Sie das meinen. Nimmt kein Morphin, davon hält sie nichts. Kommt zum Essen nach unten, wenn sie sich in der Lage fühlt.«
»Und sie hat ihren Appetit behalten, hoffe ich?«
Lily hatte genug, ging hinaus in den Flur und beschäftigte sich mit Sam, bis Proctor wieder auftauchte. Sein Zimmer war kleiner und dunkler als das Wohnzimmer, mit schmuddligen, sehr dicken Netzgardinen vor dem Fenster. Proctor, der darauf bedacht war, einen respektvollen Abstand einzuhalten, positionierte sich an der hinteren Wand neben dem Heizkörper. Lily gefiel sein Gesichtsausdruck überhaupt nicht. »Sie sind der Onkologe im Ipswich Hospital, und was Sie zu sagen haben, ist nur für die engste Familie bestimmt. Sie werden mir mitteilen, dass sie sterben wird, aber das weiß ich schon, und was gibt es noch?«
»Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was in dem Brief Ihrer Mutter steht«, sagte Proctor kurzerhand und klang nun gar nicht mehr wie der Priester, bei dem sie nicht hatte beichten wollen, sondern wie eine erheblich realere Person. Als er bemerkte, dass sie widersprechen wollte, ergänzte er: »Zumindest im Groben, wenn schon nicht im Wortlaut.«
»Ich hab doch schon gesagt«, entgegnete Lily schroff, »nicht im Groben und sonst auch nicht. Mum hat mir nichts gesagt, und ich habe nicht gefragt.«
Das Spiel, das wir im Schlafsaal gespielt haben: Wie lange kann man das andere Mädchen anstarren, ohne zu blinzeln oder zu lachen?
»Also gut, Lily, betrachten wir das doch mal von der anderen Seite«, schlug Proctor mit provozierender Nachsicht vor. »Sie wissen nicht, was in dem Brief steht. Sie wissen nicht, worum es geht. Aber Sie haben dieser oder jener Freundin erzählt, dass Sie mal eben nach London wollen, um ihn abzugeben. Wem haben Sie davon erzählt? Das müssen wir unbedingt wissen.«
»Ich habe niemandem auch nur ein einziges verdammtes Wörtchen erzählt«, sagte Lily ganz bewusst direkt in das ausdruckslose Gesicht auf der anderen Seite des Zimmers. »Mum hat gesagt, das soll ich nicht, also hab ich es auch nicht getan.«
»Lily.«
»Was?«
»Ich weiß sehr wenig über Ihre persönlichen Lebensumstände. Zumindest weiß ich, dass Sie irgendeine Art von Partnerschaft haben müssen. Was haben Sie ihm gesagt? Oder ihr? Sie können doch nicht einfach für einen Tag aus Ihrem schicksalsgeplagten Haushalt verschwinden, ohne irgendeine Erklärung abzugeben. Ist doch mehr als menschlich, dass man ganz nebenbei seinem Partner, seiner Partnerin, einem Kumpel gegenüber sagt: ›Weißt du was. Ich fahr mal eben nach London und übergebe für meine Mutter persönlich einen supergeheimen Brief‹!«
»Das ist menschlich, sagen Sie? Für uns? So mit anderen zu reden? Mit einer flüchtigen Bekanntschaft? Was menschlich ist: Meine Mum hat mir gesagt, ich darf es keiner Seele sagen, also hab ich das auch nicht getan. Außerdem wurde ich geschult. Von Ihrem Haufen. Das habe ich unterschrieben. Vor drei Jahren hat man mir die Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, ich sei erwachsen genug, um ein Geheimnis zu hüten. Außerdem habe ich keinen Partner. Und auch keine Mädelsclique, mit der ich herumquatsche.«
Eine neue Runde »Wer starrt am längsten?«.
»Und meinem Dad hab ich auch nichts erzählt, falls Sie das wissen wollen«, fügte sie in einem Ton hinzu, der nach Beichte klang.
»Hat Ihre Mutter von Ihnen verlangt, dass Sie ihm nichts erzählen?«, fragte Proctor recht streng.
»Sie hat nicht gesagt, dass ich es tun soll, also habe ich es auch nicht getan. So sind wir. So ist das bei uns zu Hause. Wir laufen auf rohen Eiern. Vielleicht ist das bei Ihnen zu Hause auch so.«
»Dann sagen Sie mir doch bitte«, fuhr Proctor fort, ohne darauf einzugehen, wie man es bei ihm zu Hause mit so etwas hielt oder nicht hielt. »Nur aus Interesse. Welchen Grund haben Sie vorgeschoben, warum Sie heute nach London mussten?«
»Sie meinen, wie meine Legende lautet?«
Das hagere Gesicht auf der anderen Seite des Zimmers hellte sich auf.
»Ja, schätze, das meine ich«, räumte Proctor ein, als wäre eine Legende ein ganz neues Konzept für ihn und zudem noch ein erheiterndes.
»Wir schauen uns in unserem Viertel eine Vorschule an. In der Nähe meiner Wohnung in Bloomsbury. Um Sam auf die Warteliste setzen zu lassen, wenn er drei ist.«
»Großartig. Und tun Sie das auch? Schauen Sie sich wirklich eine Vorschule an, Sam und Sie? Treffen Sie sich mit den Lehrerinnen und alles? Melden Sie ihn tatsächlich an?« Proctor wirkte ganz wie der besorgte Onkel, und das ziemlich überzeugend.
»Kommt darauf an, wie Sam drauf ist, wenn wir hier raus sind.«
»Bitte tun Sie das, wenn es geht«, drängte Proctor. »Das würde die Sache so viel einfacher machen, wenn Sie wieder nach Hause kommen.«
»Einfacher? Wie ›einfacher‹?«, ging Lily erneut hoch. »Einfacher zu lügen, meinen Sie?«
»Es ist einfacher, nicht zu lügen, das meine ich«, verbesserte Proctor sie aufrichtig. »Wenn Sie sagen, Sam und Sie schauen sich eine Vorschule an, und Sie tun das wirklich, und Sie kommen nach Hause und sagen, Sie hätten sie sich angeschaut, wo wäre das denn gelogen? Sie haben doch schon genug um die Ohren. Ich kann mir kaum vorstellen, wie Sie das alles ertragen.«
Einen unsicheren Augenblick lang wusste sie, dass er es genau so meinte.
»Bleibt noch die Frage«, fuhr Proctor fort und kam damit wieder zum Geschäftlichen, »welche Antwort könnte ich Sie bitten, Ihrer überaus mutigen Mutter zu überbringen? Denn sie hat eine Antwort verdient. Und die soll sie auch haben.«
Er schwieg, als würde er auf ihre Hilfe hoffen. Als diese ausblieb, sprach er weiter.
»Wie Sie schon sagten, kann die Antwort nur mündlich sein. Und Sie werden sie allein überbringen müssen. Es tut mir sehr leid, Lily. Darf ich anfangen?« Er wartete nicht ab. »Unsere Antwort ist ein unverzügliches Ja zu allen Punkten. Also dreimal Ja. Wir werden ihre Nachricht beherzigen. Wir werden uns um ihre Bedenken kümmern. Alle ihre Bedingungen werden erfüllt. Können Sie sich das alles merken?«
»Mit den paar Sätzen komme ich schon klar.«
»Und natürlich einen riesengroßen Dank an sie für ihren Mut und ihre Loyalität. Und was Sie angeht genauso, Lily. Wieder mal. Es tut mir so leid.«
»Und mein Dad? Was soll ich dem sagen?«, fragte die keineswegs besänftigte Lily.
Wieder dieses merkwürdige Lächeln, wie ein Warnlicht.
»Ja, hm. Sie können ihm alles über die Vorschule erzählen, die Sie noch besuchen werden, richtig? Schließlich ist das ja der Grund, warum Sie heute nach London gekommen sind.«
Der Regen spritzte vom Pflaster auf, während Lily bis zur Mount Street ging, wo sie ein Taxi anhielt und sich zur Liverpool Street Station fahren ließ. Vielleicht hatte sie tatsächlich vorgehabt, die Vorschule zu besichtigen. Sie war sich nicht mehr sicher. Vielleicht hatte sie am vergangenen Abend tatsächlich etwas Derartiges angekündigt, aber das bezweifelte sie, denn zu dem Zeitpunkt hatte ihr Entschluss bereits festgestanden, sich niemals wieder irgendjemandem gegenüber zu rechtfertigen. Vielleicht war sie ja auch erst auf den Gedanken gekommen, als Proctor es aus ihr herausquetschen wollte. Sie wusste nur eines: Proctor zuliebe würde sie nicht eine einzige blöde Schule aufsuchen. Zum Teufel damit, mit sterbenden Müttern und deren Geheimnissen, zum Teufel mit allem.
2
An demselben Vormittag trat ein dreiunddreißigjähriger Buchhändler namens Julian Lawndsley in einem kleinen Küstenstädtchen an den äußeren Gestaden von East Anglia aus der Seitentür seines nagelneuen Geschäfts, klappte die samtbezogenen Kragenspitzen seines schwarzen Mantels – ein Relikt aus der Zeit des vor zwei Monaten aufgegebenen Großstadtlebens – nach oben und machte sich auf, um sich über den einsamen Kiesstrand zu dem einzigen Café vorzukämpfen, das in dieser trübseligen Jahreszeit Frühstück anbot.
Er war nicht sonderlich freundlich gestimmt, weder sich selbst noch dem Rest der Welt gegenüber. Nach stundenlanger einsamer Inventur war er letzte Nacht in seine frisch renovierte Dachwohnung über dem Laden hinaufgestiegen, nur um festzustellen, dass er weder Strom noch fließend Wasser hatte. Das Telefon des Handwerkers war auf den Anrufbeantworter umgeschaltet. Statt sich ein Hotelzimmer zu suchen, sofern es in dieser Jahreszeit überhaupt eins gegeben hätte, hatte er vier Haushaltskerzen angezündet, eine Flasche Rotwein entkorkt, sich ein großes Glas eingeschenkt, zusätzliche Decken auf dem Bett verteilt, sich hineingelegt und in den Geschäftskonten vergraben.
Sie verrieten ihm nichts, das er nicht schon wusste. Seine spontane Flucht aus dem gnadenlosen Konkurrenzkampf hatte einen armseligen Start erwischt. Und wenn die Konten auch nicht den Rest der Geschichte offenlegten, so konnte er sich den selbst enthüllen: Er war nicht geschaffen für die Einsamkeit des Zölibates; die grölenden Rufe aus seiner jüngsten Vergangenheit ließen sich auch durch Distanz nicht zum Schweigen bringen, und sein Mangel an grundlegender literarischer Bildung, wie sie bei einem anspruchsvollen Buchhändler vorausgesetzt wurde, konnte er in ein paar Monaten nicht aufholen.
Das Café war eine geschindelte Hütte hinter einer Reihe aus edwardianischen Strandhäuschen unter einem düsteren Himmel voller kreischender Seevögel. Er hatte das Café bei seiner morgendlichen Joggingrunde entdeckt, doch war er nie auf die Idee gekommen, es zu besuchen. Eine kaputte grüne Leuchtreklame bot flackernd EI an, das S fehlte. Er zog die Tür auf, hielt sie gegen den Wind fest, ging hinein und schloss sie vorsichtig.
»Guten Morgen, mein Lieber!«, rief eine herzliche Frauenstimme aus der Küche. »Setzen Sie sich, wo Sie möchten. Ich komme sofort zu Ihnen, okay?«
»Guten Morgen«, rief er schwach zurück.
Ein Dutzend leerer Tische mit karierten Plastikdecken stand unter Neonröhrenlicht. Er suchte sich einen aus und zog die Speisekarte vorsichtig aus einem Gewirr an Gewürzständern und Soßenflaschen. Das Geplapper eines ausländischen Nachrichtensprechers drang durch die offene Küchentür. Ein Rummsen, dann das Schlurfen schwerer Schritte hinter ihm verrieten die Ankunft eines weiteren Gastes. Julian schaute in den Wandspiegel und war wenig erfreut, darin die außergewöhnliche Gestalt von Mr Edward Avon zu entdecken, dem lästigen, aber einnehmenden Kunden vom Vorabend, ein Kunde, der allerdings nichts gekauft hatte.
Er hatte zwar das Gesicht noch nicht gesehen – Avon, der ununterbrochen in Bewegung zu sein schien, war viel zu sehr damit beschäftigt, seinen breitkrempigen Homburg abzulegen und den tropfnassen braunen Regenmantel über den Stuhl zu hängen –, doch der wilde weiße Wuschelkopf und die unerwartet zarten Finger, mit denen er in einer überschwänglichen Geste den Guardian aus den Tiefen seines Regenmantels zog und auf dem Tisch ausbreitete, waren unverwechselbar.
Am Vorabend, fünf Minuten vor Ladenschluss. Das Geschäft ist leer. So war es den Großteil des Tages gewesen. Julian steht an der Kasse und zählt die mageren Tageseinnahmen zusammen. Vor ein paar Minuten ist ihm die einsame Gestalt in Homburger und Regenmantel aufgefallen, die, mit einem zusammengerollten Regenschirm bewaffnet, auf der anderen Straßenseite steht. Nach sechs Wochen mit stockenden Umsätzen ist Julian ein wahrer Experte für das Erkennen von Menschen geworden, die das Geschäft anstarren, aber nicht betreten, und so langsam gehen ihm solche Leute auf die Nerven.
Hat der Mann ein Problem mit dem Erbsengrün, in dem das Geschäft gestrichen wurde? Ist er ein alter Anwohner, der auffällige Farben nicht mag? Sind es die vielen guten Bücher in der Auslage, die Sonderangebote für jeden Geldbeutel? Oder geht es um Bella, Julians zwanzigjährige Praktikantin aus der Slowakei? Um sie geht es schon mal nicht. Zur Abwechslung ist Bella nämlich im Lager damit beschäftigt, unverkaufte Bücher zu verpacken, um sie an die Verlage zurückzuschicken. Jetzt – Wunder über Wunder – überquert der Mann tatsächlich die Straße, nimmt den Hut ab, die Ladentür öffnet sich, und ein Mann Mitte sechzig mit weißem Wuschelkopf schaut sich nach Julian um.
»Sie haben geschlossen«, teilt ihm eine selbstbewusste Stimme mit. »Sie haben geschlossen, und ich komme ein anderes Mal wieder, ich bestehe darauf«, doch schon befindet sich ein schmutziger brauner Schuh in der Tür, der andere folgt ihm, begleitet vom Regenschirm.
»Nein, wir haben eigentlich noch geöffnet«, versichert ihm Julian ebenso freundlich. »Genau gesagt, schließen wir um halb sechs, aber wir sind flexibel, also kommen Sie nur herein, und lassen Sie sich Zeit«, und damit nimmt Julian seine Zählerei wieder auf, während der Fremde sorgsam seinen Regenschirm in dem viktorianischen Schirmständer verstaut und seinen Homburg an den viktorianischen Hutständer hängt, womit er dem Retrostil seinen Respekt erweist, der die ältere Kundschaft ansprechen soll, von der es in dem Städtchen nur so wimmelt.
»Suchen Sie etwas Bestimmtes, oder möchten Sie sich nur umschauen?«, fragt Julian und dreht die Regalbeleuchtung hoch. Doch sein Kunde hört die Frage kaum. Sein breites, glatt rasiertes Gesicht, das so wandelbar wirkt wie das eines Schauspielers, erhellt sich in Verzücken.
»Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung«, versichert er und weist mit einer ausladenden Handbewegung auf die Quelle seiner Verwunderung. »Endlich gibt es im Ort eine waschechte Buchhandlung. Ich bin erstaunt, muss ich schon sagen. Durch und durch.«
Und damit macht er sich an eine ehrfurchtsvolle Erkundung der Regale – Belletristik, Sachbuch, Heimatkunde, Reiseliteratur, Klassiker, Religion, Kunst, Dichtung, bleibt hier und da stehen, fischt einen Band heraus und unterzieht ihn der Prüfung des Bücherkenners: Umschlaggestaltung, Klappentext, Papierqualität, Bindung, Gewicht und Lesefreundlichkeit.
»Ich muss schon sagen«, wiederholt er.
Ist die Aussprache hundertprozentig britisch? Seine Stimme klingt voll, interessant und überzeugend. Aber hört man da nicht einen ganz leichten fremdsprachigen Einschlag heraus?
»Was müssen Sie denn sagen?«, ruft Julian aus seinem winzigen Büro herüber, in dem er gerade die E-Mails des Tages durchgeht. Der Fremde setzt mit einem anderen, vertrauensvolleren Ton in der Stimme neu an.
»Hören Sie. Ich nehme an, dass Ihr bezauberndes neues Geschäft unter anderer Leitung steht. Habe ich recht, oder bin ich völlig auf dem Holzweg?«
»Unter neuer Leitung, ja«, sagt Julian noch immer aus dem Büro durch die offene Tür, und ja, da schwingt etwas Fremdsprachiges mit. Ganz leicht.
»Und ein neuer Besitzer, wenn man fragen darf?«
»Man darf, und die Antwort lautet Ja«, bestätigt Julian fröhlich und stellt sich wieder hinter die Kasse.
»Dann sind Sie also – verzeihen Sie.« Er beginnt noch mal von vorne, mit einem strengen, fast militärischen Ton in der Stimme: »Hören Sie – sind Sie zufällig, oder sind Sie es nicht, der junge Seemann höchstpersönlich, denn das müsste ich wissen? Oder sind Sie sein Stellvertreter? Sein Ersatzmann. Was auch immer?« Dann schließt er willkürlich den Schluss, dass Julian sich von seinen eindringlichen Fragen angegriffen fühlen könnte: »Damit meine ich nichts Persönliches, das versichere ich Ihnen. Ich meine nur, auch wenn Ihr unbedeutender Vorgänger sein Sortiment The Ancient Mariner genannt hat, haben Sie, Sir, als sein erheblich jüngerer und, wenn ich so sagen darf, erheblich angenehmerer Nachfolger …«
Doch da haben sich die beiden schon in ein durch und durch englisches, höfliches Sprachknäuel verwirrt, das sich erst auflöst, als Julian erklärt, dass er tatsächlich Betreiber und Besitzer zugleich ist, und der Fremde sagt: »Dürfte ich mich bedienen?«, und mit langen, spitzen Fingern flink einen Geschäftsflyer aus der Halterung zieht und ins Licht hält, um das Beweisstück mit eigenen Augen zu begutachten.
»Also spreche ich, und verbessern Sie mich, falls ich mich irre, mit Mr J. J. Lawndsley persönlich, dem alleinigen Inhaber von Lawndsleys Bessere Bücher«, stellt er fest und lässt den Arm effektvoll langsam sinken. »Wahrheit oder Dichtung?«, dreht er sich um und beobachtet Julians Reaktion.
»Wahrheit«, bestätigt Julian.
»Und das erste J, wenn man fragen darf?«
»Man darf: Julian.«
»Ein großer römischer Kaiser. Und das zweite J, um noch kühner zu sein?«
»Jeremy.«
»Und nicht andersherum?«
»Definitiv nicht.«
»Nennt man Sie Jay-Jay?«
»Ich persönlich würde einfach Julian bevorzugen.«
Der Unbekannte brütet darüber mit buschigen, hochgezogenen, rötlich-grau melierten Augenbrauen.
»Dann, mein Herr, sind Sie Julian Lawndsley, nicht sein Bildnis, nicht sein Schatten, und ich bin nur Edward Avon, wie der Fluss. Für die meisten mag ich Ted oder Teddy sein, unter meinesgleichen bin ich allein Edward. Wie geht es Ihnen, Julian?«, womit er eine Hand über den Tresen streckt und trotz der zarten Finger erstaunlich fest zudrückt.
»Hallo, Edward«, erwidert Julian heiter, zieht die Hand so schnell zurück, wie es der Anstand erlaubt, und wartet, während Edward Avon einen ziemlichen Aufwand betreibt, seinen nächsten Schritt zu überlegen.
»Erlauben Sie mir, Julian, eine Bemerkung, die womöglich persönlich und vielleicht anstößig ist?«
»Solange es nicht zu persönlich wird«, antwortet Julian argwöhnisch, aber in unbeschwertem Ton.