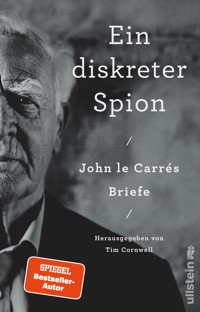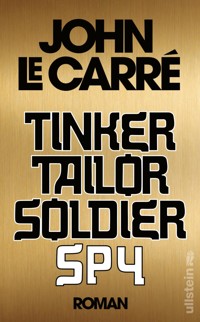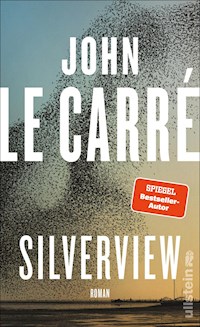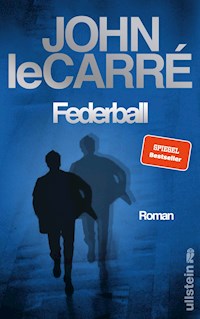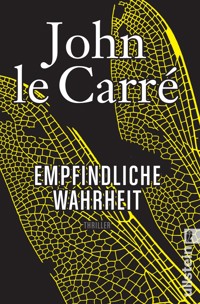8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! Das Buch zum Film: "Verräter wie wir" mit Ewan McGregor, Naomie Harris, Stellan Skarsgård, Damian Lewis und vielen weiteren Stars. Dima ist die Seele der russischen Mafia. Seit seiner Zeit als Gefangener im Gulag hat er sich an ihre Spitze hochgearbeitet. Sein Spezialgebiet: die Geldwäsche. Doch seine Tage sind gezählt. Er hat Feinde unter den mächtigen Weggefährten. Um das Überleben seiner Familie zu sichern, geht er einen Pakt mit dem Westen ein. Er bietet sein Wissen im Tausch gegen ein Leben in England. Eine Sensation für den britischen Geheimdienst, der einwilligt. Aber die Agenten stoßen auf einen bedrohlichen Widerstand. Der lange Arm der Mafia reicht bis weit in den Westen. Wie lange wird Dima seine russischen Freunde täuschen können? "Verräter wie wir" ist ein leidenschaftlicher Roman über die Korrumpierbarkeit des Westens und über die Zerbrechlichkeit der Demokratie. Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
John le Carré
VERRÄTER WIE WIR
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Roth
Ullstein
Die Originalausgabe erschien 2010
unter dem Titel Our Kind of Traitor
bei Viking, London.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie
etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder
Übertragung können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
ISBN 978-3-550-92015-8
© 2010 by David Cornwell
© der deutschsprachigen Ausgabe
2010 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Gesetzt aus der Berling und Bodoni bei Leingärtner, Nabburg
eBook: LVD GmbH, Berlin
In memoriam
Simon Channing Williams
Filmemacher, Magier
und
ein ehrenwerter Mann
Wer herrscht, hasst den Verräter
Und liebt doch den Verrat.
Samuel Daniel
1
An einem Karibikmorgen um sieben spielte auf der Insel Antigua ein gewisser Peregrine Makepiece, kurz Perry, Universalsportler und Noch-Anglistikdozent an einem renommierten Oxforder College, drei Sätze Tennis gegen einen muskulösen Mittfünfziger, einen braunäugigen Russen mit kahlem Kopf und hoheitsvoller Haltung, der Dima hieß. Die Ereignisse rund um das Match gerieten schon bald ins Fadenkreuz britischer Agenten, die von Berufs wegen nicht an Zufälle glaubten. Dabei war der Hergang, soweit es Perry betraf, über jeden Vorwurf erhaben.
Sein nahender dreißigster Geburtstag drei Monate zuvor hatte bei ihm eine Sinnkrise ausgelöst, die sich, von ihm unbemerkt, schon ein Jahr oder länger angebahnt hatte. Den Kopf in den Händen vergraben, hatte er morgens um acht in seiner bescheidenen Oxforder Wohnung gehockt, nachdem auch ein Sieben-Meilen-Lauf keine Linderung gebracht hatte, und sich mit der Frage gequält, was zum Henker er nach dem ersten Drittel seines Erdendaseins vorweisen konnte außer einem Freibrief dafür, sich um die Welt jenseits der träumenden Türme Oxfords nicht weiter zu kümmern.
* * *
Warum?
Jedem Außenstehenden musste seine akademische Laufbahn als Erfolgsgeschichte sondergleichen erscheinen. Der Sohn eines Lehrerehepaars, der nie eine Privatschule von innen gesehen hat, kommt mit einem Abschluss von der London University und bergeweise akademischen Auszeichnungen nach Oxford und tritt eine Dreijahresstelle in einem altehrwürdigen, reichen, erfolgsorientierten College an. Seinen Taufnamen, traditionsgemäß der englischen Oberschicht vorbehalten, verdankt er einem aufrührerischen methodistischen Prälaten des neunzehnten Jahrhunderts, Arthur Peregrine von Huddersfield.
In seiner Freizeit während des Semesters tut er sich als Querfeldeinläufer und Sportsmann hervor. Wenn er einen Abend erübrigen kann, hilft er in einem Oxforder Jugendclub aus. In den Ferien bezwingt er schwierigste Gipfel und beweist sich im extremen Fels. Aber als ihm sein College eine Dauerstelle anbietet – oder, wie es sich seiner angesäuerten Wahrnehmung darstellt, die lebenslange Gefangenschaft –, stemmt er die Fersen ein.
Nochmals: Warum?
Letztes Semester hat er seine Vorlesung über George Orwell »England in Ketten?« betitelt, und seine eigene Rhetorik hat ihn erschreckt. Hätte Orwell sich träumen lassen, dass die gleichen saturierten Stimmen, die ihm die dreißiger Jahre vergällt hatten, die gleiche lähmende Inkompetenz, die gleiche koloniale Kriegswut, die gleichen Vormachtallüren auch 2009 noch fröhliche Urständ feiern?
Und als sich auf den Gesichtern der Studenten, die dasaßen und zu ihm hochstarrten, keinerlei Reaktion abzeichnete, hat er sie selbst geliefert: Nein, nie im Leben hätte Orwell sich das träumen lassen. Und wenn doch, dann wäre er auf die Straße gegangen. Dann hätte er Krawall geschlagen, aber wie.
* * *
Gegenüber Gail, seiner langjährigen Freundin, hatte er seinem Groll noch gründlicher Luft gemacht, als sie nach dem Geburtstagsessen für ihn zusammen in Gails Bett lagen, in Gails Wohnung in Primrose Hill, die sie von ihrem ansonsten mittellosen Vater geerbt hatte.
»Collegedozenten kotzen mich an, und dass ich selbst einer bin, kotzt mich auch an. Der ganze Unibetrieb kotzt mich an, und je eher ich diesen Scheißtalar in die Ecke pfeffern kann, desto eher fühle ich mich wieder als freier Mann«, hatte er in das goldbraune Haar geschimpft, das sich sanft um seine Schulter ergoss.
Und als er nur ein anteilnehmendes Schnurren zur Antwort erhielt: »Was soll ich Byron oder Keats oder Wordsworth irgendwelchen jungen Schnöseln andienen, die nichts anderes wollen als rauskommen, rumvögeln und reich werden? War da. Hab mitgemacht. Drecksbande.« Und indem er noch eins draufsetzte: »So ziemlich das Einzige, was mich in diesem Scheißland noch halten könnte, ist eine Revolution.«
Worauf ihm Gail, eine aufgeweckte, ambitionierte junge Rechtsanwältin, die sowohl mit Schönheit als auch einem losen Mundwerk gesegnet war – manchmal loser, als ihr oder Perry lieb sein konnte –, versicherte, keine Revolution wäre vollständig ohne ihn.
Auch Gail war praktisch elternlos. Aber während Perrys Eltern ein Muster an hochgesinnter christlich-sozialer Askese gewesen waren, waren ihre das glatte Gegenteil. Ihren Vater, einen liebenswert-unbegabten Schauspieler, hatten Alkohol, sechzig Zigaretten täglich sowie eine verfehlte Passion für seine launenhafte Frau vorzeitig dahingerafft. Ihre Mutter, ebenfalls Schauspielerin, nur weniger liebenswert, hatte sich vom Acker gemacht, als Gail dreizehn war, und huldigte nun Gerüchten zufolge an der Seite eines zweiten Kameramannes an der Costa Brava dem einfachen Leben.
* * *
Perrys Entschluss, den Staub der Gelehrsamkeit von seinen Füßen abzuschütteln – unwiderruflich, wie alle Entschlüsse bei Perry –, sollte gekoppelt sein mit einer Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der einzige Sohn von Dora und Alfred Makepiece würde ihre sämtlichen Überzeugungen in die Tat umsetzen. Er würde seine pädagogische Laufbahn an dem Punkt neu beginnen, an dem sie gezwungen gewesen waren, die ihrige aufzugeben.
Er würde nicht länger den intellektuellen Überflieger spielen, sondern die ganz normale, prosaische Lehrerausbildung nachmachen und, getreu dem elterlichen Vorbild, Oberschullehrer in einer der sozial schwächsten Regionen des Landes werden.
Er würde Standardfächer unterrichten und dazu die einschlägigen Sportarten, bei Kindern, die ihn als Retter aus der absoluten Chancenlosigkeit brauchten, nicht als Freifahrschein zu bürgerlicher Betuchtheit.
Aber Gail fühlte sich durch diese Pläne nicht so beunruhigt wie vielleicht von ihm beabsichtigt. Bei all seiner Entschlossenheit, sich den Brennpunkten der Realität zu stellen, blieben doch Seiten an ihm, die nicht ins Bild passten, und mit den meisten war Gail mehr als vertraut:
Da war Perry, der verhinderte T. E. Lawrence, der als Student an der London University, wo die beiden sich kennengelernt hatten, zum Zwecke der Selbstkasteiung mit dem Fahrrad durch Frankreich gestrampelt war, bis er vor Erschöpfung umkippte.
Da war Perry, der Gipfelstürmer, der Perry, der keinen Lauf mitlaufen und kein Spiel mitspielen konnte, ob 7er-Rugby oder die Weihnachtsscharaden mit Gails Nichten und Neffen, ohne zwanghaft gewinnen zu wollen.
Doch da war auch noch Perry, der heimliche Bacchant, der sich vereinzelte unvorhersehbare Ausbrüche von Genusssucht gönnte, bevor er zurückeilte in seine Dachstube. Und das war der Perry, der an diesem frühen Maimorgen auf dem besten Tennisplatz der besten rezessionsgebeutelten Hotelanlage Antiguas gegen den Russen Dima antrat, solange es noch kühl genug war zum Spielen, während Gail in Badeanzug, breitkrempigem Sonnenhut und einem seidenen Überwurf, der mehr freiließ als verhüllte, von der Tribüne aus zusah, um sie herum ein Sammelsurium stumpfblickender Zuschauer – nicht alle in Schwarz zwar, aber offenbar alle miteinander grimmig entschlossen, nicht zu lächeln, nicht zu sprechen und um Gottes willen kein Interesse an dem Match zu zeigen, dem sie hier beiwohnen mussten.
* * *
Gail dankte dem Himmel, dass das Karibik-Abenteuer noch in der Zeit vor Perrys impulsiver Lebensentscheidung beschlossen worden war. Seine Ursprünge reichten zurück bis in den tristesten November, als Perrys Vater an dem gleichen Krebs gestorben war wie zwei Jahre zuvor seine Mutter, wodurch sich Perry plötzlich als leidlich gutsituierter Mann wiederfand. Ererbter Reichtum gehört einem nicht. Perry schwankte ernsthaft, ob er nicht alles, was er hatte, den Armen geben sollte. Aber nach einer von Gail inszenierten Zermürbungskampagne einigten sie sich stattdessen auf einen Tennisurlaub in der Sonne, ein Schnäppchen, wie es im Leben nicht wiederkam.
Und kein Zeitpunkt hätte besser gewählt sein können, wie sich zeigte, denn als sie losfuhren, gab es für sie beide noch weit schwerwiegendere Entscheidungen zu treffen:
Was sollte Perry mit seinem Leben anfangen, und sollten sie es gemeinsam anfangen?
Sollte Gail die Juristerei an den Nagel hängen und ihm blindlings hinausfolgen in die blaue Ferne, oder blieb sie besser London und ihrem kometenhaften Aufstieg dort treu?
Oder wurde es vielleicht langsam Zeit, sich einzugestehen, dass ihr Aufstieg nicht kometenhafter war als der der meisten Junganwälte, und einfach schwanger zu werden, womit Perry ihr ohnehin schon ständig in den Ohren lag?
Und auch wenn Gail, sei es aus Eigensinn, sei es zum Selbstschutz, große Fragen gern als kleine abtat, standen sie doch unzweifelhaft beide, jeder für sich wie auch als Paar, an einem Scheideweg und mussten erst mal ordentlich in sich gehen, und ein Urlaub auf Antigua schien dafür die ideale Gelegenheit.
* * *
Ihr Flug hatte Verspätung, weshalb sie erst nach Mitternacht in ihrem Hotel ankamen. Ambrose, der allzeit bereite Majordomus der Anlage, brachte sie in ihr Häuschen. Sie schliefen lange, und als sie ihr Frühstück auf dem Balkon beendet hatten, war es zu heiß zum Tennisspielen. Sie schwammen an dem zu drei Vierteln leeren Strand, nahmen ein einsames Mittagessen am Pool ein, zogen sich dann wieder ins Bett zurück und wurden abends um sechs im Pro-Shop vorstellig, ausgeruht, glücklich und richtig in Spiellaune.
Aus der Entfernung betrachtet, bestand die Hotelanlage nur aus einem Grüppchen weißer Bungalows, verstreut um einen hufeisenförmigen Strand von puderfeinem Sand, der eine gute Meile breit war. Seine Endpunkte bildeten zwei Felshügel, beide mit krüppeligen Bäumchen bewachsen. Ein Korallenriff und eine Reihe grellbunter Bojen schirmten die Bucht vor lärmenden Motorjachten ab. Und auf mehreren dem Gefälle abgetrotzten Terrassen lagen die turniertauglichen Tennisplätze der Anlage versteckt. Kärgliche Steinstufen wanden sich zwischen blühenden Sträuchern hindurch bis zum Eingang des Pro-Shops. Hinter dieser Pforte tat sich der Tennishimmel auf – der wahre Grund für Perrys und Gails Wahl.
Es gab fünf Plätze und den Centre-Court. Turnierbälle wurden in grünen Kühlboxen aufbewahrt. Silberne Trophäen in Glasvitrinen trugen die Namen der Champions von einst, und Mark, der übergewichtige australische Pro, war einer von ihnen.
»Von welchem Niveau sprechen wir, wenn ich das fragen darf?«, erkundigte er sich demütig-jovial und taxierte mit schweigender Kennermiene Perrys verschrammte Schläger, seine dicken weißen Socken und abgetragenen, aber zweckdienlichen Tennisschuhe sowie Gails Dekolleté.
Für zwei Menschen, die jung, aber nicht mehr blutjung waren, gaben Perry und Gail ein bemerkenswert attraktives Paar ab. Die Natur hatte Gail mit langen, wohlgeformten Beinen und Armen ausgestattet, hochangesetztem kleinem Busen, einem biegsamen Körper, klarem englischem Teint, feinem Goldhaar und einem Lächeln, das noch die dunkelsten Winkel des Lebens aufhellte. Perry sah man den Engländer auf andere Art an; er war schlaksig und auf den ersten Blick unproportioniert, mit langem Hals und einem stark vorspringenden Adamsapfel. In der Schule hatte er den Spitznamen Giraffe verpasst bekommen, aber nur so lange, bis diejenigen, die unklug genug waren, ihn laut so zu nennen, ihre Lektion gelernt hatten. Als Erwachsener jedoch hatte er – unbewusst und dadurch umso eindrücklicher – eine schwer festzumachende, aber unbestrittene Eleganz entwickelt. Er hatte dichte braune Locken, eine breite sommersprossige Stirn, und die großen Augen spähten mit einer Konsterniertheit durch die Brillengläser, die nicht ganz von dieser Welt schien.
Gail als seine treue Beschützerin wollte nicht zulassen, dass er sein Licht unter den Scheffel stellte, darum beantwortete sie Marks Frage lieber gleich selbst.
»Perry spielt die Qualifikation für Queen’s, und einmal hat er’s sogar bis ins Hauptfeld geschafft, stimmt’s? Du warst bei den Assen dabei. Und das, nachdem er sich beim Skifahren das Bein gebrochen und ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hatte«, fügte sie hinzu.
»Und Sie selbst, Ma’am, wenn Sie gestatten?«, wollte der unterwürfige Mark wissen, wobei er dem »Ma’am« für ihren Geschmack eine Idee zu viel Topspin gab.
»Ich dilettiere mehr so herum«, erwiderte sie kühl, worauf Perry »Völliger Blödsinn« sagte und der Australier die Luft durch die Zähne sog, zweifelnd den schweren Kopf wiegte und in den zerfledderten Seiten seiner Kladde blätterte.
»Hm, hier hätte ich ein Pärchen, das was für Sie sein könnte«, sagte er und wischte sich mit einem schmuddeligen Handtuch den Schweiß von der Stirn. »’n Tick zu gut für meine anderen Gäste, wenn ich das mal so sagen darf. Wobei ich nicht behaupten kann, die volle Bandbreite der Menschheit zur Auswahl zu haben … doch, ihr vier solltet ruhig mal ein Spielchen wagen.«
Ihre Gegner erwiesen sich als zwei Flitterwöchner aus Mumbai. Der Centre-Court war besetzt, aber die Nummer 1 war frei. Schon bald hatte sich eine Handvoll von Schaulustigen und Spielern von anderen Plätzen eingefunden, die den vieren beim Aufwärmen zusahen: flüssige Schläge von der Grundlinie, die lässig pariert wurden, Weitschüsse, nach denen niemand lief, ein unerwiderter Schmetterschlag vom Netz aus. Perry und Gail bekamen den Aufschlag, Perry ließ Gail den Vortritt, die zwei Doppelfehler nacheinander machte, so dass das Spiel an die anderen ging. Die indische Braut tat es Gail nach. Das Match blieb verhalten.
Erst als Perry mit dem Aufschlag an der Reihe war, begann sein wahres Können sich zu zeigen. Sein erster Ball war hoch und kraftvoll, und er schlug ein wie eine Bombe. Nummer zwei, drei und vier genauso. Die Zuschauerschar wuchs, die Spieler waren jung und gutaussehend, die Balljungen entwickelten ganz neue Energien. Gegen Ende des ersten Satzes kam Mark der Pro angeschlendert, um nach dem Rechten zu sehen, blieb für drei Spiele und kehrte mit gedankenvoll gerunzelter Stirn in seinen Laden zurück.
Nach einem langen zweiten Satz stand es eins beide. Im dritten und letzten Satz führten Perry und Gail 4 zu 3. Gail hätte die anderen gern noch mal rankommen lassen, doch bei Perry gab es kein Halten mehr, und das Spiel endete, ohne dass das indische Paar noch einen Ballwechsel hätte gewinnen können.
Die Menge zerstreute sich. Die vier blieben noch etwas, tauschten Komplimente aus, vereinbarten ein Rückspiel – und vielleicht sah man sich ja später auf einen Drink in der Bar? Unbedingt! Die Inder zogen ab, Perry und Gail packten ihre Ersatzschläger und die Pullover ein.
Sie waren fast fertig, da kehrte der australische Pro auf den Platz zurück, im Schlepptau einen muskulösen Kahlkopf mit enormem Brustkorb und sehr aufrechter Haltung, der eine brillantenfunkelnde goldene Rolex trug und dazu eine graue Trainingshose mit Zugband, das vor dem Bauch zu einer Schleife gebunden war.
* * *
Weshalb Perry die Schleife eher bemerkte als die restliche Erscheinung des Mannes, ist leicht erklärt. Er vertauschte gerade seine betagten, aber bequemen Tennisschuhe gegen ein Paar Strandschuhe mit Hanfsohle, und als er seinen Namen hörte, stand er noch vornübergebeugt. Daher hob er seinen langen Kopf so langsam, wie es die Art großer, knochiger Männer ist, und registrierte als Erstes ein Paar Lederespadrilles an nackten, fast frauenhaft kleinen Füßen, so breitbeinig in den Boden gepflanzt wie Seeräuberstiefel, dann zwei stämmige, in graues Trikot gehüllte Waden und darüber die Schleife, die die Hose an ihrem Platz hielt, doppelt gebunden, wie es ratsam war bei einer Schleife, der solch immense Verantwortung zukam.
Und über der Buglinie einen gewaltigen, in feinste tiefrote Baumwolle gehüllten Rumpf, bei dem der Bauch nahtlos in den Brustkorb überging, gekrönt von einem Russenkragen, der in zugeknöpftem Zustand der vereinfachten Version eines priesterlichen Kollars entsprochen hätte, nur hätte er dann niemals um den dicken Hals gereicht.
Und über dem Kragen ein faltenloses Gesicht – seelenvolle braune Augen, bittend hochgezogene Brauen –, das sich auffordernd schräglegte: das Lächelgesicht eines Delphins. Seine Faltenlosigkeit verlieh ihm nichts Unerfahrenes, im Gegenteil, Perry, dem Freiluft-Abenteurer, schien es sogar ein besonders markantes Gesicht. Vom Leben geformt, wie er es später gegenüber Gail nannte – noch so ein Prädikat, nach dem er für sich selber strebte, aber das er trotz mannhaften Einsatzes noch nicht für sich in Anspruch nehmen mochte.
»Perry, gestatten Sie mir, Ihnen meinen guten Freund und Stammkunden Mr Dima aus Russland vorzustellen«, sagte Mark noch eine Spur salbungsvoller als sonst. »Dima fand, dass Sie da vorhin ein fabelhaftes Spiel hingelegt haben, nicht wahr, Sir? Als ein großer Kenner und Liebhaber des Tennissports hat er Ihnen mit dem höchsten Genuss zugeschaut, das darf ich doch so sagen, Dima, oder?«
»Ein Match, ja?« Dima fragte es, ohne die bittenden braunen Augen von Perry abzuwenden, der mittlerweile in seiner vollen, ungelenken Größe über ihm aufragte.
»Hallo«, sagte Perry atemlos und streckte die verschwitzte Hand aus. Die von Dima war erstaunlich zart, aber gepolstert; in den zweiten Daumenknöchel war ein Kreuzchen oder Sternchen tätowiert. »Und das ist Gail Perkins, meine Komplizin bei dieser Schandtat hier«, fügte er hinzu, um das Tempo ein wenig zu drosseln.
Aber bevor Dima etwas erwidern konnte, schnaubte Mark schon in katzbuckelnder Empörung. »Schandtat, Perry?«, protestierte er. »Glauben Sie dem Mann kein Wort, Gail! Sie haben Ihre Sache super gemacht, und das meine ich ernst. Ein paar von diesen Rückhandpassierschlägen waren erste Sahne, stimmt’s, Dima? Das haben Sie selbst gesagt. Wir haben vom Shop aus zugeschaut. Videoüberwachung.«
»Mark sagt, Sie spielen Queen’s«, sagte Dima, sein Delphinlächeln unverändert auf Perry gerichtet, die Stimme tief und kehlig mit einem entfernten amerikanischen Beiklang.
»Na ja, das ist schon ein paar Jährchen her«, wiegelte Perry, der immer noch Zeit zu schinden versuchte, bescheiden ab.
»Dima hat vor kurzem Three Chimneys erworben, nicht wahr, Dima?«, warf Mark ein, als würde das Match mit ihm durch diese Mitteilung verlockender. »Das attraktivste Anwesen hier auf unsrer Seite, stimmt’s, Dima? Hat damit Großes vor, wie man hört. Sie beide bewohnen ja Captain Cook, wenn ich nicht irre, eins der besten Häuser in der ganzen Anlage, wenn Sie mich fragen.«
Er irrte nicht.
»Sehen Sie? Dann sind Sie Nachbarn, stimmt’s, Dima? Three Chimneys liegt ganz am Ende der Landzunge, gleich Ihnen gegenüber auf der anderen Seite der Bucht. Der letzte nennenswerte Grundbesitz auf der Insel, der noch unerschlossen ist. Aber nicht mehr lange, hab ich recht, Sir? Es ist von einem Beteiligungsmodell die Rede, mit Bevorzugung der Einheimischen, was mir ein hochanständiger Ansatz zu sein scheint. Und in der Zwischenzeit campen Sie ja mehr oder weniger, nicht wahr? – ganz wildromantisch, was man so hört. Haben noch ein paar gleichgesinnte Freunde und Verwandte zu Gast. So was bewundere ich. Wir alle bewundern das. Für einen Mann mit Ihren finanziellen Mitteln beweisen Sie da echten Abenteuergeist.«
»Ein Match, ja?«
»Doppel?«, fragte Perry und löste den Blick aus Dimas unverwandtem Starren, um zweifelnd zu Gail hinüberzuspähen.
Doch Mark witterte Morgenluft.
»Danke, Perry, aber kein Doppel für Dima, tut mir leid«, schob er forsch dazwischen. »Unser Freund spielt nur Einzel, hab ich recht, Sir? Sie sind ein Mann, der sich ungern auf andere verlässt. Sie machen Ihre Fehler lieber selber, haben Sie mir erzählt. Genau das waren Ihre Worte, noch gar nicht lange her ist das, und an mich waren sie nicht verschwendet, wie man merkt.«
Gail, die sah, wie hin- und hergerissen Perry war, kam ihm zu Hilfe: »Mach dir wegen mir keine Gedanken, Perry. Wenn du Einzel spielen willst, ist das völlig in Ordnung.«
»Glauben Sie mir, Perry, Sie werden es nicht bereuen, gegen diesen Gentleman angetreten zu sein«, insistierte Mark, nun endgültig auf der Zielgeraden. »Wenn ich auf einen von Ihnen beiden setzen müsste, ich wüsste nicht, auf wen, großes Indianerehrenwort.«
War das ein Hinken, mit dem Dima von ihnen wegging? Dieses leichte Nachziehen des linken Fußes? Oder kam es nur von der Anstrengung, den ganzen Tag diesen riesigen Oberkörper durch die Gegend wuchten zu müssen?
* * *
Waren Perry da schon die beiden weißen Männer aufgefallen, die am Tor zum Tennisplatz herumlungerten? Der eine mit den Händen auf dem Rücken, der andere die Arme vor der Brust gekreuzt. Beide in Turnschuhen. Blond der eine, ein Milchgesicht, der andere dunkel und träge.
Wenn, dann höchstens unbewusst, erklärte er störrisch gegenüber dem Mann, der sich Luke nannte, und der Frau, die sich Yvonne nannte, als sie zehn Tage später alle vier um den ovalen Esstisch im Souterrain eines hübschen Reihenhäuschens in Bloomsbury saßen.
Ein schwerleibiger Herr mit Baskenmütze und einem Ohrring, der sich freundlich als Ollie vorstellte, hatte sie mit einem schwarzen Taxi in der Wohnung in Primrose Hill abgeholt. Luke hatte ihnen die Tür aufgemacht; hinter Luke wartete schon Yvonne. In einem dick mit Teppichboden ausgelegten Flur, in dem es nach frischer Farbe roch, wurden Perry und Gail mit Handschlag begrüßt, erhielten von Luke einen formvollendeten Dank für ihr Kommen, und dann ging es hinunter in diesen ausgebauten Keller mit seinem Tisch, sechs Stühlen und einer Kochnische. Hinter den Milchglasfenstern, die wie Halbmonde geformt waren und hoch oben in der Wand saßen, flackerten schattenhaft die Füße der Passanten vorbei, die draußen den Gehsteig entlanggingen.
Als Nächstes mussten sie ihre Mobiltelefone abgeben und bekamen eine Erklärung im Rahmen des Geheimhaltungsgesetzes zur Unterschrift vorgelegt. Gail, die Juristin, las den Text durch und war empört. »Nur über meine Leiche«, rief sie, während Perry mit einem gemurmelten »Was soll’s« schon ungeduldig unterschrieb. Nachdem sie ein paar Wörter ausgestrichen und andere handschriftlich eingefügt hatte, unterzeichnete Gail unter Protest. Die einzige Lichtquelle hier unten war eine trübe Lampe, die über dem Tisch hing. Die Ziegelmauern dünsteten einen schwachen Geruch nach altem Portwein aus.
Luke war zuvorkommend, glattrasiert, Mitte vierzig und für Gails Gefühl zu klein – Geheimagenten, so befand sie mit einer krampfigen Fröhlichkeit, die der Nervosität entsprang, hatten ein paar Nummern größer zu sein. Die tadellose Haltung, der smarte graue Anzug, die kleinen grauen Hörnchen, zu denen sein Haar sich über den Ohren hochzwirbelte, das alles passte entschieden besser zu einem distinguierten Jockey als zu einem Spion.
Yvonne dagegen konnte nicht viel älter als Gail sein. Ein Blaustrumpf, das war Gails erster Eindruck von ihr, aber dabei auf streberhafte Art hübsch. Mit ihrem biederen Kostüm, kurzgeschnittenen dunklen Haar und ungeschminkten Gesicht schien sie älter als nötig und für eine Spionin – auch dies wieder Gails bewusst leichtfertige Perspektive – nicht Femme fatale genug.
»Sie haben sie da also noch gar nicht als Leibwächter erkannt.« Lukes adretter kleiner Kopf sah emsig zwischen ihnen beiden hin und her. »Sie haben nicht hinterher im stillen Kämmerlein zueinander gesagt: ›Hoppla, dieser Dima, wer immer er sein mag, scheint ja bestens bewacht zu sein‹ – irgendetwas dergleichen?«
Reden Perry und ich so miteinander?, dachte Gail. Ist mir neu.
»Gesehen habe ich sie, sicher«, gab Perry zu. »Aber wenn Ihre Frage ist, ob ich über sie nachgedacht habe, kann ich nur sagen, nein. Da hoffen zwei auf ein Spiel, dachte ich wahrscheinlich, wenn ich überhaupt etwas gedacht habe« – und indem er mit den langen Fingern grüblerisch an seiner Stirn herumknetete: »Ich meine, man assoziiert ja nicht sofort Leibwächter, oder? Gut, Sie vielleicht schon. Das ist die Welt, in der Sie leben, nehme ich an. Aber als normaler Bürger kommt man nicht auf die Idee.«
»Und Sie, Gail?«, hakte Luke flugs ein. »Sie sind den ganzen Tag bei Gericht. Sie erleben die böse Welt in all ihrer blut’gen Pracht. Kamen sie Ihnen verdächtig vor?«
»Wenn überhaupt, dann dachte ich sicher, es sind zwei Typen, die mich anglotzen, also habe ich sie ignoriert«, sagte Gail.
Doch Yvonne, Streberin, die sie war, ließ sich damit nicht abspeisen. »Aber am Abend, Gail, beim Zurückschauen auf den Tag« – war das ein schottischer Zungenschlag, den man da heraushörte? Gut möglich, dachte Gail, die sich einiges auf ihr Ohr für Akzente zugutehielt –, »erschien es Ihnen da immer noch nicht seltsam: zwei überzählige Männer, die einfach nutzlos herumstanden?«
»Es war unser erster richtiger Abend im Hotel«, sagte Gail in einem Aufwallen entnervter Gereiztheit. »Perry hatte uns ein Candle-Light-Dinner auf dem Captain’s Deck gebucht, verstehen Sie? Wir hatten Sterne und Vollmond, kopulierende Ochsenfrösche brüllten sich die Seele aus dem Leib, die Mondbahn reichte uns praktisch bis auf den Teller – glauben Sie im Ernst, da blicken wir uns tief in die Augen und reden über Dimas Aufpasser? Ich meine, sonst noch Wünsche!« – und aus Angst, rüder geklungen zu haben als beabsichtigt: »Gut, sicher, ein bisschen haben wir natürlich über Dima geredet. Er ist ja nicht gerade eine Durchschnittserscheinung. Und unser erster russischer Oligarch, ich bitte Sie! Außerdem streute sich Perry zwischendurch immer wieder Asche aufs Haupt, weil er sich auf ein Einzel mit ihm eingelassen hatte, und wollte unbedingt den Pro anrufen und das Match abblasen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit Männern wie Dima getanzt habe und sie eine unvergleichliche Technik haben. Da fiel dir nichts mehr ein, was, Perry-Schatz?«
Die Kluft, die sie trennte, schien so breit wie der Atlantik, den sie vor kurzem überquert hatten. Dennoch war es ihnen auch eine Erleichterung, allen beiden, ihre Geschichte an jemanden loszuwerden, für den das Weiterfragen zum Beruf gehörte.
* * *
Um Viertel vor sieben am nächsten Morgen erwartete Mark sie oben an der Steintreppe, in sein schönstes Weiß gekleidet, in den Händen zwei Dosen kühlschrankkalter Tennisbälle und einen Pappbecher Kaffee.
»Mann, hatte ich einen Bammel, ihr zwei Hübschen könntet verschlafen«, begrüßte er sie aufgekratzt. »Aber wir sind gut in der Zeit, alles astrein. Gail, wie fühlen Sie sich heute? Prächtig, nach allem, was man sieht. Nach Ihnen, Perry, Sir. Ich danke. Was für ein Tag, hm? Was für ein Tag.«
Perry ging ihnen voran die zweite Treppe hinauf, an deren Ende der Weg eine Linkskurve machte. Als er ihr folgte, standen vor ihm zwei Männer in Bomberjacken – dieselben beiden untätigen Männer vom Vorabend. Sie hatten sich links und rechts von dem blütenbedeckten Laubengang postiert, der wie ein Hochzeitsspalier auf den Eingang zum Centre-Court zuführte, hinter dem eine Welt für sich wartete, auf allen vier Seiten abgeschirmt durch Segeltuchwände und sechs Meter hohe Hibiskushecken.
Beim Anblick der drei trat der milchgesichtige Blonde einen halben Schritt vor und streckte mit mechanischem Lächeln die Hände aus, die klassische Gebärde des Filzens. Perry, baumlang und verwirrt, blieb stehen, noch gute zwei Meter außer Reichweite. Gail neben ihm stockte ebenfalls. Der Mann machte noch einen Schritt vorwärts, Perry einen zurück, wobei er Gail mit sich zog und laut rief: »Was soll das, verdammt?« – an Marks Adresse letztlich, denn weder das Milchgesicht noch sein dunklerer Kollege ließen in irgendeiner Weise erkennen, dass sie die Frage gehört, geschweige denn verstanden hatten.
»Reine Routinesache, Perry«, erklärte Mark, der sich an Gail vorbeidrängte, um Perry beruhigend ins Ohr raunen zu können. »Einfach zur Sicherheit.«
Perry blieb, wo er war, und reckte den Hals vorwärts und seitwärts, während er diese Auskunft verdaute.
»Wessen Sicherheit? Versteh ich nicht. Du vielleicht?« – zu Gail jetzt.
»Nein«, sagte sie.
»Dimas Sicherheit, Perry. Was dachten Sie denn? Er spielt ganz oben mit. Internationales Big Business. Diese Jungs hier führen lediglich Befehle aus.«
»Ihre Befehle, Mark?« Perry drehte sich um und starrte anklagend durch seine Brillengläser auf ihn hinab.
»Dimas Befehle, nicht meine, Perry, seien Sie nicht kindisch. Das sind Dimas Jungs. Begleiten ihn überallhin.«
Perry richtete den Blick wieder auf den blonden Leibwächter. »Sprechen die Herren zufällig Englisch?«, fragte er. Und als sich die Züge des Blonden als einzige Reaktion leicht verhärteten: »Offenbar nein. Sprechen nicht nur keins, sondern hören auch keins.«
»Himmelherrgott, Perry«, flehte Mark, und sein biergerötetes Gesicht wurde noch röter. »Ein kleiner Blick in Ihre Tasche, und das war’s schon. Hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Reine Routine, wie gesagt. Genau wie an jedem Flughafen auch.«
Perry wandte sich wieder an Gail. »Hast du dazu eine Meinung?«
»Allerdings.«
Perry neigte den Kopf nach der anderen Richtung. »Nicht dass ich hier irgendetwas missverstehe, Mark«, erklärte er in strengem Oberlehrerton. »Mein avisierter Tennispartner Dima wünscht sicherzustellen, dass ich keine Bombe auf ihn werfe? Ist es das, was diese Männer mir sagen wollen?«
»Es ist eine sehr gefährliche Welt da draußen, Perry. Vielleicht haben Sie davon noch nichts gehört, aber wir anderen schon, und wir versuchen, damit zu leben. Bei allem Respekt würde ich Ihnen doch sehr dazu raten, mit dem Strom zu schwimmen.«
»Es sei denn, ich mähe ihn einfach mit meiner Kalaschnikow nieder«, sagte Perry und hob seine Sporttasche ein paar Zentimeter an. Daraufhin trat auch der zweite Mann aus dem Schatten der Büsche und stellte sich neben dem ersten auf. Aber ihren Mienen war nach wie vor nichts zu entnehmen.
»Also wirklich, Sie machen aus einer Mücke einen Elefanten, Mr Makepiece«, protestierte Mark, dessen mühsam antrainierte Manieren unter der Anspannung zu bröckeln begannen. »Da drin wartet tolles Tennis auf Sie. Diese Jungs tun nichts als ihre Pflicht, und sie tun sie sehr höflich und professionell, wenn ich das mal so sagen darf. Ganz ehrlich, ich verstehe Ihr Problem nicht, Sir.«
»Ah. Mein Problem.« Perry wiederholte das Wort sinnend, als sähe er darin einen geeigneten Einstieg in eine Gruppendiskussion mit seinen Studenten. »Dann gestatten Sie mir, Ihnen mein Problem darzulegen. Wenn ich darüber nachdenke, sehe ich sogar mehrere Probleme. Problem Nummer eins: Niemand schaut in meine Sporttasche, wenn ich es nicht erlaube, und in diesem Fall erlaube ich es nicht. Dasselbe gilt für die Tasche dieser Dame« – mit einer Kopfbewegung in Gails Richtung.
»Und zwar strikt«, sekundierte Gail.
»Problem Nummer zwei: Wenn Ihr Freund Dima denkt, ich möchte ihn umbringen, warum will er dann mit mir Tennis spielen?« Und nachdem er reichlich Zeit für eine Antwort eingeräumt und keine erhalten hatte außer einem geräuschvollen Lippenschmatzen, fuhr er fort. »Und mein drittes Problem ist, dass das Ansinnen in seiner jetzigen Form einseitig ist. Habe ich gebeten, in Dimas Tasche schauen zu dürfen? Nein, habe ich nicht, und ich verspüre auch keinerlei Verlangen danach. Vielleicht können Sie ihm das erklären, wenn Sie mich bei ihm entschuldigen. Was meinst du, Gail, wollen wir dieses dicke fette Frühstücksbüfett plündern gehen, für das wir bezahlen?«
»Gute Idee«, sagte Gail mit Nachdruck. »Mir war gar nicht klar, dass ich so einen Bärenhunger habe.«
Und sie drehten sich um und stiegen, ohne sich um die Beschwörungen des Pros zu kümmern, schon die ersten Stufen hinab, als das Tor zum Centre-Court aufflog und Dimas Bass sie innehalten ließ.
»Nicht weglaufen, Mr Perry Makepiece. Wenn Sie mich wegballern, dann mit gottverdammten Schläger, okay?«
* * *
»Und auf wie alt würden Sie ihn schätzen, Gail?«, fragte Miss Blaustrumpf und machte sich eine säuberliche Notiz in ihrem Block.
»Den Milchbubi? Fünfundzwanzig, wenn’s hoch kommt«, antwortete Gail und wünschte sich zum wiederholten Mal, einen Mittelkurs zwischen Flapsigkeit und Verschrecktheit fahren zu können.
»Perry? Wie alt?«
»Dreißig.«
»Größe?«
»Unterm Durchschnitt.«
Für jemanden, der fast eins neunzig ist, Perry-Schatz, sind wir alle unterm Durchschnitt, dachte Gail.
»Eins fünfundsiebzig«, sagte sie.
Das blonde Haar ganz kurz geschoren, darin waren sie sich einig.
»Und ein goldenes Kettenarmband hatte er an«, erinnerte sie sich zu ihrer eigenen Verblüffung. »Ich hatte einmal einen Mandanten, der hatte genauso eins. Wenn’s mal hart auf hart ging, wollte er es auseinandernehmen und die Glieder einzeln verkaufen.«
* * *
Yvonnes unlackierte, vernünftig geschnittene Fingernägel schieben ihnen einen Stoß Pressephotos über den ovalen Tisch. Im Vordergrund ein halbes Dutzend strammer junger Männer in Armani-Anzügen, die ein siegreiches Rennpferd beglückwünschen, ihre Champagnergläser hoch erhoben für die Kamera. Im Hintergrund Werbebanner auf Kyrillisch und Englisch. Und ganz links außen, die Arme vor der Brust verschränkt, der milchgesichtige Leibwächter mit seiner blonden Stoppelfrisur. Anders als seine drei Gefährten trägt er keine Sonnenbrille. Dafür liegt um sein linkes Handgelenk ein goldenes Kettenarmband.
Perry schaut eine Spur selbstgefällig. Gail ist es eine Spur schlecht.
2
Gail verstand selbst nicht ganz, warum fast immer nur sie redete. Im Sprechen hörte sie ihre eigene Stimme von den Ziegelwänden des Kellerzimmers widerhallen, genau wie beim Scheidungsgericht, wo sie derzeit den Großteil ihres beruflichen Daseins verbrachte: Jetzt mime ich rechtschaffene Empörung, jetzt ätzende Ungläubigkeit, jetzt klinge ich wie meine bescheuerte Mutter, wenn sie ihren zweiten Gin Tonic intus hatte.
Aber sosehr sie es zu verbergen suchte, ertappte sie sich heute obendrein bei einem gelegentlichen kleinen Schauer der Furcht, der nicht zum Skript gehörte. Ihren Zuhörern auf der anderen Seite des Tisches mochte es entgehen, aber ihr nicht. Und Perry neben ihr merkte es offenbar auch, denn ab und zu neigte er den Kopf leicht in ihre Richtung, um zärtlich und besorgt zu ihr herunterzuspähen, trotz der Dreitausend-Meilen-Kluft zwischen ihnen. Ja, vereinzelt drückte er sogar unterm Tisch ihre Hand, bevor er sie beim Erzählen ablöste, in dem verfehlten, aber entschuldbaren Glauben, ihren Gefühlen dadurch eine Ruhepause zu verschaffen, wo doch ihre Gefühle als Einziges abtauchten, sich neu formierten und an die Oberfläche zurückkamen, um sich bei erster Gelegenheit noch verbissener in den Kampf zu stürzen.
* * *
Perry und Gail schlenderten nicht direkt, als sie den Centre-Court betraten, aber – doch, ja, sagten beide, sie ließen sich Zeit. Als Erstes der Weg durch das Blütenspalier, bei dem die Leibwächter die Ehrengarde abgaben und Gail die Krempe ihres breiten Sonnenhutes festhielt und ihr dünnes Röckchen flattern ließ:
»Ein bisschen die Hüften geschwenkt hab ich schon«, gab sie zu.
»Und wie«, bestätigte Perry, und auf der anderen Tischseite wurde verhalten gelächelt.
Dann das Hin und Her am Eingang zum Platz, als Perry von erneuten Zweifeln befallen schien, bis klarwurde, dass er nur Gail den Vortritt lassen wollte. Die darauf auch vorging, mit so viel damenhafter Gemessenheit, dass man meinen konnte, es hätte den versuchten Affront nie gegeben, während gleichzeitig durchschimmerte, dass er keineswegs vergessen war. Und hinter Perry kam Mark.
Dima erwartete sie in der Platzmitte, die Arme zur Begrüßung weit ausgestreckt. Er trug einen langärmligen blauen Nicki mit rundem Ausschnitt und schwarze Shorts, die ihm bis übers Knie reichten. Ein grünes Sonnenvisier ragte wie ein Schnabel von seinem kahlen Kopf weg, der schon jetzt so stark in der Morgensonne glänzte, dass Perry sich gefragt hatte, ob er eingeölt war. Die brillantenstarrende Rolex hatte Gesellschaft bekommen; um den mächtigen Hals lag jetzt eine geheimnisträchtige Goldkette mit vielen Anhängern: noch mehr Glitzern, noch mehr Ablenkung.
Dabei war Dima, sehr zu Gails Überraschung, gar nicht der Hauptblickfang, sagte sie. Auf der Zuschauertribüne hinter ihm aufgereiht saß eine kleine und, so Gail, absolut schräge Versammlung von Kindern und Erwachsenen.
»Wie ein Haufen trister Wachsfiguren«, unterstrich sie. »Aber nicht nur, weil sie überhaupt da waren zu dieser unchristlichen Zeit, und dazu noch so aufgeputzt. Sondern weil sie so völlig stumm und griesgrämig dasaßen. Ich habe mich in die unterste Reihe gesetzt, die leer war, und gedacht, guter Gott, wo bin ich denn da reingeraten? In ein Volkstribunal? Einen Bittgang?«
Selbst die Kinder schienen nichts voneinander wissen zu wollen. Sie waren ihr sofort aufgefallen. Das ging ihr immer so. Vier Stück waren es.
»Zwei furchtbar tragisch dreinschauende kleine Mädchen von vielleicht fünf und sieben in dunklen Kleidchen und Sonnenhüten, die eng aneinandergeschmiegt neben einer üppigen Schwarzen saßen, einer Art Nanny offenbar«, sagte sie, entschlossen, ihre Gefühle nicht vorzeitig mit ihr durchgehen zu lassen. »Und zwei strohblonde halbwüchsige Jungen mit Sommersprossen und Tenniszeug. Und alle mit so langen Gesichtern, dass man denken konnte, sie wären als Strafe aus dem Bett geprügelt und hierhergeschleift worden.«
Während die Erwachsenen, fuhr sie fort, einfach so fremdartig waren, so überdimensional und so anders, als kämen sie aus einem Charles-Addams-Cartoon. Und das lag nicht nur an ihrer städtischen Kleidung und den Siebziger-Jahre-Frisuren. Oder daran, dass die Frauen trotz der Hitze für den tiefsten Winter gewandet waren. Es lag an ihrer kollektiven Düsterkeit.
»Warum sagt keiner was?«, flüsterte sie Mark zu, der sich ungebeten auf dem Sitz neben ihrem eingefunden hatte.
Mark zuckte die Achseln. »Russen.«
»Aber Russen sind doch Weltmeister im Reden!«
Nicht diese Russen, sagte Mark. Die meisten von ihnen seien erst ein paar Tage hier und müssten sich noch akklimatisieren.
»Irgendwas scheint bei denen vorgefallen zu sein« – er reckte das Kinn Richtung Bucht. »Nach dem Krach zu urteilen, haben die da drüben Familienrat im großen Stil, und nicht grade harmonisch. Fragen Sie mich nicht, wie die das hygienetechnisch hinkriegen. Das halbe Leitungssystem ist hinüber.«
Gail deutete auf zwei dicke Männer, einer mit einem braunen Filzhut auf dem Kopf und Handy am Ohr, der andere in einer Schottenmütze mit rotem Bommel.
»Vettern von Dima«, sagte Mark. »Die sind alle irgendwie verwandt und verschwägert. Kommen aus Perm. Perm, wie Permafrost, verstehen Sie?«
Eine Reihe höher dann die strohblonden Teenager, die mit angewiderten Mienen Kaugummi kauten. Dimas Söhne, erklärte Mark, Zwillinge. Und ja, nun da Gail noch einmal hinsah, entdeckte sie die Ähnlichkeit: kräftiger Brustkorb, gerader Rücken, hängelidrige braune Schlafzimmeraugen, die bereits heimlich in Gails Richtung wanderten.
Rasches, lautloses Durchatmen. Was jetzt kam, hieß bei ihnen in der Kanzlei die Abschussfrage, die Frage, die den Zeugen ein für alle Mal zerlegte. Zerlegte sie sich jetzt also selbst? Aber als sie weitersprach, stellte sie befreit fest, dass in der Stimme, die von der Ziegelwand zu ihr zurückhallte, kein Beben zu hören war, kein Stocken oder sonst eine verräterische Schwankung.
»Und in züchtigem Abstand zu allen anderen – demonstrativ, hatte ich fast den Eindruck – saß diese bildhübsche Fünfzehn- oder Sechzehnjährige mit schulterlangen kohlschwarzen Haaren, Schulbluse und einem marineblauen Schulrock, der ihr bis übers Knie ging, und sie schien zu gar niemandem zu gehören. Also habe ich Mark gefragt, wer sie ist. Natürlich.«
Sehr natürlich, allerdings, befand sie erleichtert, nachdem sie sich zu Ende angehört hatte. Nicht eine erhobene Augenbraue am Tisch. Gut gemacht, Gail.
»Sie heißt Natascha, eröffnete mir Mark. Ein Blümchen, das gepflückt sein will – nichts für ungut, höhö. Dimas Tochter, aber nicht Tamaras. Der Augapfel ihres Vaters.«
Und was, so fragte Gail ihre Zuhörer, macht die schöne Natascha, Tochter von Dima, aber nicht von Tamara, um sieben Uhr morgens, statt ihren Vater beim Tennis zu bewundern? Liest völlig vertieft in einem ledergebundenen Wälzer, den sie wie einen Keuschheitsgürtel über ihren Schoß gebreitet hält!
»Aber wirklich umwerfend hübsch«, betonte Gail. Und um ganz sicherzugehen: »Nicht nur gutaussehend, richtig schön.« Und dann dachte sie: Ach du Schreck, jetzt klinge ich schon wie eine Lesbe, dabei will ich doch nur unbekümmert klingen.
Doch auch diesmal schienen weder Perry noch ihre Inquisitoren einen falschen Ton zu bemerken.
»Und wo finde ich Tamara, die nicht Nataschas Mutter ist?«, fragte sie Mark streng und nutzte die Gelegenheit, um ein Stück von ihm wegzurücken.
»Zwei Reihen hinter Ihnen, links. Sehr fromme Dame. Heißt bei den Einheimischen nur die Nonne.«
Ein beiläufiger Blick über die Schulter zeigte ihr eine gespenstische Gestalt, die von Kopf bis Fuß in Schwarz gehüllt war. Auch das Haar war schwarz, wenngleich mit weißen Fäden durchzogen, und in einen Knoten gerafft. Ihr Mund, ein schmaler Abwärtsbogen, schien noch nie gelächelt zu haben. Sie hatte einen violetten Chiffonschal um.
»Und auf der Brust so ein orthodoxes Goldkreuz mit doppeltem Querbalken, Bischof war das mindeste«, rief Gail. »Daher wohl auch die Nonne.« Und, nachgeschoben: »Aber eine Ausstrahlung hatte die Frau, unglaublich! Eine enorme Bühnenpräsenz« – ihre Schauspielereltern ließen grüßen –, »die Willenskraft war förmlich mit Händen greifbar. Sogar Perry hat sie gespürt.«
»Nicht jetzt«, warnte Perry, ohne Gail anzusehen. »Wir sollen keine späteren Erkenntnisse ins Spiel bringen.«
Andere habe ich ja leider nicht, dank dir, hätte sie ihm am liebsten hingerieben, aber in ihrer Erleichterung, die Hürde Natascha so glatt genommen zu haben, verzichtete sie darauf.
Irgendetwas an dem geschniegelten kleinen Luke irritierte sie: die Art, wie ihre Augen unversehens immer wieder den seinen begegneten und umgekehrt. Anfänglich hatte sie sich gefragt, ob er vielleicht schwul war – bis sie ihn auf ihre Bluse schielen sah, bei der ein Knopf aufgegangen war. Er hatte diesen Heldenmut des Verlierers, das war es. Diese Entschlossenheit, bis zum letzten Mann zu kämpfen, und der letzte Mann war er. In den Jahren, die sie auf Perry gewartet hatte, war Gail mit so einigen Männern ins Bett gegangen, und einen oder zwei davon hatte sie aus reiner Gutmütigkeit erhört, einfach um ihnen zu zeigen, dass sie besser waren, als sie glaubten. Daran musste sie denken, als sie nun Luke gegenübersaß.
* * *
Perry dagegen hatte, wie er seinen großen, flach vor ihm auf dem Tisch ausgespreizten Händen angelegentlich mitteilte, die Zuschauer vor dem Spiel mit Dima kaum beachtet. Er wusste, da saßen Leute, er hatte mit dem Schläger in ihre Richtung gewinkt und keine Reaktion erhalten. Aber in erster Linie war er damit beschäftigt, seine Kontaktlinsen einzusetzen, die Schnürsenkel nachzuziehen, Sonnencreme aufzutragen, sich zu sorgen, ob Mark Gail auf die Pelle rückte, und ansonsten zu überlegen, wie schnell er wohl gewinnen und hier abhauen konnte. Er wurde außerdem von seinem Gegner verhört, der keinen Meter von ihm entfernt stand.
»Stört Sie?«, fragte Dima in feierlich gedämpftem Ton. »Mein Fanclub? Ist besser, ich soll sie heimschicken?«
»Natürlich nicht«, antwortete Perry, der noch nicht recht über die Geschichte mit den Leibwächtern hinweg war. »Da ich annehme, dass es Ihre Freunde sind.«
»Sie sind britisch, ja?«
»Korrekt.«
»Englisch-britisch? Von Wales? Schottland?«
»Einfach nur englisch.«
Perry suchte sich eine Bank, knallte seine Sporttasche darauf und öffnete den Reißverschluss. Er kramte zwei Schweißbänder heraus, eins für die Stirn, eins fürs Handgelenk.
»Sind Sie Priester, vielleicht?«, forschte Dima in unverändert feierlichem Ton nach.
»Wieso? Brauchen Sie einen?«
»Doktor? Von Medizin?«
»Nein, auch kein Doktor, tut mir leid.«
»Anwalt?«
»Ich spiele einfach nur Tennis.«
»Banker?«
»Da sei Gott vor«, sagte Perry gereizt und fingerte an einem ramponierten Sonnenhut herum, nur um ihn dann zurück in die Tasche zu stopfen.
Doch in Wahrheit war er mehr als gereizt. Er fühlte sich für dumm verkauft, und er ließ sich nicht gern für dumm verkaufen. Für dumm verkauft von dem Pro und für dumm verkauft von den Leibwächtern, auch wenn er dem einen Riegel vorgeschoben hatte. Trotzdem, dass sie mit auf dem Platz waren – wie Linienrichter je an einem Ende aufgebaut –, genügte vollauf, um seinen Zorn am Schwelen zu halten. Vor allem aber fühlte er sich von Dima selbst für dumm verkauft, und dass Dima einen Haufen Herumtreiber dazu vergattert hatte, um sieben Uhr früh aufzumarschieren, um ihn gewinnen zu sehen, machte die Sache nicht besser.
Dima hatte die Hand in die Tasche seiner langen schwarzen Tennisshorts geschoben und einen silbernen John-F.-Kennedy-Halbdollar herausgezogen.
»Wissen Sie, was meine Jungs sagen? Irgendein Gauner hat mir den manipuliert, sagen sie«, vertraute er Perry an und nickte mit seinem kahlen Schädel hinüber zu den beiden sommersprossigen Teenagern auf der Tribüne. »Ich werf hoch, ich gewinn, gleich denken meine Kinder, das verdammte Ding ist manipuliert. Sie haben Kinder?«
»Nein.«
»Aber bald, ja?«
»Irgendwann.« Sprich: Kümmer dich um deinen eigenen Kram.
»Kopf oder Zahl?«
Manipuliert, wiederholte Perry stumm für sich. Woher kannte ein Mann, der ein verhunztes Englisch mit Pseudo-Bronx-Akzent sprach, ein Wort wie manipuliert? Er sagte Zahl, verlor und hörte ein Schnauben, das erste Anzeichen von Interesse, das irgendjemand auf der Tribüne zu bekunden geruhte. Sein Lehrerauge machte rasch Dimas beide Söhne aus, die hinter vorgehaltener Hand kicherten. Dima spähte zur Sonne hoch und wählte das schattige Ende.
»Was für ein Schläger haben Sie da?«, sagte er, und die Seehundaugen zwinkerten. »Sieht verboten aus. Egal, schlag ich Sie sowieso.« Und ehe er nach seiner Seite abzog: »Ist viel Kamele wert, so ein Mädchen. Besser, Sie machen schnell Hochzeit mit ihr.«
Und woher zum Teufel weiß der Kerl, dass wir nicht verheiratet sind?, fragte sich Perry grimmig.
* * *
Perry hat vier Asse in Folge erzielt, genau wie gegen das indische Paar, aber jetzt drischt er zu fest, weiß es, scheißegal. Und als Dima mit dem Aufschlag an der Reihe ist, macht er etwas, was er sich sonst nur herausnimmt, wenn er unmittelbar vor dem Sieg steht und einen klar unterlegenen Gegner hat: Er bleibt ganz vorn, praktisch an der Aufschlaglinie, und spielt den Ball mit einem Halbvolley zurück, diagonal über den Platz oder bis haarscharf an die Seitenlinie, wo sich der milchgesichtige Leibwächter mit verschränkten Armen aufgepflanzt hat. Aber nur für die ersten beiden Bälle, denn Dima kommt ihm schnell auf die Schliche und treibt ihn zurück an die Grundlinie, wo er hingehört.
»Ab da hab ich mich dann so langsam wieder eingekriegt«, sagte Perry mit einem reuigen Grinsen in Richtung seiner Befrager und rieb sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Perry war ein grauenhafter Snob«, stellte Gail richtig. »Und Dima war ein Naturtalent. Für sein Gewicht, seine Größe und sein Alter geradezu phänomenal. Nicht wahr, Perry? Und so viel Sportsgeist dabei. Großartig. Das hast du selber gesagt. Du hast gesagt, er hätte die Schwerkraft überwunden.«
»Er ist nicht nach dem Ball gesprungen, er ist levitiert«, räumte Perry ein. »Und ja, er hat sich sportlich verhalten, vollkommen einwandfrei. Ich hatte mich auf Wutanfälle gefasst gemacht, auf endlose Liniendispute, aber nichts dergleichen. Er war ein extrem angenehmer Gegner. Und gerissen wie eine Horde Affen. Hat seine Schläge bis zur allerletzten Sekunde zurückgehalten und noch länger.«
»Und er hat gehinkt«, ergänzte Gail lebhaft. »Er stand seitlich zum Netz, und das rechte Bein war ihm ganz klar das liebere, stimmt’s, Perry? Und er war so steif wie ein Ladestock. Und er hatte ein bandagiertes Knie. Und trotzdem schien er schwerelos.«
»Na ja, ein bisschen zurückhalten musste ich mich schon«, wandte Perry ein und knetete an seiner Stirn herum. »Sein Gekeuche wurde mit der Zeit ein bisschen schwer zu ertragen, um ehrlich zu sein.«
Aber bei allem Gekeuche ging das Verhör in den Spielpausen doch unverdrossen weiter:
»Sind großer Wissenschaftler, vielleicht? Jagen die gottverdammte Welt hoch, so wie hier mit dem Ball?«, fragte Dima, während er Eiswasser in sich hineinschüttete.
»Ganz bestimmt nicht.«
»Apparatschik?«
Das Ratespiel zog sich schon zu lange hin. »Nein, ich bin Dozent«, sagte Perry und begann sich eine Banane zu schälen.
»Dozent, das ist für Studenten, ja? Wie Professor?«
»Ja, ich unterrichte Studenten. Aber ich bin kein Professor.«
»Wo?«
»Zurzeit in Oxford.«
»Oxford wie Cambridge?«
»Richtig.«
»Und was?«
»Englische Literatur«, antwortete Perry, dem nicht eben danach war, einem Wildfremden zu erklären, dass seine Zukunft augenblicklich in den Sternen stand.
Aber Dima geriet ganz aus dem Häuschen vor Glück:
»Hören Sie! Sie kennen Jack London? Nummer-Eins-Schriftsteller von England?«
»Nicht persönlich.« Ein Scherz, auf den Dima nicht einstieg.
»Und? Mögen Sie?«
»Er ist großartig.«
»Charlotte Brontë? Sie mögen auch?«
»Sehr sogar.«
»Somerset Maugham?«
»Nicht sonderlich, muss ich zugeben.«
»Ich hab Bücher von alle diese Leute! Hunderte! Alles Russisch! Riesenschränke voll Bücher!«
»Sehr gut.«
»Sie lesen Dostojewski? Lermontow? Tolstoi?«
»Natürlich.«
»Hab ich alle. Alle die Nummer-Eins-Leute. Ich hab Pasternak. Wissen Sie was? Pasternak hat von meine Stadt daheim geschrieben. Jurjatino, so heißt sie bei ihm. Das ist Perm. Dieser Spinner sagt Jurjatino. Keine Ahnung, warum. Schriftsteller machen so was. Alles Spinner. Sie sehen meine Tochter da oben? Das ist Natascha, interessiert sich ein Dreck für Tennis, liebt nur immer Bücher. He, Natascha. Sag dem Professor hier guten Tag!«
Verzögert, damit auch ja klarwird, dass sie sich gestört fühlt, hebt Natascha den Kopf und streicht zerstreut das Haar zur Seite, gerade lange genug, um Perry mit ihrer Schönheit zu blenden, bevor sie sich wieder in ihren ledergebundenen Wälzer versenkt.
»Ist ihr peinlich«, erklärt Dima. »Mag nicht, wenn ich so laut zu ihr rufe. Sehen Sie das Buch, das sie hat? Turgenjew. Nummer-Eins-Schriftsteller von Russland. Hab ich ihr gekauft. Sie will ein Buch, ich kauf es. Okay, Professor. Ihr Aufschlag.«
»Von diesem Moment an war ich der Professor. Ich hab ihm immer wieder gesagt, dass ich keiner bin, aber er wollte nicht hören, also hab ich irgendwann aufgegeben. Nach ein paar Tagen hat das halbe Hotel mich Professor genannt. Was einem schon reichlich merkwürdig vorkommt, wenn man gerade beschlossen hat, dass man nicht mal mehr Dozent ist.«
Als sie die Seiten wechseln, tröstet es Perry zu sehen, dass Gail den zudringlichen Mark abgeschüttelt hat und jetzt auf der obersten Bank zwischen zwei kleinen Mädchen sitzt.
* * *
Das Spiel hatte zu einem ganz brauchbaren Rhythmus gefunden, sagte Perry. Nicht das größte Match aller Zeiten, aber – solange er halbwegs leisetrat – spannend und unterhaltsam anzusehen, immer vorausgesetzt, jemand wollte unterhalten werden, was fraglich schien, denn bis auf die Zwillinge hätte die Gesellschaft ebenso gut zu einer Séance versammelt sein können. Mit Leisetreten meinte er, das Tempo ein wenig drosseln und hier und da einen Ball annehmen, der auf dem Weg ins Aus war, oder ihn zurückschlagen, ohne allzu genau darauf zu schauen, wo er gelandet war. Denn das Gefälle zwischen ihnen – vom Alter, vom Können und von der Beweglichkeit her – trat doch immer deutlicher zutage, und Perry wollte einfach nur zum Ende kommen, Dima seine Würde lassen und sich mit Gail ein verspätetes Frühstück auf dem Captain’s Deck gönnen. So zumindest hatte er sich das gedacht, bis beim nächsten Seitenwechsel Dima ihn beim Arm packte und mit wütendem Knurren auf ihn losfuhr:
»Verdammt, was ist das hier? Schwuchteltennis?«
»Wie bitte?«
»Der lange Ball da war Aus. Sie sehen ihn draußen, Sie spielen ihn rein. Sie denken, ich bin so ein fetter alter Schlappschwanz, der gleich tot umfällt, wenn Sie nicht Samtpfoten nehmen.«
»Es war ein Grenzfall.«
»Ich spiel nicht klein-klein, Professor. Ich will was, ich hol’s mir verdammt noch mal. Ich brauch kein Schwuchteltennis. Sollen wir um ein Tausender spielen? Bisschen Zug reinbringen?«
»Nein danke.«
»Fünftausend?«
Perry lachte und schüttelte den Kopf.
»Sie sind Schisser, ja? Ein Schisser, deshalb Sie wetten nicht.«
»Das muss es sein«, stimmte Perry zu, dem der linke Oberarm noch von Dimas Griff schmerzte.
* * *
»Vorteil Großbritannien!«
Der Ruf schallt über den Platz und erstirbt. Die Zwillinge brechen in nervöses Kichern aus und warten auf das Donnerwetter. Bisher hat Dima ihre gelegentlichen Anfälle von Übermut geduldet. Jetzt nicht mehr. Er legt seinen Schläger auf der Bank ab, humpelt die Stufen der Tribüne hinauf, bis er vor den Jungen steht, und setzt ihnen beiden den Zeigefinger auf die Nasenspitze.
»Wollt ihr, ich nehm mein Gürtel und prügel euch grün und blau?«, fragt er auf Englisch – damit Perry und Gail auch etwas davon haben vermutlich, denn warum sonst redet er nicht russisch mit ihnen?
Worauf einer der Jungen in deutlich besserem Englisch antwortet: »Du hast doch gar keinen Gürtel an, Papa.«
Das war’s. Dima gibt dem näheren Sohn eine so schallende Ohrfeige, dass der Bub eine halbe Drehung auf der Bank macht, bis er sich mit den Beinen abfangen kann. Auf die erste Ohrfeige folgt eine nicht minder laute zweite, mit derselben Hand, aber für den anderen Sohn, so dass Gail sich an ihren gesellschaftlich aufstrebenden älteren Bruder erinnert fühlt, wenn der mit seinen reichen Freunden auf Fasanenjagd geht (ein Zeitvertreib, den Gail verabscheut) und, wie er es nennt, einen Doppeltreffer landet: ein toter Fasan pro Gewehrlauf.
»Und sie haben nicht mal den Kopf weggedreht, das war das Verrückte. Sie saßen einfach da und haben es eingesteckt«, sagte Perry, der Lehrerssohn.
Aber das Seltsamste, warf Gail ein, war doch, wie friedlich das Gespräch danach weiterging:
»Ihr wollt Tennisstunde bei Mark nachher? Oder lieber heim, dass eure Mutter euch Religion gibt?«
»Stunde, bitte, Papa«, sagt einer von den Jungen.
»Dann kein Rumschreien mehr, sonst gibt’s heut Abend kein Kobefleisch. Ihr wollt Kobefleisch heute Abend?«
»Klar, Papa.«
»Du, Viktor?«
»Klar, Papa.«
»Wenn ihr klatschen wollt, klatscht dem Professor hier, nicht eurem dämlichen alten Vater. Kommt her.«
Und jeder der beiden wird von ihm ungestüm ans Herz gedrückt, bevor das Match ohne weiteren Zwischenfall seinem unausweichlichen Ende zugeht.
* * *
Dima begrüßt seine Niederlage mit einem Überschwang, der schon fast peinlich ist. Er verliert nicht nur großmütig, sondern mit Tränen der Bewunderung und der Dankbarkeit. Erst muss er Perry für die dreifache russische Umarmung an seine breite Brust ziehen – eine hürnene Brust, schwört Perry. Die Tränen strömen ihm derweil über die Wangen und von da Perrys Hals hinab.
»Sie sind echter Engländer, Fairplay und alles, hören Sie, Professor? Sie sind gottverdammter englischer Gentleman wie in Büchern. Ich lieb Sie, hören Sie? Gail, Sie auch.« Bei Gail fällt die Umarmung noch einmal andächtiger aus – und vorsichtiger, wofür sie dankbar ist. »Sie haben Auge auf diesen Blödmann, hören Sie? Tennis kann er null, aber ich sag Ihnen, er ist ein gottverdammter Gentleman. Er ist Professor für Fairplay, hören Sie?« – eine Formel, die er wiederholt, als hätte er sie erfunden.
Worauf er sich mit Schwung wegdreht und barsch in ein Handy raunzt, das der milchgesichtige Leibwächter ihm hinhält.
* * *
Die Zuschauer ziehen langsam ab. Die kleinen Mädchen wollen von Gail gedrückt werden. Gail lässt sich nicht lange bitten. Einer von Dimas Söhnen näselt ein sehr amerikanisches»Cool game, man«, als er auf dem Weg zu seiner Stunde an Perry vorbeistiefelt, seine Backe noch rot von der Ohrfeige. Die schöne Natascha reiht sich in die Prozession ein, ihr dickes Buch in der Hand. Ihr Daumen klemmt an der Stelle, wo man sie aus ihrer Lektüre gerissen hat. Die Nachhut bildet Tamara an Dimas Arm, ihr Bischofskreuz glitzernd im Schein der gestiegenen Sonne. Jetzt, nach dem Match, ist Dimas Humpeln ausgeprägter. Er geht hintübergelehnt, das Kinn vorgeschoben, die Schultern trutzig gereckt vor dem Feind. Die Leibwächter eskortieren die Gruppe den gewundenen Treppenpfad hinunter. Drei Minivans mit getönten Scheiben warten hinter dem Hotel, um sie heimzubringen. Mark der Pro geht als Letzter.
»Klasse Match, Sir!« – er klopft Perry auf die Schulter. »Exzellente Court-Performance. Nur eine Spur holprig bei der Rückhand, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Vielleicht sollten wir daran noch ein bisschen feilen?«
Seite an Seite beobachten Gail und Perry schweigend, wie der Konvoi die zerfurchte Uferstraße entlangrumpelt und zwischen den Mahagonibäumen verschwindet, die das Haus mit dem Namen Three Chimneys vor zudringlichen Blicken abschirmen.
* * *
Luke schaut von seinen Notizen auf. Wie auf ein Stichwort hebt auch Yvonne den Kopf. Beide lächeln. Gail versucht Lukes Blick auszuweichen, aber Luke sieht ihr mitten ins Gesicht, sie hat keine Chance.
»Also, Gail«, sagt er zackig. »Jetzt wieder zu Ihnen, wenn’s recht ist. Mark war eine Nervensäge. Trotzdem scheint er informationstechnisch ja eine Goldgrube gewesen zu sein. Was konnten Sie von ihm denn noch über Familie Dima erfahren?« – seine zarten Hände machen eine ruckende Bewegung, als wollte er sein Pferd antreiben.
Gail späht zu Perry hinüber, wozu, weiß sie selbst nicht recht. Perry erwidert den Blick nicht.
»Er war einfach dermaßen schleimig«, beschwert sie sich, indem sie ihren Unmut über Luke auf Mark abwälzt, und rümpft die Nase zum Zeichen, dass der üble Nachgeschmack noch anhält.
* * *
Mark saß noch kaum neben ihr auf der Bank, begann Gail, da schwadronierte er auch schon los. Was für ein hochwichtiger Millionär sein russischer Freund Dima doch sei. Und dass Three Chimneys nur einer seiner vielen Landsitze sei. Auf Madeira habe er auch einen, und noch einen in Sotschi am Schwarzen Meer.