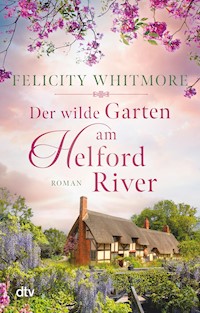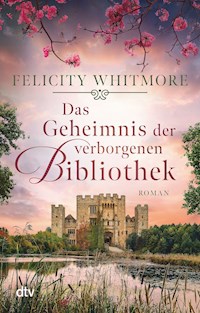9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hampton-Hall-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt zur großen Trilogie über die starken Frauen von Hampton Hall - Mit Herzblut erzählt – voller Geheimnisse und dem Zauber alter britischer AdelshäuserFür Leserinnen von Lucinda Riley, Kate Morton und Katherine Webb Wer war Lady Abigail Hampton, und was ist vor 180 Jahren wirklich geschehen? Ist sie in den Tod gesprungen, nachdem ihr Geliebter Oliver Rashleigh wegen des Mordes an ihrem Schwager George gehängt wurde? Als die Staatsanwältin Melody Stewart auf einem alten Familiensitz Quartier bezieht, findet sie in dem verlassenen Gemäuer die Tagebücher ihrer Vorfahrin. Fasziniert folgt sie dem Faden der Vergangenheit in das Jahr 1841 und stößt dabei auf eine kluge und tatkräftige Frau, die mutig gegen ihr Schicksal aufbegehrte. Alle Bände der Serie: Band 1: Der Faden der Vergangenheit Band 2: Die Straße der Hoffnung Band 3: Die Heimat des Herzens Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
»Als Oliver Abigail zum ersten Mal sah, verliebte er sich so unsterblich in sie, dass er einen Mord für sie beging.«
Melody Stewart, als Staatsanwältin nach Stockmill versetzt, bezieht Quartier auf einem alten Familiensitz, der Fabrikantenvilla Abigail's Place. Nie zuvor hat sich Melody mit ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt – nun lädt das verwinkelte und seit fast 180 Jahren unbewohnte Haus dazu ein, auf Entdeckungstour zu gehen. Schlimme Dinge seien in diesen Mauern geschehen, heißt es, die ihre Vorfahrin Abigail Hampton, Lady of Mahony in den Selbstmord getrieben hätten. Fasziniert folgen Melody und Polizeiinspektor Dan Rashleigh, der in Besitz eines Porträts von Lady Abigail ist, dem Faden der Vergangenheit und stoßen dabei auf eine kluge, mutige Frau und ein lange gehütetes Familiengeheimnis.
Von Felicity Whitmore sind bei dtv außerdem erschienen: Das Herrenhaus im Moor Der Klang der verborgenen Räume Die Straße der Hoffnung. Die Frauen von Hampton Hall, Band 2 Die Heimat des Herzens. Die Frauen von Hampton Hall, Band 3 Das Geheimnis der verborgenen Bibliothek Der wilde Garten am Helford River
FELICITY WHITMORE
Der Faden der Vergangenheit
DIE FRAUEN VON
Hampton Hall
ROMAN
Für Elke und Willi, Nadine und Carsten Kunz und Birgit Ebbert
Prolog
Herbst 2017
Dan trat in das Büro der neuen Oberstaatsanwältin und hielt einen Augenblick lang überrascht die Luft an. Es war nicht ihr außerordentlich hübsches Gesicht, das ihn aus der Fassung brachte, und auch nicht die strahlenden grünen Augen und das samtene, haselnussbraune Haar, das ihre hellen Wangen umspielte. Es waren vielmehr die Sanftheit und das Verständnis, die in ihren Zügen lagen und ihn auf sonderbare Weise berührten. Instinktiv hatte er das Bedürfnis, dieses Wesen zu beschützen und sich gleichzeitig von ihm beschützen zu lassen. Noch nie zuvor hatte er etwas Derartiges erlebt. Er war kein gefühlsbetonter Mensch und immer stolz auf seine Sachlichkeit gewesen, auf die Fähigkeit, Emotionen ausblenden zu können. Das machte ihn zu einem guten Polizisten. Daher traf ihn dieser Moment auch vollkommen unvorbereitet. Wie in Zeitlupe nahm er wahr, dass sie zu ihm aufblickte. Ein zartes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Sie kam um ihren Schreibtisch herum und streckte ihm die Hand entgegen. Er sah ihre geschmeidigen Bewegungen, wie die einer Tänzerin, und es gelang ihm nicht, sich diese Frau in einem Gerichtssaal vorzustellen. Er verfolgte sie mit den Augen und nahm den dezenten blumigen Duft ihres Parfüms wahr.
»Melody Stewart«, stellte sie sich vor. »Sie sind sicher Detective Inspector Daniel Rashleigh?«
Er nickte linkisch wie ein Teenager und wusste nicht, was er sagen sollte.
»Wir arbeiten also im Burford-Fall zusammen«, stellte sie fest und deutete zu dem kleinen Tisch neben der Tür, an dem zwei Stühle standen.
Dan nickte wieder und stolperte über die Kante des Teppichs, als er zum Tisch hinübergehen wollte. Was war mit ihm los? Er war vierundvierzig Jahre alt, geschieden und sah nicht zum ersten Mal eine attraktive Frau. Warum brachte Melody Stewart ihn dermaßen aus der Fassung?
Er atmete tief durch und legte seine Mappe auf den Tisch. »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit«, sagte er schließlich. »Hier habe ich eine Aufstellung der Zeugenaussagen, die Mr Jenkins angefordert hat. Ich weiß nicht, was Sie sonst noch brauchen …«
»Das ist erst einmal ausreichend, vielen Dank.« Sie lächelte und griff nach dem Computerausdruck, den er in die Mitte des Tisches gelegt hatte. Sein Blick blieb an den langen, schlanken Fingern hängen, an dem Ehering an ihrer linken Hand. Sie fuhr fort: »Ich habe mich in den Fall eingelesen und den Eindruck gewonnen, dass Mr Jenkins allen Hinweisen nachgegangen ist. Es sind nur noch wenige offene Punkte zu klären.«
Dan nickte und sein Blick begegnete ihrem. Einen Moment lang gab es nur diese Augen. Er riss sich von dem Grün los und versuchte, sich auf ihre Fragen zu konzentrieren. Er konnte sich hinterher nur schwach an seine Antworten erinnern, aber sie schien damit zufrieden zu sein.
»Hier ist meine Telefonnummer«, sagte sie, stand auf und holte eine Visitenkarte vom Schreibtisch. Sie warf einen prüfenden Blick darauf. »Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, melden Sie sich bitte.«
Dan nahm ihr die Karte ab, einen Moment lang berührten sich ihre Finger.
»Ich bemühe mich, erreichbar zu sein.« Sie zog ganz leicht die Augenbrauen zusammen, was zwei kleine Falten auf ihrer Stirn entstehen ließ. »Aber mein Handynetz in dem alten Haus ist nicht das beste. Ich wohne übergangsweise in Abigail’s Place auf dem Hampton’s-Mill-Gelände, falls Sie das kennen.«
Dan sah sie überrascht an. »In der alten Villa?«
Melody Stewart lachte. Ihre Zähne waren weiß und gleichmäßig, die Lippen seidig und voll. »Ungewöhnlich, ich weiß. Ich bin tatsächlich seit fast hundertachtzig Jahren wieder die erste Bewohnerin dort. Aber es ist nur für eine kurze Zeit. Ich habe das Haus geerbt und werde es wohl verkaufen.«
»Stammen Sie denn aus der Hampton-Familie?« Ein Kribbeln breitete sich in Dan aus.
Sie nickte. »Abigail, nach der die Villa benannt ist, war eine Vorfahrin von mir.«
Plötzlich war alles ganz klar. Diese Frau berührte ihn so sehr, weil er die Ähnlichkeit zwischen ihr und Abigail gesehen hatte, ohne es sofort verstanden zu haben. Dan war mit Abigails Bild aufgewachsen. Das Porträt von Melodys Urahnin hing im Haus seiner Eltern. Das Gemälde war viel zu groß für ihr kleines Haus, aber es war das wertvollste Erbstück, das die Familie besaß. Seit Generationen wurde es weitergegeben, gemeinsam mit seiner Geschichte. Dans Vorfahre Oliver Rashleigh war vor vielen Jahren Verwalter in der Baumwollfabrik des sechsten Lords of Mahony gewesen, der mit Abigail Hampton verheiratet war. Als Oliver Abigail zum ersten Mal sah, verliebte er sich unsterblich in sie, sodass er einen Mord für sie beging. Bevor er hingerichtet wurde, schenkte Abigail ihm das wertvolle Porträt, um seine Kinder finanziell abzusichern. Dann sprang Abigail Hampton, die sechste Lady Mahony, aus lauter Verzweiflung aus dem Fenster von Abigail’s Place in den Tod. Olivers Kinder hatten das Bild nie verkauft, sondern es von Generation zu Generation weitergereicht.
Dan wusste nicht, ob diese Geschichte stimmte und warum Oliver einen Mord begangen haben sollte, aber er würde das Bild immer genauso in Ehren halten, wie es seine Vorfahren getan hatten. Jetzt einer Frau gegenüberzustehen, die nicht nur eine direkte Nachkommin Abigails war, sondern ihr auch noch sehr ähnlich sah, erklärte seine emotionale Reaktion auf Melody Stewart.
Er atmete tief durch. »Ich habe davon gehört.«
»Oh«, sagte Melody und betrachtete ihn abwartend. Vermutlich kannte sie die Geschichte vom Selbstmord ihrer Ahnin ebenfalls.
Dan ging nicht weiter darauf ein und reichte ihr zum Abschied die Hand. »Ich hoffe, Sie leben sich gut ein.«
Das Lächeln, das sie ihm schenkte, begleitete ihn hinaus, und es sollte ihn bis an sein Lebensende nicht mehr loslassen.
Kapitel 1
September 1838
Abigail reckte sich und sah zu Renard, ihrer Zofe, hinüber, die auf der gegenüberliegenden Bank der Equipage saß und schlummerte. Sie musste lächeln. Renard hatte weiß Gott anstrengende Wochen hinter sich. In London hatte Abigail jeden Abend auf einem anderen Ball oder bei einer Dinnergesellschaft verbracht, hatte nachmittags Besucherinnen empfangen oder selbst ihre Aufwartung in einem der herrschaftlichen Häuser gemacht, und während der Stunden, die dann noch übrig geblieben waren, hatte sie Renard von einem Geschäft ins nächste getrieben, um sich mit den feinsten Seiden- und Leinenstoffen, Perlen, Bändern und Spitzen einzudecken. Wenn Abigail – wie in diesem Jahr – nicht nach Paris kam, erledigte sie ihre Einkäufe meist in London und besuchte bei dieser Gelegenheit alte Freundinnen und Verwandte. Renard hatte Abigail viermal am Tag beim Umkleiden helfen müssen, sie hatte dafür gesorgt, dass ihre Einkäufe in ihr Londoner Stadthaus gebracht wurden, und sich um Abigails gesamte Garderobe gekümmert. Die junge Französin hatte mehr als einmal entnervt das Gesicht verzogen, sodass Abigail sie zurechtweisen musste, obwohl sie durchaus Verständnis für die Zofe hatte. Abigail war bekannt für ihre schier unerschöpfliche Energie, und ihr war bewusst, dass andere schnell von ihrem Temperament überfordert waren. Dabei brauchte sie eine zuverlässige und loyale Begleiterin an ihrer Seite. Anthony hatte ihr von Anfang an zu einer englischen Dienerin geraten, aber Französinnen waren geschickter, was Frisuren, Kleider und andere Schönheitsdinge betraf.
Abigail beugte sich vor und lächelte, als sie an ihre baldige Heimkehr dachte. Sie freute sich darauf, ihre Söhne endlich wiederzusehen. Und Anthony. Sie runzelte die Stirn und betrachtete ihr eigenes Bild in einem der kleinen Spiegel, die als Dekoration neben den Türen der Equipage angebracht waren. Ihre haselnussbraunen Haare waren kunstvoll hochgesteckt, und einzelne gelockte Strähnen umspielten ihr blasses Gesicht. Während sie in ihre grünen Augen sah, musste sie sich eingestehen, dass ihr Mann ihr in den letzten Wochen kaum gefehlt hatte – im Gegenteil. Sie lehnte sich wieder in den weichen Sitz zurück. Abigail hatte die Tage ohne ihn genossen. Sie hatte ihre Zeit verbringen können, wie es ihr gefiel. Wenn Anthony bei ihr war, verlangte er, dass sie ihn auf Empfänge und Gesellschaften begleitete, auf denen sie sich meist zu Tode langweilte. Während er sich mit anderen Fabrikanten unterhielt und Geschäfte mit ihnen abschloss, musste Abigail sich mit den Fabrikantengattinnen in ermüdenden Gesprächen ergehen. Viel lieber hätte sie den Männern bei ihren Verhandlungen zugehört und hätte beobachtet, wie um Geld gefeilscht und Vermögen verschoben wurde. Ja, bei diesen oft hitzigen Verhandlungen musste es spannend zugehen, wohingegen die Pläusche mit den tumben Frauen für Abigail beinahe unerträglich waren.
Sie zog den Vorhang des Kutschfensters zur Seite. In der Ferne konnte sie schon die dunklen Rauchwolken sehen, die Stockmill werktags einhüllten. Die unzähligen Schornsteine der Fabriken sorgten für einen beständigen grauen Nebel über der Stadt.
Die Kutsche verlangsamte ihr Tempo, und Abigail beobachtete, wie sie auf die breite Straße Richtung Stockmill abbogen. Ein großes Fuhrwerk, beladen mit Fässern und Kisten, kam ihnen entgegen, gefolgt von zwei kleinen Equipagen und einem Zweispänner. In den letzten Jahren war Stockmill auf mehr als das Doppelte seiner Einwohnerzahl gewachsen, und man hatte viele neue Straßen in und um die Stadt herum angelegt. Während sie die neu gebaute Poststation passierten, die Abigail verriet, dass sie in wenigen Minuten die Südlodge von Hampton Hall erreichen würden, dachte sie mit Stolz daran, dass ihr Mann entscheidend zur Blüte der Stadt beitrug. Hampton’s Mill war die größte Baumwollfabrik der Gegend, und Anthony beschäftigte in diesem Jahr fast achthundert Arbeiter. Zu gern würde Abigail sich mehr in die Verwaltung der Fabrik einbringen, aber sie wusste, dass Anthony das nicht dulden würde. Er war der Meinung, dass seine Ehefrau mit ihren Repräsentationspflichten und dem Haushalt schon genug zu tun habe, und hielt nichts davon, dass Frauen sich außerhalb des Hauses betätigten. Wenn sie ihm vorhielt, dass er in der Fabrik doch auch Frauen beschäftige – dort schien er also nichts gegen arbeitende Frauen einzuwenden zu haben – , entgegnete er, dass es sich bei den Arbeiterinnen nicht um Damen handele und somit ein derartiger Vergleich nicht statthaft sei.
Abigail ließ sich wieder in das Polster der Kutsche zurücksinken und dachte an die vergangenen Wochen. Sie liebte London, die Theater und Museen dort, und auch viele ihrer Freundinnen lebten in der Hauptstadt. Fünf Wochen lang war sie der Langeweile von Hampton Hall entkommen. Obwohl Anthony ihr jede Annehmlichkeit gewährte und sie mit schönen Dingen überhäufte und obwohl sie, wann immer sie wollte, die Damen der benachbarten Anwesen einladen konnte, um sich die Zeit zu vertreiben, fühlte sie sich hier oben im Norden oft einsam und von der Gesellschaft isoliert. London schien so weit entfernt. Und dieses Jahr hatte Anthony – zu Abigails großem Leidwesen – auch die Jagdgesellschaft abgesagt, die er sonst jeden Herbst in seinem Landhaus in Nordwales zu geben pflegte und auf die Abigail sich immer sehr freute. Die Wochen kurz nach ihrer Rückkehr aus London waren für Abigail normalerweise ein Trost gewesen und hatten ihr Kraft für den langen Winter gegeben, der ihr bevorstand. Doch nun würde sie sich bis zum Weihnachtsball im Dezember gedulden müssen, erst dann würden die Gästezimmer wieder mit Leben gefüllt werden, überall im Haus würde es von Menschen wimmeln und Abigail in ihrer Rolle als Gastgeberin aufgehen.
Sie fuhr mit den Händen über den hellblauen Samt des Sitzes. Fünf lange Wochen hatte Abigail auf Ebenezer und Hugo, ihre beiden Söhne, verzichten müssen, denn während ihres Aufenthalts in der Hauptstadt waren die Jungen mit der Kinderfrau in Hampton Hall geblieben. London war für Kinder zwar eine gewisse Zeit lang interessant, aber wenn alle Museen besucht waren, wurde es ihnen dort schnell langweilig. Und der Garten ihres Hauses in der Hauptstadt war lächerlich klein im Vergleich zu dem großen Park und den Wäldern von Hampton Hall.
Abigail starrte wieder aus dem Fenster auf die vertraute Straße, die sie schon hundertmal in Richtung Stockmill gefahren war. Ein altbekanntes Gefühl breitete sich in ihr aus. Es war die Erwartung von Langeweile und Beklemmung, die sie immer überfielen, wenn sie zurückkehrte. Natürlich, sie konnte es kaum erwarten, Ebenezer und Hugo wiederzusehen, und doch schien ihr Leben hier oben trist und bedeutungslos zu sein.
Es hatte schon wenige Jahre nach ihrer Hochzeit begonnen, damals, als Hugo – ihr jüngerer Sohn – gerade laufen gelernt hatte. Abigail presste die Lippen aufeinander. Sie konnte die Stimme ihrer Mutter hören, die vermutlich jetzt sagen würde, dass Abigail undankbar war. Sie hatte mit Anthony eine außerordentlich gute Partie gemacht, hatte einen Mann von Adel geheiratet, der nicht nur hoch angesehen innerhalb der Gesellschaft war, sondern auch noch über ein jährliches Einkommen von sechshunderttausend Pfund verfügte. Das war eine Summe, die ihn im ganzen Land bekannt gemacht hatte, und sie kam größtenteils aus der Baumwollfabrik, die sein Vater gegründet und die Anthony mit großem Geschick erweitert hatte.
Aber schon bald hatte sich diese entsetzliche Langeweile ausgebreitet, die Abigail nicht zu vertreiben wusste. Wie viele Bälle, Dinnergesellschaften oder Teepartys sie auch gab, wie viele Wohltätigkeitskomitees sie auch leitete, die Leere in ihr blieb und begleitete sie überallhin. Sogar nach London, auch wenn sie dort am wenigsten zu spüren war. Abigail wusste, dass ihre Rastlosigkeit aus dieser inneren Leere hervorgegangen war, sie organisierte und repräsentierte, ob in London oder Stockmill, und sie wurde dafür bewundert. Die Menschen fragten, woher sie all diese Energie nur nähme. Abigail lächelte und gab Floskeln von sich, dass es ihr Spaß mache, dass sie darin Erfüllung finde, doch in Wahrheit war ihre Umtriebigkeit nichts anderes als eine Flucht, eine Flucht vor der Eintönigkeit ihres Lebens.
Sie beugte sich gerade wieder zum Fenster der Kutsche, als ihr Blick an einem Bündel hängen blieb, das am Straßenrand lag. Sie hatten die Stadtmauer von Stockmill erreicht und mussten nun in die Straße einbiegen, die rechts an der Mauer entlanglief, um nach Hampton Hall zu gelangen. Doch Abigail schlug erschrocken an die Wand der Kutsche. Sofort drosselte der Kutscher die Pferde, bis sie schließlich zum Stehen kamen. Kurze Zeit später wurde die Tür geöffnet, und Abigail drängte sich an dem Kutscher vorbei ins Freie.
»Schauen Sie – da, Kay!« Abigail deutete auf den Lumpenhaufen am Straßenrand. Sie schlug die Hand vor den Mund, als sie erkannte, dass es sich bei dem Bündel in Wirklichkeit um eine zusammengekauerte Frau handelte, die auf der staubigen Erde lag. Sie war so abgemagert, dass ihre Wangenknochen hervortraten, und ihre Arme, die aus der zerrissenen Bluse ragten, waren kaum dicker als Besenstiele. Ihr Gesicht war aschfahl und das schmutzige, von Staub bedeckte braune Haar so verfilzt, dass man es wohl nur noch abschneiden konnte. Das, was Abigail jedoch die Tränen in die Augen trieb, was ihre Brust zusammenschnürte, war der Junge, der sich weinend an seine kraftlose und ohnmächtige Mutter schmiegte. Er trug kein Hemd, keine Schuhe oder Strümpfe, nur eine zerrissene Hose, und jede seiner Rippen war so deutlich zu sehen, als hätte Abigail ein Skelett vor sich gehabt. Die Tränen hinterließen helle Spuren auf den schmutzigen Wangen des Kindes.
»Um Himmels willen, Kay, wir müssen ihnen helfen. Sie scheinen sehr krank zu sein«, rief Abigail ihrem Kutscher zu, und sie lief zu den ärmlichen Kreaturen hinüber. »Die Frau ist vollkommen kraftlos!«
»Eure Ladyschaft, das ist eine Arbeiterin«, erwiderte Kay und deutete mit seiner Mütze, die er sich vom Kopf genommen hatte, in Richtung Stadt. »Dort drinnen sind Hunderte von ihnen, die im Rinnstein liegen und betteln.«
Abigail hatte sich zu den Hilfsbedürftigen hinabgebeugt und sah nun erschrocken auf. »Hier? In Stockmill? Hunderte von Arbeitern, die Hunger leiden?«
Kay nickte. Seine roten Locken leuchteten unter dem von Qualm verhangenen Himmel. »Leider Ma’am. Wir können ihnen nicht helfen.«
Abigail schluckte. Das hier war Stockmill, hier verhungerten keine Arbeiter! Sie lebte inzwischen seit fünfzehn Jahren in Hampton Hall, es wäre ihr doch aufgefallen, wenn es den Menschen hier so schlecht ginge. Auch wenn Abigail nur selten in die Stadt fuhr – schließlich gab es in Stockmill keine angemessenen Läden für Damen der Gesellschaft – , so fuhr sie doch beinahe täglich an den Stadtmauern entlang und die Landstraßen zu den benachbarten Anwesen hinauf und hinunter, ein Elend wie dieses wäre ihr längst aufgefallen!
»Wir müssen den Wachmann rufen, er wird die beiden in die Stadt scheuchen.« Kay ging zur Kutsche zurück und hielt ihr die Tür auf. Abigail bemerkte den Blick, den er mit Renard wechselte, die Zofe hatte ihren Kopf aus der Tür gestreckt.
»Quelle canaille!«, rief sie und rümpfte ihre zierliche Nase. »Madame, vite! Steigen Sie ein!« Sie warf einen letzten, angewiderten Blick auf Mutter und Sohn im Rinnstein und verschwand dann schnell wieder im Inneren der Kutsche.
»Ich werde die Polizei rufen«, sagte Kay, der noch immer neben der Equipage stand, die Hand am Türgriff.
»Die Polizei?« Abigail richtete sich auf. Bei ihren Worten öffneten sich die trüben Augen der Frau. Abigail erkannte die Angst darin. Sie schluckte. Noch nie hatte sie so viel Leid, Not und Sorge in einem einzigen Blick gesehen.
Die Frau schüttelte den Kopf, und Abigail merkte, wie viel Kraft es sie kostete.
»Sie darf nicht hier sein«, erklärte Kay. »Das Gesetz verbietet das Betteln außerhalb der Stadtmauern. Die Reisenden sollen nicht belästigt werden. Steigen Sie ein, Ma’am, ich werde gleich einen Boten zum Wachtmeister schicken.«
Die Augen der Frau flehten. Der Junge in ihrem Arm schluchzte leise. Abigail war plötzlich übel. Das gekochte Hühnchen und der Yorkshire Pudding, die sie am Mittag in einem Rasthaus bei Nottingham gegessen hatte, lagen ihr mit einem Mal schwer im Magen. Sie strich der Frau vorsichtig über das verfilzte Haar.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte Abigail. »Ich lasse nicht zu, dass er die Polizei ruft.«
Abigail wusste nicht, ob ihre Worte bei der Frau angekommen waren, doch die bemitleidenswerte Kreatur schloss wieder die Augen und sank zurück auf die staubige Straße. Abigails Kehle wurde eng, und auch ihr liefen nun Tränen über die Wangen. Langsam richtete sie sich auf und ging zur Kutsche zurück.
Sie sah Kay an. »Können wir ihr denn nicht helfen? Wir können sie doch nicht einfach hier liegen lassen.«
Der Kutscher senkte den Blick. »Ich schicke gleich den Boten zum Wachmann.«
»Nein«, sagte Abigail mit belegter Stimme, sie wischte sich die Tränen von der Wange, »nicht die Polizei. Wir müssen sie mitnehmen und ihnen Essen geben.«
»Wem?« Kay sah sie erschrocken an. »Eure Ladyschaft, das können wir nicht. Sie ist eine Arbeiterin, ganz offensichtlich ohne Stellung. Die sind gefährlich. Wenn wir sie mit ins Haus nehmen, wird sie uns alles stehlen, was sie in die Finger bekommt.«
Abigail warf einen Blick auf die Frau, die jetzt wieder reglos am Straßenrand lag. Der Junge hatte sich an sie geschmiegt, er war noch viel jünger als Hugo. »In ihrem Zustand? Wenn sie stehlen könnte, dann hätte sie es längst getan und läge jetzt nicht hier.«
»Wenn Sie sie mitnehmen, müssten Sie alle mitnehmen. Die Stadt ist voll von ihnen.« Der Kutscher nickte in Richtung des Stadttores.
Abigail seufzte und stieg langsam wieder in die Kutsche. Kay warf noch einen letzten Blick auf die beiden Gestalten am Wegesrand und kletterte dann eilig auf seine Kutschbank.
Abigail hörte sein Schnalzen durch das geöffnete Fenster. Die Pferde setzten sich in Bewegung. Sie betrachtete die Mutter und den Jungen, die sie gerade ihrem Schicksal überließ. Die Übelkeit verstärkte sich. Abigail atmete tief durch. Renard hatte ihren Spiegel hervorgeholt und arrangierte gerade ihre vom Schlaf zerzauste Frisur. Sie schien keinen Gedanken an diese armen Geschöpfe zu verlieren.
Da richtete Abigail sich plötzlich auf. Nein, sie würde die beiden nicht im Staub liegen lassen. Sie klopfte wieder an die Wand, und als der Kutscher wenige Sekunden später die Tür öffnete, sprang sie, schneller als es für eine Dame schicklich war, aus der Kutsche.
»Vielleicht können wir nicht alle Bettler retten, aber diese beiden schon. Wir nehmen sie mit nach Hampton Hall. Bitte, helfen Sie ihnen in die Kutsche.« Abigail lief zurück zu der Frau und ihrem Sohn. Sie waren nur wenige Schritte weitergefahren.
Kay sah Abigail skeptisch an, und einen Moment lang glaubte sie, er würde sich ihrer Anordnung widersetzen, doch dann nickte er, wandte sich um und bat einen vorbeieilenden Jungen, ihm mit den beiden zu helfen.
»Eure Ladyschaft, wir haben zurzeit genug Probleme.« Mrs Alison rang die Hände und warf den beiden ausgezehrten Gestalten auf dem Bett einen misstrauischen Blick zu.
Als sie Hampton Hall erreicht hatten, hatte die Dienerschaft bereits vor dem Haus gestanden, um Abigail zu begrüßen. Die Haushälterin Mrs Alison, die Abigail aus ihrem Elternhaus mitgebracht hatte und die für sie eher eine Mutter als eine Dienerin war, hatte sofort das Kommando übernommen und die beiden abgemagerten Kreaturen in eine Kammer neben der Küche bringen lassen. Abigail ließ nach Doktor Smith schicken und eine Suppe und Brot für die beiden Kranken zubereiten.
Jetzt stand sie in dem schmalen Zimmer, sah in das frisch entzündete Feuer und spürte mit einem Mal die Müdigkeit, die sie wie eine Welle überkam. Mühsam wandte sie den Blick von den züngelnden Flammen auf ihre Haushälterin. »Probleme? Was meinen Sie damit?«
Mrs Alison hob die Augenbrauen und deutete auf den Holzstuhl, der neben dem Kamin stand.
Nachdem Abigail Platz genommen hatte, sagte Mrs Alison: »Lord Mahony ist vor einer Woche in den Süden aufgebrochen. Er fühlte sich gesundheitlich nicht in bester Verfassung, und Lord George ist gekommen, um die Angelegenheiten der Fabrik in seiner Abwesenheit zu übernehmen.«
Abigail sprang auf. »Anthony ist verreist? Aber das ist unmöglich. Er hat mir doch letzte Woche erst geschrieben, er freue sich auf meine Rückkehr.«
Mrs Alison, deren graue Haare wie immer in einem strengen Knoten zusammengefasst waren, zuckte mit den Schultern. »Vermutlich wollte er Sie nicht beunruhigen. Es scheint nur eine Art Erholungsaufenthalt zu sein. Sicherlich plant er, in Kürze zurückzukehren. Er hat Ihnen einen Brief hiergelassen. Er liegt in Ihrem Zimmer.«
Abigail schüttelte den Kopf. Das sah ihrem Mann nicht ähnlich. Auch wenn sie sich in den letzten Wochen nicht täglich geschrieben hatten, so doch regelmäßig, und Anthony hätte seine Reisepläne bestimmt erwähnt. Verunsichert warf sie einen letzten Blick auf die Frau und ihren Sohn, die auf dem Bett lagen und tief schliefen. Dann ging sie zur Tür.
»Bitte, sorgen Sie dafür, dass sie etwas zu essen bekommen, und wenn Doktor Smith da ist, soll er, sobald er hier fertig ist, bei mir vorbeikommen.«
Während Abigail die Treppe hinaufstieg, die von der Küche nach oben führte, versuchte sie, sich den Inhalt von Anthonys letztem Brief ins Gedächtnis zu rufen. Es waren belanglose Dinge gewesen, worüber er geschrieben hatte – dass der Gärtner im Terrassengarten neue Buchsbaumfiguren geschnitten hatte, dass Anthony darüber nachdachte, ein neues Klingelsystem für die Dienstboten einzuführen, und noch weitere Punkte, an die sich Abigail schon kaum mehr erinnern konnte.
Sie öffnete die mit rotem Filz bezogene Schwingtür und trat aus dem Dienstbotentrakt in den Flur, der zur großen Halle führte. Sie nahm den vertrauten Geruch des Hauses nach Holz, Rauch, Blumen und Bohnerwachs wahr. Nichts hatte sich während ihrer Abwesenheit verändert. Vor dem großen Kamin in der Halle standen das Sofa und daneben der jahrhundertealte Sessel. Ein roter Teppich bedeckte die Holzdielen. Auf dem Tisch in der Ecke stand ein Blumenstrauß. Paravents waren hinter dem Sofa und neben der Treppe aufgestellt und ließen den riesigen Raum gemütlicher erscheinen, um den auf Höhe der ersten Etage eine imposante Galerie verlief. Ein Teppich mit kunstvollem Muster führte die Treppe hinauf, die Abigail nun hastig erklomm.
Als sie auf dem ersten Treppenabsatz angekommen war, hörte sie die Stimmen ihrer Söhne, die von ihrer Ankunft erfahren haben mussten. Gleich darauf tauchten die beiden braunhaarigen Köpfe vor ihr auf. Ebenezer war schneller als sein sechs Jahre jüngerer Bruder Hugo und warf sich sofort in Abigails Arme. Sie lachte und hielt sich mit der freien Hand am Geländer fest.
Der Vierzehnjährige schien während der letzten fünf Wochen schon wieder gewachsen zu sein, er überragte Abigail inzwischen um fast einen Kopf und wirkte beinahe erwachsen. Hoffentlich passten ihm die neuen Hosen und Röcke, die sie in London für ihn hatte schneidern lassen.
Jetzt hatte auch Hugo sie erreicht und drückte sich fest an seine Mutter. Während Abigail den geliebten Duft ihrer Söhne einsog, dachte sie wieder an den weinenden Jungen auf der Straße, der sich an seine dürre Mutter geklammert hatte. Was für ein Glück hatten Ebenezer und Hugo, in diesem reichen Haus geboren worden zu sein! Wie schrecklich musste es für eine Mutter sein, ihrem Sohn beim Hungern zusehen zu müssen, selbst zu schwach, um ihn versorgen zu können.
Abigail küsste Hugo aufs Haar und drückte ihn und Ebenezer fest an sich. Tränen standen ihr in den Augen. Sie würde alles tun, um Ebenezer und Hugo zu schützen. Sie war unendlich glücklich darüber, diese zwei gesunden, reizenden Kinder geschenkt bekommen zu haben. Während sie den aufgeregten Schilderungen ihrer Söhne lauschte, die ihr von ihren Abenteuern in den letzten Wochen erzählten, genoss sie ihre Nähe und ihre Liebe. Dann versprach sie, gleich in ihr Spielzimmer zu kommen, sobald sie sich etwas ausgeruht habe.
Als sie in ihren eigenen Räumen angekommen war, schickte sie das Hausmädchen fort, das gerade dabei war, Abigails Reisetruhe und Taschen auszuräumen. Dann trat sie an den Frisiertisch.
An einer Vase mit frischen Rosen lehnte der Brief von Anthony. Sie runzelte die Stirn. Wenn ihr Mann bereits vor einer Woche abgereist war, hätte er ihr den Brief nach London schicken können, er hätte sie auf jeden Fall dort noch erreicht.
Sie ließ sich auf den mit heller Seide bezogenen Sessel fallen, der vor dem Tisch stand, und brach das Siegel auf. Nachdem sie den Bogen entfaltet hatte, las sie die wenigen Sätze, die Anthony ihr geschrieben hatte.
Liebe Abigail,
ich fühle mich ermattet und gesundheitlich angeschlagen. Nichts Ernstes, du brauchst dich nicht zu sorgen. Aber aus diesem Grunde und auf Anraten von Doktor Smith begebe ich mich für eine Weile in den Süden an die Küste, um mich in einem Sanatorium dem Müßiggang zu widmen. Danach werde ich dich gestärkt wieder in die Arme schließen können. Die Leitung von Hampton’s Mill und die Verwaltung des Anwesens habe ich solange in Georges Hände gelegt.
Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit in London, und freue mich, dich bald gesund wiederzusehen.
In Liebe,
Anthony
Abigail ließ den Brief sinken und starrte aus dem Fenster. In der Ferne sah sie die dunklen Rauchwolken über den Schornsteinen der Baumwollfabriken. Vor ihr erstreckte sich der weitläufige Garten von Hampton Hall. Anthonys Verhalten war merkwürdig. Diese übereilte Abreise ergab keinen Sinn. Weshalb hatte er nicht ein paar Tage warten können, um Abigail noch zu sehen? Es wirkte beinahe so, als hätte er ihr Zusammentreffen absichtlich vermeiden wollen. Aber warum? Sie hätte ihn begleiten können, eine gemeinsame Auszeit hätte ihnen beiden gutgetan.
Abigail stand auf und durchquerte den großen Raum. Sie warf ihre Handschuhe aufs Bett und wollte gerade nach Renard läuten, als sie innehielt. Oder war es genau das, worum es Anthony ging? Er wollte eine Begegnung mit Abigail vermeiden, um der möglichen Bitte zu entkommen, dass sie ihn begleiten durfte? Hatte er allein verreisen wollen? Anthony hatte Abigail noch nie einen Wunsch abschlagen können, und wenn sie ihn bekniet hätte, dann hätte er es ihr bestimmt gestattet. Aber wieso würde Anthony ihre Begleitung nicht wollen? War er wirklich aus gesundheitlichen Gründen in den Süden gereist, oder steckte etwas anderes dahinter? Eine Frau etwa? Abigail wurde plötzlich kalt. Sie stand wie erstarrt vor ihrem Bett. Sie wusste, dass die meisten verheirateten Männer es heutzutage mit der Treue nicht so genau nahmen, viele hatten Mätressen. Abigail machte sich nichts vor, sie ahnte, dass auch Anthony da keine Ausnahme war. Ihre Ehe war nicht aus Liebe geschlossen worden, es war eine Verbindung, die ihre Väter arrangiert hatten. Aber selbst wenn Anthony nie sonderlich liebevoll war, hätte Abigail es schlechter treffen können. Ihr Ehemann war diskret, er hatte keine Geliebten in der Dienerschaft – zumindest wusste Abigail nichts davon. Sie hätte es nur schwer ertragen können, wenn sie sich die Gunst ihres Mannes mit einer ihrer Angestellten hätte teilen müssen. Und doch vermutete sie, dass er, wenn er allein verreiste, von Zeit zu Zeit andere Frauen traf. Abigail konnte es spüren, wenn er sie betrogen hatte. Es waren nur kleine Anzeichen, aber deutlich genug für sie: Wenn er nach seiner Rückkehr ihren Blicken auswich, sich in seine Zimmer zurückzog und geistig abwesend war. Oft stand er dann stundenlang am Fenster und starrte hinaus. Abigail hatte sich früher nichts dabei gedacht, bis sie zufällig einen Brief gefunden hatte, dessen Inhalt eindeutig gewesen war. Sie hatte Anthony zur Rede gestellt, und er hatte das Verhältnis unumwunden zugegeben. Ja, er war der Meinung, als Mann ein Recht dazu zu haben. Abigail hatte monatelang nur das Nötigste mit ihm gesprochen, bis sie sich endlich mit ihren Freundinnen ausgesprochen und erfahren hatte, dass es ihnen allen nicht anders erging. Also hatte sie sich in ihr Schicksal gefügt, was hätte sie auch anderes tun sollen? Anthony war ihr Mann, er sorgte gut für sie, sicherte ihr eine angesehene Position in der Gesellschaft und stellte sie wenigstens nicht vor ihren Angestellten oder gar seinen Freunden bloß, indem er bei seinen außerehelichen Affären äußerst diskret vorging. Abigail hatte nie wieder einen Brief oder andere Spuren gefunden, und doch merkte sie es fortan, wenn er mit einer anderen Frau zusammen gewesen war.
Abigail streckte sich. Das lange Sitzen in der Kutsche war anstrengend gewesen. Wenn sie nur wüsste, ob Anthony wirklich gesundheitlich angeschlagen oder ob er mit einer anderen Frau verreist war.
Als Renard plötzlich im Zimmer stand, fuhr sie erschrocken zusammen. Sie war so in Gedanken versunken gewesen, dass sie ihr leises Klopfen überhört hatte.
»Le docteur, Madame. Er erwartet Sie in Ihrem Salon.« Renard deutete auf die linke Tür aus schwarzem Ebenholz, als könnte Abigail vergessen haben, dass es dort in ihren privaten Salon ging. »Soll ich Ihnen Tee bringen lassen?«
»Ja, bitte.« Abigails Schritte klangen dumpf auf dem teuren Teppich. »Und anschließend möchte ich mich umkleiden.«
Abigail sehnte sich danach, ihr Reisekleid abzulegen, das vom Staub der englischen Landstraßen bedeckt war. Aber zuerst musste sie mit dem Arzt sprechen.
Als sie ihren Salon betrat, stand Doktor Smith vor dem Kamin und starrte in das Feuer, das die Diener bei Abigails Ankunft entzündet haben mussten. Einen Moment lang betrachtete sie die gebückte Gestalt des Arztes, seinen kahlen Hinterkopf, den eleganten Gehrock. Hoffentlich konnte er ihr mehr über Anthonys überraschende Reise sagen.
»Doktor Smith?« Sie trat auf ihn zu.
Der Arzt drehte sich um. Er ergriff ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf.
»Bitte, nehmen Sie Platz.« Abigail deutete auf das große Sofa, das mit dunkelgrünem Samt bezogen war. Sie selbst setzte sich in den zierlichen Sessel gegenüber.
Die Augen des Arztes ruhten auf ihr. Er lächelte. »Wie geht es Ihnen? Sie wirken müde.«
Abigail nickte. »Die Fahrt war anstrengend und dann der Schrecken über die armen Geschöpfe, die wir vor der Stadtmauer gefunden haben … Wie steht es um sie?«
Doktor Smith holte tief Luft. »Ich habe ihnen ein Stärkungsmittel verabreicht und der Küchenmagd aufgetragen, ihnen regelmäßig Suppe und Wein zu geben. Sie haben sicher seit Tagen nichts Anständiges mehr gegessen. Nun müssen sie wieder zu Kräften kommen.«
Abigail strich über den braunen Leinenstoff ihres Reisekleides. Seit sie die Frau gefunden und ihren entkräfteten Jungen gesehen hatte, war etwas in ihr in Aufruhr geraten. Sie wusste es nicht genau zu benennen, aber mit einem Mal schämte sie sich – wegen ihrer Unwissenheit. Sie musste mehr über die Menschen hinter der Stadtmauer erfahren. Also fragte sie: »Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass eine Frau und ein Junge so ausgezehrt sind? Greifen in diesem Fall denn unsere Armengesetze nicht?«
Doktor Smith lehnte sich zurück. »Das Geld reicht bei Weitem nicht aus, um all die Hungernden zu unterstützen. Die Armenhäuser sind überfüllt.«
Abigail sah den Arzt erschrocken an. »Sind es denn so viele?«
Er nickte. Seine Hände lagen gefaltet in seinem Schoß. »Die Not in den Städten wird leider von Jahr zu Jahr größer. Die Politiker müssen nach Lösungen suchen. Ich kann Ihnen nur raten, Eure Ladyschaft, die Frau und den Jungen schnell wieder aus dem Haus zu schaffen und anschließend alles gut auszuräuchern.«
»Was?« Abigail schüttelte verwundert den Kopf. »Aber Sie sagen doch, die Not wird größer. Und dass die beiden zu Kräften kommen müssen. Wie kann ich sie in diesem Fall ihrem Schicksal überlassen?«
Der Arzt zog unbehaglich die Schultern hoch. »Eure Ladyschaft, ganz Stockmill ist voller Kreaturen wie diesen. Und nicht nur Stockmill. Auch in Manchester, Blackpool, London oder Leeds sieht es nicht besser aus.«
Der Arzt hielt inne, als das Hausmädchen den Tee brachte. Nancy knickste und stellte die Silberkanne vor ihre Herrin auf den Ebenholztisch. Dann verteilte sie die Tassen und den Teekuchen.
Abigail rührte den Tee und goss ihn durch das feine Silbersieb in die beiden Tassen aus chinesischem Porzellan. Der würzige Geruch des Assamtees stieg ihr in die Nase. Sie betrachtete den Dampf, der aus dem heißen Getränk kam.
Nachdem sie beide Sahne in den Tee gegeben und ihn gekostet hatten, fuhr Doktor Smith fort: »Sie können diese Geschöpfe nicht alle retten. Und Sie sollten einen großen Bogen um die Armen machen. Sie sind unsauber, Krankheiten und Seuchen brechen immer wieder in den Arbeitervierteln aus. Recht und Gesetz kennen diese Menschen nicht. Besonders schlimm sind die Irländer. Sie sind brutal und gewalttätig. Und sie ziehen unsere englischen Arbeiter mit in den Strudel der Kriminalität.«
Abigail starrte in ihren Tee. Nachdenklich trank sie einen weiteren Schluck. Dann stellte sie die Tasse ab. »Wie ist es möglich, dass ich bislang so wenig von diesem Elend gesehen habe? Wenn Ihre Worte stimmen, und ich zweifle nicht daran, hätte ich dann nicht viel mehr davon mitbekommen müssen?«
»Es wird darauf geachtet, dass die rechtschaffene Gesellschaft nicht belästigt wird. Die Straßen der Armen sind versteckt. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie danach suchen müssen, finden Sie sie nicht.« Doktor Smith lehnte sich zurück und nahm ebenfalls noch einen Schluck Tee.
»Aber wenn es wirklich so viele sind …?« Abigails Blick wanderte zum Fenster. Am Ende des Parks von Hampton Hall lag ihre Fabrik Hampton’s Mill. Und dahinter begann die Arbeitersiedlung, kaum drei Meilen von Abigails Salon entfernt. Hatte sie all das Leid nicht sehen wollen? Plötzlich kam sie sich unendlich dumm und naiv vor.
»Es gibt viele dieser Straßen, Eure Ladyschaft. Aber Sie sollten sich Ihren Kopf nicht darüber zerbrechen. Das sollen die hohen Herren im Parlament tun. Ihr Mann gibt den Menschen Arbeit, er tut genug für sie.«
Abigail sah den Arzt an. »Vermutlich«, sagte sie nachdenklich.
»Soll ich dem Diener auftragen, die Frau und den Jungen zurück in ihr Cottage zu bringen?«, fragte Doktor Smith und nahm sich ein Stück Kuchen.
Abigail schüttelte den Kopf. »Sie sollen ruhig noch ein wenig hierbleiben und sich erholen. Ich werde sie zurückbringen lassen, wenn es ihnen besser geht.«
Doktor Smith legte die Stirn in Falten. »Als Ihr Arzt muss ich Ihnen entschieden davon abraten. Denken Sie an Ihre Kinder. Der Junge hat am ganzen Körper Skrofeln und außerdem Rachitis. Nicht auszudenken, was für gefährliche Erreger er mit sich herumträgt. Und die Frau ebenso.«
Abigail dachte an Hugo und Ebenezer. Sie würde sie niemals in unnötige Gefahr bringen. Und doch war es gerade der Gedanke an ihre Söhne, der es ihr unmöglich machte, den Jungen und seine Mutter wegzuschicken. »Ich werde aufpassen, aber wie kann ich meine Söhne Nächstenliebe lehren, wenn ich diese Menschen, die unsere Hilfe nötiger haben als jeder andere, abweise? Nein, Doktor Smith, ich muss den beiden helfen.«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Krankheiten können über Dritte weitergegeben werden. Sie selbst könnten zum Überträger werden. Bitte, Ma’am, Sie können sie nicht retten.«
Abigail stand auf. Sie trat ans Fenster und sah in den Garten hinaus. Ein feiner Nieselregen hatte eingesetzt und einen dunstigen Schleier über den Rasen und die Beete gelegt. Sie drehte sich zu Doktor Smith um. »Ich schäme mich, dass ich bislang nicht mehr von dem Elend bemerkt habe. Schauen Sie mich an. Ich organisiere Wohltätigkeitsfeste, auf denen getanzt, gegessen und getrunken wird. Und anschließend, wenn alle mit vollen Bäuchen in ihren warmen Betten liegen, beweihräuchern wir uns gegenseitig, so viel Gutes getan zu haben.«
Doktor Smith lächelte sie an. »Zu Recht, Eure Ladyschaft. Ihre Wohltätigkeitsbälle sind legendär.«
Abigail sah ihn entsetzt an. Er hatte nicht verstanden, was sie ihm sagen wollte. »Es geht dabei doch gar nicht um die Armen. Es geht um uns. Die Armen sind für uns nur ein Vorwand, um zusammenzukommen und zu feiern. Wir amüsieren uns auf diesen Wohltätigkeitsveranstaltungen und versuchen uns gegenseitig zu übertreffen, was unsere Güte und Großzügigkeit angeht. Aber wenn wir einem Geschöpf begegnen, das Hilfe braucht, wenden wir uns angewidert ab und scheuchen es hinter die Stadtmauern zurück, damit wir seinen Anblick nicht ertragen müssen.« Abigail sah wieder die Bilder der Frau und ihres Jungen vor sich.
»Aber Eure Ladyschaft …!« Der Arzt stellte seine Tasse ab und stand auf. »Sie tun so viel für diese Menschen.«
Abigail hob die Hand, und der Arzt schwieg.
Sie fragte mehr sich selbst als Doktor Smith: »Wie kann ich jemals wieder zufrieden mit meinen Veranstaltungen und anderen Unternehmungen sein, wenn es gleichzeitig Hunderte von Menschen wie diese Frau und ihren Jungen gibt, die kaum drei Meilen entfernt im Rinnstein verhungern?«
Der Arzt sah sie unsicher an. »Eure Ladyschaft, es kann nicht Ihre Aufgabe sein, die Armen zu retten. Sie können das Leid so vieler Menschen nicht mindern.«
Abigail schüttelte den Kopf. Sie setzte sich auf den zierlichen Sessel und wartete, bis der Arzt auch wieder Platz genommen hatte.
»Die Frau und ihr Junge bleiben vorerst hier«, sagte sie dann entschlossen. »Bitte kommen Sie morgen wieder, um nach ihnen zu sehen. Sollte es einem von ihnen schlechter gehen, schicke ich schon früher nach Ihnen.«
Doktor Smith nickte und nestelte an der goldenen Taschenuhr, die in seiner Weste steckte.
Um ihn am Aufbrechen zu hindern, sagte Abigail schnell: »Kommen wir zu einem anderen Thema, das mich beschäftigt.« Sie trank einen Schluck Tee, bevor sie sich der delikaten Frage zuwandte. »Ich war sehr … überrascht, als ich von der plötzlichen Reise meines Mannes erfuhr.«
Doktor Smith legte die Fingerspitzen aneinander und sah Abigail an. Er machte keine Anstalten, etwas zu erwidern.
Also sprach Abigail weiter: »Mich wundert besonders, dass er mir keine Nachricht in London zukommen ließ. Ich habe erst vorhin davon erfahren, als ich in Hampton Hall eingetroffen bin.«
Doktor Smith schwieg weiter, während er Abigail mit leicht gesenktem Blick betrachtete.
»Doktor Smith, können Sie mir über Anthonys gesundheitlichen Zustand Auskunft geben? Ich hatte nie das Gefühl, dass er von schwacher Konstitution sei.« Abigail spürte die Wärme, die vom Kaminfeuer ausging. Ihr war plötzlich heiß.
Doktor Smith stieß einen Seufzer aus. »Leider darf ich Ihnen nichts darüber sagen. Ihr Mann hat ausdrücklich darauf bestanden, dass ich mit niemandem spreche. Diesen Wunsch muss ich natürlich respektieren.«
»Selbstverständlich.« Abigail zögerte. »Aber ich mache mir Sorgen. Es ist ganz und gar ungewöhnlich für Lord Mahony, einfach zu verreisen, ohne mich vorher darüber zu informieren.«
Doktor Smith nickte.
»Daher wäre es eine Erleichterung für mich, wenn Sie mir wenigstens sagen könnten, ob ein Grund zur Beunruhigung besteht.« Abigail schenkte dem Arzt Tee nach. Vielleicht konnte sie wenigstens erfahren, ob Anthony tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen verreist war.
Doch die Antwort des Arztes ließ sie weiter im Unklaren. Nachdem er sich umständlich geräuspert hatte, erklärte er: »Eure Ladyschaft, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Ein paar Wochen Ruhe und Ihr Mann wird frisch und erholt wieder bei Ihnen sein.«
Abigail richtete sich nachdenklich auf, doch bevor sie weiter nachfragen konnte, warf der Arzt einen Blick auf seine goldene Taschenuhr.
»Oje, schon so spät. Ich muss weiter, fürchte ich. Ich werde morgen früh herkommen und nach der Patientin und ihrem Sohn sehen. Ich danke Ihnen für den Tee.« Er blickte auf die frisch gefüllte Tasse und lächelte Abigail an. »Und machen Sie sich keine Sorgen um Seine Lordschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.«
Doktor Smith verneigte sich und verließ das Zimmer. Abigail blickte nachdenklich auf die Tür, die er hinter sich geschlossen hatte. Der heiße Tee dampfte in der Tasse. Der plötzliche Aufbruch des Arztes hatte etwas von einer Flucht an sich. Abigail griff nach ihrer Tasse und trank in kleinen Schlucken. Dann stand sie auf und ging hinunter in die Küche. Sie wollte noch einmal nach der Frau und ihrem Sohn sehen, sich umziehen und dann den Nachmittag mit Ebenezer und Hugo verbringen.
Als Abigail in die Kammer neben der Küche trat, hatte die Frau die Augen geöffnet und nippte an einer Tasse Suppe. Der Junge schlief neben ihr. Noch nie hatte Abigail so ausgezehrte Gestalten gesehen. Die Augen der Frau wirkten riesig in dem eingefallenen Gesicht, die Hautfarbe war mehr grau als rosig, und sie trug noch immer die zerrissene Kleidung, in der Abigail sie gefunden hatte.
Als die Frau sie sah, stellte sie die Tasse hastig auf den Steinboden.
»Bitte«, Abigail griff nach dem Holzstuhl und stellte ihn neben das niedrige Bett, »lassen Sie sich von mir nicht stören. Sie müssen wieder zu Kräften kommen. Essen Sie!« Sie lächelte ihr aufmunternd zu und deutete auf die Suppentasse.
Zögernd griff die Frau wieder danach. Abigail fielen die Knochen auf, die sich deutlich unter der schlaffen blassen Haut abzeichneten.
»Wie ist Ihr Name?«, fragte sie, während sie auf dem Stuhl Platz nahm.
»Nelly. Nelly Brixton, Ma’am.« Sie trank einen Schluck Suppe, ohne Abigail aus den Augen zu lassen.
Sie erinnerte Abigail an ein ängstliches Reh, jederzeit zur Flucht bereit.
Eine Weile lang sagte keine der beiden ein Wort. Abigail rieb sich die Augen. Sie war müde. Der Tag war lang gewesen und hatte viele Überraschungen für sie bereitgehalten. Ihr Blick wanderte zu dem dürren Jungen, dessen Brust sich unter seinen Atemzügen hob und senkte. Er wirkte so hilflos und verletzbar.
Abigail stand auf und beugte sich über Mutter und Kind. Sie zog die Decke höher und deckte ihn fest zu, wie sie es auch bei Ebenezer und Hugo tat, wenn sie ihnen eine gute Nacht wünschte.
»Ich werde Ihnen und Ihrem Jungen Kleidung bringen lassen«, sagte sie zu Nelly. »Meine Söhne können Etliches entbehren. Und ich bin sicher, dass ich auch das ein oder andere Kleid für Sie habe.«
»Nein, Ma’am. Ich habe kein Geld, ich …«
»Aber nicht doch«, wehrte Abigail ab, »ich möchte kein Geld von Ihnen haben. Ich schenke Ihnen die Kleidung.«
Die Frau sah sie einen Moment lang an. Dann fragte sie mit leiser Stimme, als fürchtete sie sich vor der Antwort: »Warum tun Sie das?«
Abigail erschrak, als ihr klar wurde, dass dieser Frau bisher keine Hilfsbereitschaft widerfahren sein konnte. Sie schluckte die Tränen hinunter, die plötzlich in ihr aufstiegen. Dann räusperte sie sich.
»Ich habe mehr Kleider, als ich jemals tragen kann«, sagte sie. »Wenn ich mich mit einem Abendkleid einmal in der Gesellschaft gezeigt habe, gebe ich es weg, denn es schickt sich nicht, zweimal im selben Kleid auszugehen. Sie hingegen haben nicht einmal ein einziges ordentliches Kleid, das Sie wärmt.« Abigail presste die Lippen fest aufeinander. Sie schämte sich so sehr für ihre Verschwendungssucht, zu der sie erzogen worden war.
»Eure Ladyschaft, warum haben Sie mich mitgenommen?«
Abigail hielt inne. Statt eine Antwort zu geben, fragte sie: »Hat Ihr Sohn auch schon gegessen?«
Nelly nickte.
Abigail stand auf. Die Kammer war klein, aber trocken und warm. Früher hatte die Köchin hier gewohnt, das war zu Zeiten von Anthonys Großeltern gewesen. Heute wohnte die Köchin mit den anderen Dienstboten oben unter dem Dach. Nur Mrs Alison und Mr Tucker, der Butler, hatten eigene Räume hier unten.
Abigail strich gedankenverloren über die alte Steinwand der Kammer. »Es war Ihr Sohn … Sie waren … sind so schwach, und ich dachte, Sie würden sterben. Und Ihr Sohn hat um Sie geweint. Ich habe an meinen Sohn Hugo gedacht, kaum älter als Ihrer. Da konnte ich Sie nicht dort liegen lassen. Auf der Straße. Ich glaube, Sie wären verhungert.«
»Bitte, rufen Sie nicht die Polizei, Eure Ladyschaft.«
Abigail nahm Nelly die Tasse ab und reichte ihr das Stück Brot, das die Köchin auf den Tisch gelegt hatte. »Sie haben Angst, ich könnte mich beschweren, weil Sie vor dem Stadttor waren, um zu … betteln?«
Nelly sah Abigail mit ihren großen, dunklen Augen ängstlich an.
»Nicht dort. Nicht vor der Stadt.« Die Frau schüttelte den Kopf und ließ sich in die Kissen zurücksinken. »Dort gibt uns niemand was.«
»Haben Sie keine Arbeit?«
Nelly schloss die Augen. »Schon seit dem letzten Winter nicht mehr. Viele von uns haben keine Arbeit, Eure Ladyschaft.«
Abigail trat ans Fenster. Sie starrte in den schmucklosen Hinterhof. Jetzt erinnerte sie sich daran, dass sie Anthony im Frühjahr mit seinem Verwalter über eine Handelskrise hatte sprechen hören. Damals hatte sie der Sache keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Anthony hielt alles Geschäftliche von ihr fern, versorgte sie aber stets mit sämtlichem Luxus, den sie sich wünschen konnte. Eine Handelskrise fiel in Hampton Hall nicht groß auf. Das Leben ging seinen gewohnten Gang.
»Wo haben Sie gearbeitet, Nelly? In Hampton’s Mill?« Abigail beobachtete ein paar Spatzen, die im Hof umherhüpften.
»Nein, bei Uman’s. Mein Mann und mein Sohn waren auch dort. Wir haben alle unsere Arbeit verloren. Nur unsere beiden Töchter werden noch beschäftigt, bei Hampton’s Mill. Aber das, was sie bekommen, reicht bei Weitem nicht.« Nellys Stimme klang müde.
»Ihr Mann wird sich Sorgen um Sie machen«, erwiderte Abigail. Sie drehte sich um und sah Nelly an.
Die schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf. »Er ist gestorben. Letzte Woche. Hatte keine Kraft mehr.«
Abigail starrte die Frau an, die ebenfalls nicht weit entfernt vom Tod zu sein schien. Wenn sie Nelly heute nicht mitgenommen hätte, wäre sie jetzt vermutlich nicht mehr am Leben. Abigail schluckte. »Und Ihre Töchter?«
»Sie sind besser ohne uns dran«, flüsterte Nelly, die das Gespräch sehr anzustrengen schien. »Deshalb sind wir vor die Stadt gegangen, Ben und ich. Wir wollten in den Wald, um dort zu sterben. Die Mädchen sollten uns nicht finden, sie haben genug Kummer. Aber wir hatten keine Kraft mehr. Haben es nicht geschafft.«
Abigail wandte sich ab, um die Tränen zu verbergen, die ihr über die Wangen liefen. Sie hatte keine Vorstellung vom Leid dieser Frau. Als sie sich wieder umdrehte, schüttelte Nelly mit letzter Kraft den Kopf.
Abigail trat zu ihr und legte ihr die Hand auf den Arm. »Es tut mir unsagbar leid, dass Sie so viel Not ertragen mussten. Ich werde Ihnen helfen. Wie heißen Ihre Töchter?«
»Margaret und Frances«, flüsterte Nelly.
»Schlafen Sie jetzt. Ich werde meine Zofe beauftragen, Ihnen Kleidung herauszusuchen, die Sie besser wärmt als das, was Sie tragen. Auch für Ihren Sohn. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen helfen.«
Abigail wollte nicht nur Nelly und ihrem Sohn Ben helfen. Auf einmal wusste sie, dass sie mehr tun musste. Ihre Wohltätigkeitsveranstaltungen gehörten der Vergangenheit an. Sie würde sich von nun an wirklich um das Wohl der Armen kümmern. Zuallererst würde sie sich einen Eindruck von dem Leben der Arbeiter verschaffen, die ganz in ihrer Nähe zu verhungern drohten, während Abigail im Luxus lebte.
An diesem Nachmittag schaffte Abigail es jedoch nicht mehr, zur Fabrik hinunterzugehen. Nachdem sie zwei Stunden mit ihren Söhnen verbracht, mit ihnen gespielt, ihnen vorgelesen und Tee mit ihnen getrunken hatte, stand plötzlich ihr Schwager George in der Tür des Spielzimmers. In der Hoffnung, von ihm vielleicht mehr über Anthonys mysteriöses Verschwinden zu erfahren, willigte sie ein, ihn zu einem Abendessen bei den Umans zu begleiten, die auf dem benachbarten Anwesen lebten. Weder Abigail noch Anthony mochten diese Familie besonders gern, sie waren in ihren Umgangsformen eher gewöhnlich, und man merkte ihnen deutlich an, dass sie erst vor Kurzem in den Besitz von Geld gelangt waren. Normalerweise würden sich Lord und Lady Mahony niemals mit Fabrikanten abgeben, die nicht von Geburt an ihrer gesellschaftlichen Schicht angehörten, doch da die Umans die zweitgrößte Baumwollfabrik in Stockmill betrieben, meinte Anthony, dass ein freundschaftlicher Umgang unerlässlich sei. Dabei zeigte Mr Uman immer wieder unverhohlenes Interesse an Hampton’s Mill und spielte gern auf eine Übernahme an, obwohl Anthony ihm wiederholt versichert hatte, die Baumwollfabrik nicht verkaufen zu wollen.
Während Abigail sich von Renard in die Unterröcke helfen ließ, war sie also nicht gerade begeistert darüber, dass sie den Abend bei den Umans verbringen würde. Hinzu kam, dass sie ihren Schwager George nicht ausstehen konnte, was sie Anthony gegenüber niemals erwähnt hätte, der seinen Bruder sehr bewunderte. In Abigails Augen war George ein Müßiggänger, der im Gegensatz zu seinem Bruder – der die vom Vater gegründete Baumwollfabrik mit viel Fleiß vorantrieb – den unterschiedlichsten Vergnügungen zugetan war. George flirtete gern und machte auch bei Abigail keine Ausnahme. Mehr als einmal hatte sie sich in der Gesellschaft ihres Schwagers unwohl gefühlt, Anthony schien das jedoch nicht zu bemerken.
Sie seufzte, während sie in die Knie ging und die Arme nach oben streckte, damit die Zofe ihr das hellgrüne Brokatkleid über den Kopf stülpen konnte. Heute Abend würde sie ihrem Schwager hilflos ausgeliefert sein und noch dazu der tumben Unterhaltung mit den Umans. Sie konnte nur hoffen, dass Anthony bald wieder zurück war und ihr weitere dieser Abende erspart blieben. Außerdem war sie in Sorge wegen Nelly.
Als sie in der Kutsche saßen, die sie zu den Umans brachte, fragte Abigail George nach seinem Bruder. Doch sie erfuhr nichts Neues. Anthony habe sich überarbeitet und gesundheitlich nicht wohlgefühlt und sei aus diesem Grund in den Süden gereist, sagte George. Er habe ihn gar nicht mehr persönlich gesehen, Anthony sei bei Georges Ankunft in Hampton Hall bereits abgereist gewesen.
Abigail runzelte die Stirn. Also hatte Anthony ein Zusammentreffen mit George ebenfalls vermieden. Das sprach nicht unbedingt für ihre Vermutung, dass eine Mätresse im Spiel war, denn Abigail hatte mitbekommen, dass die beiden Brüder intime Dinge durchaus miteinander besprachen. Sie war überzeugt davon, dass Anthony seinem Bruder George von einer anderen Frau erzählt hätte. Diese seltsam überstürzte Reise blieb Abigail ein Rätsel.
Als sie am Abend bei den Umans eintrafen, empfing sie der Butler, der sie in den Salon des Hauses führte. Abigail runzelte unmerklich die Stirn. Niemals würde sich ein Mitglied des alten Adels erlauben, seine Gäste – noch dazu wenn sie gesellschaftlich weit über ihnen standen – nicht an der Tür zu empfangen, sondern in den Salon kommen zu lassen.
»Abigail!« Mrs Uman ging mit ausgestreckten Armen auf sie zu, als sie den großen Raum betraten. In seiner Mitte plätscherte ein Springbrunnen, große Farne standen in den Ecken, und zwei Kamine spendeten eine angenehme Wärme. »Wie schön, dass Sie kommen konnten, wo Sie doch heute erst aus London zurückgekehrt sind, wie ich hörte.«
Abigail lächelte freundlich und reichte der Gastgeberin die Hand. Innerlich zuckte sie vor der ungehobelten Art der Frau zurück. Es gehörte sich ganz und gar nicht, sie mit ihrem Vornamen anzusprechen. Aber hier oben im Norden galten ohnehin andere Gesetze als in London, und seit Abigail mit Anthony verheiratet war und sich zwangsläufig viel in Gesellschaft anderer Fabrikanten bewegte, hatte sie es sich abgewöhnt, allzu sehr auf die Regeln der Etikette zu bestehen.
»Vielen Dank für die Einladung, Mrs Uman.« Abigail nahm ein Glas Sherry entgegen, das der Butler ihr reichte.
»Oh bitte, nennen Sie mich Isobell. Wir sind doch Freunde.« Mrs Uman verzog den Mund zu einem breiten Grinsen, was ihr ohnehin schon rundes Gesicht noch fleischiger wirken ließ. Mit den blonden Löckchen, die ihr in die Stirn fielen, erinnerte sie Abigail an eine antike Statue, wie sie im Garten von Hampton Hall standen. Isobell Uman war trotz allem auf eine gewisse Weise attraktiv.
»Lady Mahony.« Mr Uman, der in ein Gespräch mit einem weiteren Gast vertieft gewesen war, sah nun auf und ging auf Abigail zu. Seine lange, hagere Gestalt überragte Abigail um gut einen Kopf. Ein gepflegter Backenbart bedeckte seine Wangen. Abigail schätzte den Mann auf Mitte dreißig. Ein wohlwollendes Lächeln umspielte seine Lippen, als er sagte: »Wie schön, dass Sie unseren Abend durch Ihre Anwesenheit bereichern. Kennen Sie schon meinen Freund Sir Laurence Lancaster?« Er deutete auf den Herrn neben sich.
»Sir Laurence.« Abigail streckte dem schlanken großen Mann ihre Hand entgegen.
Sir Laurence ergriff sie und deutete einen Handkuss an. »Lady Mahony, welch eine Freude! Ich habe von Ihrer Schönheit gehört, doch sämtliche Beschreibungen reichen nicht an Ihren tatsächlichen Liebreiz heran.«
Abigail errötete. Sie wusste um ihr attraktives Aussehen, und doch war es ungehörig, es so offen anzusprechen. Noch dazu hatte sie ihn erst in diesem Moment kennengelernt. Ob Sir Laurence sich diese Taktlosigkeit herausnahm, weil ihr Mann Anthony nicht dabei war?
Da löste sich ein Schatten aus der hinteren Ecke des Salons, und Lord Walter Lutlow, ein alter Freund von Abigail und Anthony, kam auf sie zu. Ihm gehörte das größte Anwesen der Gegend. Seine Familie ging auf William the Conqueror zurück und hatte seit Jahrhunderten die Gerichtsbarkeit des Bezirks inne. Walter hielt regelmäßig den Gerichtstag in Stockmill ab.
Erfreut lächelte Abigail ihn an. »Ich wusste nicht, dass du auch hier bist, Walter.«
Er zwinkerte ihr zu, was bei jedem anderen anstößig gewirkt hätte, aber Abigail kannte ihn so lange, dass sie es als freundschaftliche Geste verstand.
»Wie geht es Ihrem Mann, meine Liebe?«, fragte Isobell und deutete auf das Sofa, das mit gelbem Seidenstoff bezogen war.
Abigail lächelte gezwungen. »Danke, sehr gut.«
»Wir hörten, er sei gesundheitlich angeschlagen«, warf Sir Laurence ein. Er wirkte noch sehr jung, kaum dem Knabenalter entwachsen. Sein dunkles Haar war dick und schimmerte im Licht der Kerzen. Laurence’ dunkle Augen blickten sie interessiert an.
»Als ich ihn zuletzt sah, schien mir Anthony bei bester Gesundheit zu sein«, widersprach Lord Lutlow, der neben dem Springbrunnen in der Mitte des Zimmers stehen geblieben war.
»Aber dieser plötzliche Aufbruch …« Isobell hob die Augenbrauen und ließ ihren Blick zwischen Abigail und Walter Lutlow hin und her wandern. »Ist es etwas Ernstes?« Sie nippte an ihrem Sherry.
»Nein, gar nicht.« Abigail sah ihre Gastgeberin an. »Eine kleine Unpässlichkeit. Nicht der Rede wert. Ein paar Tage Seeluft und es geht ihm schon viel besser.«
Abigails Finger spielten nervös mit ihrer langen Perlenkette. Schnell ließ sie ihre Hände in ihren Schoß sinken. Sie wusste ja nicht einmal, ob Anthony wirklich an die See gefahren war. Er hatte ihr keine Adresse hinterlassen. Um von dem Thema abzulenken, fragte sie: »Sir Laurence, was führt Sie in unsere Gegend? Sie stammen nicht von hier, nicht wahr?«
Der junge Mann lächelte. »Ganz recht, Eure Ladyschaft. Meine Ländereien liegen in Northumberland.«
»Ist das möglich?«, rief Abigail. »So weit nördlich? Dabei habe ich immer das Gefühl, am Nordpol zu wohnen.«
Die anderen lachten höflich und Sir Laurence fuhr fort: »Ich beabsichtige, ins Baumwollgeschäft einzusteigen, und Victor war so freundlich, mir seine Fabrik zu zeigen.« Er prostete Mr Uman zu, der ebenfalls das Glas hob.
»Ich hatte gehofft, heute Abend Lord Mahony zu treffen«, wandte er sich an George. »Schließlich ist Hampton’s Mill die größte Fabrik hier in Stockmill.«
Abigails Schwager nickte. »Das stimmt. Aber ich kann Ihnen sicher auch behilflich sein. Ich leite die Geschäfte während der Abwesenheit meines Bruders.«
»Das wäre großartig.«
»Hampton’s Mill ist ein Vorreiter in der Baumwollproduktion«, mischte sich nun Lord Lutlow in die Unterhaltung. »Erst dieses Jahr hat Anthony neue Webstühle und drei der modernsten Selfaktoren angeschafft.«
Die Männer vertieften sich in ein Gespräch über die Herstellung von Baumwolle, und Abigail hörte Isobell Umans ausschweifenden Erzählungen zu. Sie berichtete von einem Ball, der am vergangenen Wochenende bei den Regans von Bentley Hall stattgefunden hatte und den Abigail aufgrund ihrer Reise nach London verpasst hatte. Abigail sehnte sich zurück in die Gesellschaft der Londoner Damen, die so viel interessanter waren als diese plumpe Fabrikantengattin.
Das Dinner war gut, sehr gut, wie Abigail zugeben musste. Die Umans hatten einen französischen Koch eingestellt, der ein exquisites Mahl zubereitet hatte.
Als sie bei Kaffee wieder im Wohnzimmer saßen, spürte Abigail die Anstrengungen und Aufregungen des langen Tages allzu deutlich. Sie hatte Mühe, die Augen offen zu halten und Isobell Umans Geplapper zu folgen. Immer wieder wanderte ihr Blick zur Tür, in der Hoffnung, die Männer würden sich mit ihren Zigarren und dem Portwein beeilen. Sie sehnte sich danach, das Korsett und das unbequeme Kleid abzulegen und sich endlich auf ihrem Bett ausstrecken zu können.
»Sicherlich werden Sie im Dezember wieder Ihren berühmten Weihnachtsball geben, nicht wahr, Abigail?« Isobells Wangen waren gerötet vom Wein, die blonden Löckchen lösten sich allmählich aus der kunstvollen Frisur.
Abigail bemühte sich um ein verbindliches Lächeln und nickte.
»Wissen Sie, ich war im Mai auf einem großen Ball bei meiner Cousine in Bath. Dort ist eine Ballettgruppe aufgetreten. Ich habe sofort an Hampton Hall und Ihren Weihnachtsball gedacht. Den Platz dafür hätten Sie, ich könnte meine Schwester bitten, mir den Kontakt zu vermitteln.« Isobell trank ihren Kaffee aus.
Abigail versteifte sich. Was für eine impertinente Person! Jetzt wollte sich Mrs Uman auch noch in die Organisation ihres Balles einmischen.
Glücklicherweise wurde in diesem Moment die Tür zum Salon geöffnet, und die Männer kehrten ins Wohnzimmer zurück und befreiten Abigail damit von einer Antwort.
Sie entschuldigte sich bei ihrer Gastgeberin und stand auf. »Ich fürchte, der Tag war sehr anstrengend. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich zum Aufbruch dränge.« Sie sah George auffordernd an.
»Wie schade, dass Sie schon gehen müssen«, sagte Mr Uman. Er ergriff Abigails Hand und deutete einen Kuss an.
Auch Walter Lutlow verabschiedete sich von ihr. Als sie sich an den jungen Sir Laurence wandte, fasste er sie bei der Hand und sah ihr tief in die Augen. Abigail erschauderte unter dem durchdringenden Blick. Sie wandte den Kopf ab, doch er ließ ihre Hand nicht los. Erst nachdem George zu ihnen getreten war, lockerte sich sein Griff. Plötzlich steckte ein Zettelchen zwischen Abigails Fingern. Sie hielt inne, doch der junge Mann hatte sich bereits ihrem Schwager zugewandt. Abigail errötete, als ob sie bei einer Straftat erwischt worden wäre. Es war vollkommen ungehörig, dass ein Mann einer verheirateten Dame ein Briefchen zusteckte. Einen Moment lang überlegte sie, es fallen zu lassen und so zu tun, als hätte sie es nicht bemerkt. Aber was stand wohl in der Nachricht? Würde jemand falsche Schlüsse ziehen, wenn er sie fand? Unauffällig ließ sie den Brief in ihre Rocktasche gleiten.
Als sie endlich in der Kutsche saßen, war Abigail froh, Isobell Umans nicht enden wollendem Redefluss und Sir Laurence’ Blicken entkommen zu sein. Der Zettel lag schwer in ihrer Tasche.
Eine Weile fuhren sie schweigend durch die Dunkelheit. Nur das gleichmäßige Pferdegetrappel war zu hören. Abigail dachte über die Fabriken nach. Bislang hatte sie sich nie sonderlich für die Abläufe dort interessiert, es war Anthonys Arbeitsstätte, er war gern dort, und mehr war für Abigail nicht wichtig. Doch heute, als sie das Elend erkannt hatte, in dem die Arbeiter leben mussten, war ihr zum ersten Mal aufgefallen, wie wenig sie darüber wusste.
»George, wäre es möglich, dass du mir die Fabrik zeigst?« Sie sah zu ihrem Schwager, der neben ihr eingeschlummert war.
Jetzt öffnete er die Augen und blinzelte Abigail müde an. »Die Fabrik?«
Abigail nickte. »Hampton’s Mill. Ich würde gern mehr darüber wissen.«
»Warum um Himmels willen?« Er lehnte den Kopf gegen die Scheibe und tastete nach ihrer Hand. Seine Finger schlossen sich um ihre.