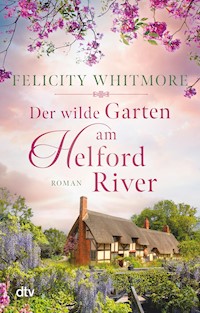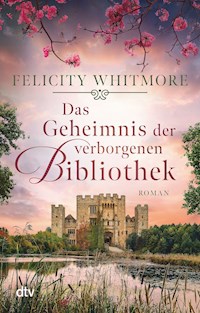9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hampton-Hall-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine alte Villa. Eine große Liebe. Ein dunkles Geheimnis. Zweiter Teil der Trilogie über die starken Frauen von Hampton Hall - Die ergreifenden Schicksale zweier tatkräftiger und beherzter Frauen - Für Leserinnen von Lucinda Riley, Kate Morton und Katherine WebbDie Staatsanwältin Melody Stewart flüchtet vor ihren beruflichen und privaten Problemen in die Vergangenheit. Im idyllischen Stockmill hat sie ein Haus geerbt und folgt mit Dan Rashleigh den verschlungenen Wegen der gemeinsamen Familiengeschichte. Dreh- und Angelpunkt dabei ist ihre Vorfahrin, die mutige Lady Abigail Hampton, die bereit war, aus Liebe alles zu opfern. Um ihren Geliebten Oliver Rashleigh vor der Hinrichtung zu retten, floh sie im Jahr 1843 mit ihm nach New York. Und von dort weiter Richtung Westen nach Oregon, wo sie sich eine neue Existenz aufbauten. Doch ihr Glück war schon bald bedroht: Unbemerkt hatte sich ein gefährlicher Verehrer an Lady Abigails Fersen geheftet. Alle Bände der Serie: Band 1: Der Faden der Vergangenheit Band 2: Die Straße der Hoffnung Band 3: Die Heimat des Herzens Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Felicity Whitmore
Die Straße der Hoffnung
Die Frauen von Hampton Hall
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine beste Freundin Sarah Krebs und meine kleine Patentochter Emilie Augustin
Prolog
Mai 1844
Victor Uman hatte sich noch nie so geschämt. Noch immer stieg ihm die Röte in die Wangen, wenn er an die letzte Nacht dachte. Es hatte ein Abend des Triumphes werden sollen, der glamouröse Aufstieg seiner Familie in die Kreise des Adels. Jetzt lehnte er sich als gebrochener Mann an den Kaminsims seines Arbeitszimmers. Dieser Bengel hatte ihn blamiert. Victor trank den letzten Schluck seines Brandys und warf das Glas in den Kamin. Es zerschellte, und die Scherben sprangen auf den Boden. Es war der sechste Brandy und das sechste Glas, das er heute zerschmetterte. Er presste die Lippen zusammen und rieb sich über das müde Gesicht. Die ganze Nacht hatte er kein Auge zugetan. Nie würde er den verzweifelten Blick seiner Tochter vergessen und den vorwurfsvollen seiner Frau. Dabei war er selbst es, dem die Affäre am meisten schadete. Hatte er doch geglaubt, durch eine Verbindung zwischen seiner Tochter und Ebenezer Hampton, dem fünften Lord of Mahony, ein geschicktes Geschäft eingefädelt zu haben. Nicht nur, dass seine Familie endlich in den alten Adel einheiraten würde und sich gesellschaftlich dadurch immens verbesserte, nein, er hatte vor allem an eine Zusammenlegung von Hampton’s Mill mit seiner eigenen Fabrik Uman’s Baumwollstoffe gedacht. Früher oder später hätte er Hampton’s Mill in seiner Fabrik aufgehen lassen und sich endlich die unumstrittene Führungsposition am Stockmiller Baumwollmarkt erkämpft.
Aber dieser sonst so dümmlich wirkende kleine Lord hatte ihn ausgetrickst. Monatelang hatte er ihn in dem Glauben gelassen, dass er sich auf die Hochzeit mit seiner Tochter freue, und dann, gestern, am Tag der Bekanntgabe der Verlobung, hatte er ihn abgewiesen. Die Gäste konnten nicht mehr informiert werden, die Blamage war besiegelt. Am Abend war Victor Uman vor die versammelte Gesellschaft getreten, um die geplante Verlobungsfeier abzusagen. Noch nie hatte er etwas derart Erniedrigendes tun müssen. Er hatte natürlich so getan, als könnte ihm all das nichts anhaben, aber er hatte sich zutiefst schlecht gefühlt. Und das war nur die Schuld dieses miesen kleinen Verräters Ebenezer Hampton!
Victor griff nach einem neuen Glas, füllte es bis zur Hälfte mit Brandy, stürzte die bernsteinfarbene Flüssigkeit hinunter und schmetterte auch dieses Glas in den Kamin. Aber wie viele Gläser er auch zerstörte, seine Wut und sein Hass auf den gegenwärtigen Lord of Mahony ließen nicht nach. Er würde sich an diesem Mistkäfer rächen, er würde ihn zerstören, sich seine Fabrik aneignen, koste es, was es wolle.
Es klopfte an die Tür seines Arbeitszimmers, und im nächsten Moment betrat sein Butler Darwin den Raum.
»Was ist?«, schnauzte Victor ihn an.
»Mr Scott, der Juwelier, ist wegen des Hochzeitscolliers hier«, sagte Darwin.
Victor stöhnte auf. Nahmen die Demütigungen denn kein Ende? Er hatte ein aufwendiges Collier bestellt, das seine Tochter Caroline zur Verlobung erhalten sollte, doch nun war das natürlich hinfällig.
»Bringen Sie ihn her«, befahl er und ließ sich in den Sessel am Kamin fallen.
Als Mr Scott wenig später hereinkam, hob Victor bloß die Hand und sagte in ruppigem Ton: »Vermutlich haben Sie es ja schon mitbekommen. Lord Mahony hat uns einen Korb gegeben. Sie können Ihr Collier also behalten.«
Mr Scott war mitten im Raum stehen geblieben. Jetzt trat er auf Victors Schreibtisch zu. »Ja, Sir, davon habe ich gehört.«
»Dann verschwinden Sie gefälligst«, brummte Victor, der es nicht für nötig hielt, sich aus dem Sessel zu erheben.
»Das würde ich ja gern tun«, Mr Scott hob die Schultern und setzte sich sein Monokel auf die Nase, »aber ich habe einen unterzeichneten Auftrag von Ihnen und kann das Schmuckstück nicht zurücknehmen. Ich habe die Edelsteine extra für Sie bestellt.«
»Schicken Sie sie zurück!«, rief Victor wütend und fasste sich an den Kopf, als eine Welle von Schmerz über ihn hinwegrollte.
»Ich fürchte, das geht nicht, Mr Uman.« Mr Scott hob bedauernd eine Hand und stellte den Koffer, den er in der anderen trug, vor Victor auf den Tisch. »Schauen Sie sich die hervorragende Qualität der Steine an. An so wertvolle Diamanten kommen Sie so schnell nicht noch einmal.«
Missmutig richtete Victor sich in seinem Sessel auf. Die Diamanten funkelten. Sie waren wirklich herausragend, das musste er zugeben. »Vielleicht kann man daraus etwas anderes machen?«
»Das wäre möglich«, sagte Mr Scott und dachte eine Weile nach. »Ich habe vor ein paar Jahren aus ähnlichen Steinen eine Art Skulptur für die verstorbene Lady of Mahony angefertigt. Was wohl mit diesem Schmuckstück geschehen ist?«
Victor hielt inne. »Was genau haben Sie für die Lady angefertigt?«
Mr Scott zögerte. Offensichtlich überlegte er, ob er die Informationen preisgeben durfte.
»Sie ist tot«, erinnerte Victor ihn, er war plötzlich hellwach.
Das schien den Juwelier zu überzeugen. Bereitwillig erzählte er: »Oh, das war ein ungewöhnlicher Auftrag. Die Lady gab uns sämtliche Schmuckstücke aus Hampton Hall und auch aus ihrem Privatbesitz, und wir haben daraus eine Art Madonnenfigur geschaffen. Ein ausgesprochen wertvolles Stück. Ich war zuerst skeptisch, schließlich waren Gold, Silber, Platin und Edelsteine im Wert von mehr als einer Million Pfund darin verarbeitet. Und diese verschiedenen Materialien in einem einzigen Kunstwerk zu vereinen, war eine eigenartige Bitte. Aber Seine Lordschaft hat den Auftrag unterschrieben, und am Ende wurde es ein wunderschönes Stück.«
»Wo ist diese Madonna jetzt? Abigail ist tot und ihr Ehemann Anthony auch. Eine so wertvolle Skulptur kann doch nicht spurlos verschwunden sein.« Victor wusste noch nicht, wie er diese Informationen verwenden konnte. Vielleicht würden sie ihm ja dabei helfen, seinen Plan voranzutreiben, Ebenezer für das, was er ihm angetan hatte, bezahlen zu lassen.
Der Juwelier hob die Schultern. »Ich habe sie Ihrer Ladyschaft im Sommer 1841 in ihre Villa Abigail’s Place gebracht. Vielleicht ist sie noch in dem Haus.«
Victor nickte. Das war durchaus möglich. Und soweit er wusste, stand dieses Haus zurzeit leer. Es war zwar unwahrscheinlich, dass sich die Skulptur noch dort befand – aber in der Aufregung damals … Wer wusste schon, was genau geschehen war? Vielleicht war dieser Schatz ja immer noch irgendwo in dem Haus versteckt.
Eine Skulptur im Wert von mehr als einer Million Pfund würde ihn für die Schmach, die Ebenezer ihm angetan hatte, wohl entschädigen, aber Victor ging es nicht um Geld. Nein, davon hatte er selbst genug. Er wollte sich nicht bloßstellen lassen, einen einflussreichen Unternehmer wie ihn ließ man nicht einfach mit seiner Tochter vor dem Altar stehen. Ihm fiel der Brief ein, der ihn vor einigen Tagen aus Richmond erreicht hatte. Sein Freund Sir Laurence hatte überaus interessante Entdeckungen gemacht. Und Sir Laurence war Wachs in seinen Händen. Ja, mit seiner Hilfe würde ihm die Rache an den Lords of Mahony gelingen.
Er lächelte Mr Scott zufrieden an und dachte: Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich doch immer eine andere.
Kapitel 1
Februar 2018
Haben Sie denn nichts geahnt?«, fragte die Ärztin, während sie mit dem Ultraschallgerät über Melodys Bauch strich.
Melody schüttelte kraftlos den Kopf. Sie lag starr auf der unbequemen Behandlungsliege. Das Gel auf ihrem Bauch war kalt und feucht. Die Geräte summten in dem abgedunkelten Zimmer, das nach Desinfektionsmittel roch. Melody war entsetzt. Ja, sie hatte sich müde gefühlt, erschöpft und gereizt. Doch das hatte sie zunächst auf ihre veränderte Lebenssituation geschoben. Die Trennung von ihrem Mann Philip, die neue Beziehung zu Dan und der anstrengende Job als Oberstaatsanwältin. Und nicht zuletzt vermisste sie ihre Töchter Mia und Miranda, die weit weg bei ihrem Vater in London lebten.
Vor ein paar Tagen hatte sie nicht mehr verdrängen können, dass etwas nicht stimmte. Ihre Periode war ausgeblieben, was sie zunächst auf den Beginn der Wechseljahre geschoben hatte. Immerhin war sie schon über vierzig.
»Für einen Abbruch ist es noch nicht zu spät«, erklärte Doktor Owen ihr gerade. »Sie sind erst in der dreizehnten Woche.«
Melody schloss die Augen. Das musste ein entsetzlicher Alptraum sein. Ein Baby? Jetzt? Das war einfach unmöglich. Sie konnte sich im Augenblick keine berufliche Pause leisten. Nachdem sie im letzten Jahr zur Oberstaatsanwältin in Stockmill ernannt worden war, hatte sie zunächst Schwierigkeiten gehabt, sich einzuleben. Ihre inzwischen fast fünfzehnjährigen Töchter lebten zwei Autostunden entfernt bei ihrem Vater, und Melody hatte Angst vor einer Entfremdung gehabt. Deshalb hatte sie einen Rückversetzungsantrag gestellt, den sie jedoch nach einer Aussprache mit ihren Töchtern zurückgezogen hatte. In den letzten Wochen hatte sie sich stark auf den neuen Job konzentriert und sich gut eingearbeitet. Wenn sie jetzt noch ein Kind bekam, würde das ihre Karriere zum Stillstand bringen.
Doktor Owen hängte das Ultraschallgerät in die Halterung und wischte Melodys Bauch mit einem Papiertuch trocken.
»Die Blutwerte sind morgen da.« Die Ärztin stand auf und schaltete das Licht wieder ein.
Melody rollte sich benommen von der Liege und starrte die ältere Frau an. Im Blick der Ärztin meinte sie den Hauch eines Vorwurfs zu erkennen. Oder bildete sie sich das ein, weil sie sich selbst vorwarf, nicht genug aufgepasst zu haben? Dreizehn Wochen. Sie rechnete hektisch nach. Das musste ganz am Anfang ihrer Beziehung zu Dan passiert sein.
Melody räusperte sich. Sie erkannte ihre eigene Stimme kaum, als sie fragte: »Wie riskant ist eine Schwangerschaft in meinem Alter?«
Doktor Owen lächelte. »Natürlich steigt das Risiko, je älter die Mutter ist. Aber Sie sind keine Erstgebärende.«
Melody nickte mechanisch.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie auf sich achten, sich ein wenig mehr Ruhe gönnen und mir sofort Bescheid geben, wenn Ihnen irgendetwas seltsam vorkommt, sehe ich keine Probleme.«
Melody hatte das Gefühl, gleich in Tränen ausbrechen zu müssen. Sie konnte sich keine Ruhe gönnen. Schließlich hatte sie einen anspruchsvollen Job, den sie sich hart erarbeitet hatte. Sie hörte nur halbherzig zu, als die Ärztin ihr die nächsten Termine nannte und den Mutterpass aushändigte.
Sie konnte sich kaum an die Rückfahrt nach Hause erinnern. Als sie ihr Auto am Rande des kleinen Parks abstellte, der Abigail’s Place umgab, war Dans Wagen schon da. Melody schluckte. Was würde er dazu sagen? Dan hatte keine Kinder. Sie kannten sich erst relativ kurz, und Melody wusste so wenig über ihn. Wollte er Kinder haben? War er überhaupt zum Vater geeignet? Sofort fiel ihr Philip ein, der Melody vor den Augen ihrer gemeinsamen Töchter mit Emily, der Haushaltshilfe, betrogen hatte. Was, wenn Dan sich auch als Fehlgriff herausstellte? Eine solche Affäre hätte Melody Philip nie zugetraut, und ihn kannte sie immerhin schon seit vielen Jahren. Dan hingegen war sie erst vor wenigen Monaten begegnet. Wer war er? Wollte sie ihn als Vater ihres Kindes überhaupt haben?
Melody ging über den schmalen Weg zum Eingang des Hauses. Die Handwerker waren anscheinend schon nach Hause gegangen, sie hatten die alte Villa in eine Baustelle verwandelt. Melody hatte elektrische Leitungen verlegen und eine Heizung einbauen lassen. Die letzten Monate waren so kalt gewesen, dass sie oft bei Dan übernachtet hatte, weil es in Abigail’s Place eisig war. Das Haus hatte hundertsechzig Jahre lang leer gestanden, und es war ein enormer finanzieller Aufwand nötig, um das Gebäude komplett zu modernisieren. Doch inzwischen war die Villa viel gemütlicher und wärmer geworden. Nun musste Melody sie noch entrümpeln, ehe sie weitere Renovierungsarbeiten vornehmen konnte.
Nachdem sie die Haustür aufgeschlossen hatte, hielt sie einen Augenblick inne. Es roch nach frischem Putz, Mörtel und verbranntem Gummi. Darunter mischte sich der Geruch von Moder, Staub und Rauch. Plötzlich hatte sie Angst davor, Dan von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Wie würde er reagieren? Was, wenn er sie daraufhin verließe? Sie starrte auf die bunten Fliesen zu ihren Füßen, die seit über hundertsechzig Jahren diese Halle schmückten. Eigentlich brauchte Dan sie nicht einmal zu verlassen. Schließlich war ihre Beziehung noch in einem Stadium, in dem jeder sein eigenes Leben führte. Getrennte Wohnungen, regelmäßige Verabredungen. Zurzeit sahen sie sich eher selten, denn Dan hatte oft Bereitschaftsdienst bei der Polizei, und Melody kam immer erst spät nach Hause. Er müsste sich nur nie wieder bei ihr melden …
Melody schüttelte den Kopf. Sie selbst hatte darauf bestanden, es langsam angehen zu lassen. Immerhin war die Trennung von Philip noch frisch, und sie wollte sichergehen, dass nicht allein Dan der Grund dafür war. Aber jetzt? Die fehlende Verbindlichkeit lastete mit einem Mal schwer auf ihr. Melody wurde übel, als sie daran dachte, das Kind vielleicht allein großziehen zu müssen. Sie versuchte die aufsteigende Panik zu unterdrücken und atmete tief durch.
Dann rief sie nach Dan, und kurz darauf erschien sein Kopf wenige Meter über Melody am Treppengeländer. Über ihm erstrahlte das bunte Deckenfenster im Schein der Abendsonne, die das große Treppenhaus in ein warmes Licht tauchte.
»Hallo, Liebling, komm hoch, die Lampen funktionieren seit einer halben Stunde. Die Arbeiter haben den Strom freigeschaltet«, rief er. »Jetzt können wir endlich die ganzen Unterlagen aus den Kartons lesen, die deine Vorfahren hierhergebracht haben.«
Melody winkte ihm teilnahmslos zu und zog den Mantel aus. Sie war viel zu müde, verwirrt und verzweifelt, um in den alten Kisten zu wühlen, die ihre Verwandten nach dem Verkauf des Familiensitzes Hampton Hall hier in der Villa deponiert hatten.
Sie musste es Dan sagen. Aber wie? Sie stieg die Treppe hinauf bis unters Dach, wo Dan bereits auf sie wartete.
»Tada!«, machte er, als Melody eintrat. Er knipste den Lichtschalter an, und eine nackte Glühbirne leuchtete auf. »Ist das nicht der Wahnsinn? Plötzlich kann man jedes Staubkorn sehen.«
Melody lächelte halbherzig und ließ sich von ihm in die Arme ziehen.
»Schau mal«, sagte Dan und ging zu einem der vielen Umzugskartons, die im Raum standen. Er schien viel zu aufgeregt zu sein, um Melodys Verwirrung zu bemerken. »Das hier sind alles Briefe an Ebenezer.«
Melody nickte. »Ich weiß. Auf der Suche nach Abigails Tagebüchern habe ich diese Kisten ja schon mal durchgesehen.«
Nachdem sie im letzten Herbst auf die unglaubliche Geschichte ihrer Vorfahrin Abigail gestoßen war, hatte Melody monatelang versucht, mehr über sie und ihre Familie in Erfahrung zu bringen. Sie hatte sämtliche Winkel der Villa durchkämmt und schließlich eingesehen, dass sie wohl keine Informationen zu Abigails späterem Leben hier finden würde.
»Abigail und ihr Geliebter Oliver wollten nach Amerika fliehen. In Stockmill gingen alle davon aus, dass Oliver gehängt wurde und dass Abigail aus Kummer um ihn Selbstmord begangen hat«, sagte Melody und trat neben Dan.
»Außer Ebenezer«, warf Dan ein. »Er wusste, dass seine Mutter nach Amerika gegangen war.«
»Aber um sie zu schützen, musste er jeglichen Kontakt mit ihr vermeiden. Abigail hat ihm sicher nicht aus Amerika geschrieben, die Gefahr einer Entdeckung war einfach zu groß.«
Melody hatte lange nicht wahrhaben wollen, dass ihr Abigails weiteres Schicksal für immer verborgen bleiben würde. Erst als ihr klar wurde, dass Abigail die Verbindung zu ihrer Heimat England vollkommen hatte aufgeben müssen, um überleben zu können, hatte sie aufgehört zu suchen.
»Vielleicht sind sie damals auf der Überfahrt ums Leben gekommen«, überlegte Dan. »Schließlich war die Überquerung des Atlantiks 1842 noch sehr gefährlich.«
»Wer weiß …« Melody zögerte. Wenn sie es jetzt nicht endlich sagte, würde sie vielleicht nie den Mut dazu finden. »Dan?«
»Was denn?« Er zog eine dicke Ledermappe aus dem Karton und schlug sie auf. »Wahnsinn! Diese Briefe sind kurz nach Abigails Weggang an Ebenezer geschrieben worden.«
Melody wartete darauf, dass er sich ihr zuwandte, aber Dan war in die alten Papiere vertieft. Also trat sie neben ihn und sah ihm über die Schulter. Sie würde es ihm jetzt sagen. Kurz und schmerzlos.
»Dan, ich fühle mich in letzter Zeit nicht so gut …«
»So?« Er warf ihr einen kurzen Blick zu und blätterte dann vorsichtig durch die alten Papiere. Melody erkannte, dass es sich um Firmendokumente aus dem neunzehnten Jahrhundert handelte. »Du arbeitest zu viel, mein Liebling. Was hältst du davon, wenn wir ein paar Tage wegfahren, vielleicht nach …«
Er brach ab und blickte auf ein Dokument, das zwischen den Auftragsformularen, Listen und Briefen an Lord Ebenezer Mahony lag. Melody folgte seinem Blick und stieß einen leisen Schrei aus. Sie starrte auf die Schrift, die sie wie ihre eigene kannte. Der Brief war an Ebenezer Hampton, den fünften Lord of Mahony, gerichtet. Auch wenn der Absender sich Albert Harvey Ottokar Riley nannte, wusste Melody, dass der Brief von Abigail stammte. Mit zitternden Fingern zog sie das Papier zwischen den anderen Dokumenten hervor und las:
Willamette Tal, 13. Februar 1844
Eure Lordschaft,
mein Name ist Albert Harvey Ottokar Riley, und ich wende mich heute mit einem geschäftlichen Anliegen an Sie. Meine Gattin und ich sind im Jahre 1842 von England nach Amerika ausgewandert, und das Schicksal hat uns in den Westen des Kontinents geführt. Der Weg hierher war steinig, und wir haben kaum noch finanzielle Mittel, aber gleichzeitig sind wir auch glücklich über die Möglichkeiten, die sich uns hier in diesem fremden Land bieten. In den sehr wilden Gebieten des Westens gibt es kaum Kleidung für die ausgezehrten Siedlerfamilien, und wir möchten Abhilfe schaffen. Nun überlegen wir, wie wir nicht nur uns, sondern auch möglichst vielen anderen Menschen, die momentan ohne Einkommen sind und unsicher in die Zukunft blicken müssen, helfen können. Da wir in England bereits geschäftlich miteinander zu tun hatten, kam meiner Gattin die Idee, unsere Beziehung wieder aufleben zu lassen.
In der Hoffnung, dass Ihre Geschäfte gut laufen und Sie sich der Armen annehmen und auch Ihre Arbeiter gerecht behandeln, wie es Sie Ihre Mutter gelehrt hat, bitten wir Sie um einen Vertrauensvorschuss, wie er sonst nur unter Familienangehörigen üblich ist. Wenn Sie uns auf dem Seewege einige Stoffe Ihrer Fabrik zukommen lassen würden, mit denen wir hier in Oregon ein Handelsgewerbe aufbauen könnten, wären wir Ihnen von Herzen dankbar. Allerdings wären wir leider erst in der Lage, Ihre Rechnung zu begleichen, wenn wir die ersten Stoffe verkauft hätten. Als Sicherheit können wir Ihnen nur unser Wort geben, das – wie Sie wissen – verbindlich für uns ist. Sollten Sie sich auf dieses Geschäft einlassen, schicken Sie die Ware bitte zum Hafen von Fort Vancouver, der ganz in unserer Nähe liegt.
Wir hoffen, Sie sind wohlauf und glücklich. Wie geht es Ihrem Bruder Hugo? Wir senden Ihnen hiermit die herzlichsten Wünsche und die Versicherung, dass wir oft an Sie denken.
Ihr Albert Harvey Ottokar Riley nebst Gattin
Melody starrte auf den Brief. Die Initialen des Namens waren die Anfangsbuchstaben von Abigails und Olivers Namen.
Wortlos legte Dan das Dokument zurück in die Mappe.
»Unglaublich«, stieß er hervor, »und ausgesprochen clever. So konnte sie ihrem Sohn mitteilen, dass es ihr gut ging, und mit ihm in Kontakt bleiben.«
In der Kladde steckten noch andere Briefe, ebenfalls in Abigails Handschrift. Obwohl es Melody drängte, weiterzulesen, stand sie auf und ging zur Treppe nach unten. Dan folgte ihr. Im Salon schaltete Melody ihren Laptop ein und wartete ungeduldig, bis er hochgefahren war. Dann suchte sie den Namen Albert Harvey Ottokar Riley im Internet.
Als sie den ersten Eintrag las, der oben auf der Seite auftauchte, schlug sie verblüfft die Hand vor den Mund. AHOR. Konnte das möglich sein? Hatte Abigail damals mit ihrem Stoffhandel tatsächlich den Grundstein für die bekannte amerikanische Kleidungsmarke AHOR gelegt? Wenn diese Vermutung stimmte und Abigail und Oliver wirklich die erfolgreiche Modefirma gegründet hatten, dann gab es sicher noch genauere Informationen über die beiden. Melody klickte auf einen Wikipedia-Artikel, der sich mit dem Unternehmen befasste. Schnell überflog sie den Eintrag und scrollte zu der Rubrik »Geschichte« hinunter.
Das Unternehmen wurde 1843 von dem englischen Auswanderer-Ehepaar Adriana und Albert Harvey Ottokar Riley gegründet, die im Januar 1842 nach Amerika kamen. Sie schlossen sich dem großen Siedlertreck an, der im Mai 1843 in den Westen zog. Über die frühen Jahre des Ehepaares ist nicht viel bekannt. Wie Briefen zu entnehmen ist, die sich im Besitz der Familie Riley befinden, waren Adriana und Albert bereits in England als Geschäftsleute aktiv. 1847 kam es zu einem Familiendrama, als Adriana ihren Mann Albert Harvey Ottokar Riley im Schlaf erstach.
Melody keuchte erschrocken auf. Das war unfassbar. Abigail hatte Oliver doch geliebt, sie hatte England für ihn verlassen, und er hatte für sie gelogen.
»Das … ich kann das nicht glauben!«, stieß sie hervor.
Dan, der den Eintrag ebenfalls gelesen hatte, schüttelte den Kopf. »Das ergibt keinen Sinn. Warum soll sie ihn umgebracht haben?«
Melody sah Dan an, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Sie dachte an die liebevollen Worte, mit denen Abigail Oliver in ihrem Tagebuch beschrieben hatte, an den Großmut und die Gerechtigkeit, mit der er gehandelt hatte. Damals hatte er die Verantwortung für einen Mord auf sich genommen, den Abigails Sohn Ebenezer begangen hatte. Damit hatte er Ebenezer vor dem Tod durch den Strang bewahrt. Was konnte geschehen sein, dass Abigail ihren treuen Geliebten Oliver tötete?
Melody gab in das Suchfeld nun »Adriana Riley« ein und betrachtete die Ergebnisse. Sie klickte auf einen Eintrag, der zu der AHOR-Firmenwebsite führte. Ein unscharfes Schwarz-Weiß-Bild leuchtete ihr entgegen, auf dem sie ihre Vorfahrin sofort erkannte. In Dans Elternhaus hing ein Gemälde von Abigail, das sie zwar noch deutlich jünger zeigte als auf dieser Fotografie, aber die Ähnlichkeit war nicht zu übersehen. Das dunkle Haar, die schwarzen Augen, die von langen Wimpern eingerahmt wurden, und der entschlossene Blick. Abigail stand, zusammen mit einem Mann, neben einem großen Suppenkessel. Ob das Oliver war? Melody las die Bildunterschrift:
Adriana und Albert Harvey Ottokar Riley 1842 in New York. Sie gründeten wenige Jahre nach der Entstehung dieser Fotografie unsere Firma AHOR und entwarfen die ersten Kleider.
Und doch passte das alles nicht zusammen. Die Frau auf dem Foto, die sich Adriana Riley nannte, war eindeutig Abigail. Auch die Handschrift des Briefes, der angeblich von Adrianas Mann Albert stammte, war zweifelsfrei ihre. Adriana war also Abigail. Aber warum sollte Abigail Oliver ermordet haben, nach allem, was er für sie getan hatte?
Wieder kehrte Melody zu der Suchmaschine zurück und öffnete jetzt den Wikipedia-Eintrag zu Adriana Riley. Er enthielt das gleiche Bild wie auf der Firmenwebsite, und darunter stand: Adriana Riley um 1842. Da musste Abigail etwa vierzig Jahre alt gewesen sein. Melody überflog den Artikel und stockte, als sie las, dass Abigail, alias Adriana, im Jahr 1848 angeblich einen Sohn namens William geboren hatte. Das konnte doch alles nicht stimmen. War sie beim Tod ihres geliebten Oliver etwa schwanger gewesen? Hatte sie den Vater ihres ungeborenen Kindes ermordet? Das passte nicht zu der Frau, die Melody in ihren Tagebüchern kennengelernt hatte.
Melodys Blick wanderte durch den Salon von Abigail’s Place. Hier hatte Abigail vor vielen Jahren gesessen. Wenn sie ihr nur erzählen könnte, was damals in Amerika geschehen war!
»Abigail muss, als ihr Kind zur Welt kam, schon über vierzig gewesen sein«, stellte Dan fest, der über Melodys Schulter mitgelesen hatte.
»Das bin ich auch«, erwiderte Melody.
»Aber du bekommst keine Kinder mehr«, sagte er.
Melody zuckte zusammen. Kälte stieg in ihr auf. Was wollte Dan damit sagen? Dass er es unverantwortlich fand, wenn man in diesem Alter noch Mutter wurde?
Sie atmete tief durch und starrte auf den Bildschirm. »Ich finde nirgendwo ein Sterbedatum von Abigail. Was ist nach der Geburt des Kindes mit ihr geschehen?«
»Ob sie Oliver wirklich getötet hat?«, sagte Dan nachdenklich.
»Nein, das kann ich nicht glauben«, erwiderte Melody. »Das passt nicht zu ihr.«
»Aber irgendjemand scheint davon auszugehen. Immerhin steht es so im Internet, und ich denke, dass AHOR sehr auf seine Firmengeschichte achtet. Sollte es irgendeinen Zweifel an diesem Mord geben, hätte die Firma das doch längst klargestellt, oder etwa nicht?«
Melody zog die Schultern hoch.
»Ich denke, sie ist vermutlich gehängt worden«, führte Dan seine Gedanken zu Ende. »Nur eigenartig, dass man nichts darüber findet.« Dan nahm Melody den Laptop ab und tippte »Adriana Riley Todestag« in die Suchmaschine. Es gab kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Melody stand auf und trat an den Kamin. »Wenn wir nur irgendwie an Dokumente herankommen könnten, die uns Abigails Geschichte in Amerika erzählen.«
»Du meinst weitere Tagebücher?«, fragte Dan.
Melody nickte. »Sie hat hier in Stockmill ausführlich Tagebuch geschrieben. Dann wird sie in Amerika doch nicht plötzlich damit aufgehört haben.«
»Stimmt. Aber diese Tagebücher müssten wohl irgendwo in Oregon sein oder wo immer sie zuletzt war«, stellte Dan fest. Er stand auf und zog Melody in seine Arme. »So, mein Liebling. Ich muss jetzt gehen. Meine Eltern sind momentan ziemlich anstrengend.«
Melody schmiegte sich an ihn. »Es ist bestimmt nicht leicht, mit ihnen zusammenzuleben.«
»Ja. Wir müssen eine Entscheidung treffen, es kann auf die Dauer nicht so weitergehen. Sie können nicht mehr ohne Aufsicht sein.« Dan sah sie nachdenklich an. Dann küsste er sie und schob sie in Richtung Eingangstür.
Melody hatte es ihm den ganzen Abend sagen wollen, aber die neuen Entdeckungen über ihre Vorfahrin hatten sie immer wieder abgelenkt. Jetzt musste sie es endlich tun, bevor er ging. Sie wollte ihr Geheimnis unbedingt loswerden.
»Dan?« Ihre Stimme klang dünn.
»Ja?« In seinen Augen lag Müdigkeit und Sorge.
Melody hielt inne. Sie spürte, wie groß die Belastung war, die er mit seinen Eltern zu tragen hatte. Sie wollte ihm von der Schwangerschaft erzählen, aber sie brachte es einfach nicht fertig. Stattdessen sagte sie: »Ihr findet schon die richtige Lösung. Mach dir nicht zu viele Gedanken.«
»Du hast recht«, sagte er, aber Melody spürte, dass er die Worte selbst nicht glaubte. Nein, im Augenblick konnte sie ihm nicht noch mehr Sorgen aufhalsen.
Kapitel 2
Januar 1842
Das ist sie.« Walter Lutlow deutete auf das gewaltige Dampfschiff, das außerhalb der Docks vor Anker lag.
Abigail rutschte in dem weichen Polstersitz der eleganten Equipage nach vorn und folgte Walters Blick. Der Schornstein der Britannia stieß bereits dicke Rauchwolken aus.
»Jetzt ist also endgültig die Zeit des Abschieds gekommen«, sagte Oliver Rashleigh und lächelte Abigail tapfer an. Doch sie erkannte den Schmerz in seinen Augen. Ihm fiel es genauso schwer, England zu verlassen, wie ihr selbst. Sie ließen beide ihre Kinder zurück, und das war das größte Opfer, das sie ihr Überleben kostete. Doch hier in England erwartete Oliver der Strick und Abigail Verachtung und gesellschaftlicher Ruin. Denn Lord Walter Lutlow hatte Oliver wegen des Mordes an Abigails Schwager zum Tode verurteilt. Walter wusste, dass Oliver unschuldig war, doch es war ihm – genau wie Abigail und Oliver – daran gelegen, den wahren Täter zu schützen. Unwillkürlich wanderte Abigails Blick zu dem vierten Mitglied ihrer kleinen Reisegesellschaft, zu ihrem Sohn Ebenezer. Der Achtzehnjährige saß mit unbewegter Miene neben ihr. Sein Atem bildete kleine Wölkchen in der kalten Winterluft.
»Wenn ihr diese Kutsche verlasst, seid ihr Abigail und Oliver Middleton«, sagte Walter. Er zog einen Stapel Papiere aus seiner Jackentasche und ließ seinen Blick zwischen Abigail und Oliver hin- und herwandern. »Abigail Hampton, Lady of Mahony, und den ehemaligen Verwalter Oliver Rashleigh gibt es ab jetzt nicht mehr.«
Abigail atmete tief ein. Sie nickte. Es tat weh, die eigene Existenz auslöschen zu müssen. Doch dadurch, dass sie zu ihrer Liebe zu Oliver stand, hatte sie sich selbst aus der Gesellschaft gestoßen. Und Oliver war nur durch Walter Lutlows Güte dem Strang entkommen. Die Bedingung des Richters war ebenso einfach wie grausam: Oliver Rashleigh musste für tot gehalten werden und durfte in England nie wieder gesehen werden. Abigail blieb nichts anderes übrig, als das Land an der Seite ihres Geliebten zu verlassen, wenn sie die Zukunft ihrer Söhne nicht zerstören wollte. Sie würde ihnen enormen gesellschaftlichen Schaden zufügen, wenn sie in England bliebe. Und doch war es für sie das Schwerste auf der Welt, Ebenezer und Hugo für immer zurückzulassen. Ihr jüngerer Sohn Hugo durfte nicht einmal wissen, dass seine Mutter und ihr Geliebter noch am Leben waren. So wenige wie möglich sollten das Geheimnis kennen, um Oliver nicht in große Gefahr zu bringen und Walter Lutlow nicht als Betrüger bloßzustellen, der sich das ganze Komplott ausgedacht hatte. Hugo war erst vierzehn, und wie schnell konnte er versehentlich etwas verraten. Also mussten sie ihn – genau wie Olivers Kinder – in dem Glauben lassen, dass Abigail nach der Hinrichtung des Verwalters den Freitod gewählt hatte.
Von draußen drang das Geschrei der Möwen in die Kutsche. Abigail hörte Männer rufen und aufgeregte Kinderstimmen. Die Kälte kroch durch ihren dicken Wintermantel.
»Es ist gleich ein Uhr«, sagte Walter Lutlow und räusperte sich. »Der kleine Dampfer, der euch zur Britannia bringt, läuft in wenigen Minuten aus.«
Ein Schluchzen entfuhr Abigail. Sie schlug die Hand vor das Gesicht, um sich wieder zu fangen, und spürte gleich darauf Ebenezers kalte Finger auf ihrem Arm. Verzweifelt zog sie ihren Sohn an sich. Ein letztes Mal atmete sie seinen Duft ein und spürte seine Nähe. Sie versuchte den Gedanken an jenen Tag zu verdrängen, als sie ihn als Neugeborenen zum ersten Mal in ihren Armen gehalten hatte. Fortan würde er nur noch eine Erinnerung für sie sein.
»Mutter«, flüsterte Ebenezer. »Es tut mir so leid.«
Sie presste ihn noch fester an sich. »Du hast dir nichts vorzuwerfen, mein Liebling. Pass auf deinen Bruder auf und sei immer ein gerechter und gütiger Herr.«
Ebenezer nickte. Unwillig ließ Abigail ihn los und wischte sich über das nasse Gesicht. Dann wandte sie sich an Walter. »Ich gebe die Jungen in deine Hand und vertraue dir. Bis Ebenezer volljährig ist und selbst über seinen Besitz verfügen kann, verwalte du alles mit Klugheit und in Anthonys und Ebenezers Sinn.«
Sie dachte an ihren Ehemann, der an einer seltsamen Krankheit gelitten hatte, die seinen Verstand aufzufressen schien. Abigails Schwager, Anthonys Bruder, hatte ihn in eine Anstalt gebracht, in deren Mauern er kurze Zeit später verstorben war.
Abigail schluckte und konzentrierte sich auf Walter Lutlows Worte.
»Selbstverständlich, meine Liebe!« Die Stimme des Richters klang belegt. Seine Augen schimmerten feucht.
»Ich danke dir.« Abigail drückte ein letztes Mal Ebenezer an sich und stand auf, bevor sie Walter die Hand reichte. »Danke. Für alles.«
Er nickte und gab ihr die Papiere.
Abigail schüttelte den Kopf. »Von nun an sind wir Mr und Mrs Oliver Middleton. Diese Dokumente stehen meinem Mann zu.«
Ohne sich noch einmal umzusehen, verließ sie die Kutsche. Sie musste um Atem ringen und versuchte ein Schluchzen zu unterdrücken. Tränen strömten über ihre Wangen, nie war ihr ein Weg so schwergefallen wie dieser. Einen Teil ihres Herzens ließ sie an diesem eisigen Januartag in der Kutsche bei ihrem Sohn zurück. Von nun an klaffte ein tiefes Loch in ihr, das sie bis zum letzten Atemzug begleiten würde.
Abigail spürte Olivers Hand auf ihrem Arm. Ohne ihn ansehen zu müssen, wusste sie, dass es ihm ebenso elend zumute war wie ihr. Ein Träger hatte ihr Gepäck auf einen Karren geladen. Als Abigail und Oliver sich nun langsam in Bewegung setzten, folgte er ihnen durch die Menschenmenge aus Matrosen und Reiselustigen, Abschiednehmenden und Hafenhändlern. Die salzige Meeresluft legte sich auf ihre Gesichter und vermischte sich mit ihren Tränen. Ein paar Matrosen sangen Shantys, eine Gruppe junger Reisender lachte lauthals. Abigail bewegte sich wie in einem Traum. Sie nahm das aufgeregte Durcheinander um sich herum kaum wahr, während Oliver sie zum Landungssteg hinunterführte, wo das Dampfboot lag, auf dem sich bereits mehrere Dutzend Passagiere drängten. Die Hälfte des Bootes war durch Gepäck belegt.
Mit zitternden Beinen kletterte Abigail auf das kleine Schiff, das sie zu dem Ozeandampfer hinüberbringen würde. Kaum hatten sie mitten unter den anderen Menschen einen Platz gefunden, legte es auch schon ab. Abigail sah zum Kai zurück und erkannte die von Lord Walter Lutlow gemietete Kutsche. Sie konnte Ebenezer und Walter nicht sehen, aber sie wusste, dass sie sie durch das Kutschenfenster beobachteten. Also hob Abigail die Hand zu einem letzten Gruß. Ihr Herz krampfte sich zusammen, der Schmerz war so überwältigend, dass sie in diesem Augenblick glaubte, daran zu ersticken. Mit letzter Kraft wandte sie sich ab und blickte dann entschlossen nach vorn, in Richtung der Britannia, die sie in ihre Zukunft bringen sollte und die nur schemenhaft in dem dichten Nebel des Wintertages zu erkennen war.
Bald näherten sie sich dem großen Paketschiff, aus seinem roten Schornstein stieg bereits dunkler Rauch auf. An der Reling konnte Abigail eine Reihe herausgeputzter Offiziere erkennen, die auf die Neuankömmlinge warteten.
»Wie lange ist es her, dass die President untergegangen ist?«, fragte gerade ein Mann, der Abigail gegenüberstand und bis zur Nasenspitze in einen dicken Mantel gehüllt war.
Abigail schluckte, und ihre Hand fasste automatisch nach der ihres Geliebten. Wie riskant war diese Überfahrt? Sie hatte bisher keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Plötzlich stieg Angst in ihr auf. Ihr fielen die Geschichten ihrer alten Nanny ein, die in Cornwall an der Küste aufgewachsen war und von Schiffen berichtet hatte, die an den Klippen zerschellt waren. Und vom Untergang der President hatte Abigail in der Zeitung gelesen. Ihr Blick wanderte zu Oliver, der sie beruhigend anlächelte. Sie versuchte zurückzulächeln, aber es gelang ihr nicht. Stattdessen betrachtete sie die Mitreisenden neben sich.
Die meisten Passagiere sahen – von der Taktlosigkeit des Herrn peinlich berührt – auf die Planken des Bootes. Nur ein älterer Gentleman prustete los: »Unwichtig! Ich habe diese Überfahrt schon dreizehn Mal gemacht! Ohne den geringsten Unfall.«
»Wie schön die Britannia aussieht! Wir werden gewiss eine ganz bequeme Überfahrt haben«, rief eine Dame mit starkem schottischem Akzent.
Abigail betrachtete das Dampfschiff, das vor ihnen im Strom lag und nun immer näher kam. Der blaue Anstrich leuchtete ihnen durch den Nebel entgegen. Zum ersten Mal dachte Abigail über die Reise nach. Die letzten Tage waren von Abschied, Schmerz und Angst vor Entdeckung erfüllt gewesen und hatten für Überlegungen, die Zukunft betreffend, keinen Platz gelassen. Abigail zog den Wollschal enger um ihre Schultern. Sie wusste nicht, ob sie die Angst oder die Kälte zittern ließ. Ihr Blick wanderte wieder zu ihrem Geliebten, der neben ihr saß. Sein Hut war tief ins Gesicht gezogen und verdeckte die Stirn, die – da war sich Abigail sicher – in Falten gezogen war. In diesem Moment begegneten sich ihre Blicke, und sofort breitete sich ein warmes Lächeln auf seinem Gesicht aus. Oliver griff nach ihrer Hand und drückte sie liebevoll. Doch in seinen Augen lag der Schmerz, der in ihm ebenso wütete wie in Abigail selbst. Von nun an waren sie einander der einzige Halt, die einzige Verbindung zu einer Vergangenheit, die sie beide verleugnen mussten. Sie schmiegte sich so eng an ihn, wie es die Etikette erlaubte, und versuchte ihrer Reise mit Zuversicht entgegenzusehen.
Inzwischen hatte das kleine Boot den Dampfer erreicht. Abigail beobachtete die Matrosen, die flink eine Kette gebildet hatten und das Gepäck der Bootsinsassen von Hand zu Hand auf das Paketschiff wandern ließen. Auch die Passagiere hatten es offenbar eilig, das kleine Boot zu verlassen, und strömten über den wackligen, schmalen Steg auf die Britannia. Abigail und Oliver kletterten ebenfalls zur Reling hinauf. Abigail hatte Olivers Hand fest umklammert, um ihn in dem Gewühl nicht zu verlieren.
»Da ist das ganze Gepäck«, sagte Oliver und deutete auf einen Haufen Koffer, Reisetaschen, Truhen und Beutel, um die sich bereits eine Menschentraube gebildet hatte.
Ein junger Mann zerrte mit vor Aufregung geröteten Wangen einen großen Überseekoffer hinter sich her. Zwei ältere Herren schleppten einen Weidenkorb davon. Nach und nach schien jeder von ihnen sein Gepäck gefunden zu haben. Offenbar waren viele der Passagiere schon am Tag zuvor auf dem Paketdampfer gewesen und hatten sich ihre Kabinen angesehen, wie Abigail aus den Gesprächen und zielstrebigen Schritten schließen konnte. Abigail hatte nicht daran gedacht. Zu wertvoll waren ihr die letzten gemeinsamen Stunden mit Ebenezer gewesen.
Inzwischen hatte Oliver ihre beiden großen Koffer und die Reisetasche gefunden. Glücklicherweise kam ihnen ein Steward zu Hilfe. Er versprach ihnen, dafür zu sorgen, dass das Gepäck in die richtige Kajüte gebracht wurde, und war auch noch so freundlich, sie zu ihrer Unterkunft zu begleiten, an deren Tür verheißungsvoll »Staatszimmer« geschrieben stand. Als Abigail jedoch das winzige Verlies betrat, überlegte sie, ob sich hier jemand einen Scherz erlaubt hatte. Die Schiffskabine war so klein, dass man sich kaum herumdrehen konnte und sie sich ernsthaft fragte, wo sie die großen Koffer und die Tasche unterbringen sollten.
Abigail trat an den Waschtisch, der gegenüber der Tür stand und in den zwei Löcher für die Schüsseln eingelassen waren. Als sie in den Spiegel blickte, der darüber hing, erschrak sie. Sie sah furchtbar aus, die Sorgen und der Kummer der vergangenen Jahre waren nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Die ersten Falten zeigten sich auf ihrer sonst makellosen Haut, und unter den Augen lagen tiefe Schatten. Das einst so schimmernde braune Haar hatte seinen Glanz verloren. Seufzend wandte sie sich ab und betrachtete das schmale Etagenbett an der Wand. Auf der dünnen Matratze lag ein Zettelchen: »Oliver Middleton, Esquire, nebst Gemahlin.« Die Haltestangen, die an der Kabinenwand angebracht waren, ließen beunruhigende Vorahnungen in Abigail aufsteigen.
In diesem Moment brachten zwei Stewards das Gepäck.
»Wann werden wir auslaufen?«, fragte Oliver die Männer, während sie dabei waren, Abigails großen Überseekoffer unter die schmale Koje zu zwängen.
»Sobald das Boot da ist, Sir«, antwortete der kleinere Steward.
Oliver hob die Augenbrauen. »Werden denn noch mehr Passagiere erwartet?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Wir warten auf ein Postboot.«
Abigail seufzte. Sie sehnte den Augenblick herbei, in dem sie endlich in See stachen und die Zeit des Abschieds vorüber war.
Abigail würde niemals diese zwei Stunden vergessen, in denen sie noch im Hafen warten mussten. England vor Augen, so nah und doch für immer unerreichbar. Die Ungewissheit, wie es ihren Söhnen ergehen würde. Der Schmerz um den Verlust ihres Mannes Anthony. Jetzt befand sie sich hier, auf der Britannia, mit Oliver, der von nun an ihr Ehemann war. Sie waren von keinem Pfarrer getraut worden, hatten sich nie die Treue vor ihren Familien und Freunden geschworen. Nur ein paar gefälschte Dokumente, die sie Lord Walter Lutlow verdankten, machten sie zu Mann und Frau. Dass diese Ehe eigentlich nicht gültig war, würde in Amerika hoffentlich niemand herausfinden. Die fremden Pässe und Reisedokumente hatten neue Menschen aus ihnen gemacht.
Abigail seufzte und starrte in die Wellen hinaus, die sich vor dem Bullauge auftürmten. Eine Seereise mit ungewissem Ausgang lag vor ihr, in ein Land, das sie nicht kannte. Oliver schien zu ahnen, wie ihr zumute war. Er zog Abigail in seine Arme und hielt sie lange eng umschlungen. Um sie beide von den trübsinnigen Gedanken abzulenken, schlug er einen Rundgang auf der Britannia vor, der die Laune der beiden Vertriebenen jedoch kaum verbessern sollte.
Der Salon war ein langgestrecktes schmales Zimmer, in dem zwei karge Holztische mit Bänken standen. Unter der Decke waren Regalkörbe angebracht, in denen sich bunt durcheinandergewürfelt Tassen, Teller, Besteck, Essig- und Ölständer befanden. Ein winziger Ofen stand an einem Ende des kalten Zimmers, davor hatten sich drei junge Männer versammelt, die sich anscheinend aus dem Studium kannten. Abigail und Oliver gingen weiter in die Damenkajüte, die selbstverständlich auch den Herren zur Verfügung stand und ihren Namen dem großen Kamin in der Mitte verdankte, durch den dieser Raum wohl zum wärmsten auf dem Schiff wurde und für die Damen zum angenehmsten.
Nachdem sie jeden Winkel des Schiffes erkundet hatten, gingen sie an Deck. Noch immer war nichts von dem Boot zu sehen, ohne dessen Ladung die Britannia nicht abfahren konnte. Abigail und Oliver blieben an der Reling stehen, in ihre warmen Mäntel gehüllt, und starrten in den Nebel hinaus. Dann endlich tauchte ein schwarzer Punkt vor ihnen auf, der rasch zu einem Boot heranwuchs. Der Kapitän erschien mit einem Sprachrohr, die Offiziere nahmen ihre Positionen ein, und sobald das kleine Boot das Paketschiff erreicht hatte, wanderten die Postsäcke von Hand zu Hand herüber auf die Britannia.
Wenig später wurde der Anker gelichtet und die großen Schaufelräder begannen sich zu drehen. Die Britannia dampfte auf den Atlantik hinaus und brachte Abigail und Oliver in ein neues Leben.
Um fünf Uhr schlug die Glocke zum ersten gemeinsamen Abendessen, das in dem langgestreckten Salon eingenommen wurde. Sechsundachtzig Passagiere waren an Bord, und nachdem Abigail und Oliver sich an ihren Tisch gesetzt hatten, betrachtete Abigail die anderen Reisenden. Sie zuckte zusammen, als sie ein Ehepaar erkannte, das sie schon öfter auf verschiedenen Londoner Bällen gesehen hatte. Sie waren einander nie vorgestellt worden, und doch bemerkte sie, dass auch die Frau sie erkannt haben musste. Aber vermutlich würde sie ihren wahren Namen nicht kennen. Sie lächelte Abigail zu und nickte freundlich. Abigail erwiderte den Gruß und versuchte sich ihre Beunruhigung nicht anmerken zu lassen. Die Gesellschaft war bunt gemischt. Gleich neben der Dame saß ein ärmlich gekleideter Mann, der gerade seinem Nachbarn auf der anderen Seite berichtete, dass er zu seiner Tochter fahre, die seit fünf Jahren in Boston lebe. Sie hatte so lange gespart, bis sie ihrem Vater die Überfahrt bezahlen konnte. Ein älteres Ehepaar reiste mit seinem bereits erwachsenen Sohn, der griesgrämig auf seinen Teller starrte. Das Ehepaar, das Abigail und Oliver gegenübersaß, war ungefähr in ihrem Alter, und auch diese beiden kannte Abigail von verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen. Der Mann schien Schriftsteller zu sein, wie Abigail den Unterhaltungen entnehmen konnte, die er mit seinem Nachbarn führte.
»In Amerika steht einem die Tradition nicht so im Weg wie in England«, erklärte der Herr gerade und spießte eine gesottene Kartoffel auf seine Gabel. »Ich werde viel lernen können, was ich in meinen Romanen dann beschreiben kann.«
»Haben Sie keine Angst, den Menschen falsche Ideen in den Kopf zu setzen?«, fragte sein Sitznachbar. »In Barnaby Rudge haben Sie dem Bürgertum gegenüber teilweise sehr drastisch Stellung bezogen.«
Der Schriftsteller hob eine Augenbraue. »Und Sie glauben, damit würde ich die unterdrückten Massen zur Revolution anstacheln?«
Sein Nachbar nickte.
Der Schriftsteller warf seine braunen Locken zurück und schüttelte den Kopf. »Sie vergessen, dass die meisten von ihnen gar nicht lesen können. Sie haben keine Zeit, es zu lernen, weil sie schon mit sechs Jahren in die Fabrik müssen.«
Abigail war plötzlich aufmerksam geworden. Vorsichtig rutschte sie auf der harten Holzbank ein Stück nach vorn, um dem Gespräch besser folgen zu können. Zu gern hätte sie sich in die Unterhaltung gemischt, aber sie wusste, dass es zu gefährlich war. Niemand durfte erfahren, wer sie einst gewesen war und dass sie bis vor Kurzem noch eine Fabrik mit sechshundert Angestellten geleitet hatte. Abigail hatte hart dafür gekämpft, die Bedingungen der Arbeiter zu verbessern. Sie hatte eine Kinderverwahranstalt und eine Arbeiterspeisung eingeführt. Außerdem hatte sie die Luft in der Fabrik verbessert, indem sie ein Rad hatte anbringen lassen, das den Baumwollstaub herausfilterte.
»An wen richtet sich Ihr Roman also?«, fragte der zweite Herr gerade.
»An das Bürgertum natürlich. An die Fabrikanten und großen Händler, die ihre Überlegenheit den Massen gegenüber ausspielen, ganz nach dem Vorbild der Aristokratie.« Der Schriftsteller schob sich die Kartoffel in den Mund und war eine Weile mit Kauen beschäftigt. Abigail hätte ihm am liebsten laut applaudiert. Sie hatte sich in den letzten Jahren sehr für die Arbeiter in Hampton’s Mill eingesetzt. Doch dann war ihr Schwager George aufgetaucht und hatte all ihre Bemühungen zunichtegemacht. Am liebsten hätte sie den Schriftsteller nach seinem Namen gefragt, seine Werke zu lesen wäre bestimmt ein Gewinn gewesen. Doch dann hätten Oliver und Abigail sich ebenfalls vorstellen müssen, und sie wollte so wenigen Menschen wie möglich ihren neu angenommenen Namen nennen.
»Ich freue mich nun auf Amerika«, nahm der Autor das Gespräch wieder auf. »Drüben sind sie viel weiter. Dort ist jeder gleich, und die Arbeitsbedingungen sind viel besser als bei uns. England ist einfach zu traditionsgebunden.«
»Wirklich?«, entfuhr es Abigail, die ihre Begeisterung für den Herrn nun kaum mehr verbergen konnte.
Der Mann sah überrascht zu ihr herüber. Abigail fielen seine großen Augen auf, die sie jetzt interessiert musterten. Ein Lächeln legte sich auf sein Gesicht. »Oh ja, Ma’am. Ich entnehme Ihrer Frage eine gewisse Anteilnahme an dem Thema?«
Abigail biss sich auf die Unterlippe. Sie nickte zögernd. Dann entschloss sie sich, so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben. »Die erste Frau meines Mannes ist an Baumwollstaublunge gestorben. Wir sind beide sehr bemüht, dass die Arbeitsbedingungen in den Fabriken verbessert werden. Besonders für die Kinder, die teilweise so lange Arbeitszeiten haben, dass sie keine Schule besuchen können.«
»Vollkommen richtig, Ma’am«, sagte der Dichter und trank einen Schluck des nicht sehr gut schmeckenden Branntweins, der mit Wasser gemischt und allen gereicht worden war. »Sind Sie denn in einer Position, die es Ihnen ermöglicht, Einfluss zu nehmen?«
Abigail errötete. Wie unvorsichtig von ihr. Was sollte sie nun sagen?
Glücklicherweise kam Oliver ihr zuvor. »Nicht mehr und nicht weniger als jeder andere hier, Sir. Ich bin Oliver Middleton und das ist meine Frau Abigail.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Dickens. Charles Dickens, und das ist meine Frau Catherine.« Der Schriftsteller ließ seinen Blick von Abigail zu Oliver wandern. »Woher stammen Sie?«
»Manchester«, rief Abigail und wunderte sich, wie schnell ihr diese Lüge eingefallen war. »Und Sie, Sir?«
Mr Dickens zog eine Augenbraue hoch. »London.«
»Und was führt Sie nach Amerika?«, fragte Abigail weiter, um ihn von sich und Oliver abzulenken.
»Recherchen für meine Romane«, erklärte er. »Wie ich eben schon sagte, ist Amerika das Land der Freiheit und Gleichheit. Dort stehen jedem Menschen alle Möglichkeiten offen, und ich möchte die amerikanische Gesellschaft in einem meiner nächsten Romane abbilden.«
»Wie spannend«, sagte Abigail und lächelte ihn an.
»Und Sie? Warum unternehmen Sie diese nicht ganz ungefährliche Überfahrt?«, fragte er nun doch, und Abigail zuckte zusammen.
»Wir besuchen Verwandte in New York«, übernahm Oliver die Antwort.
»So?« Der Autor ließ seinen Blick wieder zwischen den beiden hin- und herwandern. Abigail schluckte. Bestimmt war sie ihm schon bei dem ein oder anderen Londoner Gesellschaftsereignis begegnet. Erinnerte er sich etwa an sie? Noch schlimmer als diese Sorge war jedoch die Tatsache, dass es von nun an immer so sein würde. Immer musste sie in der Angst leben, entdeckt zu werden.
»Wo lebt Ihre Familie in New York?«, fragte Mr Dickens jetzt.
»Am Broadway«, erklärte Oliver, und Abigail bewunderte ihn insgeheim für sein Improvisationstalent.
»Oh, am Broadway gedenke ich auch zu residieren«, erwiderte der Autor, während er sich ein Stück von dem Ferkelbraten abschnitt. »Im Carlton House Hotel. Ich habe viel Gutes darüber gehört. Wir werden nur wenige Tage dort bleiben, schließlich wollen wir so viel wie möglich von diesem freien und gerechten Land sehen.«
Abigail nickte. Ihr fiel auf, dass sie und Oliver bisher noch gar nicht darüber nachgedacht hatten, wie es weitergehen sollte, sobald sie in Amerika an Land gegangen waren. Walter hatte ihnen eine stattliche Geldsumme zukommen lassen, von der sie zunächst gut leben konnten, aber sie mussten auch an die Zukunft denken. Sofort fiel der nächste dunkle Schatten auf Abigails Gedanken. Ihre Zukunft mussten sie fern der Heimat verbringen, ohne die Menschen, die sie liebten.
»Ich werde jetzt etwas frische Luft schnappen.« Charles und Catherine Dickens erhoben sich, um an Deck zu gehen. Und viele der anderen Passagiere taten es ihnen nach, sodass sich der Raum innerhalb weniger Minuten leerte.
Oliver griff nach Abigails Hand und drückte sie. Er schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln und Abigail fasste tatsächlich etwas neuen Mut.
Die nächsten zwei Tage fuhren sie bei ruhigem Wetter. Abigail vertrug die Seefahrt gut, anders als viele ihrer Mitreisenden, deren Reihen sich beim Mittag- und Abendessen zunehmend lichteten. Am dritten Morgen wurde Abigail dadurch geweckt, dass sie beinahe aus ihrem schmalen Bett geschleudert worden wäre. Erschrocken riss sie die Augen auf. Ihre dünne Bettdecke flog durchs Zimmer. Sie hörte, wie das Wasser draußen auf die Planken schwappte, und vernahm die Schreie der Matrosen und aufgeregtes Getrampel auf den Dielenbrettern. In größter Panik klammerte sich Abigail an dem Haltegriff fest. Waren sie in Gefahr? War die Britannia in Seenot geraten? Noch bevor sie einen klaren Gedanken fassen konnte, flog die Tür ihrer Kajüte auf, und plötzlich schien das ganze Schiff auf dem Kopf zu stehen. Abigails Haarbürste flog im hohen Bogen gegen das winzige Bullauge, durch das man die hohen Wellen sehen konnte, die immer wieder gegen die Scheibe klatschten. Im nächsten Augenblick drehte sich das Schiff zurück, um gleich darauf wieder in eine gefährliche Schräglage zu geraten.
»Abigail?«, hörte sie Olivers Stimme aus dem oberen Bett.
»Mir geht es gut«, krächzte sie, obwohl sie vor Angst zitterte und ihr ziemlich flau im Magen war.
In diesem Moment sah sie einen Steward, der auf dem Gang vorbeiwankte.
Oliver hielt ihn auf. »Steward, ist alles in Ordnung?«
»Oh ja, Sir«, antwortete der junge Mann, während er sich an der Stange festhielt. »Wir haben nur etwas hohe See und widrigen Wind.« Dann hangelte er sich weiter.
Jetzt erinnerte sich Abigail an die vielen Vögel, die gestern Abend das Schiff umkreist hatten, und ihr fiel ein, dass sie als Vorboten eines Sturmes galten. Gestern hatte sie daran gar nicht gedacht, sondern war in der Gewissheit zu Bett gegangen, dass auch die nächsten Tage so ruhig verlaufen würden wie die ersten.
Ihr war entsetzlich kalt ohne die Bettdecke. Sie beschloss, sich selbst ein Bild von der Lage zu verschaffen, und schwang entschlossen die Beine aus dem Bett. Doch als sie versuchte, aufzustehen, wurde sie durch den schweren Seegang gleich wieder zurückgeworfen. Es brauchte mehrere Versuche, bis es ihr gelang, sich zur Tür zu schleppen. Sie schloss sie rasch und hockte sich dann auf den nassen Boden, um eines der dicken Leinenkleider aus ihrem Koffer zu ziehen. Seufzend stellte sie fest, dass sämtliche Kleidung feucht war. Der Boden wurde immer wieder mit Wasser überflutet, das nach und nach in die Reisetruhe gedrungen sein musste.
Abigail suchte das trockenste Kleid heraus, und es kostete sie viel Anstrengung, sich anzukleiden. Natürlich war nicht daran zu denken, sich waschen zu können. Das Wasser wäre bei dieser unruhigen See nicht lange in der Schüssel geblieben. Als Abigail sich schließlich einigermaßen hergerichtet hatte, wandte sie sich an Oliver, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Doch er war schrecklich blass, und obwohl er es nicht zugeben wollte, schien er seekrank zu sein.
Abigail ließ ihn in seiner Koje liegen und versprach, ihm etwas Zwieback mitzubringen. Dann begab sie sich in den Salon zum Frühstück. Nicht einmal die erfahrenen Stewards, denen sie unterwegs begegnete, waren imstande, aufrecht zu gehen, sondern krochen in gebückter Haltung an den Seiten des Ganges entlang. Aus den Kajüten, deren Türen größtenteils durch die wütende See aufgerissen worden waren, hörte Abigail das Stöhnen und Würgen seekranker Passagiere. Als sie sich endlich zum Salon durchgekämpft hatte, fand sie den Raum verwaist vor. Nur die Aufwärterin klammerte sich an dem langen Esstisch fest. Also bestellte Abigail bei ihr etwas Toast, Zwieback und Tee in ihre Kajüte. Anscheinend war kaum ein Passagier in der Lage, das Bett zu verlassen.
Abigail wollte gerade wieder in ihre Kabine zurückkehren, als das Schiff einen solchen Stoß bekam, dass sie erschrocken aufschrie. Im nächsten Moment wurde sie in hohem Bogen durch den Raum geschleudert. Die erschrockene Aufwärterin landete direkt neben ihr auf dem Boden. Wasser überflutete die Dielen. Abigail war sicher, dass die Britannia nun endgültig in Stücke gerissen worden war.
»Oh mein Gott!«, kreischte sie wenig damenhaft. »Das Schiff sinkt!«
»Alles in Ordnung«, keuchte die Aufwärterin. »Ein ganz normaler Tag auf See.«
Abigail starrte die Frau an, die inzwischen wieder aufrecht stand, und schluckte den bitteren Geschmack hinunter, der sich in ihrem Mund gebildet hatte. Sie nickte tapfer und entschuldigte sich bei der Frau. Dann wankte sie zu ihrer Kajüte zurück.
Unterwegs hörte sie Gläser zerbrechen, die Schreie der seekranken Passagiere, das Poltern, wenn wieder ein Steward oder Matrose umgeworfen worden war, und das Donnern der riesigen Wellen, die auf das Schiffsdeck schlugen. Immer wieder strömte ein Schwall Wasser den Gang entlang. Mit zusammengebissenen Zähnen klammerte sich Abigail an den Haltegriffen fest, deren Zweck ihr erst jetzt gänzlich bewusst wurde.
Mit äußerster Anstrengung erreichte sie ihre Kabine, wo Oliver auf der Matratze lag, dem es noch schlechter ging als zuvor. Er war so blass, dass Abigail ihn kaum von dem weißen Laken unterscheiden konnte. Auch schien er sie nicht wahrzunehmen. Abigail tastete nach seiner Decke und stellte erleichtert fest, dass sie noch einigermaßen trocken war. Sie steckte sie fest und küsste Olivers schweißnasse Stirn. Ihr eigenes Kleid war völlig durchnässt, und es blieb ihr nichts anderes übrig, als es auszuziehen und sich ein anderes herauszusuchen, das aber auch nicht wesentlich trockener war. Dann legte sie sich unter ihre feuchte Decke und wartete, zitternd vor Kälte und Angst, auf das bestellte Frühstück.
Als es endlich kam, war kaum noch Tee in der Kanne. Der Steward hatte anscheinend das meiste davon unterwegs verschüttet. Immerhin war der letzte Schluck noch einigermaßen warm, sodass Oliver und Abigail wenigstens etwas Wärme aufnehmen konnten. Oliver trank den Tee nur, als Abigail ihm gut zuredete und die Tasse an seine Lippen führte. Dann sank er kraftlos zurück in sein Kissen. Natürlich war er nicht in der Lage, etwas zu essen, und auch Abigail hatte keinen besonders guten Appetit. Seufzend legte sie sich wieder in ihre Koje, klammerte sich am Griff fest und wartete darauf, dass der Sturm aufhörte. Doch in den nächsten Stunden schien er eher noch stärker zu werden.
Am Nachmittag konnte Abigail die Enge der Kajüte nicht mehr ertragen und schleppte sich an Deck. Dort hielt sie sich an der Reling fest und starrte in den schwarzen Himmel. Sie konnte nicht sagen, wo er endete und wo das Meer begann. Die Wellen warfen das Dampfschiff wie einen Spielball umher, sodass Abigail schleunigst wieder in das Innere des Paketbootes zurückkehrte. Unterwegs traf sie Catherine Dickens, die sie tapfer anlächelte.
»Mrs Middleton, wie ich sehe, haben Sie es auch aus Ihrer Kajüte geschafft. Wie geht es Ihrem Mann?« Mrs Dickens’ dunkle Augen wirkten riesig in dem weißen Gesicht. Sie schluckte.
»Er ist ziemlich seekrank, fürchte ich«, erwiderte Abigail. »Aber einen solchen Seegang vertragen wohl nur die wenigsten. Ihnen scheint es auch nicht gut zu gehen.«
Catherine nickte. »Mir geht es schlecht, aber Charles ist ganz elend dran. Ich will etwas Tee für uns bestellen und dann rasch wieder ins Bett kriechen.«
»Ich kümmere mich um Ihren Tee«, sagte Abigail und ein erleichtertes Lächeln breitete sich auf Catherines Gesicht aus.
»Vielen Dank, Mrs Middleton.«
In den nächsten drei Tagen beruhigte sich das Wetter kaum, und Abigail hatte alle Hände voll damit zu tun, den seekranken Oliver zu pflegen. Anscheinend war sie fast die einzige Passagierin, der nicht hundeelend zumute war. So fristete sie in diesen Tagen ein ziemlich einsames Leben an Bord, das sich beinahe ausschließlich auf ihre kleine Kajüte beschränkte. Erst als sich der Sturm endlich legte, schienen die Passagiere allmählich wieder lebendig zu werden. Den meisten stand die aschfahle Blässe aber noch ins Gesicht geschrieben, und beim Essen gingen die Schüsseln halbvoll zurück. Doch mit der Zeit fühlten sich alle besser, die nasse Kleidung trocknete, und auch Oliver wurde wieder gesund. Abigail war froh, der Enge ihrer kleinen Zelle zu entkommen, und sie verbrachten ihre Tage nun überwiegend in der Damenkajüte. Das Feuer im Kamin wollte zwar nur selten brennen, doch auf den Sofas dort ließen sich die Tage einigermaßen bequem verbringen.
Sooft es das Wetter zuließ, zogen sich Abigail und Oliver ihre warmen Mäntel an und gingen an Deck. Dort sah Abigail Dinge, die sie noch nie zuvor erlebt hatte. Einmal zog ein großer Schwarm Fische an dem Dampfer vorbei, die sich manchmal sehen ließen und dann wieder mit einem Satz in den Fluten verschwanden. Ein anderes Mal zeigte sich eine Haifischflosse ganz in der Nähe der Britannia. Abigail hätte das Tier stundenlang beobachten können, doch auch der Haifisch verschwand irgendwann in der Weite des Ozeans. Oft begegneten sie dem alten Mann, der auf dem Weg zu seiner Tochter nach Boston war. Auch er vertrieb sich die Zeit gern an Deck und erzählte Abigail und Oliver von seinem Leben in Wales. Seine Mutter hatte früher am Spinnrad gesessen, während sein Vater, er selbst und seine Brüder das gesponnene Garn am Webstuhl verarbeitet hatten. Auf diese Weise hatten sie jede Woche zwei Pfund erwirtschaftet, wovon die Familie gut leben konnte. Später hatte er das mit seiner Frau und seiner Tochter genauso fortgeführt, bis die Konkurrenz durch die Baumwollfabriken immer größer wurde. Schon seit vielen Jahren konnte er nicht mehr davon leben. Aus diesem Grund war seine Tochter nach Amerika ausgewandert. Sie hatte sich dort ein neues Leben aufgebaut, und jetzt holte sie ihn zu sich. Abigail konnte die Wehmut und Trauer um den Verlust der Heimat von seinem Gesicht ablesen. Diese Gefühle trug auch sie selbst in sich. Aber in den Augen des alten Mannes schimmerte etwas, um das sie ihn beneidete: die Zuversicht und Freude, seine Tochter wiederzusehen.
Abigail sehnte sich nach ihrer Ankunft in Amerika und hatte gleichzeitig Angst davor. Denn sobald sie an Land gingen, mussten sie sich ihrer Zukunft stellen. Hier auf der Britannia waren sie noch zum Abwarten gezwungen. Wenn Oliver und sie allein waren, stellten sie verschiedene Überlegungen an. Von den begeisterten Schilderungen Mr Dickens’ zur sozialen Gerechtigkeit in Amerika angeregt, wollte Abigail Fabriken besuchen, um zu sehen, wie viel besser es die Arbeiter dort hatten als in England.
Und endlich, in der fünfzehnten Nacht, Abigail und Oliver wollten gerade zu Bett gehen, lief die Britannia auf Sand. Sie hatten das amerikanische Ufer erreicht! Abigails Herz klopfte schneller. Aufregung überkam sie. Rasch warfen sie ihre Mäntel über und eilten an Deck. Und Abigail und Oliver waren nicht allein, mit einem Mal drängten alle nach oben. Jeder wollte in dieser sternenklaren, mondhellen Nacht die amerikanische Küste sehen. Plötzlich standen die Dampfräder still, und eine unheimliche Ruhe breitete sich aus. Nachdem das Dröhnen der Dampfmaschinen ihnen mehr als zwei Wochen lang Tag und Nacht in den Ohren geklungenen hatte, war die plötzliche Stille ungewohnt und beinahe beängstigend. Der Kapitän ließ Raketen abfeuern und einige Signalschüsse, doch vom Land kam keine Antwort zurück. Zitternd vor Kälte und Aufregung beobachtete Abigail, wie eine kleine Abordnung in eines der Beiboote stieg und an Land ruderte. Kaum eine Stunde später kamen sie zurück mit der Nachricht, dass die Britannia ihr Ziel, den sicheren Hafen von Halifax, verfehlt habe und in der östlichen Passage liege. Morgen würden sie bei Tageslicht den Strom nach Halifax hinunterfahren müssen.
Müde legten Abigail und Oliver sich schlafen, und als sie am nächsten Morgen wieder an Deck kamen, glitt das Paketboot bereits den Strom hinab. Statt zu frühstücken, nahmen sie Plätze an der Reling ein und beobachteten das in der Januarsonne schimmernde Wasser des breiten Stroms. Zu beiden Seiten erstreckte sich das schneebedeckte Land mit seinen weißen Holzhäusern, die so neu wirkten, als wären sie gerade erst gebaut worden. Menschen standen in den Türen und betrachteten den großen Dampfer. Abigail ließ ihren Blick über die vielen Zuschauer am Ufer gleiten. Fröhliche Stimmen, Geschrei und die Rufe der Möwen drangen an ihr Ohr. Männer und Jungen rannten den Berg hinunter zur Pier, um die Britannia zu begrüßen.
Als sie einen Hafen erreicht hatten, wurden die Schiffsmotoren ein weiteres Mal gestoppt und die Landungsbrücke ausgeworfen. Die Passagiere schienen es gar nicht abwarten zu können, das Paketschiff zu verlassen, und eilten den Steg hinunter. Abigail und Oliver blieben, an die Reling gelehnt, stehen und sahen sich hilflos an. Nun waren sie also angekommen. Hier würde ein neues Leben für sie beginnen. Aber niemand erwartete sie. Niemand half ihnen, das fremde Land kennenzulernen. Sosehr Abigail die Enge ihrer Kajüte auch gestört hatte, sie wünschte sich an diesem sonnigen Januarmorgen, an Bord der Britannia bleiben zu können. Irgendwann nahm Oliver ihren Arm und führte sie wortlos den Landungssteg hinunter.
Zum ersten Mal seit mehr als zwei Wochen hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Abigail schirmte die Augen gegen die Sonne ab und betrachtete die Stadt, die vor ihnen auf einem Berghang lag. Ganz oben wurde gerade eine Zitadelle errichtet, Abigail konnte die Hammerschläge bis hier herunter hören. Breite Straßen führten vom Meer den Hügel hinauf. Pferdegespanne zogen Kutschen und Wagen, in den Höfen und an den Straßenrändern parkten ausladende Schlittenfuhrwerke, die auf neuen Schnee zu warten schienen. Abigail fiel auf, dass beinahe alle Häuser aus Holz waren.