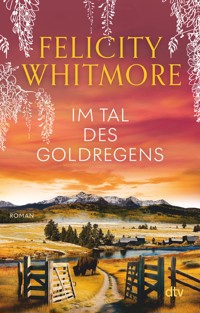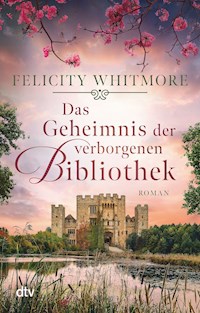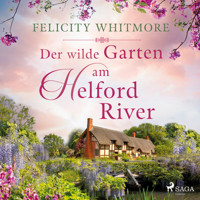
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felicity Whitmore ist die deutsche Lucinda Riley - Große Gefühle vor der überwältigenden Kulisse Cornwalls - Felicity Whitmore beherrscht den perfekten Mix aus Romantik, Spannung und Atmosphäre Drehbuchautorin Emily soll das Skript für die Verfilmung des Bestsellers von Ryan Scott verfassen. Doch schon das erste Treffen in London verläuft angespannt, keiner von beiden ist kompromissbereit, und immer wieder eskaliert die Situation. Was Emily nicht weiß: Ryans kleine Tochter Kelly hat Leukämie, und nur eine kostspielige Behandlung in den USA verspricht Rettung. Was Ryan nicht weiß: Emilys langjähriger Freund Luca ist depressiv, und auch Emily ist dringend auf ihr Honorar angewiesen ... Am Ende des gemeinsamen Projekts sind Emily und Ryan rettungslos ineinander verliebt. Doch sie können nicht zusammensein. Jahre später führt sie das Schicksal in einem verwilderten Garten am Helford River wieder zusammen. »Liebe ist stärker als gesellschaftliche Schranken, sie kann kurieren, was keine Medizin zu heilen vermag, sie ist der Grund, weiterzuleben, wenn uns der Mut dazu fehlt. Liebe ist die größte Kraft dieser Welt.« Felicity Whitmore
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felicity Whitmore
Der wilde Garten am Helford River
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Hanne
Prolog
Frankreich, Nordküste, April 1791
Marianne kniff die Augen zusammen, um in der Dunkelheit besser sehen zu können. Es war ihre Aufgabe, Ausschau zu halten und die Männer vor den Soldaten des Königs zu warnen, vor dem Bürgermeister und seinen Kumpanen und vor all dem anderen Abschaum, der sich nachts herumtrieb. In den vielen Jahren hatte sie gelernt, auch in schwärzester Finsternis Bewegungen auszumachen, und ihr entging kaum etwas. Sie stand auf einer der Klippen, die an diesem Teil der Küste über dem Meer aufragten. Von hier aus konnte sie in jede Richtung schauen. Unter ihr brachen sich die Wellen an den Felsen. Salz bedeckte jeden Zentimeter ihrer Haut, aber sie schmeckte es längst nicht mehr. Der Wind zerrte an ihren Haaren.
Die Männer unten am Strand arbeiteten zügig. Sie hatten eine Kette gebildet, die Kisten mit Tee und französischem Brandy vom Pferdekarren auf die Boote wandern ließ. Wenn es so weiterging, würden sie in einer halben Stunde ablegen können. Noch war Flut, noch konnten sie auslaufen. Die Männer verrichteten ihre Tätigkeit ohne Licht, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Marianne zog fröstelnd das zerschlissene Tuch enger um ihre Schultern und ließ ihren Blick an der zerklüfteten Küste entlangwandern. Der Sturm toste laut in ihren Ohren. Einen Moment hielt sie inne. Hatte sich da etwas gerührt? Sie starrte auf den dunklen Fleck zwischen den Felsen, etwas weiter rechts von ihnen. Nein. Sie stieß die Luft wieder aus, die sie unwillkürlich angehalten hatte. Es musste sich um ein Stück Treibgut oder einen abgestorbenen Baum handeln, der auf dem Strand lag.
Marianne wollte sich gerade wieder abwenden, als sich der Gegenstand regte. Sie spannte jeden Muskel an, während sie nach unten starrte – es war eine Gestalt, deren Kleidung im Wind flatterte. Wer auch immer es war, er ging auf das Wasser zu. War es ein Späher? Einer der Revolutionäre, die sie in eine Falle locken wollten? Hatten sich etwa weitere Männer hinter den Felsen verborgen und warteten auf seinen Befehl zum Angriff? Marianne glitt vom Felsen hinunter und sprang über die Steine zu den Schmugglern.
»Pst, dahinten ist jemand am Strand«, sagte sie leise zu ihrem Mann Jean, der sofort einen kurzen Pfiff ausstieß.
Alle verharrten und blickten sich zu Marianne um.
»Runter«, wisperte Jean, und im nächsten Moment kauerten sich die Männer so flach auf den Boden, wie sie es vermochten. In der Dunkelheit fielen sie jetzt kaum noch auf zwischen den Felsen am Strand. Wer nicht Bescheid wusste, sah nur ein paar harmlose Fischerboote, die an den Steinen festgemacht waren.
»Schleich dich ran und sieh nach, Weib«, raunte Jean ihr über das Tosen der Wellen hinweg zu, während er sein Messer aus der Scheide zog.
Marianne nickte und schlich sich in der Dunkelheit davon. Sie hielt sich im Schatten der Felsen. Während sie der Stelle immer näher kam, an der sie die Bewegung wahrgenommen hatte, überlegte sie fieberhaft, mit wem sie es wohl zu tun bekommen würden. Das Schmugglergeschäft war hart umkämpft, mehrere Familien beanspruchten diesen Strandabschnitt für sich, und es war immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen. Erst im letzten Jahr hatte sie einen Vetter verloren, der sich bei einem Überfall der Gérard-Familie eine üble Stichverletzung zugezogen hatte. Die Wunde hatte sich entzündet, und drei Wochen später war er an dem hohen Fieber gestorben.
Marianne drückte sich in eine Felsspalte. Sie biss sich auf die Unterlippe und strich die Haarsträhnen zurück, die der Seewind aus ihren schwarzen Locken gelöst hatte. Vorsichtig lugte sie um die Ecke. Zuerst sah sie nichts, nur Finsternis. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie das Flattern wieder wahrnahm. Sie wagte nicht, sich aus ihrem Versteck zu stehlen. Atemlos beobachtete sie die Gestalt, die inzwischen beinahe die Wasserkante erreicht hatte. Marianne stutzte. War das etwa …? Nein, unmöglich. Einen Moment lang hatte sie geglaubt, die Person am Strand sei eine der Nonnen. Aber was hätte die mitten in der Nacht hier unten am Strand zu suchen? Die Ordensschwestern betrieben keinen Schmuggel, sie lebten schweigend und zurückgezogen in ihrem Konvent. Und doch wirkte die Gestalt in ihrem Habit genau wie eine von ihnen.
Eine Weile wartete Marianne noch ab, aber bald war sie sich ziemlich sicher, dass es sich um eine Frau handelte und dass sie allein hier am Strand unterwegs war. Trotzdem musste sie vorsichtig sein. Langsam kroch sie aus dem Felsspalt hervor und glitt von Felsen zu Felsen näher ans Meer heran. Bald war sie so nah, dass ihre nackten Füße von den Wellen umspült wurden. Der Wind riss an ihrem dünnen Kleid. Sie sah sich um. Nichts, hinter ihr schien alles ruhig zu sein. Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Gestalt vor sich. Jetzt bestand kein Zweifel mehr: Es war eine der Zisterzienserinnen aus dem Kloster auf dem Hügel. Sie trug einen dunklen Mantel über der weißen Ordenstracht, der im Wind wehte. Der schwarze Schleier musste sehr fest sitzen, er war noch nicht vom Sturm fortgezerrt worden.
Marianne überlegte fieberhaft. Was hatte die Nonne vor? Sie ging immer weiter ins Meer hinein. Das Wasser reichte ihr schon bis zu den Knien, ihre Gewänder bauschten sich auf der Wasseroberfläche. In diesem Moment rauschte eine Welle heran und riss die Frau von den Füßen. Als das Wasser zurückwich, kniff Marianne erneut die Augen zusammen. Wo war die Frau geblieben? Dann erkannte sie das Häuflein Kleider, das zappelnd im Wasser lag. Ohne nachzudenken, rannte Marianne los und stürzte sich in die Wellen. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie die Nonne erreicht, die erschrocken aufschrie, als Marianne ihre Arme packte und sie mit festem Griff hinter sich her zum Strand schleifte.
»Nein, bitte!« Die Frau hustete und spuckte Meerwasser aus. »Bitte lassen Sie mich, ich will …« Sie brach ab, weil sie würgen musste.
»Sie wären beinahe ertrunken«, stellte Marianne fest.
Die Nonne sackte kraftlos auf dem Sand zusammen. Wieder würgte sie.
»Kommen Sie, Sie müssen das nasse Kleid ausziehen.« Marianne sah sich Hilfe suchend um und winkte in Richtung der Männer. Hoffentlich nahm Jean sie wahr. »Stehen Sie auf, es ist viel zu kalt im Wasser!«
»Nein, lassen Sie mich sterben. Bitte.« Die Nonne lag immer noch in sich zusammengesunken am Strand.
In diesem Moment erkannte Marianne die Verzweiflung in ihrem Blick.
»Was ist los?«
Marianne fuhr herum. Sie hatte Jean gar nicht kommen hören. Jetzt schälte sich sein Umriss aus der Dunkelheit direkt neben ihr, und er betrachtete die Nonne skeptisch.
»Es ist nur eine aus dem Kloster, die ins Wasser gehen wollte. Hilf mir, sie in die Hütte hinaufzubringen, sie muss die nassen Sachen ausziehen.« Marianne fasste einen Arm der Frau, ohne auf ihr Jammern zu hören.
»Marianne!« Jean stöhnte leise auf. »Wenn sie sich umbringen will, dann lass sie doch. Wer kann es ihr verübeln? Sie sitzt den ganzen Tag in diesem Kloster fest. Wir haben keine Zeit für solche Dinge.«
»Ich lasse sie nicht hier zurück«, erwiderte Marianne trotzig und sah ihren Mann herausfordernd an. Sie wusste, dass er recht hatte, denn sie konnten sich keine Verzögerung leisten. Wenn bald die Ebbe kam, mussten sie die Bucht wieder verlassen haben.
Und doch konnte sie diese Frau hier nicht sterben lassen. Und das würde sie, wenn Marianne sie nicht mitnahm. »Schick mir einen der Männer, der soll mir helfen, sie hochzutragen. Dann kannst du weitermachen.«
Jean brummte etwas und machte sich davon. Wenige Augenblicke später erschien einer der Schmuggler und warf sich die Nonne wie einen Getreidesack über die Schulter.
Kurz darauf stand Marianne in ihrer Wohnung, die in den Felsen hineingehauen worden war, vor dem Feuer und legte einen neuen Holzscheit in die Flammen. Sie hatte die Nonne gezwungen, ihre nassen Sachen auszuziehen, und die immer noch zitternde Frau in warme Decken und Tücher gewickelt. Jetzt hängte sie den Kessel über das Feuer, um die Suppe vom Vorabend aufzuwärmen.
»Geht es wieder?« Sie sah die Nonne mitleidig an, während sie im Topf rührte. Die Frau hatte auch ihren Schleier abgenommen, und darunter war schimmerndes haselnussbraunes Haar zum Vorschein gekommen, das ihr nun über die Schultern fiel.
Die Nonne starrte in die Flammen. Dann flüsterte sie: »Warum haben Sie mich nicht sterben lassen?«
»Einfach so?« Marianne schüttelte den Kopf. »Ich will erst wissen, was so schlimm ist, dass Sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Gerade Sie müssten doch wissen, dass es Sünde ist, sich das Leben zu nehmen.«
Jetzt liefen Tränen über das Gesicht der Frau. »Ich stehe schon lange nicht mehr in Gottes Gnade.«
Marianne griff nach einem tiefen Teller und schöpfte Suppe hinein. »Hier, ich fürchte, es ist kein Brot mehr da.«
Als die Nonne keine Anstalten machte, den Teller entgegenzunehmen, stellte Marianne ihn neben sie auf den Tisch. Dann holte sie einen Löffel und reichte ihn ihrem Gast.
»Essen Sie. Danach können Sie sich immer noch das Leben nehmen. Aber zuerst erzählen Sie mir, warum Sie sterben wollen.«
Die Frau nahm den Löffel und sah weiter gedankenverloren ins Feuer. Ihre Wangen waren feucht.
»Wie heißen Sie?«
Die Nonne zuckte mit den Schultern. »Hier hat man mich Schwester Maria Ignazia genannt.«
»Aber es ist nicht Ihr wahrer Name?«, fragte Marianne nach.
Die Frau atmete tief ein. »Ich hieß Aurelie, aber diesen Namen darf ich nicht mehr benutzen.«
»Warum sind Sie ins Kloster gegangen?«
»Ich musste. Meine Eltern hatten nicht genug Geld, um alle Töchter verheiraten zu können.«
Marianne deutete auf die Suppe. »Essen Sie, bevor sie kalt wird.«
»Ich habe keinen Hunger«, wehrte Aurelie ab.
»Essen Sie trotzdem«, wiederholte Marianne mit Nachdruck.
Zögernd begann die Frau, die Suppe zu löffeln.
Marianne beobachtete sie, bis der Teller geleert war. Dann lächelte sie. »Sehen Sie, es schmeckt Ihnen. Möchten Sie noch einen Nachschlag?«
Der flackernde Schein des Feuers tauchte das Gesicht der Nonne in warmes Licht. Sie war eine schöne Frau, das konnte Marianne selbst in der Dunkelheit ihrer Wohnhöhle erkennen. Die großen graublauen Augen, die schmale Nase und die hohen Wangenknochen ließen sie elegant und vornehm wirken.
Aurelie schüttelte den Kopf und sagte leise: »Danke, aber es war sehr gut.«
Marianne räumte den Teller weg und nahm den halb vollen Wasserkessel, um ihn über die Flammen zu hängen. Anschließend setzte sie sich wieder neben die Nonne.
»Was haben Sie jetzt vor? Soll ich Sie zurück zum Kloster begleiten?«
»Nein«, Aurelie sah sie erschrocken an, »ich kann nicht dorthin zurück. Niemals. Ich kann nirgendwohin.«
»Aus diesem Grund wollten Sie auch …« Marianne ließ den Satz unvollendet.
Die Frau nickte.
Im Licht des Feuers konnte Marianne ihre weiche Haut erkennen. Diese Nonne schien noch jung zu sein, sehr jung. Zu jung, um zu sterben.
»Ich weiß nicht, was Ihnen zugestoßen ist, und ich habe kein Recht, in Sie zu dringen, aber ich bin sicher: Was auch immer Sie so hat verzweifeln lassen, es geht vorbei. Irgendwann ist all das nur eine ferne Erinnerung, und Sie werden wieder glücklich sein.«
Die Frau presste die Lippen zusammen. Erneut quollen Tränen unter den dichten, langen Wimpern hervor. »Ich bin nicht dazu auserkoren, glücklich zu sein.«
»Sie wollen also nicht wieder zurück ins Kloster?«, fragte Marianne.
Die Nonne trocknete sich die Wangen mit der Leinendecke, die Marianne ihr um die Schultern gelegt hatte, und schüttelte stumm den Kopf.
»Und auch sonst können Sie nirgendwohin?«
»Nicht nur das«, antwortete Aurelie leise. »Sie werden nach mir suchen. Und wenn sie mich finden …«
Marianne konnte die Angst in den Augen der jungen Frau erkennen.
»Na schön«, sagte sie und stand auf. »Ich helfe Ihnen.«
»Was?«, erwiderte Aurelie überrascht.
»Ich bin Engländerin, vor zehn Jahren habe ich meinen Mann Jean geheiratet, seitdem lebe ich hier in Frankreich. Doch meine Familie wohnt drüben am Helford River, wo ich aufgewachsen bin. Die Familie meines Mannes und meine eigene sind seit vielen Generationen … Geschäftspartner.« Marianne öffnete die Holzkiste, in der sie ihre Kleidung verwahrte. Sie und Jean waren nicht reich, aber sie kamen gut über die Runden. Auch wenn sie nicht viel über diese junge Frau wusste, spürte sie instinktiv, dass sie ihr vertrauen konnte. Marianne musste diesem armen Geschöpf helfen.
»Wir müssen uns beeilen, die Männer können Sie mit über den Ärmelkanal nehmen. Sie werden allerdings nicht lange auf Sie warten, weil sie nur bei Flut in die Bucht dort gelangen und vor Ebbe wieder weg sein müssen. Kommen Sie mal her.« Sie winkte die junge Frau herbei, die offensichtlich Französin war.
Aurelie stand zögernd auf. »Helford River? Sie sprechen von England?«
»Cornwall.« Marianne nickte und hielt prüfend eines ihrer alten Kleider in den Schein des Feuers. »Das hier müsste Ihnen passen. Und ein altes Unterkleid habe ich auch noch für Sie.«
»Aber … brauchen Sie es nicht selbst?«
»Doch«, gab Marianne zu. »Aber Sie benötigen es im Augenblick dringender.«
»Oh, Madame«, Aurelie nahm Marianne das Kleid ab und befreite sich von der Decke, »ich kann es Ihnen nicht bezahlen.«
»Das sollen Sie auch nicht.« Marianne lächelte und half der jungen Frau beim Anziehen. Die nasse Unterwäsche, die Wollstrümpfe und die Nonnentracht wickelte sie zu einem Bündel zusammen, das sie fest verschnürte. »So, nur die Schuhe müssen Sie feucht anziehen. Aber auf dem Boot werden sie sowieso wieder nass.«
Nachdem die junge Frau fertig war, brachte Marianne sie hinunter zum Strand, wo die Männer inzwischen die Boote beladen hatten.
»Sagen Sie meinen Tanten in Cornwall, dass ich Sie schicke und dass sie Sie bitte bei sich aufnehmen sollen. Sie werden hart arbeiten müssen, aber so sind Sie erst einmal fort von hier.«
Aurelie hatte Tränen in den Augen. Marianne konnte nicht sagen, ob sie von ihrer Trauer, Verzweiflung oder Erleichterung herrührten. Insgeheim wünschte sie ihr Glück für die Überfahrt und für ihr weiteres Leben, denn das würde sie auf jeden Fall gebrauchen können.
Kapitel 1
London, Oktober 2010
Emily umklammerte ihre Laptoptasche und starrte durch das Fenster auf die vorbeiziehenden Vororte Londons. Mit ihren Gedanken war sie noch immer in Cambridge. Dabei hätte sie eigentlich noch einmal in den Roman schauen sollen, der ein wichtiger Grund für ihre Reise in die Hauptstadt war.
Sie zuckte zusammen, als ihr Smartphone vibrierte. Erleichtert sah sie, dass es nicht Stephanie, sondern John war – der Produzent, für den sie das Drehbuch schreiben sollte.
»Hallo, John«, meldete sie sich. »Ich bin in einer halben Stunde bei dir.«
»Fein«, antwortete der Produzent. »Du wirst schon sehnsüchtig in Kendal House erwartet. Dann gebe ich Bescheid, dass wir pünktlich anfangen können.«
»Okay«, antwortete Emily. Wem auch immer er Bescheid geben wollte, sie würde es noch früh genug erfahren. Vermutlich plante er eine Produktionsbesprechung, er hatte ja schon angedeutet, dass es strenge Vorgaben für das Drehbuch gab.
»Wie geht es Luca?«, hörte sie John fragen.
Emily seufzte. »Es wird besser. Er ist jetzt bei seinen Eltern.«
»Sehr gut. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, Em. Es war gut, diesen Auftrag anzunehmen. Wir sehen uns gleich am Bahnhof. Mein Fahrer holt dich am Gleis ab.«
»Danke, John.« Emily legte auf und starrte einen Moment lang auf das Display. Dann schrieb sie eine kurze Nachricht an Stephanie, in der sie sich erkundigte, ob zu Hause alles in Ordnung sei.
Die Antwort kam wenige Sekunden später. Alles okay, ich melde mich, falls es Probleme gibt. Und jetzt schalte ab, genieß deine Arbeit.
Emily steckte das Handy weg und schüttelte den Kopf. Sie konnte nicht abschalten, zu groß war die Angst vor dem, was passieren könnte, während sie fort war. Der Arzt hatte ihnen gesagt, dass jeglicher Stress zu einem Rückfall führen könne. Und Emilys Abwesenheit bedeutete eindeutig Stress für ihren Freund Luca, der unter starken Depressionen litt. Sie presste die Lippen zusammen und strich gedankenverloren über den Stoff des Sitzes in ihrem Zugabteil. Würde das ein Leben lang so sein? Emily lehnte sich zurück. Eine enorme Verantwortung lastete auf ihr. Manchmal hatte sie das Bedürfnis, einfach wegzulaufen. Nein! Was dachte sie denn da? Sie liebte Luca, und das würde sie ihm niemals antun. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, dass sie überhaupt daran gedacht hatte. Luca war ihr Traummann, ihre große Liebe. Eine Sandkastenliebe. Sie wollten heiraten. Und eine Beziehung musste auch Tiefs wie dieses überstehen. Aber es würde wieder besser werden, irgendwann.
Sie zog die Beine ein, als sich eine füllige Frau mit einer gigantischen Tasche im Sitz gegenüber niederließ.
Emily nahm den Roman »Sterne am Nachthimmel« aus ihrem Rucksack und schlug ihn auf. Es brachte nichts, sich den Kopf zu zerbrechen. Stephanie würde sich genauso gut um Luca kümmern, wie Emily es sonst immer tat. Schließlich war sie seine Mutter.
Planlos blätterte Emily durch das Buch mit dem dunkelblauen Leineneinband. Auf dem Umschlag war ein Foto zu sehen, auf dem ein junger Mann durch eine öde Wüstenlandschaft in Richtung Horizont lief. Ein gutes Bild – auch für den Film, den John auf der Grundlage dieses Romans produzieren wollte. Vielleicht würde sie eine ähnliche Szene in das Drehbuch einbauen. Emily schlug den hinteren Deckel auf, um sich das Autorenbild genauer anzusehen. Bislang hatte sie diesem jungen Mann nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Sie wollte das Buch zunächst für sich selbst sprechen lassen. Aber vielleicht würde sich im Laufe der nächsten Wochen, in denen sie intensiv an dem Drehbuch arbeiten würde, eine Gelegenheit ergeben, Kontakt mit dem Autor aufzunehmen, um ihm ein paar Fragen zu den Hintergründen seines Romans zu stellen. Manchmal konnte das durchaus hilfreich sein, um tiefere Botschaften zu ergründen. Der Autor, Ryan Scott, war offenbar nur fünf Jahre älter als Emily selbst, also dreißig. Seine braunen Locken hingen ihm wirr ins Gesicht, die dunklen Augen blitzten amüsiert in die Kamera.
Emily sah auf. Die Umgebung änderte sich, sie erkannte die modernen Geschäftshäuser und Einkaufsstraßen Londons. Es wurde langsam Zeit, ihr Gepäck zusammenzusuchen. Der nächste Halt war King’s Cross, wo John sie erwartete. Die einstündige Fahrt war nur so verflogen. Sie zerrte ihre beiden Koffer aus der Gepäckablage und hängte sich ihre Laptoptasche um. Als der Zug wenig später in den Bahnhof einfuhr, verließ sie den Waggon als Erste.
»Miss Greenberg?« Ein Mann in dunklem Anzug kam auf sie zu.
Emily nickte.
»Ich bin Martin Sanchez, Mr Mercys Fahrer.« Er nahm ihr das Gepäck ab. »Hier entlang, bitte.«
Als sie aus dem Bahnhof traten, stand John an die elegante Limousine gelehnt, die Hände lässig in den Taschen seiner maßgeschneiderten Hose, und erwartete sie.
»Em!« Er breitete die Arme aus und drückte sie einen Moment lang an sich. Sie nahm den dezenten Duft seines vermutlich sündhaft teuren Parfüms wahr. »Ich bin froh, dass du da bist. Du bist genau die Richtige für diese Aufgabe.«
»Danke«, presste Emily gerührt hervor. John war so lieb, er vermittelte ihr den Eindruck, als tue sie ihm einen Gefallen. Dabei hätte er jeden für diesen Job bekommen können, aber er hatte Emily gewählt. Es war ihr erster ganz großer Drehbuchauftrag! Durch viele Zufälle und noch mehr Glück hatte sie während ihres Studiums in London an der Central Film School den Produzenten John Mercy kennengelernt und nach ihrem Studium gleich eine ziemlich erfolgreiche Miniserie für ihn geschrieben.
Vor einigen Wochen hatte John Emily dann angerufen und um ein Treffen gebeten. Während eines Mittagessens in London unterbreitete er ihr das Angebot, ein Filmdrehbuch zu einem erfolgreichen Roman zu schreiben, dessen Rechte seine Produktionsfirma erworben hatte. Emily hatte lange überlegt, ob sie den Auftrag annehmen sollte, da es ihrem Verlobten Luca gerade gesundheitlich nicht gut ging.
Luca und Emily kannten sich seit der Grundschule, mit sechzehn hatten sie sich ineinander verliebt. Damals hatten wohl auch seine Depressionen begonnen, auch wenn er nie darüber gesprochen hatte. Erst Jahre später bemerkte Emily, dass etwas mit ihm nicht stimmte, und wenn sie nicht mit seiner Mutter darüber gesprochen hätte, würde sie vermutlich bis heute nicht genau wissen, was ihm fehlte. Luca war ein Meister darin, zu verbergen, wenn es ihm schlecht ging. Vor einigen Jahren waren Emily und er in ein kleines Haus in Cambridge gezogen. Aber seit dem letzten Winter waren seine Depressionen nicht mehr zu übersehen. Er konnte morgens das Bett nicht verlassen, selbst der Gang zur Toilette fiel ihm schwer. Stundenlang saß er auf einem Stuhl in der Zimmerecke und starrte vor sich hin. Emily konnte ihn nicht erreichen, egal was sie auch versuchte. Sie drohte ihm, versuchte, ihn zu zwingen aufzustehen, aber es war, als kämen ihre Worte gar nicht bei ihm an. Einmal hatte sie es mit einer Party versucht, hatte ein Picknick im Park organisiert, aber Luca hatte nicht reagiert. Er saß auf seinem Stuhl und starrte vor sich hin. Sie hatte für ihn gebacken und gekocht, Luca hatte nichts angerührt. Sie hatte vor Verzweiflung geweint, es hatte ihn nicht berührt. Schließlich hatte Emily sich nicht anders zu helfen gewusst und Lucas Mutter Stephanie angerufen. Gemeinsam brachten sie ihn in eine Klinik, in der er sechs Wochen lang behandelt wurde. Jetzt war er seit zwei Monaten wieder zu Hause und nahm Medikamente, die ihm zu helfen schienen, aber er war kaum belastbar, wie der Arzt ihnen mitgeteilt hatte. Und genau in dieser schwierigen Phase kam Johns Angebot. Sie sollte Ryan Scotts Roman adaptieren, unter der Bedingung, während der Arbeitsphase in Kendal House, Johns Firmensitz in London, zu wohnen. Emily hatte gezögert, aber John hatte sie dazu gedrängt, mit Luca und seinen Eltern zu sprechen, was sie schließlich auch getan hatte.
Stephanie war sofort von Johns Angebot begeistert gewesen und hatte versprochen, sich während Emilys Abwesenheit um ihren Sohn zu kümmern. Sie war es gewesen, die Emily dazu überredet hatte, ihre große Chance zu ergreifen.
»Das könnte dein absoluter Durchbruch werden, Schätzchen«, hatte sie in einem Ton gesagt, der keine Widerrede erlaubte. »Wir werden alle mächtig stolz auf dich sein.«
»Steig ein, Em«, unterbrach John jetzt ihre Erinnerungen. »Wir werden in Kendal House erwartet.«
Emily schüttelte die Gedanken an Luca ab und stieg in die geräumige Limousine. Sobald John neben ihr saß, fragte sie ihn: »Und du bist sicher, dass ich für diesen Job nicht pendeln kann? Ich bin mit der Bahn in einer Stunde in Cambridge.«
»Em«, John hob die Hand, »darüber haben wir doch schon gesprochen. Ich möchte, dass du dich ganz auf die Arbeit konzentrierst.«
»Aber zwischendurch muss ich den Kopf frei bekommen …«, warf sie ein.
John unterbrach sie. »Wie willst du denn bei deinen Problemen mit Luca den Kopf zu Hause frei bekommen?«
Emily schwieg, auch wenn sie absolut nicht davon überzeugt war, dass sie besser arbeiten würde, wenn sie sich in Kendal House zurückzog. Schließlich war sie immer in Gedanken bei Luca. Wenn sie ihn regelmäßig sehen und sich vergewissern könnte, dass alles in Ordnung war, würde sich das nur positiv auf ihre Arbeit auswirken. Aber John war der Boss, und sie wusste, dass es besser war, nicht weiter mit ihm zu diskutieren.
Sie starrte durch das getönte Fenster in den Londoner Vormittagsverkehr hinaus. Menschen eilten über den Bürgersteig, Autos reihten sich, Stoßstange an Stoßstange, aneinander, und eine milde Oktobersonne strahlte auf das bunte Treiben herab. Die weichen Sitze aus beigem Leder dufteten nach Geld und Erfolg. Klassische Musik drang leise an ihr Ohr und verdrängte die Stadtgeräusche von außen. John reichte ihr einen Espresso, den er in einer kleinen Maschine in einer Verkleidung im Rücksitz zubereitet hatte. War das schon ein Vorgeschmack auf Kendal House? Herbert, einer ihrer Professoren an der Filmhochschule, hatte immer von dem Luxus dort geschwärmt. Emily streckte die Beine aus – was für ein nobles Gefährt! Sie war in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, und auch Luca kam aus einer Familie, die immer sparsam leben musste. Eine solche Extravaganz kannte sie nur aus Filmen. Ihr Bauch kribbelte, als sie sich an den mit Stolz erfüllten Blick ihrer Mutter erinnerte, nachdem sie ihr die Vorschusssumme mitgeteilt hatte, die John ihr für das Drehbuch angeboten hatte. Ihre Mutter hatte sich die Kosten für Emilys Ausbildung vom Mund abgespart, bis Emily schließlich das Stipendium für die Filmhochschule erhalten hatte. Somit war Emilys Mutter also maßgeblich an ihrem heutigen Erfolg beteiligt. Emily hoffte, dass sie ihr irgendwann ihre Dankbarkeit dafür zeigen konnte. Sie träumte davon, einmal so reich zu sein, dass sie ihrer Mutter jeden Monat ein paar Hundert Pfund schenken konnte, damit sie nicht mehr als Verkäuferin mit zahlreichen Überstunden die Woche arbeiten musste.
Trotz des dichten Verkehrs kamen sie erstaunlich schnell voran, und schon nach zwanzig Minuten hatten sie die Londoner Innenstadt hinter sich gelassen und befanden sich auf dem Weg nach Wood Green. Kendal House lag im Norden der Stadt, Emily war noch nie dort gewesen, sie wusste nur, dass es der Firmensitz von Johns Produktionsfirma war, der auch über einige Gästezimmer verfügte. John war dafür bekannt, dass er immer die besten Teams zusammenstellte, die sich in Kendal House dann in Klausur begaben. Tatsächlich waren bereits einige Erfolgsproduktionen daraus hervorgegangen. Herbert hatte schon mehrere Drehbücher für John geschrieben und das ein oder andere Mal im Unterricht von Kendal House erzählt. Normalerweise wäre Emily jetzt sehr stolz gewesen, dass sie so schnell, kaum drei Jahre nach ihrem Studium, nach Kendal House eingeladen worden war, aber die Sorgen um Luca überschatteten diesen Erfolg, und sie konnte ihn nicht richtig genießen.
Wenig später hielten sie vor einem großen Eisentor, das sich nach einer kurzen Wartezeit elektrisch öffnete. Die Limousine passierte, und die Pforte schloss sich hinter ihnen wieder. Emily sah sich um, und einen kurzen Moment lang wurde ihr mulmig. Sie war tatsächlich eingesperrt, rechts und links des Tores konnte sie eine hohe Backsteinmauer sehen, die vermutlich das gesamte Gelände umschloss.
»Aber ich darf das Grundstück zum Spazierengehen oder zum Einkaufen schon verlassen?«, fragte sie halb scherzhaft.
»Du bist nicht meine Gefangene«, schmunzelte John. »Einkäufe sollten jedoch nicht nötig sein, das Personal ist angewiesen, all deine Wünsche zu erfüllen.«
»Oh, okay …« Emily starrte durch das Fenster auf die Rhododendren, die zu beiden Seiten des Weges wuchsen. Sie begann sich zu fragen, ob sie tatsächlich zum Arbeiten hierhergekommen war oder ob es sich nicht eher um einen Luxusurlaub handelte. Noch nie hatte sie Personal gehabt, das sich um ihre Wünsche kümmerte.
Über eine Kieszufahrt gelangten sie an ein paar Bäumen vorbei zum Haus. Kendal House bestach nicht gerade durch seine Schönheit. Es war ein großes eckiges, gregorianisches Anwesen aus roten Ziegelsteinen, das aus drei Komplexen bestand. Ein hoher vierstöckiger Turm versuchte, mit den Wolkenkratzern der Großstadt am Horizont wettzueifern, daneben stand ein langes Haus mit zwei Etagen, das in einen weiteren Gebäudetrakt überging.
Der Fahrer hielt an, und sie stiegen aus. Emily sah sich um. Vor dem Haus erstreckte sich eine grüne Wiese, die von der Auffahrt gesäumt war. Ein paar Hundert Meter weiter verlief die Mauer, die das Grundstück umgab.
John war bereits die zwei flachen Stufen zur Eingangstür hinaufgestiegen und wartete dort auf Emily.
»Erstaunlich, dass es mitten in der Stadt eine solche Oase gibt«, stellte sie fest, während sie in den kleinen Vorraum trat.
»Das Gebäude wurde Anfang des neunzehnten Jahrhunderts für einen Kommandanten der Royal Marine gebaut«, erklärte John. »Damals war hier in der Gegend kaum ein Haus zu finden.«
Emily nickte und betrachtete die hübsche Eingangshalle. Der Boden war mit schwarzen und weißen Kacheln ausgelegt, Zimmerfarne standen in den Ecken, und es duftete nach Kaffee, Zitronen und Gebäck. Drei Türen gingen links und rechts von der Halle ab, eine geschwungene Treppe führte nach oben. Geradeaus konnte Emily einen Blick in eine große, modern eingerichtete Küche erhaschen.
Schritte waren zu hören, kurz darauf tauchte eine schwarzhaarige Frau in dunkler Hose und weißer Bluse in dem Durchgang zur Küche auf.
»Hallo, Sie sind bestimmt Emily.« Sie streckte ihr die Hand entgegen. »Ich bin Mary Sanchez, die Haushälterin. Mein Mann und ich wohnen über der Garage. Wenn Sie irgendwas brauchen, am Tag oder in der Nacht, scheuen Sie sich nicht, sich an mich zu wenden.«
»Danke.« Emily lächelte und schüttelte Marys Hand.
John deutete zur Treppe. »Am besten, Mary, Sie bringen Em jetzt nach oben und begleiten sie in ihr Zimmer. In einer halben Stunde treffen wir uns auf der Terrasse zum Kennenlernen.«
Emily folgte Mary die schmale, mit blauem Teppich ausgelegte Treppe hinauf.
»Hier oben befinden sich die Büros der Produktionsfirma«, erklärte ihr Mary, als sie die erste Etage erreicht hatten. »Wenn Sie ein Anliegen haben, das Ihr Projekt betrifft, finden Sie hier immer einen Ansprechpartner.«
Mary führte Emily einen schmalen Flur entlang, an den Büros vorbei zu einem weiteren Treppenhaus.
»Ah, das ist der Turm, richtig?«, fragte Emily.
Mary lächelte. »Im Turm befinden sich die Gästezimmer. Es gibt insgesamt fünf Schlafzimmer im Haus. Ursprünglich waren es zehn, aber da John ja Büroräume brauchte …«
Die Haushälterin stieg die zweite Treppe hinauf. »Ich habe Ihnen ein Zimmer ganz oben hergerichtet, da haben Sie Ihr eigenes Bad.«
Als sie die vierte Etage erreicht hatten, stellte Emily begeistert fest, dass das Dach ganz aus Glasfenstern bestand, die für größtmögliche Helligkeit sorgten. Von einem Vorraum gingen drei Türen ab.
»Das ist Ihr Zimmer.« Mary öffnete die zweite Tür auf der rechten Seite und ließ Emily eintreten.
»Oh, das ist wunderschön!«, rief Emily begeistert, als sie in das helle Zimmer trat. Moderne und antike Möbel waren geschmackvoll kombiniert worden. Ein Boxspringbett stand in der Mitte des Raumes, alte Kommoden und Tischchen reihten sich an den Wänden. Hinter der Tür stand ein weißer Kleiderschrank. Emily trat ans Fenster und sah in den Garten hinunter, der sich bis zu einem kleinen See erstreckte.
»Unglaublich!« Sie schüttelte den Kopf. »Und das alles mitten in London.«
Auf der anderen Seite des Sees standen einige Hochhäuser, in der Ferne ragten die Wolkenkratzer der Innenstadt auf.
»Falls Sie gern angeln oder Boot fahren«, Mary trat neben sie, »können Sie sich eine Ausrüstung aus dem Gartenzimmer schnappen. Das Ruderboot liegt unten im Bootshaus, das können Sie von hier aus nicht sehen, weil es von den Bäumen verdeckt wird.«
»Gehört der See zu Kendal House?«, fragte Emily.
Mary schüttelte den Kopf. »Er ist öffentlich. Aber dieser Teil des Ufers mitsamt dem Bootshaus ist privat und gehört tatsächlich uns. Sehen Sie die Bank da unten?«
Emily nickte.
»Dort ist es abends wunderschön. Jetzt wird es in der Dämmerung schon langsam kühl, aber ein paar Sonnentage sollen in den nächsten Wochen ja noch kommen. Ziehen Sie sich einfach eine dicke Jacke an, vielleicht können Sie ja sogar dort arbeiten.«
»Das wäre toll.« Emily lächelte Mary an. »Ich danke Ihnen für den Tipp.«
In diesem Moment erschien Martin, der Fahrer, in der Tür, der John und Emily hierhergebracht hatte. Er stellte Emilys Gepäck vor dem Bett ab.
»Das ist mein Mann Martin«, erklärte Mary. »Aber Sie haben ihn ja schon kennengelernt. Dann lassen wir Sie jetzt allein, damit Sie sich frisch machen können. In zwanzig Minuten erwartet John Sie auf der Terrasse.«
Sobald sie allein war, setzte Emily sich für einen Moment auf das Bett. Sie hatte plötzlich ein schlechtes Gewissen, die nächsten Wochen in diesem Luxus zu leben, während Luca zu Hause auf sie wartete. Sie stand auf und hievte ihre Koffer aufs Bett. Während sie ihre Kleidung in den Schrank und in die Kommode räumte, versuchte sie, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die vor ihr lagen.
Ryan Scott wurde als Shootingstar in der Literaturszene gefeiert. Sein Debüt »Sterne am Nachthimmel«, in dem es um einen jungen Mann mit Borderline-Störung ging, war letztes Jahr erschienen und stand weltweit auf den Bestsellerlisten. Emilys Aufgabe war es nun also, aus dem Roman ein Drehbuch zu machen. Nachdem sie ihre leeren Koffer unter dem Bett verstaut hatte, setzte sie sich auf den Stuhl, der in der Ecke stand, und griff noch einmal zu Scotts Buch. Sie hatte es bisher erst einmal gelesen. Sie hatte zwar ein Exposé und ein umfangreiches Treatment erstellt, das sie John vor zwei Wochen zugeschickt hatte, aber sie hätte sich vielleicht noch gründlicher vorbereiten sollen. Lucas Betreuung hatte sie derart in Anspruch genommen, dass sie nicht einmal Details über den Schriftsteller recherchiert hatte. Nun, darüber würde ihr das Produktionsteam sicher gleich eine kurze Zusammenfassung liefern. Emily stand auf und sah auf die Uhr. Es wurde Zeit, nach unten zu gehen.
Mary hatte ihr den Weg so gut erklärt, dass sie ohne Probleme ins Gartenzimmer fand. Hier standen Rattanmöbel und Zimmerfarne, und eine Glastür führte zu einer großzügigen Terrasse.
Als Emily in den Garten trat, kam John auf sie zu. Nachdem er sich erkundigt hatte, ob sie mit ihrer Unterbringung zufrieden war, deutete er auf einen jungen Mann, der mit dem Rücken zu ihnen stand und in den Garten hinaussah. »Emily, darf ich dir Ryan Scott vorstellen, den Schriftsteller?«
»Oh«, überrascht betrachtete Emily den Mann, der sich jetzt zu ihnen umdrehte, »ich hatte keine Ahnung, dass Sie hier sein würden. Ich freue mich sehr, dann kann ich Ihnen ja noch ein paar Fragen zu Ihrem Werk stellen.«
»Mehr als das, Em«, erwiderte John, während er ihr jovial den Arm um die Schulter legte. »Ihr werdet das Drehbuch gemeinsam schreiben.«
»Was?« Emily sah John verwirrt an.
Der Produzent drückte sie an sich. »Ryan wird bestimmt eine Menge guter Ideen dazu beitragen.«
»Aber ich wusste ja gar nichts davon.« Emily spürte, wie Ärger in ihr aufstieg. Warum hatte John ihr nicht im Vorfeld davon erzählt? Spätestens die Fahrt vom Bahnhof hierher wäre eine günstige Gelegenheit dafür gewesen.
»Warum auch? Es wird deine Arbeit sicher wunderbar ergänzen.« John lächelte sie an.
Emily atmete tief durch. »Und wie lange steht das schon fest?«
»Ich hatte von Anfang an klargestellt, dass ich nur mit einer Filmadaption einverstanden bin, wenn ich am Drehbuch mitarbeiten darf«, mischte sich nun Ryan ein. »Sonst hätte ich den Vertrag nicht unterschrieben.«
»Aber …«, begann Emily.
Doch John unterbrach sie. »Wir können gleich noch genug reden. Ich möchte, dass ihr jetzt erst einmal alle kennenlernt.«
Emily starrte auf die Wiese vor ihnen. Sie fühlte sich überrumpelt und fragte sich, warum John ihr nicht mitgeteilt hatte, dass der Romanautor am Drehbuch mitschreiben wollte. Ryan Scott hatte sicher klare Vorstellungen, sonst hätte er nicht so vehement darauf bestanden.
»Das sind Rose und Tatjana, unsere Teamassistentinnen, die ihr mit jeder nur denkbaren Recherche beauftragen könnt«, sagte John gerade. »Wenigstens eine von ihnen ist jeden Werktag von acht bis fünf in Kendal House. Ihr könnt sie aber auch per Mail oder Telefon erreichen.«
Emily betrachtete die beiden Frauen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Tatjana war rundlich und an die sechzig, Rose in Emilys Alter, blond und gertenschlank.
»Frank kennt ihr ja beide schon. Em, du hast bei der Miniserie ja mal mit ihm zu tun gehabt.« John deutete auf den Regisseur, an den Emily sich noch gut erinnern konnte. Er hatte bei einer der zwei Folgen Regie geführt.
»Und mein Co-Produzent Cliff Cartwright …« John deutete auf einen Mann mit gewaltigem Schnurrbart, der nun Emily und Ryan die Hand reichte.
»… sowie unser Produktionsleiter Claus.«
Claus war ein drahtiges Kerlchen und trug ein Klemmbrett unter dem Arm. Er wirkte voller Tatendrang und energiegeladen.
John nickte zufrieden. »Gut, jetzt kennt ihr alle. Claus, Cliff und meine Wenigkeit werden nur sporadisch hier sein, und natürlich am Ende, wenn das Buch steht und wir noch einmal alles durchsprechen.«
Emily wusste, dass das noch lange dauern konnte, denn Drehbücher wurden immer wieder umgeschrieben. Für die Miniserie hatte sie die Bücher viermal überarbeiten müssen.
»Ich habe euch auf die Terrasse gebeten«, fuhr John nun fort und deutete auf die Wiese und den See vor ihnen, »weil ich euch alle Möglichkeiten hier zeigen wollte. Ryan und Em, ihr könnt auf Spaziergängen um den See herum, bei einer Bootsfahrt oder auch beim Barbecue auf der Terrasse Ideen entwickeln. Wir möchten euch euren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich gestalten, damit sich eure Kreativität frei entfalten kann. Das ist auch der Grund dafür, dass ich bei euch beiden darauf bestanden habe, dass ihr während der Arbeit am Drehbuch in Kendal House wohnt. Ich brauche all eure Energie, ich will eure Aufmerksamkeit nicht teilen. Nehmt euch Zeit, entspannt euch und setzt euch nicht unter Druck.«
Emily sah zu ihrem Co-Autor, der die Stirn runzelte. Noch immer ärgerte sie sich darüber, dass John ihr im Vorfeld nicht von ihrer geplanten Zusammenarbeit erzählt hatte. Wie sollte sie sich denn entspannen, wenn er sie so überfuhr? Außerdem hatte sie keine Zeit, sie musste die Arbeit so schnell wie möglich erledigen, um zu Luca zurückzukehren.
»Dann lasst uns jetzt wieder reingehen.« John deutete auf die Tür zum Gartenzimmer, und während die kleine Gruppe den Raum durchquerte, erklärte er: »Fühlt euch bitte wie zu Hause und bedient euch in der Küche jederzeit an Essen und Getränken. Hier nebenan ist das Esszimmer, wo Mary euch den Lunch und das Dinner servieren wird. Das Frühstückszimmer liegt neben der Eingangstür – oder möchtet ihr lieber in euren Zimmern frühstücken?«
Emily schüttelte schnell den Kopf. Das fehlte noch, dass ihr das Frühstück ans Bett serviert wurde. Auch Ryan schien nichts davon zu halten, denn er runzelte nur die Stirn.
»Im Erdgeschoss gibt es außerdem noch diverse Besprechungsräume, einen Arbeitsbereich für euch und einen kleinen Salon. Im Untergeschoss sind der Kinosaal, der Weinkeller und das Fitnessstudio mit Sauna und Schwimmbecken untergebracht. Ganz oben im Haus befindet sich noch ein weiterer Kreativbereich, dort könnt ihr euch ebenfalls zum Schreiben zurückziehen.« John machte eine Pause und rieb sich erwartungsvoll die Hände. »Dann beginnen wir mal mit unserer ersten Teambesprechung.«
Er ließ allen den Vortritt in den angrenzenden Besprechungsraum. Als Emily das großzügig geschnittene Zimmer mit dem weißen runden Tisch in der Mitte betrat, fielen ihr gleich die gemütlichen Sitzecken auf, die mit hellen Sitzsäcken und dicken Flokati-Teppichen ausgestattet waren. Nachdem alle um den großen Tisch herum Platz genommen hatten, servierte Mary Cappuccino, Kaffee und Tee. Tatjana teilte Projektmappen, Schreibblöcke und Stifte aus.
Als Ryan Scott sein I-Pad einschaltete, biss Emily sich auf die Unterlippe. Vielleicht hätte sie ihren Laptop mit nach unten bringen sollen. Wenigstens hatte sie den Roman dabei, den sie jetzt neben sich auf den Tisch legte.
»Ich muss sagen, Ryan«, begann John, als sich die Unruhe im Raum gelegt hatte, »dass ich die Filmrechte an deinem Roman nicht nur wegen seines kommerziellen Erfolgs unbedingt haben wollte, sondern weil mich die Geschichte wirklich berührt hat.«
Mit einem knappen Nicken nahm der Autor das Kompliment zur Kenntnis. Emily zog eine Augenbraue hoch. Was für eine arrogante Reaktion. Er schien so sehr von sich überzeugt zu sein, dass ihn nicht einmal das Lob eines namhaften Produzenten wie John Mercy beeindrucken konnte. Emily betrachtete ihn nun genauer. Auf den ersten Blick sah er genauso aus wie auf dem Autorenbild des Buchumschlags. Ryan Scott trug sein dunkles lockiges Haar leicht zerzaust, was ihn extrem attraktiv machte und ihm eine leicht verwegene Note verlieh. Aber der Ausdruck seiner Augen, der auf dem Foto so verschmitzt wirkte, war jetzt ein anderer. Sein dunkler Blick wirkte melancholisch. Unter seinem Pullover konnte sie eine breite, gut trainierte Brust erahnen, kein Ansatz eines Bauches war zu erkennen. Ryan Scott war ein attraktiver Mann, das musste Emily zugeben.
Während John über den Roman sprach, nippte sie an ihrem Cappuccino. In den meisten Punkten schienen seine Vorstellungen mit Emilys übereinzustimmen. Er sprach sogar des Öfteren ihr Konzept an und lobte die ein oder andere Idee darin.
»Ihr habt alle in euren Projektmappen Ems Exposé und ihr Treatment.« Jetzt wandte er sich direkt an sie. »Stellst du uns bitte beides vor?«
Emily räusperte sich verlegen. Die Blicke aller richteten sich auf sie.
»Gerne.« Sie schlug ihre Mappe auf und begann, ihre Gedanken vorzutragen. »Einer der Kernpunkte meines Konzepts ist, dass Mannys Gedankenwelt in kalten Farben gedreht wird und die Realität in übersättigten Tönen. Es ist wichtig, dass deutlich wird, was real und was seine Eigenwahrnehmung ist. Gleichzeitig überfordert ihn die Wirklichkeit, was in richtig schrillen Farbtönen abgebildet werden kann«, schloss Emily ihre Erklärungen. »Der Zuschauer soll den Drang haben, die Augen zu schließen, um Mannys Überforderung nicht selbst erfahren zu müssen.«
»Danke, Em.« John sah sich in der Runde um. »Eure Ideen dazu?«
Einen Moment schwiegen alle.
»Natürlich wird das durch entsprechende Musik unterstützt«, schob Emily schnell hinterher.
John nickte. Tatjana und Rose schrieben eifrig mit.
»Okay«, meldete sich Ryan Scott zu Wort. »Aber das Ganze funktioniert nicht.«
»Wie bitte?«, fragte Emily, die im ersten Moment glaubte, sich verhört zu haben.
Die Stifte der Assistentinnen hielten inne. Aller Augen richteten sich jetzt auf den jungen Autor.
»Man kann Realität und Fiktion nicht trennen, weil bei Manny alles eins ist.« Ryan Scott sprach zu John, er sah Emily nicht einmal an.
»Wir erzählen aber eine Geschichte über Manny«, wandte sie ein. »Und nicht aus seiner Innensicht.«
Noch immer kein Blick von Ryan zu Emily. Er antwortete, zu John gewandt: »Das sehe ich anders. Die Geschichte muss aus Mannys Perspektive erzählt werden. Und zwar ausschließlich.«
Emily unterdrückte ein Seufzen. Ryan Scott wirkte wenig kompromissbereit.
»Nun«, begann John und sah zwischen Emily und Ryan hin und her. »Em hat bereits einige Texte für mich geschrieben, ich kenne sie schon länger. Sie hat ein sehr gutes Gespür, und wir sollten gründlich über ihre Vorschläge nachdenken.«
»Emily wer?«, sagte Ryan mit gelangweilter Stimme. »Ich habe noch nie von ihr gehört und frage mich, warum kein namhafter Drehbuchautor wie Walter Miller oder Evelyn Kaine engagiert wurde? Waren sie nicht frei? Oder wird hier absichtlich gespart und eine Lückenbüßerin eingesetzt?«
Emily sog empört die Luft ein. Was für ein arroganter, unverschämter Schnösel! »Entschuldigung, aber von Ihnen habe ich im Filmbereich auch noch nichts gehört.«
John lachte, es wirkte ein wenig gezwungen. »Da habt ihr wohl beide etwas verpasst. Schließlich seid ihr gute Autoren, jeder in seinem Segment. Und diese Kreativität wollen wir uns zunutze machen.« John lehnte sich zurück. »Dabei ist Emily keinesfalls eine Lückenbüßerin. Ich habe sie ausgewählt, weil ich ein großer Fan ihrer Arbeit bin.«
»Okay«, sagte Ryan und hob entwaffnend die Hände. »Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Nur leider …«, jetzt machte er eine dramatische Pause, sodass Emily sich fragte, ob er nicht lieber, statt am Drehbuch mitzuwirken, eine Rolle im Film bekommen sollte, »überzeugt mich das Konzept hier kein bisschen. Ich finde das Exposé und das Treatment einfallslos und wenig intelligent.«
Emily schluckte. Zu gern hätte sie eine schlagfertige Bemerkung gemacht, aber ihr Kopf war vollkommen leer. Wenn Ryan Scott sich über ihren unbekannten Namen mokierte, kümmerte sie das wenig, aber ihre Arbeit zu kritisieren, die er nicht einmal genau kannte, war beleidigend und verletzend. Dabei hatte er selbst bisher nur einen einzigen Roman veröffentlicht – was ihn seiner Ansicht nach weit über Emily zu stellen schien. Sie starrte ihn mit offenem Mund an und suchte verzweifelt nach einer bissigen Antwort.
Hatte dieser eingebildete Blödmann vielleicht sogar recht? Hätte sie tatsächlich etwas mehr Arbeit in die Vorbereitung stecken sollen? Aber Lucas Krankheit und die Sorge um ihn hatten sie zu sehr beschäftigt. Plötzlich zweifelte sie daran, dass John ihr die Wahrheit gesagt hatte. Am Ende hing seine Begeisterung für Emilys Arbeit mehr mit ihrem durchaus attraktiven Äußeren zusammen als mit ihrem ach so grandiosen Talent? Hatte er den Autor womöglich hierher eingeladen, weil er Emily diesen Job genauso wenig zutraute wie Ryan?
Sie sah zu John hinüber, dessen Gesicht eine Spur roter geworden war als zuvor. Die restlichen Mitarbeiter starrten verlegen auf ihre Fingernägel oder in die Mappen vor sich auf dem Tisch.
»Also gut«, presste Emily hervor. »Wie sehen das denn die anderen? Sind alle hier der Meinung, dass meine Arbeit schlecht ist?«
»Das habe ich nicht gesagt«, sagte Ryan in einem leicht genervten Tonfall, in dem er auch zu einem Kleinkind hätte sprechen können. »Es ist nur nicht wirklich originell, nichts Neues.«
»Darum geht es doch gar nicht«, mischte sich John endlich ein. »Wir können das Rad nicht neu erfinden. Und warum auch? Es dreht sich doch wunderbar. Schließlich wollen wir keinen experimentellen Film drehen, sondern eher Mainstream. Und dafür verwenden wir Formate, die schon erprobt sind, weil die Zuschauer genau das erwarten und sehen wollen. Wir sind nämlich darauf aus, dass sich der Film gut verkauft, sonst brauchen wir gar nicht weiterzumachen.«
»Das eine muss das andere ja nicht ausschließen«, antwortete Ryan.
»Doch.« John schüttelte den Kopf. »Und da musst du mir vertrauen, denn wir sind die Profis im Filmgeschäft. Ich kann sehr gut abschätzen, was läuft und was nicht. Ein Restrisiko bleibt immer, aber sicher ist, dass neue Konzepte nicht die breite Masse erreichen.«
»Im Verlagswesen ist es doch ähnlich, oder nicht?«, mischte sich jetzt Cliff Cartwright ein, der sich über seinen Schnurrbart strich. »Die hochgelobten literarischen Romane sind häufig Zuschussgeschäfte. Aber gute Unterhaltung wie Ihr Roman, Ryan«, Cliff bedachte ihn mit einem scharfen Blick, »verkaufen sich in hohen Stückzahlen.«
»Womit wir wieder beim Thema wären«, meldete sich John erneut zu Wort. »Auch du hast das Rad nicht neu erfunden. Gib Em also eine Chance. Sie versteht viel von ihrem Fach, lass dich überraschen.«
Emily wäre am liebsten wütend aus dem Zimmer gestürmt. Ja, es tat gut, zu hören, dass John sie verteidigte. Aber sie hatte nur schweigend danebengesessen und wie ein dummes Püppchen zugehört, während die Männer über sie redeten. Plötzlich bereute sie es zutiefst, diesen Auftrag angenommen zu haben. Wäre sie doch bloß bei Luca in Cambridge geblieben, wo sie dringend gebraucht wurde. Sollte dieser hochnäsige Schreiberling doch sein Drehbuch selbst schreiben.
»Von mir aus«, Ryan Scott lehnte sich zurück und legte sein rechtes Sprunggelenk auf das linke Knie, »es bleibt mir ja sowieso nichts anderes übrig, nehme ich an. Ich gehe davon aus, dass Miss …?«
»Greenberg«, half Emily ihm mit eiskalter Stimme weiter.
»… dass der Vertrag für das Drehbuch bereits unterschrieben ist und vermutlich auch schon eine ordentliche Vorschusssumme bezahlt wurde.« Er sah sich fragend im Raum um. Als er keine Antwort erhielt, fuhr er fort: »Notiz an mich selbst: Bei künftigen Rechtevergaben sollte ich die Klausel einschließen, dass ich ein Mitspracherecht beim Drehbuchautor habe.«
Emily öffnete sprachlos den Mund. Was für ein Ekel! Wie sollte sie die nächsten Wochen mit diesem Scheusal überstehen, nein, mehr noch: Wie sollte sie kreativ mit ihm zusammenarbeiten?
***
Ryan hielt Johns Blick stand. Er hatte durchaus bemerkt, dass er den sonst so eloquenten Produzenten überrumpelt hatte. Es war wie eine gute erste Duftmarke, die er gesetzt hatte. Eigentlich ging es ihm gar nicht um die kleine Drehbuchautorin, von der er tatsächlich noch nie etwas gehört hatte. Nein, er hatte es John nur ein wenig ungemütlich machen wollen, denn der wusste genau, dass Ryan gerade ganz andere Probleme hatte und definitiv nicht hier in Kendal House arbeiten wollte. Dummerweise hatte sein Agent jedoch nicht durchsetzen können, dass die Arbeit am Drehbuch in Northumberland stattfand. Jetzt war Ryan gezwungen, in Kendal House zu wohnen, da die Fahrt zu ihm nach Hause fast fünf Stunden dauerte. Dabei wurde er dringend in Hartburn gebraucht – bei seiner Frau Emma und seiner Tochter Kelly. Er hatte im Vorgespräch mit John auf seine schwierige familiäre Situation hingewiesen, hatte ihm sein Herz ausgeschüttet, seine Sorgen offenbart. Aber John war keinen Millimeter von seiner Einstellung abgewichen, dass er alle, die an der Produktion beteiligt waren, hundertprozentig brauche und private Probleme gefälligst ausgeblendet werden sollten. Doch Ryans zweijährige Tochter litt schon seit einigen Monaten an Leukämie. Kelly hatte vielleicht nicht mehr lange zu leben, und diese letzten kostbaren Wochen musste Ryan jetzt in Kendal House vergeuden. John hatte angeboten, ihn freizustellen, schließlich habe er ein exzellentes Team an seiner Seite. Aber das hätte auch den Verzicht auf die stattlichen Tantiemen für das Drehbuch bedeutet, und Ryan brauchte zurzeit jeden Penny. Kellys Therapien waren teuer, doch die Krankenversicherung zahlte nur einen Sockelbetrag. Dennoch ließen Emma und Ryan nichts unversucht, sie hofften weiter und suchten nach einer Therapie, die endlich anschlug und ihre zauberhafte und so gebrechliche Tochter gesund werden ließ. Emma hatte von einer Stammzellentherapie in Atlanta gehört, die vielversprechend klang. Ryan kannte sich nicht besonders gut aus, doch seine Frau hatte sich intensiv damit beschäftigt. Aber die Reise in die Staaten und die Behandlung waren teuer. Zu teuer für das Budget der jungen Familie. Das Honorar für Ryans Drehbuch war also für Kelly lebenswichtig.
»Gut.« John schlug mit beiden Handflächen auf die Tischplatte. »Wir lassen euch jetzt allein. Lernt euch erst einmal kennen. Ich bin mir sicher, ihr werdet großartig zusammenarbeiten. Und da es sowieso schon fast Zeit für den Lunch ist, schlage ich vor, ihr geht ins Esszimmer. Bei einem gemeinsamen Essen könnt ihr euch austauschen und nach der Mittagspause dann loslegen. Einverstanden?«
Ryan machte eine knappe Handbewegung, die – wie er hoffte – nicht allzu enthusiastisch wirkte. Unauffällig sah er zu Emily Greenberg hinüber, die John mit schreckhaft geweiteten Augen ansah. Sie schien sich gar nicht wohl in ihrer Haut zu fühlen. Einerseits tat es ihm leid, dass er seine Rache an John auf dem Rücken dieser jungen Frau austrug, andererseits wirkte sie nicht, als ob sie auch nur irgendwelche Probleme hätte. Vermutlich kam sie aus einem reichen Elternhaus, lebte in einem teuren, von ihren Eltern finanzierten Apartment, und ihre größte Sorge war es, ihre hübsche Figur zu erhalten. Vielleicht hatte sie auf diese Weise sogar den Auftrag bekommen. Ja, so musste es sein. Schließlich war sie noch viel zu jung, um Johns Aufmerksamkeit durch die Qualität ihrer Arbeit erregt zu haben. Ihre Eltern waren vermutlich seine Freunde oder im selben exklusiven Golfclub wie John Mercy. Gut, dass er sie gleich zu Beginn eingeschüchtert hatte, so würden sie schnell mit der Arbeit vorankommen.
Ryan stand auf.
John nickte ihm noch einmal zu, er war ihm gegenüber jetzt deutlich kühler als heute Morgen, aber Ryan war nicht hier, um sich Freunde zu machen. Emily griff nach ihrem Exemplar von »Sterne am Nachthimmel« und verließ zügig den Raum. John eilte ihr nach, und sie verschwanden gemeinsam in Richtung Esszimmer. Ryan wartete, bis die anderen ebenfalls den Raum verlassen hatten, dann zog er das Handy aus seiner Tasche und drückte auf die letzte Nummer, die er gewählt hatte. Während das Freizeichen ertönte, ließ er sich auf einen der Sitzsäcke fallen, die auf dem Boden verteilt lagen. Die Mailbox sprang an, Emma ging wieder nicht ran. Sie hatte natürlich eine Menge Arbeit mit ihrer Tochter, aber sie wusste doch, dass er sich große Sorgen machte. Kelly war im Krankenhaus, die Chemotherapie dauerte noch einige Wochen. Danach wurde entschieden, wie es weiterging. Alles hing nun davon ab, dass die Chemotherapie anschlug.
Emma übernachtete mit Kelly in der Klinik. Aber eine kurze Nachricht, dass alles in Ordnung war, hätte ihn beruhigt. Verdammt! Er stieß wütend die Luft aus. Es war so falsch, dass er gezwungen war, hier in London zu sitzen. Er würde diese Arbeit schnell hinter sich bringen und in wenigen Wochen wieder bei seiner Familie sein, wo er schließlich hingehörte. Auch mit seinem neuen Roman kam er nicht weiter. Seit sie Kellys Diagnose erhalten hatten, hatte er kein Wort mehr an dem Manuskript geschrieben.
»Ryan?« Mary stand lächelnd in der Tür. »Kommen Sie zum Lunch? Ich serviere das Essen in zwei Minuten, okay?«
Er nickte und massierte seine Nasenwurzel mit Daumen und Zeigefinger, bevor er aufstand und zur Tür ging. Als er das Esszimmer betrat, saß John neben Emily am Tisch. Beide sahen auf.
»Da sind Sie ja«, sagte John und erhob sich. »Ich habe Em noch etwas Gesellschaft geleistet.«
Ryan betrachtete den langen Tisch, an dem bequem zehn Personen speisen konnten. Jetzt waren Teller, Gläser und Besteck an zwei Plätzen gegenüber gedeckt. Ohne zu zögern, setzte er sich, um seine Selbstsicherheit zu demonstrieren. Emily sollte gleich merken, dass es nicht viel brachte, mit ihm zu diskutieren. Je schneller sie das einsah, desto eher würden sie fertig werden.
»Wenn ihr irgendwas braucht, wendet euch einfach an Mary oder die beiden Teamassistentinnen.« John ging zur Tür und zwinkerte ihnen aufmunternd zu. »Viel Spaß, Leute.«
»Danke«, murmelte Emily, aber ihr Tonfall klang nicht, als würde sie es auch so meinen.
Ryan nickte nur knapp.
Dann saßen sich beide einen Moment lang stumm gegenüber. Ryan blähte die Wangen und stieß die Luft in kurzen Intervallen wieder aus.
»Also«, begann Emily, »wie es aussieht, müssen wir irgendwie miteinander arbeiten, obwohl wir beide nicht viel voneinander halten.«
Ryan hob die Hände. »Das habe ich nicht …«