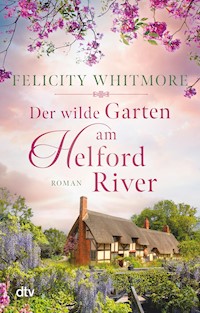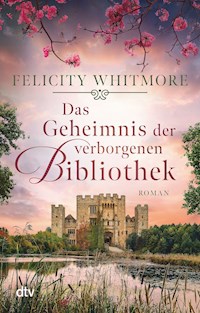9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hampton-Hall-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine spektakuläre Rückkehr. Ein Kreis, der sich schließt. Dritter Teil der Trilogie über die starken Frauen von Hampton Hall - Atmosphärische, gefühlvolle, spannende Frauenunterhaltung auf kunstvoll verflochtenen Zeitebenen - Für Leserinnen von Lucinda Riley, Kate Morton und Katherine WebbVereinigte Staaten, 1855. Abigail, die frühere Lady of Mahony, macht sich auf eine gefährliche Mission. Ihr Ziel ist New York – und eine wertvolle Statue, in die sie einst all ihren Schmuck gießen ließ. Sie wurde der Familie gestohlen und an einen New Yorker Multimillionär veräußert. Nun will sich Abigail ihr Eigentum zurückholen. In Captain James Maroon findet sie überraschend einen Verbündeten. Aber ihre Feinde tun alles, um Abigails Vorhaben zu verhindern. Währenddessen muss auf Hampton Hall ihr Sohn Ebenezer um sein großes Glück bangen … Alle Bände der Serie: Band 1: Der Faden der Vergangenheit Band 2: Die Straße der Hoffnung Band 3: Die Heimat des Herzens Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Felicity Whitmore
Die Heimat des Herzens
Die Frauen von Hampton Hall
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Anke
Prolog
Juli 1848
Sir!«, rief der Matrose über das Tosen des Windes hinweg. »Wir haben ein Problem.«
Captain Maroon sah den Jungen an. Vor vier Stunden war der Klipper aus dem Hafen von Fort Umpqua ausgelaufen und eine lange Fahrt lag vor ihnen. So kurz nach Beginn der Reise hatte Maroon nicht mit einer solchen Meldung gerechnet. Er fuhr sich mit der Zunge über die salzigen Lippen und sah zu den vom Wind geblähten Rahsegeln hinauf.
»Wir haben einen blinden Passagier an Bord«, fuhr der Matrose fort, als der Captain nicht antwortete.
»Schon wieder?« Maroon seufzte. »Ist er jung und kräftig? Dann teilt ihn für niedere Aufgaben ein. Er soll sich seine Schiffsfahrt verdienen.« Maroon wandte sich ab und hielt nach einem der Rudergänger Ausschau, um ihm eine Korrektur des Kurses durchzugeben.
»Sir …« Der Matrose zog die Augenbrauen unmerklich nach oben. »Es ist eine Frau.«
»Um Himmels willen!«, rief der Captain überrascht. »Wie ist das möglich? Hat denn niemand aufgepasst, als sie an Bord gekommen ist?«
»Sie hat sich mit der Gruppe der Missionare eingeschlichen«, erklärte der Matrose und stemmte sich gegen den Wind. »Wir dachten, sie gehört zu ihnen.«
Maroon seufzte. »Eine Frau? Bring sie hierher.«
Er verfluchte die Passagiere an Bord oft genug. Die meisten waren der Mannschaft ständig im Weg, wurden seekrank, und seine Besatzung musste ihr Erbrochenes wegwischen. Aber diese Leute brachten viel Geld, das konnte Maroon nicht abstreiten.
Während er seinen Blick über die amerikanische Küste schweifen ließ, die hinter ihnen allmählich in der Ferne verschwand, wünschte er sich einmal mehr, nur noch Waren transportieren zu müssen. Aber in diesem Jahr war der Andrang der Passagiere extrem hoch. Seit in Kalifornien Gold gefunden worden war, zog es halb Amerika – nein, die halbe Welt – in den Westen. Letztes Jahr waren es kaum mehr als dreizehn Schiffe gewesen, die die strapaziöse und gefährliche Reise von New York um Kap Hoorn herum bis zur amerikanischen Westküste auf sich genommen hatten. Doch jetzt fuhren Hunderte von Schiffen diesen Weg. Die Golden Star war einer der wenigen Klipper, der bis ins nördliche Oregon hochfuhr. Ihre Reederei hatte eine Vereinbarung mit der Marine, dass sie Fort Umpqua mit Waren beliefern sollte. Aber wenn die Schiffe in New York ausliefen, war jeder Platz an Bord mit Passagieren besetzt. Die Frachträume waren bis obenhin mit Waren gefüllt, die im Westen das Dreifache ihres Preises einbrachten. Denn hier herrschte Mangel an beinahe allen Gütern, die zum Leben benötigt wurden.
Mit dem Passagiertransport war viel Geld zu verdienen. Jedermann schien zurzeit in den Westen zu wollen und viele fanden den Seeweg angenehmer als die beschwerliche Reise über Land. Bei seinem letzten Halt in San Francisco hatte Maroon beinahe seine gesamte Mannschaft eingebüßt. Die Seeleute waren an Land gegangen und nicht zurückgekehrt. Auch sie hatten dem Ruf des Goldes nicht widerstehen können. Der Captain brauchte einige Tage, um eine neue Mannschaft zusammenzustellen.
Jetzt, auf der Rückreise nach New York, befanden sich nur wenige Passagiere an Bord. Außer fünf Missionaren hatte Maroon nur noch einen jungen Mann aufgenommen, dessen Träume bereits geplatzt waren. Er hatte sein Glück im Gold gesucht und nicht gefunden. Nun wollte er möglichst schnell zu seiner Verlobten zurück nach New England.
Die Golden Star war zwar nicht so schnell wie die Memnon, die mit 122 Tagen den Rekord für die Strecke von New York nach San Francisco hielt, aber sie übertraf die alten Dampfschiffe, die gut 200 Tage dafür gebraucht hatten. Maroon hoffte, in etwa fünf Monaten seinen Heimathafen New York zu erreichen. Aber es kam immer auf die Wetterbedingungen an. Man wusste nie, welche Unwetter einen unterwegs überraschten.
Maroon sah zwei Matrosen an Deck kommen, die eine gut gekleidete Dame zu ihm führten. Erstaunt blickte er zu ihnen. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit einer solch hübschen Frau, die ihrer eleganten Kleidung nach aus der oberen Gesellschaftsschicht stammen musste.
»Sir!« Die Matrosen schubsten sie nun rabiat vor den Captain, der die beiden Männer empört ansah. Es bestand kein Grund, so grob mit der Frau umzugehen.
Maroon zog die Augenbrauen zusammen.
»Sie sind als blinder Passagier an Bord gekommen?«, sagte er zu der Frau. »Verraten Sie mir Ihren Namen?«
Sie schien nicht mehr ganz jung zu sein, erste Falten hatten sich um ihre Augen und den Mund gebildet.
»Abigail Hampton, Lady Mahony«, stellte die Dame sich vor.
Die Matrosen lachten.
Maroon sah sie mit finsterem Blick an, woraufhin sie verstummten. Die Golden Star wurde von einer Welle erfasst und schaukelte heftig. Die Lady strauchelte kurz, fand aber sofort wieder das Gleichgewicht. Ihre Wangen waren leicht gerötet, doch sie schien zumindest seefest zu sein.
»Woher stammen Sie?«, wollte der Captain wissen.
Er war sich nicht sicher, ob er ihr glauben sollte. Eine englische Adelige als blinder Passagier auf der Golden Star war so unwahrscheinlich wie ein indischer Maharadscha auf einem Siedlertreck.
»Ich komme aus Stockmill in England«, erklärte sie.
Der Wind zerrte an ihrem Haar und hatte einige Strähnen aus ihrer sorgfältigen Frisur gelöst, die ihr um den Kopf wehten. Erste graue Haare hatten sich in den mahagonifarbenen Ton gemischt.
Maroon betrachtete das schöne Gesicht, die grünen Augen, die von langen Wimpern eingerahmt wurden, den schlanken Hals, die gerade Nase und die hohen Wangenknochen. In ihren Augen lag ein dunkler Schatten, der darauf hindeutete, dass sie bislang kein einfaches Leben gehabt hatte. Sie schwankte leicht vom Seegang, machte aber keine Anstalten, sich an der Reling festzuhalten.
»Und wie sind Sie hier in Oregon auf die Golden Star gelangt?«, fragte Maroon. »Es ist ein weiter Weg von England bis hierher. Sie haben vermutlich nicht nach Gold gesucht, nehme ich an?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es ist eine komplizierte Geschichte, die in Oregon grausam endete. Ich wurde gefangen gehalten und konnte nur durch eine List entkommen.«
In ihrer Miene lag ein Ausdruck von Melancholie und Entschlossenheit. Etwas faszinierte den Captain außerordentlich an dieser Dame, aber er konnte nicht sagen, was es genau war. Gedankenverloren blickte er zu den Rahsegeln hinauf. Was sollte er mit ihr anstellen? Er nahm grundsätzlich keine allein reisenden Damen an Bord, die Verantwortung war ihm zu groß. Er kannte seine Matrosen nur zu gut und wusste, wie hungrig sie nach Frauen wurden, wenn sie erst längere Zeit auf See waren. Es war besser, die Männer gar nicht erst in Versuchung zu führen.
Eine Möwe ließ sich auf der Reling nieder. Captain Maroon betrachtete das Tier und überlegte, welche Möglichkeiten er jetzt hatte. Er konnte umkehren und die Lady wieder in Fort Umpqua an Land bringen. Vermutlich war sie vor ihrem Ehemann geflohen, dem sie dem Gesetz nach gehörte. Sie zu ihm zurückzubringen wäre eigentlich seine Pflicht. Aber sie waren bereits vier Stunden unterwegs, und sie konnten es sich nicht leisten, auf diese Weise einen halben Tag zu verlieren. Außerdem konnte die Golden Star nur mit der Flut auslaufen, und sie würden wahrscheinlich sogar einen ganzen Tag darauf warten müssen. Nein, Maroon würde nicht kehrtmachen, nur weil sich ein Weibsbild an Bord geschmuggelt hatte! Er betrachtete die Lady nachdenklich. Es erforderte großen Mut, sich auf den Klipper zu stehlen. Diese Frau war ihm ein Rätsel. Sie war besonders, das war dem Captain klar. Und doch musste er eine Lösung finden. Er könnte sie auch bei nächster Gelegenheit an Land bringen und sich selbst überlassen.
»Als allein reisende Frau ist es nicht ungefährlich für Sie«, stellte Maroon schließlich fest. »Haben Sie die finanziellen Mittel, Ihre Fahrt zu bezahlen?«
Die Frau, die sich Lady Mahony nannte, streckte das Kinn vor. »Ich besitze nichts weiter als die Dinge, die ich am Leib trage. Aber vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, wie ich meine Passage bezahlen kann …« Sie schluckte, und ihr Blick wanderte zu den Möwen, die die Golden Star umkreisten.
»Woran haben Sie gedacht?« Maroon hätte beinahe gelacht. »Die Arbeit an Bord ist hart, auch für die Männer. Es gibt keine leichten Aufgaben, die von einer Frau erledigt werden könnten.«
»Ich bin nicht mehr jung und auch nicht mehr so schön, wie ich einmal war, aber es wird hier an Bord sicher einige Seeleute geben, die sich nach einer Frau sehnen. Ich bin bereit, mich ihrer anzunehmen, wenn ich dafür mitfahren darf.«
Maroon schnappte nach Luft. Sie wirkte nicht wie eine Dirne, und es war offensichtlich, dass ihr dieses Angebot nicht leichtfiel. Sie musste wahrhaft verzweifelt sein. Die Matrosen zu ihren beiden Seiten grinsten.
Der Captain warf ihnen einen finsteren Blick zu. Dann betrachtete er wieder die Dame, die vor ihm stand. Was musste ihr zugestoßen sein, dass sie sich freiwillig fremden Männern hingab? Ihre Flucht musste sehr wichtig für sie sein. Sie besaß offenbar einen großen Lebenswillen und musste Furchtbares erlebt haben.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, das lasse ich nicht zu. Zum einen würde das der Moral und dem Zusammenhalt der Mannschaft nicht guttun, und zum anderen wissen Sie nicht, was Sie sich damit antun würden. Sie kennen die Gier dieser Männer nicht.«
»Ich habe in den letzten Jahren Dinge erlebt, die ich mir nicht schlimmer vorstellen kann.« Sie drehte sich zu den jungen Männern um und musterte sie mit einem durchdringenden Blick. Maroon wurde klar, dass sich diese Frau durchaus zu wehren wusste. Ihr seidenes Kleid flatterte im Wind. »Diese Schiffsjungen könnten mir nichts Schrecklicheres anhaben, als ich schon erdulden musste.«
Maroon schickte die Männer weg. Dann sagte er: »Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen Glauben schenken soll, dass Sie eine englische Lady sind. Aber ich meine zumindest zu erkennen, dass Sie keine Dirne sind.«
»Ich wurde zu einer gemacht«, sagte die Frau und presste die Lippen aufeinander.
Maroon betrachtete sie eine Weile, ihr schönes Gesicht wurde von der rauen Seeluft umpeitscht. Dann fragte er: »Wohin wollen Sie?«
Sie hob die Schultern. »Erst einmal weg von Oregon. Das ist alles, was ich will.«
Maroon ließ seinen Blick in die Ferne schweifen. Die Küste war inzwischen nur noch als schmales Band zu erkennen. Eine Welle schlug an die Bordwand und Gischt spritzte bis zu ihnen herauf. Der Captain wischte sich das Salzwasser aus dem Gesicht.
»Sie haben mich in eine kompromittierende Situation gebracht«, sagte er. »Damit Sie diese Fahrt einigermaßen unbeschadet überstehen, muss ich Sie unter meinen persönlichen Schutz nehmen.« Er zögerte kurz und betrachtete die attraktive Frau, die vor ihm stand. »Sie werden wie eine Geliebte in meiner Kajüte wohnen. Ich werde Sie nicht anrühren, aber die Männer müssen davon ausgehen, dass Sie zu mir gehören. Sonst werden sie ihre Finger nicht von Ihnen lassen.«
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen diese Umstände mache«, sagte sie leise. »Glauben Sie mir, ich hätte es nicht getan, wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Aber ich bin der Hölle und dem Teufel selbst entkommen.«
»Es gibt viele Teufel«, antwortete er nachdenklich. »Als alleinstehende Frau wird es nicht leicht für Sie werden.«
Ihr Blick wanderte an ihm vorbei aufs Meer hinaus. Sie schien plötzlich weit fort zu sein, in Erinnerungen an eine andere Zeit.
»Also gut.« Er deutete zur Treppe. »Ich bringe Sie in meine Unterkunft. Ohne meine Begleitung werden Sie sie nie verlassen, haben Sie das verstanden?«
Sie nickte und ließ sich, ohne ein weiteres Wort, von ihm ins Innere des Schiffes führen.
Kapitel 1
Oktober 2018
Alles okay?« Dan sah sie von der Seite an.
Melody atmete tief ein. »Es ist seltsam, wieder hier zu sein.«
Sie betrachtete die hohen Bäume, die am Straßenrand an ihnen vorbeizogen. Melody und Dan waren gestern in Eugene angekommen. Auf dem Rücksitz schlief die kleine Abigail. Sie hatte den langen Flug sehr gut gemeistert, obwohl Melody im Vorfeld Sorgen gehabt hatte, die weite Reise mit einem zwei Monate alten Säugling anzutreten. Und jetzt schien die Kleine sogar noch weniger unter dem Jetlag zu leiden als ihre Eltern. Dabei war Melody sich nicht sicher, was ihr mehr zusetzte – die Zeitverschiebung oder das mulmige Gefühl, wieder ins amerikanischeAbigail’s Place zurückzukehren. Als sie das letzte Mal hier gewesen war, hatte sie in dem Haus eine grauenvolle Entdeckung gemacht. Sie und ihre Töchter Mia und Miranda waren auf konservierte Schrumpfköpfe ihrer Vorfahren gestoßen. Inzwischen waren die Mumienteile von Mitarbeitern der Universität abgeholt worden, und die Tagebücher von Melodys Vorfahrin Abigail, die darunter zum Vorschein kamen, lagen sicher bei ihr zu Hause im englischen Stockmill. Und doch waren noch viele Fragen offen. Melody und Dan hatten Stunden damit verbracht, zu überlegen, wie es mit Abigail weitergegangen sein könnte. Als vor zwei Monaten ihre Tochter zur Welt gekommen war, zögerten die beiden nicht lange. Sie gaben dem kleinen Mädchen den Namen ihrer Vorfahrin, dessen Schicksal sie so sehr berührte.
Melody und Dan hatten Eugene bereits hinter sich gelassen, als der Wald zu beiden Seiten der Landstraße allmählich immer dichter wurde. Sie waren auf dem Weg ins Willamette-Tal, wo das große Anwesen stand, das Melody von der Amerikanerin Louise Riley geerbt hatte. Melody betrachtete den Willamette River, der neben der Landstraße floss und zwischen den Bäumen glitzerte. Sie musste sich überlegen, was sie mit dem Haus anfangen sollte. Louise hatte es ihr in der Hoffnung vermacht, Melody würde dieses Erbe pflegen und zu schätzen wissen. Mit Sicherheit hatte die alte Frau nicht damit gerechnet, dass Melody das Haus verkaufen würde. Melody war unschlüssig. Einerseits wollte sie das in sie gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen, aber andererseits hatte sie ja schon in England eine Villa zu versorgen, und ein zweites Haus dieser Größe bedeutete viel Arbeit und hohe Instandhaltungskosten. Dabei enthielt das alte Gebäude viele Geheimnisse, die Melody unbedingt erforschen wollte.
»Ich bin wirklich gespannt auf das Haus.« Dan setzte den Blinker, um links abzubiegen. Sie verließen jetzt den McKenzie Highway, um über kleine Nebenstraßen immer tiefer in die amerikanischen Wälder vorzudringen. Die hohen Tannen tauchten die schmale Straße in ein Dämmerlicht, und wieder hatte Melody das Gefühl, in eine andere Welt zu reisen.
»Es ist irgendwie gruselig«, sagte sie. »Mia, Miranda und ich hatten ein unheimliches Gefühl, als wir letztes Mal in diesem Haus waren.«
Melody war im Frühjahr mit ihren inzwischen sechzehnjährigen Zwillingstöchtern hier gewesen. Die Atmosphäre in der alten Villa war ihnen von Anfang an merkwürdig vorgekommen – bis sie die grauenvolle Entdeckung gemacht hatten und Hals über Kopf abgereist waren. Aber die Universität von Oregon hatte Melody die Tagebücher ihrer Vorfahrin bald darauf nach England geschickt, und sie hatte im Nachhinein herausgefunden, dass dieses Gefühl der Angst und Beklemmung nicht nur von den grausigen Köpfen herrührte, die sie im Haus gefunden hatten. Nein, es hatte viel Leid dort gegeben, und es waren unvorstellbare Grausamkeiten passiert. Melody hatte diese unheilvolle Stimmung überall in der Villa gespürt.
»Ich bin jedenfalls froh, dass du bei mir bist.« Melody betrachtete Dan von der Seite. »Das Haus ist zwar eine exakte Kopie unseres englischen Abigail’s Place, aber seine Atmosphäre ist irgendwie bedrückend.«
Er lächelte, ohne den Blick von der Straße zu nehmen, und griff nach ihrer Hand. »Ist doch klar, dass ich dich begleite. Ich möchte keinen Tag in den ersten Lebensmonaten unserer Tochter verpassen. Und da du nun einmal hierher wolltest …«
»Na ja, ich musste. Schließlich habe ich das Haus geerbt und muss mich jetzt darum kümmern.« Melody war nicht besonders glücklich über dieses Erbe, aber sie hielt es für ihre Pflicht, sich gewissenhaft damit auseinanderzusetzen. Auch wenn diese Reise mit der kleinen Abigail anstrengend war, wollte Melody ihre Babypause in ihrem Job als Staatsanwältin gut nutzen, um die Angelegenheiten in Oregon zu regeln. Sie hatte in der nächsten Woche einen Termin bei Louises Anwalt und Testamentsvollstrecker in Eugene vereinbart, der ihr einen Überblick über das Vermögen geben würde, das Melody von Louise geerbt hatte. Bis dahin hatten sie und Dan sicher eine Entscheidung darüber getroffen, was sie mit dem amerikanischen Abigail’s Place anstellen wollten. Vor allem aber erhoffte Melody sich, hier im Willamette-Tal weitere Informationen über Abigail zu finden. Der letzte Tagebucheintrag ihrer Vorfahrin stammte aus dem Jahr 1848, als Abigail beschlossen hatte, die Flucht aus Oregon zu wagen. Ob ihr das wohl gelungen war? Wohin war sie geflohen? Oder hatte Sir Laurence ihre Pläne durchkreuzt und sie letzten Endes sogar umgebracht? War es Abigails Kopf, den sie im Frühjahr gefunden hatten?
»Wow! Was für ein toller See«, rief Dan auf einmal, der von der schönen Landschaft draußen abgelenkt wurde.
»Das ist der Blue River Lake«, erklärte Melody und riss sich von den Gedanken an ihre Vorfahrin los. »Wir waren auch überwältigt, als wir ihn zum ersten Mal sahen.«
»Er taucht so plötzlich und unvermutet auf«, antwortete Dan.
»Ja, das ist ein Reservoir. Dieser See ist künstlich angelegt worden. Ich habe im Internet nachgeschaut. Als Oliver und Abigail hier waren, gab es ihn also noch nicht.« Melody stellte sich vor, wie ihre beiden Vorfahren die Gegend damals wohl wahrgenommen hatten. Heute fuhren sie bequem mit dem Auto über asphaltierte Straßen, aber Abigail und Oliver waren unter den ersten Siedlern gewesen, die Oregon im Jahr 1843 erreichten. Damals gab es hier noch keine befestigten Straßen und in den Wäldern lauerten ganz andere Gefahren als heute. Melody dachte an die wilden Tiere, die heute größtenteils ausgestorben waren, und an die Indianer, deren Land sich die Siedler damals rücksichtslos angeeignet hatten.
Zwanzig Minuten später erreichten sie den kleinen Parkplatz oberhalb von Abigail’s Place. Melody stellte beruhigt fest, dass das Tor zur Straße abgeschlossen war. Nach den Wissenschaftlern schien niemand mehr in der Villa gewesen zu sein.
»Wir müssen mit Josephine sprechen«, überlegte sie laut. »Schließlich wird es auch sie betreffen, wenn wir das Haus verkaufen.«
Melody dachte an die seltsame alte Dame, die von sich selbst behauptete, die uneheliche Tochter von Louises Vater zu sein. Sie lebte in dem alten Siedlercottage, das auf dem Gelände von Abigail’s Place stand und in dem Abigail und Oliver gewohnt hatten, nachdem sie das Land für sich beansprucht hatten.
»Aber das Cottage gehört Josephine, oder nicht?«, fragte Dan, während er aus dem Wagen stieg.
Melody folgte ihm. Sie streckte ihren Rücken durch. Seit der letzten Schwangerschaft war es anstrengend für sie geworden, zu lange zu sitzen. »Ja, soweit ich weiß. Das könnte ein Problem für einen potenziellen Käufer werden.« Sie atmete tief durch und nahm den typischen süßen Duft des Willamette-Tals wahr. Es roch nach Kiefernnadeln, Feuchtigkeit und Erde.
»Nun lass uns erst einmal in Ruhe über alles nachdenken«, sagte Dan und öffnete die hintere Tür ihres Leihwagens.
Melody trat zu ihm und machte sich an dem Kindersitz ihrer Tochter zu schaffen. Abi war eingeschlafen, und Melody bemühte sich, die Kleine nicht aufzuwecken. Vorsichtig löste sie den Sicherheitsgurt.
Dan nahm ihr die Babyschale ab und Melody ging voraus. Diesmal würden sie nicht in dem alten Haus übernachten, sondern abends wieder nach Eugene zurückkehren. Die Fahrt dauerte zwar eineinhalb Stunden, aber Melody wollte nicht noch einmal in dem unheimlichen Gebäude schlafen.
Von dem kleinen Parkplatz aus mussten sie einen kurzen, von Büschen überwucherten Fußweg zurücklegen, bis sie auf eine Wiese gelangten und Abigail’s Place mit einem Mal in einem düsteren Licht vor ihnen lag, das spärlich durch die Wolken drang.
»Wahnsinn!« Dan blieb stehen und ließ den Anblick einen Moment auf sich wirken. »Das ist tatsächlich eine exakte Kopie unserer Villa in England.«
Melody nickte. Sie erinnerte sich daran, wie überrascht sie selbst gewesen war, dieses Haus hier in Oregon zu entdecken. Das Gebäude war harmonisch eingebettet in das ausgedehnte Waldgebiet. Vögel zwitscherten und in der Ferne war das Rauschen des Flusses zu hören. Es duftete nach Herbst.
Langsam gingen sie über den ungepflegten feuchten Rasen auf das Gebäude zu. Melodys Schuhe waren längst durchgeweicht. Das Gras reichte ihr bis zur Wade hinauf. Als Louise noch in dem Haus gelebt hatte, gab es wohl einen Gärtner, der die Ländereien gepflegt hatte. Doch seit die alte Dame, die im Frühjahr verstorben war, in einem Seniorenheim gelebt hatte, verwilderte alles zusehends.
Melody ärgerte sich, dass sie nicht an ihre Gummistiefel gedacht hatte. Ihr Blick wanderte wieder zum Haus. Die Fenster sahen ihnen stumm entgegen. Sie blieb einen Moment lang nachdenklich stehen. Wer hatte wohl schon alles hier gelebt? Wer war hier glücklich gewesen, wer hatte in diesem Haus gelitten? Sie dachte an ihre Ahnin Abigail und das Leid, das sie anscheinend hinter diesen Mauern hatte ertragen müssen. Doch nach ihr hatten weitere Generationen dieses Haus bewohnt. Waren sie hier glücklich gewesen? Wussten sie von dem Schicksal ihrer Vorfahrin? Melody fröstelte, als sie an Sir Laurence dachte, der für Abigails Leid verantwortlich gewesen war. Sie schüttelte den Gedanken ab und folgte Dan weiter durch das feuchte Gras.
Als sie endlich die Villa erreicht hatten, waren nicht nur ihre Schuhe, sondern auch die Hosenbeine nass. Jetzt ärgerte Melody sich, dass sie keine Kleidung zum Wechseln dabeihatte. Gras und Moos hatten sich auf den Steinen vor der Eingangstür gebildet. Das erste Laub lag auf dem Kies am Boden, und im Fensterrahmen hing ein Wespennest, von dem Melody hoffte, dass es verlassen war. Sie zog den schweren Schlüsselbund aus der Tasche und schloss auf.
Mit einem leisen Knarren schwang die Tür zurück. Dämmerlicht empfing sie. Sie blieben ein paar Sekunden lang auf der Schwelle stehen, bis ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Der Geruch des Hauses schlug ihnen entgegen. Es war eine Mischung aus Verwesung, Moder, feuchtem Holz und Chemikalien. Melody tastete nach dem Lichtschalter neben der Tür, und nach einem lauten Klacken flackerten die Wandlampen auf. Der Strom war noch immer nicht abgeschaltet. In der Luft tanzten Staubflocken, und Melody wich einem Spinnengewebe aus, das sich über die Wand spannte.
»Der gleiche Boden wie bei uns in Stockmill.« Dan war ihr gefolgt und wischte mit dem Fuß die Staubschicht über den bunten Fliesen der Eingangshalle zur Seite. Dann legte er den Kopf in den Nacken. »Und das Deckenfenster … Sogar das Muster ist identisch.«
Melody schloss die Eingangstür mit einem leisen Knall und lauschte einen Moment lang dem Echo.
»Ja, Sir Laurence hatte sich die Pläne des Architekten aus Stockmill besorgt.« Sie sah sich unschlüssig um. Noch immer fühlte sie sich unwohl in diesem Haus. Jetzt, nachdem sie Abigails Geschichte kannte, vielleicht sogar noch mehr als zuvor. »Wo fangen wir an?«
Dan hob die Schultern, was etwas unbeholfen wirkte, da er nach wie vor seine Tochter in dem Kindersitz trug. »Gute Frage, das Haus ist riesig. Und wonach suchen wir genau?«
Er trat an die Wand der Eingangshalle und betrachtete ein altes Gemälde, das dort hing.
»Wenn ich das wüsste …«, erwiderte Melody. »Ich glaube, hier gibt es noch viele Geheimnisse, die erforscht werden müssen.« Sie seufzte. »Aber vor allem hätte ich natürlich gern Aufzeichnungen, die uns verraten, wie es mit Abigail weitergegangen ist.« Ihr Blick wanderte zu den Galerien in der ersten und zweiten Etage hinauf, die von der Eingangshalle aus zu sehen waren.
»Ich glaube nicht, dass wir so etwas hier finden werden. Schließlich wollte Abigail von Fort Umpqua aus mit dem Schiff nach Europa fliehen«, erinnerte Dan Melody.
»Ja, aber warum war ihr Kopf dann hier in diesem Haus?« Melody stellte diese Frage nicht zum ersten Mal. Wieder stieg leichte Übelkeit in ihr auf, als sie sich an die Schrumpfköpfe erinnerte, die sie im oberen Stockwerk der Villa gefunden hatten.
»War es denn wirklich Abigails Kopf?« Dan sah sie zweifelnd an. »Nur weil er lange, mahagonifarbene Haare hatte, muss er noch längst nicht von ihr stammen.«
»Von wem sonst?« Melody ging zu der großen Tür auf der linken Seite der Halle. »Das ist der Salon«, erklärte sie und warf einen Blick in den Raum. Es war alles unverändert. »Hier werden wir sicher nichts Interessantes finden.«
Dan sah ebenfalls in das geräumige Wohnzimmer, das noch die Handschrift der alten Frau trug, die bis vor Kurzem hier gelebt hatte. Die Zeitschriften, die auf dem Sofa lagen, waren mit Staub bedeckt, eine Thermosflasche stand auf einem der Beistelltische.
Melody wandte sich zur Treppe. »Es dauert ewig, bis wir gefunden haben, was wir brauchen. So viel Zeit haben wir nicht.«
»Manche Geheimnisse bleiben besser für immer im Dunkeln«, erwiderte Dan. Er trat an den Kamin in der Halle und betrachtete die Fotos, die auf dem Sims aufgestellt waren. »Erkennst du jemanden, der auf diesen Bildern zu sehen ist?«
Melody sah ihm über die Schulter.
»Nein.« Sie betrachtete die alten Schwarz-Weiß-Fotos, die aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zu stammen schienen. »Schau mal, die sind aus den Zwanzigern. Die Charleston-Kleider, die Perlen und Federn …« Melody lächelte. »Damals wurde hier offenbar viel gefeiert. Einige der Bilder wurden in dieser Halle aufgenommen.« Nach den Fotos zu schließen, hatten hier wohl auch glückliche Familienmitglieder gelebt.
Dan nickte. »Schade, dass Mauern nicht sprechen können, das würde uns die Suche leichter machen.«
»Oh ja, so ein altes Haus könnte sicher viel erzählen.« Melody lächelte. Dann deutete sie zu den Galerien hinauf. »Ich habe im Frühjahr ein paar Tagebücher von Louise oben im Panoramazimmer gefunden. Da sie damals noch am Leben war und ich nicht in ihre Privatsphäre eindringen wollte, habe ich mich nicht genauer dort umgesehen. Aber jetzt …« Melody brach ab. Eine Gänsehaut breitete sich auf ihren Armen aus bei der Erinnerung daran, dass Louise wenige Stunden nach ihrem ersten Treffen gestorben war. Als hätte sie nur darauf gewartet, das Haus mit all seinen Geheimnissen in Melodys Hände zu geben.
»Also gut«, sagte Dan. »Dann lass uns dort anfangen.«
Melody atmete tief durch. Es fiel ihr schwer, wieder in diesem Gebäude zu sein, und vor der ersten Etage graute ihr regelrecht. Aber die Exponate waren zum Glück längst von den Wissenschaftlern weggebracht worden.
Melody und Dan stiegen die Treppe hinauf und folgten dem Gang, der tief ins Haus hineinführte. Die Dielen unter dem Teppich knarrten, und Melody musste niesen, als ihr Staub in die Nase geriet. Die Tür am Ende des Flures führte zu Louises altem Schlafzimmer. Melody betrat es ehrfurchtsvoll und sah sich um. Alles war noch genau so, wie sie es in Erinnerung hatte. Hier war nichts verändert worden seit ihrem letzten Besuch. In der Mitte des Raums führte eine Treppe nach oben zu einem rechteckigen Turmzimmer, das große Fenster nach allen Seiten hatte.
Als Melody und Dan hier oben ankamen, bestaunten sie einen Moment lang den Ausblick, der sich ihnen bot. Von hier aus konnte man weit über den Willamette Forrest schauen.
»Großartig«, sagte Dan schließlich. »Ich wünschte, unser Blick in Stockmill wäre nur halb so schön.«
Melody nickte. In ihrem englischen Haus gab es ein genaues Gegenstück zu diesem Raum, doch von dort aus war nur das ehemalige Industriegelände der alten Baumwollfabrik zu sehen, dessen Anblick nicht annähernd so atemberaubend war.
»Schau mal, hier sind die Tagebücher, die ich meine.«
Melody deutete auf eine Reihe Aktenordner, die in einem Regal standen. Auf dem Tisch daneben wartete eine alte Schreibmaschine darauf, wieder benutzt zu werden. Sie schien aus den Fünfzigerjahren zu stammen.
»Louise hat die Tagebücher mit der Schreibmaschine geschrieben.«
Dan zog willkürlich einen der Ordner hervor und blätterte durch die dicht beschriebenen Seiten.
Melody fuhr mit der Fingerspitze über die Ordnerrücken und nahm dann eines der Tagebücher in die Hand. »Das älteste ist von … 1920.«
»Wie alt war Louise da? War sie 1920 überhaupt schon auf der Welt?« Dan runzelte die Stirn.
Melody sah auf. »Stimmt. Diese Tagebücher können gar nicht von ihr stammen. Louise wurde erst 1927 geboren.«
Sie schlug das Tagebuch auf und las den Namen, der auf der ersten Seite stand.
»Cyrus Lancaster-Riley. – Cyrus?« Melody sah mit zusammengezogenen Augenbrauen auf. »Wer war das?«
»Vielleicht Louises Vater?«, überlegte Dan. »Es könnte einer der jungen Männer sein, die auf den Fotografien unten in der Eingangshalle zu sehen sind.«
Melody hatte schon ihr Smartphone aus der Tasche gezogen, um im Internet nach dem Namen zu suchen. Sie gelangte auf die Firmenseite von AHOR.
»Du hast recht«, bestätigte sie Dans Vermutung. »Cyrus war Louises Vater und der Enkel von Sir Laurence.«
»Also Williams Sohn?« Dan schien nachzudenken.
Melody nickte. Ein kalter Schauder lief ihr über den Rücken. »Genau. Und somit auch Abigails Enkel.«
Mit zitternden Händen schlug sie die erste Seite auf. Vielleicht konnten sie über diese Aufzeichnungen ja tatsächlich etwas über Abigails Schicksal erfahren. Ganz gleich, wer sie verfasst hatte.
Melody begann, aus dem Tagebuch vorzulesen, während Dan ihre Tochter aus der Tragschale nahm und sanft in seinen Armen wiegte.
Kapitel 2
Juli 1920
Cyrus blieb auf der Wiese stehen und sah auf das hell erleuchtete Haus, dessen Lichter in die Nacht hinausstrahlten. Musik drang bis zu ihm herauf, untermalt von ausgelassenem Lachen, Gläserklirren und fröhlichen Stimmen. Er war dem Fest einen Augenblick lang entkommen und genoss jetzt die Ruhe hier draußen. Er feierte gern, aber er hatte auch nichts gegen eine Zigarette allein. Cyrus zog sein goldenes Etui aus dem Jackett. Während er die Benson & Hedges anzündete, beobachtete er ein Paar, das sich aus dem Haus schlich und in Richtung des Flusses verschwand. Er musste grinsen. Maskenbälle riefen immer wieder die verdorbene Seite der Menschen hervor. Die scheinbare Anonymität der Kostüme nahm ihnen sämtliche Hemmungen. Nun, ihm sollte es recht sein, er war erst gestern, nach vier Monaten in Harvard, nach Hause zurückgekehrt und würde sich die nächsten acht Wochen den Freuden des Landlebens widmen. Cyrus hatte an der Universität hart gearbeitet und seine Zwischenprüfungen mit Bravour gemeistert. Wenn es so weiterging, würde er schon bald seinen Vater William an der Spitze ihres Familienunternehmens ablösen können. Cyrus wusste, dass sein Vater nur darauf wartete, den Stab an seinen Sohn weiterreichen zu können.
Cyrus schlenderte zurück zum Haus. Er schnippte die Zigarette weg und zog seine Maske aus der Tasche. Natürlich würde ihn trotz der Maske jeder erkennen, aber das war auch seine Absicht. Schließlich war er einer der begehrtesten Junggesellen Oregons, und solange er noch keinen Ring am Finger trug, würde er diese Tatsache nach Kräften ausnutzen.
Die Eingangshalle der Villa war inzwischen gut gefüllt. Auf dem Tisch in der Mitte stand eine große Schüssel mit Bowle, um die sich eine Gruppe kostümierter Gäste drängte. In den Ecken unterhielten sich bunt gekleidete Gestalten, andere huschten die Treppe hinauf und sahen von den Galerien in die Halle hinunter. Junge Leute wippten im Takt der Musik, die aus dem angrenzenden Salon in die Eingangshalle klang. Champagnerflaschen wurden herumgereicht, Korken schossen in die Luft, Diener trugen gefüllte Tabletts und einzelne Paare tanzten eng umschlungen.
»Cyrus!«, rief ein Harlekin, der die Stimme seines Freundes Herbert hatte. »Wie schön, dass du in die Provinz zurückgekehrt bist!«
Cyrus lachte und blieb bei seinem Freund stehen, der eine Gruppe kostümierter Gäste um sich geschart hatte.
»Seit wann bist du wieder hier?«, wollte Bertram Hoobster wissen, der sich als Römer verkleidet hatte.
»Ich bin gestern Abend angekommen«, erklärte Cyrus und zwinkerte seiner Freundin Vera zu, die neben Bertram stand und in einem undefinierbaren Gewand steckte. Sie kicherte und errötete.
Cyrus’ Blick wanderte durch die Halle. Federn tanzten auf und ab, Edelsteine glitzerten in den Frisuren und Dekolletés der Frauen. Die Kostüme spiegelten die gesamte Weltgeschichte wider. Die junge Heather McKenzie hatte sich als Kleopatra verkleidet, was ihr ausgesprochen gut stand. Sie sah Cyrus aus ihren stark geschminkten Augen an und warf dann aufreizend den Kopf zurück.
Cyrus streckte den Arm nach ihr aus. »Kleopatra, schenken Sie mir den nächsten Tanz?«
Heather lachte. »Gern, auch wenn ich nicht weiß, wen Sie darstellen wollen.«
Cyrus nahm ihren Arm und zog sie eng an sich. »Finden Sie es heraus.«
Lachend liefen die beiden in den Salon, der als Tanzsaal diente. Die Möbel waren herausgeschafft worden und ein kleines Orchester hatte sich an der Stirnseite des Zimmers aufgestellt. Ungefähr zehn Paare bewegten sich zur Musik, und rundherum standen Menschen, die sich unterhielten. Cyrus erkannte seinen Vater, der mit den McKenzies in ein Gespräch vertieft war. Er nickte ihm zu. Eine junge Frau stand vor dem Orchester und sang mit voller Stimme von einer verlorenen Liebe.
Heather und Cyrus betraten die Tanzfläche. Cyrus genoss die Aufmerksamkeit, die ihm von allen Seiten entgegengebracht wurde. Viele seiner alten Freunde waren gekommen, aber auch die jungen Damen aus der Gesellschaft von Oregon schienen sich zu freuen, dass der zukünftige AHOR-Erbe in seine Heimat zurückgekehrt war. Als der Tanz endete, stand schon die nächste Frau bereit, um mit Cyrus über die Tanzfläche zu schweben.
Cyrus amüsierte sich prächtig und hatte bald mit allen Damen getanzt, die zum Ball geladen waren – außer mit einer. Nur die schönste und aufregendste Frau hatte es immer wieder geschafft, ihm zu entkommen. Sie hatte sich als die französische Königin Marie-Antoinette verkleidet und war jedes Mal verschwunden, noch bevor er sie um einen Tanz bitten konnte. Das machte Cyrus beinahe verrückt. Je länger er versuchte, sich ihr zu nähern, und je weniger Erfolg er damit hatte, umso mehr wurde ihm bewusst, dass sie die begehrenswerteste Frau des Maskenballs war. Sie trug ein bauschiges Rokokokleid und eine hoch aufgetürmte Steckfrisur. Der tiefe Ausschnitt entblößte ihre weiße, zarte Haut und liebliche Rundungen, die wilde Fantasien in Cyrus weckten. Sie trug eine weiße Maske, die ihr Gesicht verdeckte.
Es war heiß im Saal. Cyrus ließ seine Tanzpartnerin lachend los und drängte sich an den Paaren vorbei in Richtung der Eingangshalle, um sich ein Glas Champagner zu gönnen. Er wollte gerade den Salon verlassen, als er an der Tür zum Arbeitszimmer seines Vaters eine Bewegung wahrnahm. Er hätte es vermutlich gar nicht bemerkt, wenn er nicht den ganzen Abend schon Ausschau nach dem auffälligen Kleid von Marie-Antoinette gehalten hätte. Sie schlüpfte in den Nebenraum. Cyrus hielt inne und kämpfte sich durch die Menschenmenge, ehe er ebenfalls in dem benachbarten Zimmer verschwand.
Er blieb an der Tür stehen und sah sich um. Das Büro lag im Dunkeln. Cyrus lauschte, aber nichts war zu hören. Sie schien nicht mehr hier zu sein. Langsam schlich er durch den Raum bis zur Verandatür. Er lächelte, als er das Rokokokleid draußen im Garten erblickte. Marie-Antoinette stand wenige Meter entfernt im Schein einer Fackel unter einem Rosenspalier und beobachtete ihn, als hätte sie nur darauf gewartet, dass er ihr folgte.
Cyrus trat zu ihr in die warme Nacht. Sie streckte ihm ihr Gesicht entgegen, das noch immer hinter der Maske verborgen war. Der Wind strich über seine Haut und die Schatten des Feuers huschten über ihre Stirn. Er hielt kurz den Atem an, so verzaubert war er von diesem Moment. Sie reichte ihm ihre Hand, und er nahm sie, ohne zu zögern. Sanft führte er sie an seinen Mund und fuhr mit seinen Lippen über ihre weiche Haut. Hinterher redete er sich ein, diese zarten, schlanken Finger nicht erkannt zu haben.
Nun setzte sich die Frau in Bewegung und zog ihn sanft, aber bestimmt mit. Er wusste genau, wohin sie ihn bringen würde. Der blumige Duft ihres Parfüms vermischte sich mit dem milden Geruch des nächtlichen Waldes. In der einen Hand hielt sie eine Fackel, die andere hatte sich fest um seine Finger geschlossen. Im Schein des Feuers fanden sie den Weg, der ihnen beiden so vertraut war. Sie gingen langsam und vorsichtig, aber zielstrebig. Eine Nachtigall sang. In der Ferne schrie ein Fuchs. Das Rauschen des Flusses wurde lauter. Der sanfte Nachtwind ließ die Blätter in den Bäumen wispern.
Cyrus spürte die Aufregung, Vorfreude erfasste ihn. Marie-Antoinettes kühle Hand in seiner, ihre verwirrende Nähe, ihre leisen Atemzüge unter der Maske und ihr betörender Duft erregten ihn. Cyrus schluckte und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
Das alte Siedlercottage tauchte vor ihnen in der Dunkelheit auf. Sie verlangsamte ihren Schritt, ließ seine Hand für einen Moment los, um sich zum Türrahmen hinauf zu strecken. Mit den Fingerspitzen stieß sie den Schlüssel herunter. Sie bückten sich beide danach und hielten kurz inne, als ihre Hände sich berührten. Spätestens jetzt erkannte er, wer sie war. Er musste fort von hier, denn er wusste, dass er im Begriff war, eine Sünde zu begehen. Aber er konnte ihr nicht widerstehen, nicht hier und nicht heute.
Während sie die Tür aufschloss, hielt er die Fackel. Ihre Taille war so zart, dass er die Hand danach ausstrecken wollte, doch er unterdrückte den Drang. Wie oft hatte er diesen Körper betrachtet, wie oft hatte er sich selbst verboten, an ihn zu denken! Was hatte diese Frau mit ihm vor? Er musste warten, bis sie sich ihm offenbarte, durfte nicht vorpreschen.
Marie-Antoinette hatte die Tür inzwischen aufgesperrt und griff nach einer Öllampe, die daneben stand. Sie entzündeten sie an der Fackel und betraten das einfache Haus. Cyrus schloss die Tür hinter ihnen. Die Luft roch muffig und abgestanden. Hier hatte seit vielen Jahren niemand mehr gewohnt. Die Frau führte ihn über die knarrenden Dielen in einen der hinteren Räume. Sie schien genau zu wissen, was sie wollte. Als sie das Zimmer mit dem schmalen Bett in der Mitte erreicht hatten, stellte sie die Lampe ab. Dann streckte sie die Arme in die Höhe und drehte ihm den Rücken zu. Cyrus trat dicht hinter sie und begann mit zitternden Fingern die Schnüre ihres Kleides zu lösen. Sein Atem beschleunigte sich und er riss sich die Maske vom Gesicht. Gierig näherten sich seine Lippen ihrem Nacken. Er küsste die duftende Haut und atmete ihren Geruch tief ein, der ihm so bekannt und doch völlig neu war. Dann fingerte er wieder an den Bändern des Kostüms herum. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis er das Kleid so weit geöffnet hatte, dass er es ihr von den Schultern streifen konnte und es mit einem leisen Rascheln zu Boden fiel.
Marie-Antoinette trat aus dem Kleiderhaufen heraus und drehte sich zu ihm um. Cyrus stöhnte auf. Die Erregung hatte ihn dermaßen übermannt, dass er nicht mehr zurückkonnte. Nie hatte er etwas so Verführerisches gesehen. Sie trug ein Korsett, das die Brüste nach oben drückte, dazu seidene Strümpfe und einen Strumpfhalter. Cyrus trat näher. Er zwang sich zur Ruhe und atmete tief durch. Sanft drehte er die Frau wieder um und machte sich an den Häkchen ihres Mieders zu schaffen. Nach und nach löste er auch die letzten Kleidungsschichten von dem perfekt geformten Körper. Sein Atem ging stoßweise. Sie stand vollkommen nackt vor ihm, nur noch durch die Maske geschützt. Cyrus streckte seine Hand nach ihr aus und strich zaghaft über die volle Brust. Wieder entfuhr ihm ein Stöhnen. Er knöpfte seine Hose auf, während Marie-Antoinette nur reglos verharrte und keine Anstalten machte, seiner Begierde Befriedigung zu verschaffen. Er zog sein Hemd über den Kopf und ließ die Hose zu Boden gleiten, bis er ihr ebenfalls unbekleidet gegenüberstand.
Jetzt endlich streckte sie ihre Arme nach ihm aus und er stürzte sich hinein. Er warf sie aufs Bett und legte sich auf sie. Gierig bedeckte er ihren Körper mit Küssen, spürte ihre Haut an seiner und konnte sich schließlich nicht mehr zurückhalten. Er zog ihr die Maske vom Gesicht und küsste nun auch das geliebte Gesicht, ihren süßen Mund.
In dieser lauen Sommernacht gab er sich endlich der brennenden Lust hin und schlief zum ersten Mal mit dieser Frau, die er so besessen liebte, dass alle moralischen Bedenken bedeutungslos wurden.
Cyrus und Marie-Antoinette kehrten erst in den Morgenstunden zu den Gästen des Balls zurück. Wenig später verabschiedete sich Cyrus von ihnen und ging zu Bett. Als er am frühen Nachmittag erwachte, schmeckte er noch immer ihre Küsse auf seinen Lippen. Er spürte ihren Körper an seinem und erneut stieg die Erregung in ihm auf. Aber er wusste, dass das, was in der letzten Nacht geschehen war, falsch gewesen war, eine Sünde, die sich nicht wiederholen durfte.
Cyrus stand auf und nahm ein kaltes Bad, um sich zu beruhigen. Doch immer wieder wanderten seine Gedanken zu Marie-Antoinette und den Stunden im Siedlercottage. Während er sich ankleidete, rief er sich zur Vernunft. Es war ein Fehler und niemand durfte jemals davon erfahren.
Er atmete tief durch, bevor er sein Zimmer verließ, das sich in der ersten Etage der großen Villa befand. Sein Großvater Sir Laurence Lancaster hatte das imposante Gebäude vor ungefähr siebzig Jahren für seine Frau Abigail bauen lassen. Laurence hatte Abigail vor einem brutalen Mann gerettet, der sie von ihrer Heimat England nach Amerika verschleppt hatte, und er hatte nicht nur die von den beiden gegründete Firma, sondern schließlich auch den Namen Riley übernommen, der bis heute ihr Familienname war. Riley war Teil des Firmennamens AHOR, der inzwischen weltweit bekannt geworden war, sodass Laurence entschieden hatte, ihn beizubehalten.
Buntes Licht fiel durch das Deckenfenster ins Treppenhaus und in die darunterliegende Eingangshalle. Die Angestellten hatten längst die letzten Spuren des Balls beseitigt. Cyrus schritt langsam die Treppe hinunter und zögerte einen Augenblick, bevor er das Esszimmer betrat. Aber der Raum war leer, das Frühstück längst abgetragen. Erleichtert zog Cyrus an der Klingel und wartete, bis Donahue, der Butler, kam. Bei ihm bestellte er Eier, ein Sandwich und Kaffee. Während er auf sein Frühstück wartete, blätterte er in der Zeitung, die wie immer auf einem Tisch neben der Tür bereitlag.
»Guten Morgen«, sagte seine Schwester Nancy, die beinahe lautlos die Tür geöffnet hatte.
Cyrus’ Herzschlag beschleunigte sich. Sein Körper reagierte, ohne dass er es beeinflussen konnte. Nancy trug ein grünes Seidenkleid, das ihre helle Haut betonte. Das braune Haar war perfekt frisiert, und wenn sie die letzte Nacht Kraft gekostet hatte, sah man es ihr nicht an.
Cyrus legte die Zeitung zur Seite und betrachtete seine Schwester prüfend, bevor er ihren Gruß erwiderte. Sie trat lächelnd hinter ihn und beugte sich zu ihm. Cyrus hielt den Atem an, doch ihre Lippen berührten nur seine Wange – wenn auch einen Moment zu lang. Er sog ihren Duft ein, spürte ihre Nähe und schloss die Augen. Wieder schlug die Erregung über ihm zusammen. Seine Schwester richtete sich auf und er beruhigte sich langsam.
»Nancy«, seine Stimme klang belegt, als er endlich so gefasst war, dass er sprechen konnte, »wir dürfen das nicht wieder tun.«
»Nein«, sagte sie in einem Ton, der genau das Gegenteil auszudrücken schien. Sie zwinkerte ihm zu und setzte sich ihm gegenüber an den Tisch. Als sie sich mit der Hand durch das braune Haar strich, erinnerte er sich daran, wie diese Finger seinen Körper liebkost hatten. Schnell wandte er den Blick ab.
Donahue brachte ihnen ihr Frühstück und sie aßen schweigend. Als Cyrus aufstand, erhob sich auch Nancy. Sie folgte ihm bis zur Tür und flüsterte ihm dann ins Ohr: »Komm noch einmal ins Siedlercottage …«
Eine Gänsehaut lief ihm über den Rücken und er schauderte. Er wusste, dass er ihre Einladung nicht annehmen durfte, dass sie damit aufhören mussten. Nancys Hand strich zärtlich über seine Wange und wanderte hinunter in seinen Schritt. Ihre seidigen Lippen berührten seine, ihre Zungen umspielten einander, dann schlüpfte sie aus dem Esszimmer und ließ ihn in einem Zustand zurück, der kaum noch erträglich war.
Cyrus brauchte einen Moment, bis er sich wieder so weit im Griff hatte, dass er das Zimmer verlassen konnte. Aufgewühlt trat er in die Eingangshalle hinaus. Er musste vernünftig sein, er durfte nicht noch einmal mit seiner Schwester schlafen. Er eilte in sein Zimmer und warf sich auf das Bett. Am liebsten hätte er sich festbinden lassen, um nicht schwach zu werden. Er musste dem Siedlercottage unbedingt fernbleiben. Doch er konnte den Gedanken an Nancy nicht unterdrücken, die jetzt auf ihn wartete und sich genauso nach ihm verzehrte wie er sich nach ihr.
Entschlossen stand Cyrus auf. Also gut, er würde zu ihr gehen und ihr erklären, dass die Sache aufhören musste. Cyrus atmete tief durch. Auf dem Weg zum Cottage redete er sich ein, dass er mit seiner Schwester nur reden wollte. Doch als er das kleine Haus auf dem Gelände der Villa erreichte, stand die Tür offen und Nancy lag nackt und verführerisch auf dem schmalen Bett. Und noch bevor er wusste, wie ihm geschah, hatte er sich seine Kleider auch schon vom Leib gerissen und auf sie gestürzt. Noch nie hatte er sich einer Leidenschaft so hemmungslos hingegeben, nie eine Frau so sehr begehrt wie seine Schwester. Er liebte sie schon seit Jahren so hingebungsvoll und aufrichtig, wie er keine andere Frau jemals lieben würde. Und diese Verbindung von Liebe und Wollust raubte ihm den Verstand.
Als sie am frühen Abend aus dem Cottage traten, fuhr Cyrus erschrocken zusammen. Auf der Wiese davor stand ihr Vater William. Scham stieg in Cyrus auf. Hatte er sie etwa durch das Fenster beobachtet? Cyrus schloss entsetzt die Augen. Warum hatte er sich nur so gehen lassen? Es gab doch genügend Frauen, die sich darum rissen, ihr Bett mit ihm teilen zu dürfen. Warum wollte er ausgerechnet die eine haben, die er nicht haben durfte? Sein Vater würde ihn sicher sofort nach Harvard zurückschicken, und das hatte er auch verdient. Wahrscheinlich war es so am besten.
Vorsichtig öffnete Cyrus die Augen in der Erwartung, das ganze Ausmaß der Enttäuschung und Verachtung im Gesicht seines Vaters zu sehen, das er selbst tief in sich spürte. Doch der Blick seines Vaters wanderte nur ruhig zwischen Cyrus und Nancy hin und her. Schließlich nickte William zufrieden und lächelte seine Kinder an. Cyrus sah überrascht zu Nancy und sie zwinkerte ihm verschmitzt zu. Dann griff sie nach seiner Hand und gemeinsam folgten sie ihrem Vater zurück zu Abigail’s Place.
In diesem Sommer gab es keinen Tag, den Cyrus nicht mit Nancy im Siedlercottage verbrachte. Er lernte die Liebe in diesen Wochen ganz neu kennen, in dem kleinen Haus, in dem schon seine Großeltern Abigail und Laurence sich ihrer Leidenschaft hingegeben hatten. Cyrus dachte immer wieder an seinen Großvater, der ihm von der tiefen Liebe zu seiner Frau Abigail erzählt hatte. Was er wohl zu der inzestuösen Beziehung seiner Enkel gesagt hätte? Cyrus wischte den Gedanken fort. Sein Vater schien die Liebe zwischen ihm und Nancy jedenfalls zu billigen, ja sogar zu begrüßen, was Cyrus nur darin bestärkte, seine Gefühle, die Lust und glühende Hingabe in vollen Zügen zu genießen. Er wusste, dass er bald nach Harvard zurückkehren musste und dann Oregon für eine lange Zeit fernbleiben würde. Dann würde das alles zwischen ihnen abflauen. Cyrus würde sich in Harvard umsehen und ein Mädchen finden, das er lieben konnte und durfte. Und wenn er das nächste Mal nach Hause zurückkehren würde, wäre die Beziehung zwischen ihm und Nancy nur noch eine, wie sie zwischen Bruder und Schwester sein durfte.
Kapitel 3
Winter 1848/49
Abigail starrte in die Wellen, die sich am Rumpf des Klippers brachen. Am Horizont gingen Wasser und Himmel ineinander über. Sie kam sich winzig vor angesichts der überwältigenden Weite des Meeres. Die Golden Star war klein, ein Spielball der Wellen, genau wie Abigail zu einem Spielball des Lebens geworden war. Doch hier an Deck, auf den glitschigen Planken, mit dem Salz auf den Lippen, konnte sie ihren Gedanken freien Lauf lassen. Hier suchten sie nicht die schrecklichen Erinnerungen heim. Manchmal sah sie minutenlang selbstvergessen in die Gischt und dachte nur an das Kind, das sie unter ihrem Herzen trug und das sie Maroon bisher verschwiegen hatte. Doch irgendwann kam alles zurück. Dann plagten sie wieder die entsetzlichen Bilder jener Nacht, als sie Oliver für immer verlor, als sie seinem Mörder hilflos ausgeliefert war. Sie fragte sich immer wieder, was Sir Laurence so kaltherzig hatte werden lassen. Was hatte er erlebt, wie war er erzogen worden, dass er zu solchen Grausamkeiten fähig war? Sie würde es vermutlich nie erfahren.
Abigail sah zu den Segeln hinauf. Endlich waren sie wieder prall gefüllt. Tagelang hatten sie in einer Flaute festgesessen. Captain Maroon hatte ihr erklärt, dass das die Kalmen seien, eine windstille Zone im Bereich des Äquators, die rund um den Erdball verlief. Die ersten Wochen waren sie im günstigen Nordostpassat gefahren und jetzt hatten sie endlich Westwinde.
Abigail blickte auf die Wellen, auf denen sich Schaumkronen bildeten. Seit Tagen hatten sie kein Land mehr gesehen. Anfangs hatte Abigail sich die meiste Zeit in der Kajüte des Captains aufgehalten, und da dieser nur zum Schlafen herunterkam, war sie mehr als sechzehn Stunden am Tag allein gewesen. Nach einer Woche hatte sie sich schließlich an Deck begeben, und Maroon hatte widerstrebend eingewilligt, dass sie sich zumindest in seiner Sichtweite dort aufhalten durfte.
Jetzt stand der Captain auf der Brücke und blickte zu Abigail herüber, die an der Reling lehnte. Sie hatte den Eindruck, dass sie ihm ziemlich gleichgültig war, da er nur selten ein Wort mit ihr sprach. Abigail betrachtete einen Schwarm Fische, der in der Gischt unter ihr zu sehen war. Sie schwammen neben dem Schiff her und wirkten so getrieben wie Abigail selbst. Sie war dankbar für die Möglichkeit, mit der Golden Star fliehen zu können, und gleichzeitig fühlte sie sich müde und unendlich ausgelaugt. Sie war nach Amerika gekommen, um Frieden und Ruhe zu finden, mit dem Mann an ihrer Seite, den sie liebte. Aber ihre Hoffnungen waren nicht erfüllt worden. Stattdessen musste sie sich erniedrigen lassen und war schließlich wieder zu einer Flüchtenden geworden. Sie hatte längst keine Heimat mehr, keinen Menschen mehr, dem sie vertrauen konnte. Nachdem sie England hatte verlassen müssen, war Olivers Liebe zu ihrer neuen Heimat geworden. Doch jetzt hatte sie alles verloren und sie wurde umhergeworfen wie dieses Schiff auf hoher See.
Abigail blinzelte in die Sonne, die hoch oben am Himmel stand und das Wasser in der Ferne glitzern ließ. Sie war des Lebens müde, fühlte sich alt und verbraucht, aber sie konnte sich nicht ausruhen. Noch nicht. Über ihr blähten sich die mächtigen Segel des Klippers.
»Ma’am?«
Abigail fuhr herum. Captain Maroon stand plötzlich vor ihr. Sie sah ihn abwartend an. Sein Gesicht war gebräunt und wettergegerbt, und seine stahlblauen Augen strahlten ihr entgegen. Das weiße Haar, das unter der Mütze hervorschaute, wehte im Wind. Der Geruch von Salz, Fisch und Algen hing in der Luft.
Der Captain räusperte sich. »Ich glaube, wir müssen uns unterhalten.«
Abigail zog besorgt die Augenbrauen zusammen. Würde er ihr nun doch die Stunden an Deck verbieten?
»Ich fürchte, es ist nicht mehr zu übersehen, dass Sie in anderen Umständen sind«, fuhr er fort und ein roter Schimmer legte sich auf seine Wangen.
Abigail war das Thema genauso unangenehm wie ihm. Sie senkte den Kopf und nickte.
»Wie haben Sie sich das vorgestellt?«, fragte er. Es lag keine Anklage in seinem Ton, kein Vorwurf, vielleicht nur ein wenig Sorge.
Abigail zuckte mit den Schultern.
»Sie sind die einzige Frau an Bord und unser Schiffsarzt hat keinerlei Erfahrung in diesen Dingen«, sagte der Captain. Sein Blick ruhte auf ihr und sie hätte nicht sagen können, ob er wütend auf sie war oder ob es ihn nervös machte, mit diesem Problem konfrontiert zu sein.
Abigail nickte. »Das weiß ich und es tut mir sehr leid, Ihnen diese Unannehmlichkeiten zu bereiten.«
»War Ihnen Ihre Schwangerschaft bewusst, als Sie sich auf diese beschwerliche Reise begeben haben?«, fragte er nach.
Sie nickte wieder.
»Dann haben Sie es also in Kauf genommen, dass wir uns um Sie und die Geburt kümmern müssen?«
»Ich hatte keine andere Wahl«, erklärte sie mit lauter Stimme, um das Tosen des Windes und das Rauschen der Wellen zu übertönen.
»Man hat immer eine Wahl«, entgegnete Maroon und sah sie nachdenklich an.
»Nicht in diesem Fall.« Abigail blinzelte gegen das Licht der Sonne. »Nicht, wenn ich weiterleben will.«
Er nickte und schwieg für eine Weile.
»Es ist das vierte Kind, das ich zur Welt bringen werde«, sagte sie und unterdrückte den aufsteigenden Schmerz bei dem Gedanken an ihre erstgeborenen Söhne Ebenezer und Hugo, die sie als Kinder in England zurücklassen musste. »Wenn mir jemand zur Hand geht, wenn Sie mir heißes Wasser und Tücher zur Verfügung stellen, wird es keine Schwierigkeiten geben.«
Der Captain schüttelte den Kopf. »Das ist zu riskant.« Er wandte sich von ihr ab und legte seine Hände auf die Reling. »Wann wird das Kind zur Welt kommen?«
»Im Dezember«, antwortete Abigail.
»Ich werde mir etwas einfallen lassen«, erwiderte er, wandte sich ab und ging zurück auf die Brücke.
Abigail hatte ein schlechtes Gewissen. Sie hätte ihre Schwangerschaft gleich zu Beginn ihrer Reise erwähnen müssen. Aber hätte er sie dann mitgenommen? Captain Maroon hätte wohl eher umgedreht und sie nach Fort Umpqua