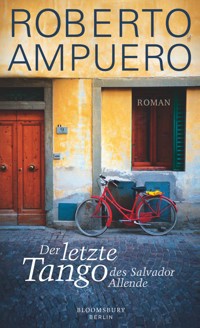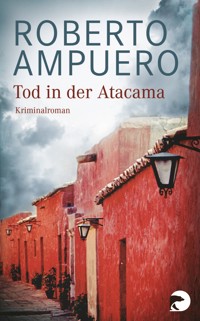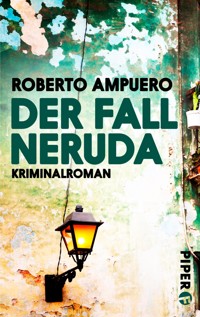
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Welches Geheimnis verbindet Pablo Neruda und die Frau, die er nicht vergessen kann? Als der berühmte Dichter 1973 nach Jahren als Botschafter alt und krank in seine Heimat Chile zurückkehrt, spürt er, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Er beauftragt Cayetano Brulé mit Nachforschungen über eine geheimnisvolle Frau. Die Suche nach ihr führt Cayetano von Mexiko nach Kuba, dann in die DDR. Immer wieder scheint sie ihren Namen, ihre Identität gewechselt zu haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Übersetzung aus dem Spanischen von Carsten Regling
ISBN 978-3-492-98164-4
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © 2008 Roberto Ampuero Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »El caso Neruda« bei Editorial Norma, »La otra orilla«, Bogotá vermittelt durch Guillermo Schavelzon & Assoc. Literary Agency durch Undercover Literary Agency © der deutschsprachigen Ausgabe: BV Berlin Verlag GmbH, Berlin 2009 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © terekhov igor / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2010
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für meine Eltern.Für die sechsundfünfzig Jahreihrer wunderbaren Liebesgeschichte.
Ich frage dich, wo ist mein Sohn?PABLO NERUDA, »Die Verschwenderin«
JOSIE
1
Was mochte die Herren von Almagro, Ruggiero & Partner derart beunruhigen, dass sie ihn so dringend in ihren Geschäftsräumen zu sehen wünschten?, fragte sich Cayetano Brulé, als er an jenem warmen Februarmorgen aus seinem Büro unter dem Dach des Turri-Gebäudes im Herzen des Bankenviertels von Valparaíso trat und mit dem alten, vergitterten Fahrstuhl hinab zur Calle Prat fuhr. Seit der Rückkehr zur Demokratie hatte sich A, R & P zur einflussreichsten Beratungsfirma des Landes entwickelt, und es wurde gemunkelt, es gäbe keine Vertragsklausel, die nicht durchzusetzen, und keine bedeutende öffentliche Ausschreibung, die nicht dank ihrer Unterschrift zu gewinnen wäre. Ihre Tentakel reichten vom Präsidentenpalast bis zu den neugotischen Firmensitzen der Unternehmer, vom Kongress bis zur staatlichen Rechnungsprüfstelle, quer durch alle Ministerien, politischen Parteien, Botschaften und Gerichte. Ihre Anwälte setzten Gesetze und Verordnungen, Subventionen und Erlasse, Steuerbefreiungen und Amnestien durch, wuschen beschmutzte Westen rein und polierten, wenn nötig, das Ansehen von Persönlichkeiten auf. A, R & P wirkten im Hintergrund, im Verborgenen, und auch wenn man ihre höchsten Führungskräfte regelmäßig auf wichtigen Empfängen und bei bedeutenden Abendessen in der Hauptstadt sah, waren ihre Eigentümer, die nur selten an gesellschaftlichen Zusammenkünften teilnahmen oder Journalisten ein Interview gewährten, so gut wie unsichtbar. Wenn sie sich jedoch einmal entschieden, auf der großen Bühne von Politik und Wirtschaft zu erscheinen, glänzten sie mit ihren italienischen Anzügen und Seidenkrawatten, ihrem Siegerlächeln und weltgewandten Auftreten und äußerten sich zu allem auf eine geheimnisvolle Weise, wie das Orakel von Delphi. Als Cayetano zwischen den Gebäuden der Calle Prat hinaufblickte, schlug die Uhr des Turri Viertel vor zwölf, die Glocken läuteten melancholisch, und die Möwen schwebten laut krächzend unter dem kristallinen Himmel dahin. Er musste an Die Vögel denken, den er sich in der Sonntagsmatinee des Filmtheaters Mauri angesehen hatte, dann stürzte er sich pfeifend und mit schnellem Schritt in das tägliche Getöse.
Als er zur Plaza Aníbal Pinto kam, ließ ihm das Knurren seines Magens keine andere Wahl, als sich einen freien Tisch im Café del Poeta zu suchen. Die Bosse von A, R & P würden schon nicht verzweifeln, wenn er etwas zu spät käme, ganz im Gegenteil, dachte er, während der Duft von geröstetem Kaffee seinen Pancho-Villa-Schnurrbart durchdrang, sie würden nur nervös vermuten, dass auch andere Klienten um diese Uhrzeit seine Dienste benötigten. Abgesehen vom Cortado und den Sandwichs hatten ihn an diesem Lokal schon immer der alte gebohnerte Dielenboden, die Glasvitrinen mit ihren Teeservice aus englischem Porzellan, die Ölgemälde mit Hafenmotiven und das behagliche Licht begeistert, das die Bronzelampen verströmten. Am liebsten mochte er den Tisch gleich neben dem Eingang, denn von dort konnte er die hundertjährigen Palmen auf dem Platz, die Skulptur Neptuns, der auf einem Felsen in der Mitte eines Brunnens voller bunter Fische saß, und sogar den Friedhof oben auf dem Cerro Cárcel betrachten, diese wunderliche Grabstätte, die bei jedem Erdbeben eine Lawine aus Mausoleumsziegeln, Holzkreuzen und klapprigen Särgen samt ihren Leichnamen auf die Stadt ausspie. Und er konnte von diesem Tisch aus die gebrauchten, aus Zürich importierten Trolleybusse sehen, die mit ihren Originalschildern umherfuhren, als befänden sie sich noch immer zwischen den blitzsauberen Fassaden der stillen helvetischen Viertel und wären nie in Valparaísos Straßen voller Schlaglöcher, streunender Hunde, fliegender Händler und dem ganzen Papiermüll gelandet.
Kurz und gut, die erlauchten Almagro und Ruggiero würden sich in Geduld üben müssen, beschloss Cayetano Brulé und rückte den Knoten seiner prächtigen lilafarbenen, mit kleinen grünen Guanakos bedruckten Krawatte zurecht, während er darauf wartete, dass sich die Bedienung, ein blasses schwarzgekleidetes Gruftimädchen mit pechschwarzem Haar, das über ein Headset, wie es auch Kanye West trug, mit der Küche in Verbindung stand, endlich dazu entschließen würde, seine Bestellung aufzunehmen. Er griff nach der Lokalzeitung, deren Titelseite die neueste Niederlage der Wanderers – des leidgeprüften Fußballclubs aus Valparaíso –, die Enthauptung eines Models im Garten des Casinos von Viña del Mar und einen beunruhigenden Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region verkündete. Letzteres überraschte ihn nicht. Der Niedergang der Stadt war allgemein bekannt. Im neunzehnten Jahrhundert war Valparaíso einmal die wichtigste und florierendste Hafenstadt am Pazifik gewesen; Enrique Caruso und Sarah Bernhard traten in ihren Theatern auf, Gath & Chaves und andere exklusive europäische Läden ließen sich in ihren Straßen nieder, und gut ein Viertel der Bevölkerung war ausländisch und sprach kein Spanisch. Doch das fürchterliche Erdbeben in der Nacht vom 16. August 1906 verwüstete Valparaíso und begrub innerhalb weniger Sekunden mehr als dreitausend Menschen unter den Trümmern. Noch in derselben Nacht verließen Tausende für immer die Stadt, und diejenigen, die blieben, beschworen von diesem Tag an ständig die Pracht und den Glanz der Vergangenheit und die Schönheit der verschwundenen Stadt herauf, überzeugt davon, dass eines nicht allzu fernen Tages ein Wunder den Fortschritt zurückbrächte. Doch genau acht Jahre später war es dieser berühmte Fortschritt, der Valparaíso einen weiteren harten Schlag verpasste: Die feierliche Eröffnung des Panamakanals am 15. August 1914 schnürte ihr die Luft ab. Von einem Tag auf den anderen blieben eine trostlose Bucht, leere Hafenkneipen und stillstehende Kräne am Kai zurück, die Bars, Geschäfte und Restaurants schlossen ihre Türen für immer und stürzten so die Angestellten, Prostituierten und Zuhälter in fortwährende Arbeitslosigkeit.
Als Cayetano 1971 am Arm seiner damaligen Frau María Paz Ángela Undurraga Cox nach Chile kam und die Entscheidung traf, sich in Valparaíso niederzulassen, wusste er nichts von dieser tragischen Geschichte, diesem unaufhörlichen Verfall, der mehr eine göttliche Strafe als eine Folge des Schicksals und mit der verrückten Architektur und Topografie der Stadt und dem freundlichen, schwermütigen Wesen ihrer Bewohner verbunden zu sein schien. Es waren die Tage von Salvador Allende und der Unidad Popular, Tage eines zügellosen sozialen Aufbegehrens, das jedoch nicht in das mündete, was das Volk sich erträumt hatte, sondern in die Diktatur des Generals Augusto Pinochet. Wie viele Jahre waren seit damals vergangen, seit dem Beginn jener Epoche, die so viele lieber vergessen wollten? Weit über dreißig Jahre. Jedenfalls glaubten die stets würdevollen porteños, die Bewohner Valparaísos – und er betrachtete sich inzwischen als einer von ihnen –, dass sowohl das Glück als auch das Pech hinter der nächsten Ecke oder hinter der Krümmung irgendeiner Steintreppe lauern konnten und daher im Leben alles relativ und flüchtig war. Für die Einheimischen, die es gewohnt waren, die Hügel Valparaísos hinauf- und hinabzusteigen, war das Leben genau wie ihre Stadt: Mal schwamm man vergnügt und voller Zuversicht auf einem Wellenberg, mal lag man bedrückt und mitgenommen in der Tiefe einer Schlucht. Stets war es möglich, auf- oder abzusteigen. Nichts war von Bestand. Keine Situation währte ewig. Das Leben brachte Unwägbarkeiten mit sich, und nur der Tod war eine feste Größe. Aus diesem Grund – und weil er ein unverbesserlicher Optimist war, solange es ihm nicht an Kaffee und Brot und hin und wieder einem kalten Bier oder seiner Ration Rum mangelte, und obwohl er als privater Ermittler nur selten Arbeit fand an diesem äußersten Rand der Welt, der sich in eine ansehnliche Exportmacht verwandelt hatte, die Früchte, Wein und Lachs verkaufte und wo sich immer mehr Familien ein zweites Auto anschafften, in den Urlaub nach Havanna oder Miami flogen oder sich haushoch verschuldeten – störte es ihn nicht, die Besitzer von A, R & P noch eine Weile warten zu lassen.
Vor sechzehn Jahren, 1990, hatten die Chilenen nach friedlichen Protesten die Demokratie zurückerobert, und jetzt wurde dieses angeblich so eintönige und konservative Land, in dem es bis vor kurzem kein Recht auf Scheidung gab, von einer geschiedenen Frau, alleinerziehenden Mutter, Sozialistin und Atheistin regiert. Das war ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dieses Stilett von Land, das sich von der Atacama, der trockensten und unwirtlichsten Wüste des Planeten, bis zum Südpol erstreckte und zwischen der wilden Brandung des Pazifischen Ozeans und dem ewigen Schnee der Anden sein Gleichgewicht suchte – immer kurz davor, mit Mann und Maus in die Tiefen des Meeres zu stürzen –, ein einzigartiger, sich fortwährend verändernder, schwankender Ort war, der sich in schwindelerregender Geschwindigkeit von der Euphorie zur Depression und von der Solidarität zum Individualismus bewegte. Ein Ort, der diesen verworrenen Hieroglyphen glich, die der Archäologe Heinrich Schliemann entdeckt und die nie jemand vollständig zu entziffern vermocht hatte, und den man – ganz den Umständen, Stimmungsschwankungen oder Jahreszeiten entsprechend – entweder liebte oder hasste.
Hier stirbt niemand endgültig, dachte Cayetano, als er von seinem Platz aus die gekalkten Nischen betrachtete, die oben auf dem Friedhof des Cerro Cárcel wie ein Salzsee in der Atacama schimmerten. Beim erstbesten Erdbeben kehren mit einem Schlag alle wieder in das Reich der Lebenden zurück.
»Was kann ich dem Herrn bringen?«, fragte ihn das Gruftimädchen.
Er bestellte einen doppelten Cortado und verlangte die Karte mit den Sandwichs. Während er hungrig auf sie wartete, strich er sich über die Enden seines Schnurrbarts. Jetzt erinnerte er sich wieder ganz genau. Er war vor fünfunddreißig Jahren in Valparaíso angekommen, nachdem er in Santiago de Chile zusammen mit Ángela, einer halbaristokratischen Chilenin mit revolutionären Überzeugungen, die an einem exklusiven College für junge Damen in den Vereinigten Staaten studiert hatte, aus einer Boeing der Lan Chile gestiegen war. Während sie sich nachts am Strand von Cayo Hueso unter Kokospalmen im warmen Sand liebten, hatte sie ihn überzeugt, am Aufbau des Sozialismus mitzuwirken, den Salvador Allende im Cono Sur vorantrieb. Freilich endeten beide Erfahrungen, die mit Allende und die mit der Liebe, auf eine sehr abrupte und wenig erfreuliche Weise mit dem Staatsstreich von Pinochet am 11. September 1973. Während sie mit dem charango-Spieler einer Folkloregruppe im Pariser Exil Zuflucht suchte, war er wie eine alte Barkasse in Chile gestrandet. Er musste sich sowohl vor den Linken verstecken, für die er ein verachtenswerter gusano, ein Castro-feindlicher Wurm aus Miami war, als auch vor den Rechten, die ihn als eingeschleusten Anhänger Castros beschimpften. Im Laufe der Diktatur versuchte er sein Glück in zahlreichen Berufen: als Verkäufer von Büchern und Versicherungen, als Marktschreier für Pflegecremes der Marke Avon und als Assistent eines Asservatenbeamten, der zu Fuß die steilsten und gefährlichsten Hügel Valparaísos ablief, um üblen Subjekten – Taschendieben, Hehlern oder Schmugglern – amtliche Benachrichtigungen zuzustellen. Später sollte ihm ein Detektivdiplom, das er sich in einem Fernstudium an einem zwielichtigen Institut in Miami erworben hatte, das Leben retten, denn es lockte Leute an, die ihn mit kleinen, unbedeutenden Ermittlungen beauftragten – der Beschattung einer abenteuerlustigen Frau etwa, der Aufklärung des Raubs der Tageseinnahmen in einem Café oder der Morddrohungen eines streitsüchtigen Nachbarn –, was ihm nicht nur ermöglichte, mit einer gewissen Würde über die Runden zu kommen, sondern darüber hinaus einer Beschäftigung nachzugehen, die am besten zu einem freien, verträumten und hedonistischen Geist wie dem seinen passte.
»Bitte sehr«, sagte das Gruftimädchen und schlug vor seinen kurzsichtigen Augen eine Karte mit bunten Fotos auf, auf denen die im Lokal angebotenen Sandwichs und Pasteten abgebildet waren.
Die Speisekarte war nicht allein dazu gedacht, den Appetit der Gäste anzuregen, sondern besaß auch einen kulturellen Nutzen, versuchte sie doch, die erstaunliche Geschichte dieser Stadt mit ihren sieben Leben zu erzählen, die einst als die »Perle des Pazifiks« bekannt gewesen war. Streng genommen hatte sie mehr Ähnlichkeit mit einem ziemlich abgenutzten Edelstein, als wäre sie nie von irgendeiner Autorität, ob weltlich oder kirchlich, gegründet worden. Mit einer halben Million leidgeprüfter Einwohner und fünfzig auf eine ebenso verschwenderische wie anarchische Weise bewohnten Hügeln, mit einer hufeisenförmigen Bucht, die einem trügerischen Amphitheater glich, voller klappriger Trolleybusse aus der Nachkriegszeit und einem knappen Dutzend jämmerlicher Drahtseilbahnen, in denen die Leute jedes Mal ihr Leben riskierten, wenn sie zur Arbeit fuhren oder in ihre Häuser mit Erkern, Balkonen und abschüssigen Gärten heimkehrten. Häuser, die sich anmutig auf den höchsten Punkten der Hügel erhoben oder sich mit aller Kraft an die Hänge klammerten und versuchten, das Gleichgewicht zu halten. Jetzt, da die Stadt zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt worden war und massenhaft amerikanische, kanadische und europäische Rentner, die sich als Jugendliche tarnten und die Taschen voller Dollars und Euros hatten, den im Sommer täglich im Hafen einlaufenden Kreuzfahrtschiffen entstiegen, begann Valparaíso wieder Anzeichen eines Aufschwungs zu erleben.
Das Leben war gar nicht so schlecht hier, dachte Cayetano zufrieden. Er wohnte in einem gelben Haus im neoviktorianischen Stil zur Miete, im Paseo Gervasoni auf dem Cerro Concepción gelegen, von wo aus er den Ausblick auf den Pazifik genießen konnte und wo es ihm an lauen Sommermorgen sogar schon gelungen war, sich vorzustellen, er wäre in Havanna, die Strandpromenade des Malecón im Rücken. Bei seinen Ermittlungen als Privatdetektiv half ihm Suzuki, ein porteño japanischer Abstammung, der nachts das Kamikaze betrieb, eine winzige Garküche. Sie befand sich im Hafenviertel zwischen der Plaza de la Aduana und der Plaza de la Matriz, in einer schmalen Gasse mit Kopfsteinpflaster und vielen Kneipen. Das half ihm, immer auf dem Laufenden darüber zu sein, was sich die Prostituierten und ihre Zuhälter erzählten, die genau wie die Taschendiebe und andere Gauner die Früchte des touristischen Aufschwungs genossen. Obwohl er bereits über fünfzig Jahre alt war, vertraute Cayetano noch immer darauf, die Frau seines Lebens zu finden und Vater eines Sohnes oder einer Tochter zu werden, bevor er zu einem vollständig kahlen, arthritischen und ständig meckernden alten Mann im Ruhestand mutierte. Auch wenn es ihm anfangs schwergefallen war, sich an die raue Art der Chilenen und die klimatischen Extreme ihres gebirgigen Landes zu gewöhnen, waren Kuba, seine Menschen und sein tropisches Klima inzwischen nur noch eine blasse, ferne Erinnerung. Am Ende hatte ihn sein neues Heimatland mit all seinen Licht- und Schattenseiten für sich eingenommen, obwohl es weder grün noch eine Insel war; doch vielleicht war es auf seine Art ja auch eine Insel.
»Haben Sie sich entschieden, was Sie essen wollen?«, fragte die Gruftikellnerin, als sie ihm den Kaffee brachte. Ihre Arme waren durchscheinend, von dicken blauen Adern durchzogen.
»Ein Barros Luco mit einer doppelten Portion Avocado«, antwortete er und versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, mit seinen Fingerkuppen über diese blauen Flüsse zu fahren, bis sie zu ihren verborgenen, parfümierten Quellen gelangten.
Er hatte gerade etwas Zucker in den Cortado getan und einen ersten Schluck getrunken, als sein Blick mit einem Mal auf ein Foto von Pablo Neruda auf der Rückseite der Speisekarte fiel. Der Dichter saß gemütlich in einem Sessel in seinem Haus in Valparaíso. Cayetano spürte, wie ihm beinahe das Herz stehenblieb; er nippte langsam an seinem Kaffee, bis seine Brillengläser beschlagen waren, und rang sich ein schwaches Lächeln ab. Ihm schien es, als ob die Palmen, die Kreuze auf den Spitzen der Mausoleen und sogar Neptun höchstpersönlich zu zittern begannen wie Luftspiegelungen in der Wüste. Die Erinnerung versetzte ihn an einen kühlen Morgen im Jahr 1973, den Morgen seines ersten Falles, den er niemals irgendwem enthüllen würde, handelte es sich dabei doch um das bestgehütete Geheimnis seines Lebens, ein Geheimnis, mit dem sie ihn eines Tages mit den Füßen voran auf diesen Friedhof dort oben bringen würden. Dort, wo sich die Toten in den lauen Sommernächten glücklich im Rhythmus der Tangos, Cumbias und Boleros wiegten, während sie sich danach sehnten, vom nächsten Erdbeben erneut auf die malerischen, verwinkelten Straßen Valparaísos geschleudert zu werden.
Er schloss die Augen und bemerkte, wie sich ganz plötzlich der Verkehrslärm, der Gesang und die Musik der blinden Akkordeon- und Pianolaspieler und sogar die Schreie der Verkäufer, die Kräuter, Avocados oder Lotterielose anpriesen, aufzulösen begannen und wie auf einmal, wie von Zauberhand und mit erstaunlicher Schärfe, die raue, grob geschliffene Holztür in der Pasaje Collado vor ihm auftauchte …
2
Da war die Holztür mit den ausgedörrten Astlöchern, doch niemand öffnete ihm. Er strich sanft über den alten Türklopfer aus Bronze, dann steckte er die Hände in die Taschen seiner Lammfelljacke und sagte sich, dass ihm wohl nichts anderes übrigblieb, als zu warten. Sein Atem hinterließ weiße Schwaden in der kühlen Luft des trüben Wintermorgens, und er dachte belustigt, dass es so aussah, als würde er rauchen – und das in einer Stadt, in der es schon lange keine Zigaretten und Streichhölzer mehr gab.
Er hatte gerade eine Stunde im Ali Baba vertrödelt, einer Bar um die Ecke, in der Avenida Alemania, schräg gegenüber dem Teatro Mauri. Dort hatte er die Kolumnen von Omar Saavedra Santis in El Popular und von Enrique Lira Massi in Puro Chile gelesen, während ihm der Türke Hadad einen Kaffee und ein Gyros zubereitete und dabei fortwährend die Versorgungsengpässe, die langen Schlangen und den Tumult auf den Straßen verfluchte. Es bedrückte ihn sehr, dass die politischen Auseinandersetzungen das Land endgültig spalten und zu Grunde gehen lassen würden. Als Cayetano erneut auf die Uhr blickte, war es bereits nach zehn. Vielleicht war er noch nicht aus der Hauptstadt zurück, sagte er sich und ließ den Blick über die nebelverhangene Bucht schweifen.
Sie hatten sich vor ein paar Tagen während einer curanto a la olla im Anwesen des Bürgermeisters von Valparaíso kennen gelernt, wohin ihn seine Frau geschleppt hatte, um ihm die Gelegenheit zu geben, einmal mit linken Politikern und Intellektuellen der Region zusammenzutreffen. Ángelas Meinung nach müsse er dort unbedingt die Abgeordneten Guastavino und Andrade, die Sänger Payo Grondona und Gato Alquinta, den Maler Carlos Hermosilla und ein paar Dichter der hafenstädtischen Boheme wie Sarita Vial oder Ennio Moltedo kennen lernen, offene, kreative Leute, die sich für den Fortschritt engagierten. Da Ángela über zahlreiche gute Kontakte verfügte, versuchte sie immer wieder, ihm dabei zu helfen, eine Arbeit in dieser bewegten Zeit zu finden, was für jemanden wie ihn, der aus der Karibik kam und gerade einmal zwei Jahre in Chile lebte, beileibe keine einfache Sache war. Hinter ihren fast mütterlichen Bemühungen spürte Cayetano jedoch noch eine weitere Art der Besorgnis: den Wunsch, ein ungelöstes Problem zu lösen, um sich danach wieder anderen Themen widmen zu können, die sie bisher vielleicht nur wegen dieser einen, nicht funktionierenden Angelegenheit verschoben hatte. Ángelas Leben war nicht auf die Ehe, sondern auf die Politik ausgerichtet, und ohne politisches Engagement oder zumindest einen öffentlichen Posten bliebe er in diesem Land, in das er ihr gefolgt war, wie ein Fremdkörper, der sich nicht anpassen wollte. Und genau so, fehl am Platz und ausgeschlossen, fühlte er sich auf diesem Fest, zu dem ihn niemand eingeladen hätte, wenn da nicht seine Frau gewesen wäre, und zu dem er, wie er mit immer schlechter werdender Laune dachte, auch gar nicht hatte eingeladen werden wollen. Er verspürte keine Lust, sich unter die Träger der ihm empfohlenen Namen zu mischen, und erst recht nicht, sich zu der Gruppe zu gesellen, die sich um den berühmten, hochgelobten Gastgeber mit dem legendenumwobenen Namen geschart hatte. Stattdessen zog es Cayetano enttäuscht vor, sich in die Bibliothek des mit gelb gestrichenen Zinkblechen verkleideten und wie eine Goldmünze über der Bucht glänzenden Hauses der Jahrhundertwende zurückzuziehen. Die Bibliothek besaß einen Holzboden, Deckenbalken aus Eichenholz und Regale voller elegant in Leder gebundener Bücher, bot den Schutz eines angenehmen Halbdunkels und war, wie Cayetano vermutet hatte, leer. Er machte es sich in einem Ohrensessel am Fenster bequem, das zum Garten ging, wo ein paar der Gäste trotz der Kälte rauchten und sich unterhielten, und dachte, während er den kräftigen, angenehmen Geruch des Pazifiks in sich aufsog, an ein anderes Meer und eine andere Ángela.
In diesem Zustand verweilte er, bis er vollständig das Gefühl für die Zeit verloren hatte. Anscheinend vermisste ihn niemand. Doch als er schon den Eindruck hatte, die festliche Zusammenkunft der Chilenen fände weit, weit weg statt, in einer anderen Epoche oder in einem verschwommenen Traum, hörte er plötzlich Schritte hinter sich, die ihn aus seinen bescheidenen Gedanken rissen. Jemand hatte den Raum betreten, zum Glück, ohne das Licht einzuschalten. Genau wie er selbst schien der Eindringling die Dunkelheit zu bevorzugen; vielleicht sehnte auch er sich nach dem Alleinsein. Cayetano blieb unbeweglich sitzen und vermied jedes Geräusch. Möglicherweise hatte sich der andere im Zimmer geirrt und ließe ihn, wenn er niemanden sähe, in Ruhe. Doch die Schritte kamen näher, ganz langsam, so als trauten sie dem Boden nicht, den sie betraten, bis sie schließlich direkt neben ihm zum Stehen kamen.
»Wie geht es Ihnen, mein Herr?«
Der ironische, aber liebenswürdige Tonfall, der so klang, als würden sie sich bereits seit langem kennen und im Spaß miteinander reden, und diese ungewöhnliche, so persönliche und freundliche Art der Begrüßung erstaunten Cayetano so sehr, dass er nicht gleich eine Antwort herausbrachte. Da ihm in der folgenden Stille die Frage aber noch unwirklicher vorkam, beeilte er sich, irgendetwas zu sagen.
»Sehr gut«, sagte er und überlegte, dass es sich aufgrund des gemessenen Schritts um einen älteren Mann handeln müsse. »Wenn einen der ganze Trubel erschöpft, kann man hier wunderbar neue Kräfte sammeln.«
Warum hatte er das gesagt? Es klang wie eine Einladung zu bleiben, dabei wollte er doch, dass der Fremde wieder verschwand. Wenigstens drehte er sich nicht um, um ihn anzublicken, sondern starrte weiterhin stur auf den vom Fenster eingerahmten Horizont. Doch der andere, dessen Gegenwart Cayetano weiterhin in seinem Rücken spürte, schloss sich seiner beschaulichen Betrachtung an.
»Es erinnert mich an das Birma meiner Jugend«, hörte er ihn sagen und fragte sich, was jenes ferne Asien, von dem er annahm, es herrsche dort eine unglaubliche Hitze, wohl mit diesem kalten Land des Südens gemeinsam habe. »Die Nacht des Soldaten. Der vom Ozean oder einer Woge in die Ferne geworfene Mensch«, sprach er wie geistesabwesend und schien sich dabei doch auf ihn, Cayetano, zu beziehen. Wo war er hergekommen? Eine leichte Brise bewegte die Vorhänge, und Cayetano betrachtete die Brandung. »Ein einsamer Mann im Angesicht des Meeres ist so, als befände er sich mitten im Meer.«
Cayetano reichte es. »Von wem sprechen Sie?«
»Bist du etwa kein Fremder?« Dass er ihn duzte, überraschte ihn zwar, störte ihn jedoch nicht; er wollte allein sein, doch trotz seines Wunsches nach Intimität begann er die fremde Stimme zu dulden. »Wenn jemand weit von seinem Heimatland entfernt ist, hat er kein Zuhause und irrt umher. Auch mir haben einmal Orte wie dieser gefallen.«
»Und gefallen Ihnen immer noch.« Er merkte, dass es diesmal er war, der seinen Gesprächspartner überrascht hatte. Dieser lachte, und Cayetano spürte seine Nähe noch intensiver.
»Du hast Recht, sie gefallen mir immer noch.« Die Stimmung entspannte sich, auch wenn beide weiterhin vermieden, sich anzuschauen, und den Pazifik betrachteten, so als wollten sie die Distanz wahren, mit der sie sich zuvor unterhalten hatten. »Ich besitze inzwischen mehrere Orte, an die ich mich zurückziehen kann, habe überall Freunde, und dennoch benötige ich hin und wieder ein stilles Plätzchen wie dieses. Du bist Kubaner, nicht wahr?«
Er dachte, dass sein Akzent ihn verraten haben musste. »Aus Havanna.«
»Dann musst du der Mann von Ángela Undurraga sein.« Augenblicklich fühlte sich Cayetano unbehaglich, doch wie ein guter Freund beeilte sich der Unbekannte, ihn zu beruhigen: »Du brauchst dich nicht zu wundern, sie ist ziemlich bekannt hier. Wir alle wissen, dass sie einen Kubaner aus Florida geheiratet hat.«
Wir alle? Was hieß das? Zum ersten Mal spürte er das Verlangen, sich umzudrehen, um seinen Gesprächspartner sehen zu können. Aber er hielt sich zurück: Seit er den Hüften seiner Frau voller Begeisterung in diese südlichen Gefilde gefolgt war und den zwei folgenden Jahren voller Fehltritte, hatte er gelernt, nichts zu überstürzen.
»Einen aus Havanna, der seine Stadt verlassen hat«, betonte Cayetano listig.
Der Mann in seinem Rücken lachte. »Du hast eine wunderschöne Frau. Klug und unternehmungslustig. Du solltest stolz auf sie sein.«
Aber das war er nicht, und das konnte man ihm bestimmt anmerken. Er suchte Schutz in der Weite, in der fernen Brandung, die ihre Blicke ablenkte, und heuchelte: »Ja, viele sind neidisch auf mich. Und fragen sich bestimmt, was ihr hier gefehlt hat, dass sie in den Norden ziehen musste, um einen Mann zu finden.«
Dieses Mal lachte der Chilene nicht.
»Liebeskummer ist überall gleich«, gab er barsch von sich. Innerhalb weniger Sekunden schien sich eine uralte Traurigkeit, die er vermutlich über mehr Jahre, als sich Cayetano vorzustellen vermochte, mit sich herumgeschleppt hatte, seiner kultivierten, freundlichen Stimme bemächtigt zu haben, die noch vor wenigen Augenblicken friedlich gelacht und gescherzt hatte. Auch wenn er kaum eine Pause machte, bevor er weitersprach, klang seine Stimme nun, als ob sie eine schwere Last zu tragen hätte. »Verzeih mir die Offenheit, mein Junge, aber ich weiß, wie schmerzlich es ist, diese Masken zu tragen. Meine Augen durchdringen sie, sobald sie sie sehen. Noch im selben Moment, als ich dich vor diesem Fenster sitzen sah, weit weg von dem Garten, wo du dich Arm in Arm mit deiner Frau aufhalten solltest, habe ich die Szene wiedererkannt. Zu viele habe ich schon gehen sehen, um nicht den Ort zu erkennen, den sie verwaist hinter sich lassen.«
Nun war Cayetano selbst dieser stille Ort. Beredt schwieg er. Sein seltsamer Gesprächspartner schien noch mehr zu sagen zu haben.
»In meinem Alter sollte man annehmen, dass man bereits alles gesehen habe, die Irrtümer nicht mehr weh täten, der ganze Verrat einen nicht mehr überraschen könne … Aber nein, ganz im Gegenteil, es braucht nur einen kleinen Schubs, ein unerwartetes Stolpern auf dem täglichen Weg, und das so sicher geglaubte Gleichgewicht ist verloren. Außerdem hat man bestimmte Reflexe verloren, und die Zeit wird knapp.« Angesichts dieser Bedrohung war seine Stimme leiser geworden, dann sprach er wieder lauter. »Was einmal brennt, brennt immer, und es gibt nichts, womit man es löschen könnte; man kann es nicht einmal ignorieren«, fuhr er nachdenklich fort, »und keine Macht kann es erklären.« Er suchte nach einem Schluss. »Wenn man jung ist, verzweifelt man schnell und fürchtet sofort, dass jemand, der eine Verabredung nicht eingehalten hat, nie mehr zurückkehren wird. Doch diese Welt hält viele Wendungen bereit …«
Auch wenn die letzte Andeutung ihm sehr nebulös vorkam, verstand Cayetano, dass der Mann von sich selbst sprach. Und doch galten seine Worte auf eine bestimmte Weise auch ihm. Eine plötzliche Ahnung überkam ihn.
»Sind Sie Schriftsteller?«, fragte er.
»Du hast das Zeug zu einem Detektiv, mein Junge«, erwiderte der Unbekannte halb im Spaß. »Wenn du einmal keine Lust mehr auf deine Arbeit hast, kannst du jederzeit ein Schild an der Tür eines kleinen, unordentlichen Büros anbringen und warten, bis dich jemand für eine Ermittlung bezahlt.«
Cayetano konnte nicht sagen, ob ihn der Mann auf den Arm nahm oder ihm einen zukünftigen Weg wies. Egal, er ging auf das Spiel ein. »Ich werde mich daran erinnern, Señor …«
»… Reyes. Ricardo Reyes.« Ihm kam es so vor, als würde der andere lächeln. »Cayetano, nicht wahr? Welcher Arbeit gehst du nach?«
»Im Moment, was gerade so kommt. Ich hoffe, dass ich bald eine richtige Arbeit finde, aber nach zwei Jahren glaube ich allmählich, dass Ángela doch nicht so gute Kontakte hat.«
Reyes schwieg. Dann fing er plötzlich an zu husten. Cayetano schämte sich, weil er sich über seine Frau beklagt hatte, und rührte sich nicht, doch irgendetwas verleitete ihn erneut zu einer höflichen Geste.
»Soll ich das Fenster schließen?«
»Keine Sorge. Das hat nichts mit offenen Fenstern zu tun«, entgegnete Reyes und räusperte sich, um den Husten zu unterdrücken. »Du suchst also Arbeit«, fuhr er fort, als die Geräusche klackernder Absätze in den Raum drangen. »Die Leute fragen nach dir, und du versteckst dich hier wie eine Auster«, sagte eine Frau mit dunkelblondem Haar, entschlossen und temperamentvoll. »Auf geht’s, deine Seeaalsuppe ist fertig, und der Bürgermeister will dir zu Ehren eine kleine Rede halten. Los, los.«
Die Unterbrechung hatte bewirkt, dass sich Cayetano endlich umdrehte. Er stellte fest, dass der Mann nicht hinter ihm, sondern direkt neben ihm stand. Verblüfft erkannte er ihn. Während des Festes hatte er es nicht gewagt, sich ihm zu nähern. Nicht nur der enge, ihn umgebende Kreis von Bewunderern hatte ihn eingeschüchtert, auch die Autorität, die er dieser beleibten, sich gemächlich bewegenden Gestalt zuschrieb, deren müde Augen mit den dicken, saurierhaften Lidern während des Gesprächs zwischen ihm und dem Meer hin- und hergewandert waren, während er selbst nicht einmal die Güte besessen hatte, ihn einen winzigen Moment lang anzuschauen. Und jetzt wurde der große Dichter und ehrenwerte Botschafter Salvador Allendes von seiner Frau fortgezogen. Noch nie war Cayetano allein mit einem Nobelpreisträger gewesen. Er war tief bewegt, und das Blut schoss ihm in den Kopf.
»Wenn Matilde befiehlt, gehorcht der Seemann«, sagte der Dichter und zwinkerte ihm zu. Da ging er, mit seinem Poncho aus Chiloé, der unverwechselbaren Mütze und den großen Muttermalen auf den Wangen. »Du weißt schon, wenn du dieser Tage einmal etwas Zeit entbehren kannst, dann komm mich in meinem Haus La Sebastiana besuchen. Ich besitze alte Postkarten von deiner Stadt, mein Junge. Ruf mich einfach an.«
Aber er hatte sich nicht getraut, ihn anzurufen. Es war der Dichter selbst gewesen, der sich mit ihm in Verbindung setzte, der ihn anrief und bat, ihn zu besuchen. Und deshalb stand er hier, in der Pasaje Collado, wo sich jetzt endlich, mit einem Quietschen der verrosteten Scharniere, die Holztür mit den ausgedörrten Astlöchern öffnete.
3
Es war der Dichter.
»Entschuldige, ich habe gelesen und bin dabei eingeschlafen. Außerdem ist Sergio, mein Chauffeur, unterwegs und schaut, was er in den Geschäften bekommen kann, und für mich bedeutet es eine enorme Anstrengung, die Treppe herunterzusteigen. Du wirst sehen, hier ist alles etwas verworren. Bitte, folge mir.«
Sie durchquerten den winzigen Garten des sich an das Teatro Mauri anlehnenden Gebäudes. Durch die Sträucher konnte Cayetano die Stadt und die an ihrem geschützten Ankerplatz liegende Kriegsflotte und in der Ferne die Bergkette der Anden ausmachen. Der Dichter begann, mühevoll eine Treppe hochzusteigen, und er folgte ihm. Im ersten Stock durchquerten sie einen Flur und stiegen dann weiter hoch, diesmal über eine enge Wendeltreppe. Durch ein Bullauge konnte Cayetano schimmernde Dächer und schattige Gassen sehen, so als schwebe das Haus über der Stadt.
Völlig außer Atem gelangte der Dichter in den zweiten Stock. Er trug dieselbe Mütze wie vor ein paar Tagen und über den Schultern eine kaffeefarbene Decke aus Kastilien. Was wollte er von ihm? Über was musste er so dringend mit ihm sprechen, dass er ihn in sein Haus einlud, ausgerechnet ihn, einen mürrischen Typen, einen Ausländer, der ihn während des einzigen Gesprächs, das sie jemals geführt hatten, einfach neben sich stehen ließ, ohne im Geringsten auf sein Alter Rücksicht zu nehmen oder das kleinste Anzeichen von Bewunderung oder wenigstens von Respekt zu bekunden, so wie es all die anderen taten? Der Dichter führte ihn in ein Wohnzimmer mit leuchtend blauen Wänden und einem ungewöhnlich großen Fenster, durch das die ganze Stadt zu sehen war, und forderte ihn auf, sich in einen Sessel aus geblümtem Stoff, der sich gegenüber einem anderen aus schwarzem Leder befand, zu setzen. Es war ein großzügiger, heller Raum, in dessen Mitte ein grünes Karussellpferdchen stand. Nebenan befand sich das Esszimmer, das mit einem ähnlich großen Fenster ausgestattet war. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es eine Bar voller Flaschen und Gläser, eine Glocke und ein Bronzeschild, auf dem Don Pablo est ici stand. Einmal mehr verglich Cayetano die Gastfreundschaft, mit der er empfangen wurde, mit seiner eigenen Taktlosigkeit, die er während des unerwarteten Telefongesprächs am Tag zuvor nur mit aller Mühe hatte wiedergutmachen können.
»Danke, dass du gekommen bist«, sagte der Dichter und setzte sich in den Ledersessel. Jetzt schien es, als schwebe er über den Glockentürmen der Stadt. »Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, Cayetano. Du wirst dich fragen, warum ich dich eingeladen habe, und die Antwort ist ganz einfach: Weil ich glaube, dass du mir helfen kannst. Mehr noch, ich glaube, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist, der mir helfen kann.«
Auch wenn er sich vorgenommen hatte, freundlich zu sein, blieb Cayetano weiterhin auf der Hut.
»Don Pablo, so viel Verantwortung macht mir Angst«, sagte er voller Respekt, beinahe unterwürfig, doch als er die Ironie bemerkte, die in seinen Worten steckte, nahm er sich vor, noch bescheidener zu sein. »Wie sollte Ihnen jemand wie ich helfen können?«
»Vielleicht sollte ich dir sagen, dass ich ein wenig über dich weiß, obwohl ich deine Frau noch besser kenne. Sie sympathisiert mit der Regierung der Unidad Polpular, so wie du vermutlich auch. In diesen Tagen traut man besser nicht jedem …«
Cayetano betrachtete die fleckigen Hände, die lange Nase und das ausgezehrte Gesicht des Dichters. Er hatte eine kräftige Statur, nur der Kragen seines Hemdes war ihm zu weit, als wäre er in den letzten Monaten schlagartig abgemagert. Da erinnerte er sich an dessen plötzliche Melancholie und die schwermütige Anspielung auf die immer knapper werdende Zeit. Auch wenn der Dichter jetzt, in seiner gewohnten Umgebung und in dem hellen Tageslicht, das sein Haus durchflutete, entschlossen und tatkräftig wirkte. Allerdings wusste Cayetano noch immer nicht, worauf er hinauswollte.
»Ich bin zwar Kubaner, aber einer aus Florida«, sagte er, um den Schwung des Dichters humorvoll zu bremsen. »Doch ich verstehe nicht –«
»Gerade weil du Kubaner bist, kannst du mir helfen«, schnitt ihm Don Pablo das Wort ab.
Cayetano rückte seine Brille zurecht und strich sich nervös über den Schnurrbart. »Weil ich Kubaner bin?«
»Eins nach dem anderen«, antwortete der Dichter. »Ich habe bemerkt, wie du die ganze Zeit über das Zimmer betrachtest. Zuerst einmal: Dieses Haus heißt La Sebastiana zu Ehren von Sebastián Collado, dem Spanier, von dem ich es 1959 gekauft habe. Für die Dachterrasse hat er eine große Voliere und einen Landeplatz für Raumschiffe entworfen.«
Cayetano glaubte, Opfer eines Scherzes zu sein. »Meinen Sie das ernst, Don Pablo?«
»Ganz und gar«, entgegnete dieser und schloss bedächtig seine großen Lider. »Eines Tages wird hier ein kosmischer Odysseus landen. Keines der Häuser, die ich besitze, schwebt so wie dieses. Das in Santiago verbirgt sich zwischen den Flanken des Cerro San Cristóbal, das am Strand von Isla Negra ist ein hübsches Boot, jederzeit bereit abzulegen, und das Manquel, ein ehemaliger Pferdestall aus Stein und Ziegeln, den ich mit dem Geld für den Nobelpreis erworben habe, liegt einsam in den Wäldern der Normandie. Aber La Sebastiana, Cayetano, ist wie ein aus Luft, Erde und dem Meer gewebtes Armband. Deshalb ist es mein Lieblingshaus. Doch nicht als Bauherr, sondern als Dichter habe ich dich hergebeten.«
Cayetano war sprachlos. Was hatte er schon mit Poesie zu tun? Wie sollte er einem gefeierten Dichter helfen können?
Vor dem Fenster segelte eine Möwe vorbei.
»Aber das ist kein Grund, nervös zu werden«, fuhr Don Pablo fort. »Man selbst ist nie so wichtig wie sein Bild in den Zeitungen oder im Fernsehen. Und allmählich fordern die Jahre ihren Tribut – im nächsten werde ich siebzig –, auch wenn sie mir noch nicht die Leidenschaft des Schreibens rauben konnten, und die des Liebens.«
Cayetano wollte endlich zur Sache kommen. »Wie kann ich Ihnen helfen, Don Pablo?«
Der Dichter verschränkte die Hände über seinem Bauch, der in das metallische Licht getaucht war, das der Morgen verströmte und das die Fassaden der Häuser und die Umrisse der Hügel im harten Kontrast hervortreten ließ, und schwieg.
»Ich muss jemanden finden«, sagte er schließlich, nachdem er eine Weile mit gesenktem Blick nachgedacht hatte. »Die Suche soll diskret sein. Es ist etwas sehr Persönliches. Ich kümmere mich um sämtliche Spesen und zahle dir selbstverständlich so viel, wie du verlangst.« Er sah ihn mit unruhiger Erwartung an.
»Sie wollen, dass ich jemanden für Sie finde?«
»So ist es.«
»Sie wollen mich« – er erinnerte sich an die Worte des Dichters bei ihrer ersten Begegnung – »als Privatdetektiv engagieren?«
»Ganz genau.«
»Aber ich bin kein Detektiv, Don Pablo. Zumindest noch nicht«, fügte er mit einem flüchtigen, hilflosen Lächeln hinzu. »Schlimmer noch: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ein Detektiv so macht.«
Die Hände des Dichters langten zu einem kleinen Tisch und griffen nach ein paar Büchern mit roten Kunststoffeinbänden. »Hast du schon einmal George Simenon gelesen?« Er sah ihn mit einem schelmischen Blick an, der seine Wangen glättete, und legte seine Stirn in Falten. »Das ist ein großartiger belgischer Autor von Kriminalromanen.«
»Nein, bisher noch nicht, Don Pablo.« Er schämte sich für seine kümmerliche literarische Bildung, und da er annahm, diese Ignoranz könne seinen Gastgeber beleidigen, entschuldigte er sich auf der Stelle. »Es tut mir leid. Ich kenne nur ein paar Romane von Agatha Christie und von Raymond Chandler, und natürlich Sherlock Holmes …«
»Dann ist es höchste Zeit, dass du den Belgier liest«, sagte der andere mit Nachdruck. »Denn wenn die Poesie dich in den Himmel hebt, dann zeigt dir der Kriminalroman, wie das wirkliche Leben ist, er macht deine Hände schmutzig und schwärzt dir das Gesicht wie die Kohle dem Heizer in den Zügen des Südens. Ich werde dir die Bände leihen, damit du etwas von Kommissar Maigret lernst. Ich rate dir davon ab, Poe zu lesen, den Erfinder der Detektivgeschichte und großen Dichter, und Conan Doyle, den Schöpfer von Sherlock Holmes, solltest du besser auch nicht lesen. Weißt du, warum nicht? Weil ihre Detektive viel zu verschroben und vergeistigt sind. Hier, in unserem chaotischen Lateinamerika, könnten sie nicht einmal den einfachsten Fall lösen. In Valparaíso würden ihnen die Taschendiebe im Trolleybus das Portemonnaie klauen, die Jungs von den Hügeln würden sie mit Steinen bewerfen, und die Straßenköter würden sie mit gefletschten Zähnen durch die engen Gassen jagen.«
Das hörte sich alles ziemlich absurd an. Ein Detektiv wider Willen, der sein Handwerk obendrein noch aus Kriminalromanen lernte? Wenn er das jemandem erzählte, würde man ihn sofort für verrückt erklären. Nicht nur den Dichter, auch ihn selbst.
»Nimm die Bücher mit und lies sie«, fügte Don Pablo gebieterisch hinzu und stopfte sie mit einigen Schwierigkeiten in einen Netzbeutel.
Zu einem Nobelpreisträger sagt man nicht Nein, erst recht nicht zu einem kranken Nobelpreisträger, dachte Cayetano, als er den Beutel entgegennahm. Es waren sechs schmale Bände, ziemlich leicht, mit Einbänden aus rotem Kunststoff und transparenten Schutzumschlägen, die sich angenehm anfühlten. Etwas aus ihnen zu lernen war allerdings eine ganz andere Sache. Zumindest würde ihm der Beutel für die Ration Fleisch beim JAP, dem Komitee für die Lebensmittelverteilung, nützlich sein, wenn es denn überhaupt etwas gäbe, denn Rindfleisch und Geflügel hatte er dort schon seit Wochen nicht mehr gesehen, genauso wenig wie Butter, Speiseöl oder Zucker. Und die Schwarzmarktpreise waren eine Frechheit.
»Wen soll ich finden?«, hörte er sich fragen, als gehörte seine Stimme einem anderen.
»Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Cayetano«, sagte der Dichter dankbar und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Er schleuderte seine Hausschuhe gegen die Wohnzimmertür, um sicherzugehen, dass sie von niemandem bespitzelt wurden. »Deshalb bitte ich dich, mir jetzt gut zuzuhören; ich werde versuchen, dir die Angelegenheit in wenigen Worten zu erklären …«
4
»Es handelt sich darum, einen Landsmann von dir zu finden, jemanden, mit dem ich befreundet war und dessen Spur ich vor langer Zeit verloren habe«, sagte der Dichter mit seiner ruhigen, nasalen Stimme und einem zuversichtlichen, aber auch eindeutig kindlichen Glanz in den Augen.
»Ich hab schon lange keinen Fuß mehr auf kubanischen Boden gesetzt«, wandte Cayetano ein. »Ich bin als Jugendlicher von dort weggegangen.«
»Ich bin nicht so einfältig zu glauben, dass du alle deine Landsleute kennst, aber die Tatsache, dass du Kubaner bist, kann dir die Aufgabe erleichtern. Du wirst schon sehen. Ich habe monatelang darüber nachgedacht, vor allem, seit es in Paris mit meiner Gesundheit bergab ging. Ich wollte mich erst an Genossen in der Partei wenden, sogar an einen guten Freund von der Botschaft in Havanna, aber dann habe ich den Gedanken verworfen, denn in diesen Zeiten wäre es mir nicht so recht, wenn gewisse Dinge durchsickern würden. Du weißt schon, die Politik …«
Cayetano Brulé betrachtete den Dichter. Er wusste nicht, was er sagen sollte.
»Du fragst dich jetzt sicher, warum ich einem Fremden vertraue«, fuhr der Dichter fort, »und die Antwort lautet ganz einfach: aus Intuition. Als ich vor kurzem bei einem Treffen mit Genossen hier im Haus von dir hörte, sagte ich mir: Das ist die Person, die ich brauche. Er kennt niemanden in Chile, und deshalb bleibt ihm nichts anderes übrig, als diskret zu sein. Außerdem ist er Kubaner und kann die Insel besuchen, ohne Verdacht zu erregen. Und da er derzeit ohne Beschäftigung ist, käme ihm ein solcher Auftrag bestimmt nicht ungelegen.«
»Deshalb sind Sie am Sonntag während des Essens zu mir in die Bibliothek gekommen, nicht wahr?«
»Ganz genau! Und das habe ich vorsätzlich und voller Heimtücke getan.«
Cayetano lächelte gezwungen. Seine Hände schwitzten, während die Füße des Dichters weiterhin in Wollsocken gezwängt auf einem Schemel aus weißem Leder ruhten. Er würde ihm kaum helfen können, dachte Cayetano, aber wenn er es nicht wenigstens versuchte, wäre der Dichter so schwer von ihm enttäuscht, dass er nie mehr ein Wort mit ihm wechseln würde. Es wäre nicht gut, einfach so die Freundschaft mit einem Dichter von solcher Größe aufs Spiel zu setzen, auch wenn sie noch ganz am Anfang stand. Auf irgendeine Weise riefen dessen melancholische Augen und lange Koteletten die Erinnerung an seinen Vater in ihm wach, den Trompeter in einem Orchester für tropische Tanzmusik, Freund der Boheme und liebenden Familienvater, der in den Fünfzigern nach einem Konzert in der verschneiten Bronx gestorben war, wo er über Jahre für Xavier Cugat und sogar für Beny Moré höchstpersönlich gespielt hatte, den großen Meister des Rhythmus, der »Hoy como ayer« sang und tanzte, als hätte man ihn statt mit Milch mit Conga- und Boleromusik gestillt. Nach dem Tod des Vaters bei einem ungeklärten nächtlichen Zwischenfall in der Canal Street war Kuba für Cayetanos Mutter, die sich ihr Geld mit Näharbeiten in Union City verdiente, in weite Ferne gerückt.
»Wie heißt der Kubaner, Don Pablo?«
»Wenn du Details wissen willst, musst du mir zuerst versprechen, dass du deine Arbeit mit äußerster Diskretion erledigst.«
»Sie können mir vertrauen, Don Pablo. Ich werde Ihr … Ihr persönlicher Maigret sein.«
»Das wollte ich hören, junger Mann«, erwiderte der Dichter begeistert, dann richtete er den Blick auf seine Bar mit den rötlichen Wänden und der Bronzeglocke und fragte: »Hast du Lust auf einen Whisky on the rocks? Einen richtig guten, mindestens achtzehn Jahre alt. Du solltest wissen, dass ich der beste Barkeeper Chiles bin. Möchtest du lieber einen doppelten oder einen dreifachen?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er zur Bar. Er stellte sich hinter die Theke, nahm ein Glas, schüttete Eiswürfel hinein und schenkte dann großzügig aus einer Flasche Chivas Regal ein. Vielleicht ist das nicht gerade die beste Art, den Tag zu beginnen, dachte Cayetano, der noch chinesische Schweinefleischkonserven beim JAP besorgen musste, aber schließlich wurde einem Sterblichen wie ihm nicht jeden Tag ein so erlesener Drink von einem Nobelpreisträger zubereitet – der ihn darüber hinaus als Privatdetektiv engagiert hatte.
»Ich werde derzeit im Krankenhaus Van Buren behandelt und kann deshalb leider nicht mit dir anstoßen«, sagte der Dichter, sog verzückt den Duft des Whiskys ein und reichte ihm anschließend das Glas. »Obwohl ich mir manchmal nachts, wenn ich das Verlangen spüre, das eine oder andere Gläschen Portwein genehmige, ohne dass Matilde etwas mitbekommt. Wenn sie mich ertappt, jammert sie furchtbar, dabei weiß man doch, dass es keine bessere Medizin als Portwein gibt. Ein kleiner Portwein wird mir schon nicht schaden, meinst du nicht auch?«
Während die Eiswürfel in seinem Glas klirrten, fragte sich Cayetano, wie er diesem Mann einmal so mürrisch hatte begegnen können. Jetzt ließ ihn die Sympathie, die der Dichter in ihm weckte, einfach nur den Drang verspüren, das in ihn gesetzte Vertrauen zu erwidern.
»Wenn Sie nicht übertreiben, Don Pablo, wird es schon in Ordnung sein …«
»Keine Sorge, junger Mann, inzwischen reizen mich Ausschweifungen dieser Art nicht mehr.« Seine Äuglein musterten Cayetanos Gesicht. Eine Möwe flog mit ausgebreiteten Flügeln und eingezogenen Füßen am großen Fenster vorbei, bewegte dabei ihren Kopf hin und her und schlug krächzend Alarm. Sie landete auf einem nahen Dach, um anschließend wieder zum Strand zurückzukehren, so als würde sie auf einen Weg verweisen.
Cayetano spürte, wie ihm der erste Schluck wie Feuer in den Eingeweiden brannte. Er war es nicht gewohnt, schon am Morgen zu trinken.
»Na, wie schmeckt er?«, fragte der Dichter.
»Ausgezeichnet, Don Pablo.« Das war das Mindeste, was er sagen konnte.
»Ich habe noch nie versagt. Ein Dichter, der nichts von Essen und Trinken versteht, ist kein Dichter.«
Cayetano stellte das Glas auf der Theke ab, direkt unter der bronzenen Glocke. »Nun. Wie heißt er?«
»Chivas. Chivas Regal. Achtzehn Jahre alt.«
»Nein, Don Pablo. Wie heißt der Kubaner, den ich finden soll?«
»Ángel. Doktor Ángel Bracamonte.«
»Nie gehört«, bemerkte Cayetano, und als er das sagte, glaubte er einen Ausdruck plötzlicher Enttäuschung im Gesicht des Dichters wahrzunehmen.
Doch der sprach einfach weiter.
»Ich habe ihn 1940 in Mexiko-Stadt kennen gelernt, als ich dort Konsul war. Er war Onkologe und erforschte die Eigenschaften von Heilkräutern, die die Indianer in Chiapas verwendeten, um Krebs zu bekämpfen. Bracamonte muss ungefähr so alt sein wie ich, vielleicht etwas älter. Ich habe ihn 1943 aus den Augen verloren, nachdem ich mit Delia del Carril, meiner damaligen Frau, nach Chile zurückgekehrt bin. Vielleicht lebt er noch immer in Mexiko.«
Dann waren die Gerüchte also wahr: Der Dichter hatte Krebs. Das Puzzle setzte sich zusammen. Der krebskranke Don Pablo vertraute darauf, dass er den kubanischen Onkologen finden und dieser ihn heilen würde, dachte Cayetano, während er den Rest seines Glases in einem Zug leerte, um sich Mut zu machen. Also war der Krebs die Erklärung für seine Erschöpfungszustände, die unruhige Atmung, seine auffälligen Augenringe und sein wachsfarbenes Gesicht. Vielleicht würde er sein Amt als Botschafter in Paris nie wieder antreten können und hier auf heimischer Scholle sterben, in Allendes revolutionärem Chile, für das er gekämpft hatte. Während Cayetano sich das vorstellte, sah er durch das große Fenster zu seinem Haus in der Siedlung Marina Mercante hinüber, das sich mit seinen ledrig-gelben Mauern unter dem verwaschenen Winterhimmel am Hügel gegenüber abzeichnete.
»Entschuldigen Sie, Don Pablo, aber glauben Sie nicht, dass es genügt, eine Anzeige im Excelsior zu schalten, um Bracamonte am nächsten Tag am Telefon zu haben? Mit seiner Gesundheit sollte man nicht spielen.«
»Und wer hat gesagt, dass es um meine Gesundheit geht?«, fragte Don Pablo, in dessen Gesicht sich eine kaum verhohlene Anspannung zeigte.
»Na, weil er doch Arzt ist …« In diesem Moment begriff er, dass der Dichter ihm das Motiv für die Suche aus Anstand verheimlichen wollte. Er war jung, aber nicht naiv. Es gab keine naiven Menschen auf Kuba. Es gab dort dumme, freche und opportunistische Menschen, und das zu Tausenden, aber keine naiven. Es war völlig klar, dass der Dichter den Onkologen und seine Kräuter brauchte, um seine Krankheit zu besiegen.
»Ich suche ihn nicht wegen meiner Gesundheit. Vermutlich befindet er sich in Mexiko. Ich will, dass du ihn findest und mir dann Bescheid gibst, aber hör mir gut zu«, erklärte der Dichter ernst und deutete mit dem Zeigefinger auf ihn. »Erwähne diese Sache niemandem gegenüber auch nur mit einem Wort! Gegenüber niemandem! Nicht einmal gegenüber ihm selbst! Wenn du seinen Aufenthaltsort in Erfahrung gebracht hast, dann darfst du das nur mir erzählen. Danach sage ich dir, wie es weitergeht. Hast du mich verstanden?«
»Vollkommen.«
»Denk daran, einen Dichter täuscht man nicht so leicht. Erst recht keinen kranken.«
»Soll ich mit meinen Nachforschungen in der mexikanischen Botschaft anfangen, Don Pablo?«
»Von wegen in Botschaften herumschnüffeln wie ein Bibliothekar, Cayetano! Du machst jetzt Folgendes: Du nimmst ein Flugzeug nach Mexiko-Stadt und beginnst dort mit den Nachforschungen. Ich will, dass du Dr. Ángel Bracamonte so schnell wie möglich findest!«
5
Da es keine freien Plätze mehr gab, konnte er nicht sofort nach Mexiko fliegen. Er beschloss, die Zeit mit den Romanen Simenons totzuschlagen – deren Charaktere, die sich durch die Gassen, Bistros und Märkte von Paris bewegten, ihn auf Anhieb fesselten – und damit, Leute ausfindig zu machen, die ihm etwas über den Dichter erzählen konnten, etwas, das über das hinausging, was allgemein über ihn, seine Reisen und seine Liebschaften bekannt war. Er würde sich um einiges wohler fühlen, wenn er mehr über ihn wüsste, denn ihm war klar geworden, dass Neruda jemand war, der bestimmte Facetten seines Lebens verbarg wie der dichte Küstennebel im Frühling die Treppen und Aufzüge Valparaísos. Natürlich ging er bei seinen Nachforschungen behutsam vor. Niemand durfte eine Ahnung bekommen, womit ihn der Dichter beauftragt hatte. Sein Misstrauen, das er wie einen Stachel in seiner Brust spürte, kam ihm schäbig vor, doch er musste mehr über den Künstler erfahren und würde dieselbe Methode wie der eifrige Maigret anwenden, der sogar seine zuverlässigsten Informanten und engsten Kollegen skrupellos bespitzelte.