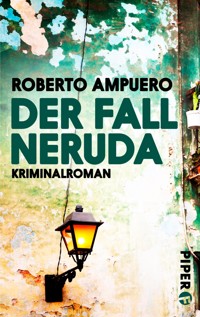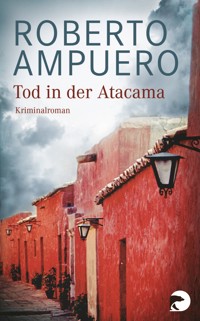11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als am Morgen des 11. Septembers 1973 der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Augusto Pinochet, nicht auf seinen Anruf reagiert, ahnt Salvador Allende, dass seine Stunden als Präsident gezählt sind: Der Putsch steht bevor. Sein Koch und persönlicher Assistent, Rufino, hält die dramatischen Ereignisse in einem Tagebuch fest — und erzählt darin ihre gemeinsame Geschichte, von den abendlichen Gesprächen über das Leben, die Liebe und den Tango, von Allendes Liebschaften und den Sorgen um das Land. Jahrzehnte später gelangen diese Aufzeichnungen in die Hände von David Kurtz, einem ehemaligen CIA-Agenten. Wird es ihm mit ihrer Hilfe gelingen, den chilenischen Geliebten seiner Tochter aufzuspüren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Den Opfern der politischen Gewalt des letzten halben Jahrhunderts in Chile, Vaterland aller, in dem kein Mensch entbehrlich ist.
Übersetzung aus dem Spanischen von Carsten Regling
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-8270-7591-8
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel
El último tango de Salvador Allende
bei Random House Mondadori, Santiago de Chile
© 2011 Roberto Ampuero
Für die deutsche Ausgabe
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2013
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz und eBook: hanseatenSatz-bremen, Bremen
Fiktion? Realität? Auch wenn sich dieses Buch auf die bewegte jüngere Geschichte Chiles und ihre eingehende Untersuchung durch den Autor stützt, so ist es doch ein Roman, und dementsprechend sollte es gelesen werden.
Ich weiß, ich habe so viele Dinge verloren, dass ich sie nicht zählen könnte, und dass diese Verluste heute das sind, was mir gehört.
Besitz des Gestern
Jorge Luis Borges
1
Die weiße Pelerine flattert im morgendlichen Wind, als der Doktor über die schmalen Gassen, Durchgänge und Treppen schwebt, die sich bis zum Pazifik hinunterschlängeln. Er passiert die rostigen, im Hafen vertäuten Schiffe, setzt seinen luftigen Weg bis zu den bunten Fischen im Brunnen auf der Plaza Echaurren fort und bestaunt aus der Höhe nicht nur die großen Blätter der hundertjährigen Palmen und die tosende Brandung an den bereits von der rauen Strenge der hügeligen Landschaft kündenden Felsen, sondern auch den weiten Bogen, den sein eigener Flug beschreibt.
Obwohl ihm die Höhe seit der Kindheit Schwindel bereitet und er das Gefühl hat, als schwirrten Kolibris in seinem Magen herum, bringt ihn der Anblick eines Schwarms dicht über dem Wasser dahingleitender Pelikane zum Lächeln. Der Doktor atmet begierig den Geruch der Algen ein und setzt seinen Flug bis zur La-Matriz-Kirche fort, wo er versucht, seine Gamsledermokassins neben dem Glockenturm aufzusetzen, dessen Holzkreuz seit dem letzten Erdbeben schief steht.
Seine Absicht, auf den Dachziegeln zu landen, wird durch das peitschende Geräusch der aufflatternden Tauben zunichte gemacht. Es dauert eine Weile, bis er begreift, dass der Grund für sein Scheitern nicht die Vögel sind, sondern das Läuten des Telefons, nach dem er jetzt im dunklen Schlafzimmer tastet. Der Wecker auf dem Nachttisch zeigt vier Minuten vor fünf an. Es ist der Morgen des 11. September 1973. Er hält den Hörer ans Ohr.
»Verdächtige Bewegungen der Marine in Valparaíso«, verkündet eine Stimme.
Der Doktor knipst die Nachttischlampe an und setzt sich die Brille auf, fest davon überzeugt, dass er den Tag nicht überleben wird. Er ist allein in seinem Schlafzimmer in der Avenida Tomás Moro 200 in Santiago de Chile, weit entfernt von seinem Heimathafen Valparaíso, in einem Zimmer, das eher an die karge Zelle eines Franziskanermönches erinnert. Es grenzt unmittelbar an die Bibliothek, wo ihn das marmorne Schachbrett und – direkt neben der Tür zu der Terrasse mit den maurischen Fliesen und dem Schwimmbecken mit dem ausgestopften Krokodil – seine geliebte Sammlung präkolumbischer Keramik erwarten. Er bleibt völlig ruhig, denkt an das sanfte Lächeln seiner Frau, die in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss schläft. Er stellt sich Hortensias tiefen, rhythmischen Atem vor. Er stellt sich vor, wie sie träumt, sie wären wieder frisch verheiratet. Er stellt sich vor, wie sie träumt, wieder das Bett mit ihm zu teilen. Er weiß, in seinen Erinnerungen wird sie für immer die blasse, schwarzhaarige Schönheit bleiben, deren blaue Augen ihn vor mehr als vierzig Jahren verzauberten, an jenem Abend, als er bei einem Erdbeben in Santiago panisch aus einem Freimaurertempel hinaus auf die Straße gerannt war.
»Etwas genauer bitte«, sagt der Doktor in den Hörer. Seit er vor drei Jahren zum Präsidenten gewählt wurde, vergeht kaum ein Tag ohne ein Gerücht über einen bevorstehenden Militärputsch.
»Gestern Abend ist die Kriegsmarine ausgelaufen, um an dem traditionellen Manöver mit der amerikanischen Flotte teilzunehmen«, erklärt die Stimme am anderen Ende.
»Das habe ich selbst genehmigt«, erwidert der Doktor und reibt seine Füße in der wohligen Wärme unter den Laken aneinander.
»Ja, aber die Flotte ist wieder da«, fügt die jetzt zitternde Stimme hinzu. »Im Dunkeln sind die Schiffe kaum zu erkennen, aber sie liegen in der Bucht und zielen auf die Stadt. Sie können uns jederzeit unter Beschuss nehmen.«
»Noch etwas, Genosse?« Der Doktor steigt aus dem Bett und schlüpft vor dem Kleiderschrankspiegel, der ihm die leichte Wölbung seines Bauches und seine mageren, blässlichen Oberschenkel vor Augen führt, aus dem Pyjama.
»An den Kreuzungen der Innenstadt haben Marineeinheiten Stellung bezogen. In Kampfmontur …«
»Haben Sie sich beim Marinekommando erkundigt?« Nachdem er den Lautsprecher am Telefon eingeschaltet hat, bückt sich der Doktor nach der Unterhose von gestern und streift sie über, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Schnell nimmt er eine Hose, ein Hemd und einen Pullover mit Rautenmuster aus dem Schrank und zieht sich in aller Eile an.
»Bei der Marine geht niemand ran, Doktor.«
»Und das Verteidigungsministerium?«
»Auch nicht.«
»Was ist mit den Oberbefehlshabern?« Er schlüpft in ein Paar schwarze Schuhe.
»Da geht auch keiner ran, nicht mal zu Hause.«
»Ich fahre zum Regierungspalast.« Der Doktor legt auf und alarmiert über die Sprechanlage die Leibwächter.
Er rasiert sich auf die Schnelle, nimmt ein Tweedsakko vom Bügel und begibt sich in die Bibliothek, wo er nach der Kalaschnikow greift, die Fidel Castro ihm einst geschenkt hat. Im Halbdunkel der Küche stürzt er einen Schluck kalten Kaffee hinunter und eilt nach draußen, wo vier blaue Fiat 125 und ein Lieferwagen die Motoren warm laufen lassen. Laut röhrend verlässt die Karawane das Grundstück. Kurz bevor die Wachposten das Tor schließen, wirft der Doktor einen letzten Blick auf die in der Dunkelheit verschwindende weiße Villa mit dem Ziegeldach und den zwei Palmen, die den Hauseingang säumen und über den Lauf der Zeit zu wachen scheinen.
2
In a gadda da vida, honey
Don’t you know that I’m lovin’ you
In a gadda da vida, baby
Don’t you know that I’ll always be true.
In-A-Gadda-Da-Vida
Iron Butterfly
»Und das, Señor?«
Der Zollbeamte am Flughafen von Santiago de Chile hielt mir das kleine graue Plastikgefäß vor die Nase.
»Asche«, erwiderte ich gelassen.
Der Beamte schraubte den Deckel auf.
»Asche?« Er betrachtete den Inhalt. »Gehört das Ihnen?«
»Ja.«
»Würden Sie mir bitte folgen?«
Ich folgte ihm. Ein Vierteljahrhundert zuvor war ich zum ersten Mal in dieses Land gereist, ohne dass mein Gepäck kontrolliert worden wäre. Die Jungs von der Botschaft hatten sich um alles gekümmert. Jetzt schiebe ich meine Koffer an den Schlangen der wartenden Passagiere vorbei, bis wir in ein Büro gelangen. Der Beamte fordert mich auf, Platz zu nehmen, und verlässt mit meinen Dokumenten das Zimmer.
Wenige Minuten später führt er mich zu einem Mann in Anzug und Krawatte, der gelangweilt vor einem Computer sitzt. Wahrscheinlich hat er gerade in einer Interpoldatei meine Vorgeschichte überprüft. Auf seinem Schreibtisch steht das Gefäß.
»Können Sie mir erklären, was das ist?«
»Asche.«
»Asche?« Sein Blick verrät Misstrauen.
»Genau.«
»Asche von was?«
»Von Victoria«, erkläre ich.
Er räuspert sich verlegen, nestelt an seinem Krawattenknoten herum und wirft einen mitleidigen Blick auf den Behälter, bei dem es sich genau genommen um eine kleine elfenbeinfarbene Urne handelt.
»Wer ist Victoria?« Er zieht ein Taschentuch hervor und schnäuzt sich lautstark. Der schnurgerade Scheitel, der sein Haar teilt, gleicht einer Furche in einem pechschwarzen Acker.
»Meine Tochter.«
»Ihre Tochter?«
»Ja.«
»Haben Sie eine Bescheinigung?«
Ich suche die Jackentaschen ab und reiche sie ihm. Ein weiterer Beamter betritt das Büro.
»Keine Sorge, das ist reine Routine«, erklärt der Typ hinter dem Computer, während der andere das Gefäß nimmt und wieder aus dem Raum geht. »Was wollen Sie mit der Asche Ihrer Tochter in Chile?«
»Sie hat eine Zeit lang hier gelebt.« Meine Augen werden feucht. »Eine glückliche Zeit.«
»Ich verstehe.« Er sieht mich nachdenklich an. Dann gibt er etwas in den Computer ein.
Eine Stunde später durfte ich mit meinem Gepäck durch den Zoll. An einem Tisch im Café der Kette Au Bon Pain packte ich die Urne zurück in meinen Handkoffer zu dem Schulheft mit dem Porträt von Vladimir Iljitsch Lenin, dem Spanisch-Englisch-Wörterbuch von Langenscheidt und den anderen Büchern und verließ das Flughafengebäude auf der Suche nach einem Taxi, das mich zu meinem Hotel bringen würde.
3
De mis páginas vividas
siempre guardo un gran recuerdo;
mi emoción no las olvida,
pasa el tiempo y más me acuerdo.
Tres amigos
Domingo Enrique Cadícamo, Rosendo Luna
Es war ein milder Morgen im Jahr 1971, als der Präsident unser Viertel besuchte. Alle rannten auf die Straße, um ihn mit roten und grünen Fahnen, Pauken und Trompeten und viel Getöse zu begrüßen. Er kam in einer Karawane aus blauen, tiefer gelegten Fiats mit breiten Reifen, die bei ihrer Ankunft Staub aufwirbelten, laut röhrten wie Rennwagen und den Kindern aufgeregte Schreie und den Hunden fröhliches Gebell entlockten.
Der Präsident, der auf dem Rücksitz eines der Autos gesessen hatte, stieg aus. Er trug eine Lederjacke mit einem schwarzen Rollkragenpullover darunter. Die Anwohner brüllten im Chor seinen Namen und stürmten auf ihn zu, um ihn zu berühren, ihm die Hand zu schütteln, etwas zu schenken oder eine Bitte an ihn zu richten, während die hoch aufgeschossenen, Anzug, Krawatte und dunkle Sonnenbrillen tragenden Leibwächter ihn umringten und die Leute daran zu hindern versuchten, ihm allzu nahe zu kommen.
Ich werde diesen Morgen nie vergessen. Die Hitze, meine Aufregung, der blaue Himmel, das tiefe Glück, das wir alle empfanden. Ich kann mich noch an jede Einzelheit erinnern, den Duft der trockenen Erde, den Schweiß der Leute, die Musik auf der Straße; und weil ich Angst habe, eines Tages all das zu vergessen, schreibe ich es in diesem in der Sowjetunion gedruckten Schulheft mit Lenins Abbild auf. Die Hefte werden an den staatlichen Schulen verteilt, da es schon seit einiger Zeit kaum noch Papier gibt. Meins habe ich von einem Nachbarn im Tausch gegen sechs Empanadas bekommen. Von der Tür der Bäckerei aus sah ich dem Empfang des Präsidenten zu. Ich trug Schürze, Mütze und Leinenschuhe, und mein Gesicht war weiß von Mehl, weshalb ich mich nicht traute, zu ihm zu gehen.
Auf einmal drehte sich der Präsident um und ging in die entgegengesetzte Richtung auf einen Lieferwagen zu, auf dessen Ladefläche eine Folkloregruppe in schwarzen Ponchos sang und wo er später eine Rede halten würde, in der es darum ging, dass die Arbeiter die Produktion in den Betrieben aufrechterhalten müssten.
Er verteilte hier einen Händedruck, da ein aufmunterndes Wort, ging mit geradem Rücken und erhobenem Haupt, während die Leute ihn hochleben ließen und die Kinder und Hunde zwischen den Beinen der Erwachsenen herumtollten.
»Was macht die Brotproduktion, Genosse?«, fragte mich der Präsident und kam auf mich zu; vielleicht hatte ihn die strahlend weiße Bäckerkleidung oder der Duft von warmem Brot angelockt. Er drückte mir die Hand und umarmte mich, bis seine elegante Lederjacke weiß von Mehl war.
»Ich backe gerade das Brot fürs Mittagessen, aber ob es noch welches zum Abendessen gibt, weiß ich nicht«, erwiderte ich, während ich ihm unter den misstrauischen Blicken der Leibwächter das Mehl vom Revers klopfte.
»Und was sollen die Genossen am Nachmittag zum Tee essen?«, fragte er mich ernst.
»Nur Tee, sonst nichts, Herr Präsident. Wenn die Läden überhaupt noch Tee haben.«
»Kein Brot?«
»Aber wenn es doch kein Mehl mehr gibt, Herr Präsident. Womit soll ich denn den Teig kneten?«, antwortete ich freiheraus, doch ohne es an dem nötigen Respekt fehlen zu lassen. Im gleichen Moment stieß mich einer der Leibwächter unauffällig mit dem Ellbogen in die Rippen.
»Wir müssen etwas gegen den Schwarzmarkt unternehmen, Genosse«, erklärte der Präsident. »Sonst nutzt der Feind das aus und macht uns fertig.«
»Erinnern Sie sich nicht mehr an mich, Herr Präsident?«
Er schob den Leibwächter, der zwischen uns getreten war, zur Seite und heftete seine kleinen, lebhaften Augen auf mich. Hinter den dicken Gläsern seiner schwarzen Brille konnte ich deutlich seine kaffeebraunen Pupillen erkennen.
»Wie heißt du?«, erkundigte er sich inmitten der Hochrufe und Rempeleien der Anwohner, während ihm eine alte Frau eine frittierte Empanada hinhielt und ein blinder Akkordeonspieler ihm einen Brief in die Hand drückte.
Ich nannte meinen Namen, aber er zeigte keine Reaktion. Schlimmer noch, ich hatte den Eindruck, dass er im Grunde nur seinen Weg fortsetzen und zu dem Lastwagen gehen wollte, auf dem gerade das Konzert der Charangos, Pauken und indianischen Flöten zu Ende ging. Schnell fügte ich hinzu:
»Erinnern Sie sich nicht an Juan Demarchi?«
»Den anarchistischen Schuster?«, fragte der Präsident überrascht.
»Genau den.«
»Natürlich erinnere ich mich«, rief er mir winkend zu, während ihn die Menge fortriss. »Das war der Lehrmeister meiner Jugend. Er hatte seine Werkstatt auf dem Cerro Cordillera in Valparaíso.«
»Ich bin der Cachafaz«, schrie ich aus voller Lunge und mit einer gehörigen Portion Stolz. »Können Sie sich jetzt erinnern?«
Der Präsident war zu einem Schiffbrüchigen geworden, der immer weiter abgetrieben und von der Strömung zu der improvisierten Bühne mitgerissen wurde. Ich blieb unter dem Baum stehen, der meiner Bäckerei Schatten spendete. Erst viel später, als ich das Brennholz für den nächsten Backgang schichtete, trat ein Mann in Anzug und Krawatte und einer Sonnenbrille auf der Nase vor meinen Tresen und fragte nach dem Cachafaz.
»Zu Ihren Diensten.« Ich klopfte mir das Mehl von den Händen.
»Ich habe eine Nachricht des Präsidenten für Sie«, verkündete der Mann gelassen. Ich spürte mein Herz bis zum Hals schlagen. »Er erwartet Sie am nächsten Montag um sechs Uhr abends im Regierungspalast.«
4
What would you think if I sang out of tune,
would you stand up and walk out on me?
Lend me your ears and I’ll sing you a song.
And I’ll try not to sing out of key.
A Little Help From My Friends
The Beatles
»Papa? Bist du da?«, fragte Victoria.
Ich hatte mehrere Stunden am Bett meiner Tochter im Abbott Northwestern Hospital in Minneapolis gewacht. Tom, mein Schwiegersohn, war nach Hause gefahren, um sich zu duschen, umzuziehen und den Hund auszuführen, nachdem er mehrere Tage hintereinander bei seiner im Sterben liegenden Frau verbracht hatte.
»Ich bin bei dir«, antwortete ich und trat ans Kopfende des Bettes, überrascht, dass Victoria, die über Schläuche und Sensoren mit verschiedenen Apparaten verbunden war, das Bewusstsein zurückerlangt hatte. Ich nahm ihre Hand und betrachtete ihr fahles, eingefallenes Gesicht, unter dem bereits der Totenschädel durchschimmerte.
»Wie schön …«, murmelte Victoria mit geschlossenen Augen.
»Brauchst du etwas, mein Schatz?«
Sie schluckte mühevoll und presste ihre rissigen Lippen aufeinander. Ich trug etwas Kakaobutter auf, und als ich ihr einen Kuss auf die schweißbedeckte Stirn gab, huschte ein schwaches Lächeln über ihr Gesicht, obwohl die unscheinbare Geste kaum als ein Lächeln zu bezeichnen war. Dann wandte sie den Blick zum Fenster, zu den Seen des Mittleren Westens, die wir damals, in den Sommern ihrer Kindheit, erkundet hatten, auf die endlose Weite des Graslandes, das sich in der Ferne unter dem Schnee abzeichnete.
»Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust«, flüsterte Victoria.
»Ich höre.«
»Aber das muss ein Geheimnis zwischen uns bleiben.«
Obwohl ich meine Gefühle nur selten zeige und meiner verstorbenen Frau zufolge ein unsensibler Mensch bin, der niemals weint, erschauderte ich.
»Natürlich. Worum geht es?« Ich spürte, wie die trockene Heizungsluft nur langsam in meine Lungen drang.
»Es geht um die Zeit nach meinem Tod.«
»Sag nicht so was, Liebling. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren.«
»Mach dir nichts vor, Papa.« Victoria öffnete die müden Augen, aus denen jeder Glanz und jede Hoffnung gewichen war. »Ich weiß, mir bleibt nicht mehr viel Zeit, deshalb möchte ich dir etwas sagen.«
Ohne ihre Hand loszulassen, ließ ich mich auf der Bettkante nieder. In der Ferne glaubte ich Trouble On Your Hands zu hören, und es kam mir vor, als hätten sich die Stimme des schwarzen Bluessängers und die sie begleitende Mundharmonika verschworen, um mich noch trauriger zu stimmen.
»Ich höre, Victoria …«
»Ich möchte, dass du mir einen Wunsch erfüllst.«
»Sag schon.«
»Etwas, wonach ich mich lange gesehnt habe, Papa. Du musst schwören, dass du ihn mir erfüllst.« Ihre grünen Augen starrten mich flehend an.
»Natürlich, sei unbesorgt. Ich tue alles, was du willst.«
»Schwörst du?«
»Ich schwöre.«
»Bei Mama?«
»Ich schwöre bei Mama.« Der Schwur schnürte mir die Kehle zu.
»Ich wusste, du lässt mich nicht im Stich.« Sie drückte meine Hand. »Es ist ganz einfach. Sobald ich tot bin und mein Körper eingeäschert wird, gehst du in den Keller bei mir zu Hause und holst eine Schatulle, die ich dort für dich hingestellt habe. Sie befindet sich hinter ein paar Lexika auf einem Metallbord gleich links unter der Treppe, auf Höhe deines Kopfs.«
»Eine Schatulle?«
»Ja, eine kleine Schatulle. Sie ist für dich. Du kannst sie holen, wenn Tom bei mir ist. Aber du darfst sie erst öffnen, wenn ich gestorben bin. Hörst du mich?« Sie schloss erneut die Augen.
»Ich bin bei dir«, stammelte ich.
»In der Schatulle befindet sich ein Brief mit Anweisungen. Die musst du befolgen.«
»Darf ich dich etwas fragen?«
»Nicht jetzt. Ich bin müde, Papa. Und du hast eine weite Reise vor dir.« Ihre fiebrige Stirn glänzte im Licht der Neonröhren.
»Was für eine Reise?«
»Du musst nach Chile fliegen.«
Ich war überrascht, den Namen dieses Landes am Ende der Welt noch einmal in meiner Familie zu hören.
»Erfüllst du mir meinen Wunsch? Im Brief steht alles, Papa«, fuhr sie fort.
»Natürlich«, antwortete ich, ohne meine Tränen unterdrücken zu können.
»Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann.« Victoria öffnete noch einmal die Augen und lächelte mir zärtlich zu. »Der Schlüssel für die Schatulle ist in meiner Handtasche.«
Ich nahm die Handtasche vom Nachttisch und wühlte so lange, bis meine Finger auf einen Metallring mit einem Schlüssel stießen.
»Ich habe ihn.« Ich steckte den Schlüssel in die Hosentasche. »Ich schwöre bei Mama, dass ich alles tun werde, worum du mich bittest.«
Es war das letzte Mal, dass ich sie lebend sah.
5
Ich packte mein Gepäck aus. Aber erst als ich den Brief meiner Tochter, das Heft mit dem Porträt von Lenin und das Schwarz-Weiß-Foto von Victoria und drei anderen, mir unbekannten jungen Leuten auf den Schreibtisch meines Hotelzimmers legte, atmete ich ruhiger. Ich dachte über den Weg vom Flughafen zum Hotel Los Españoles in Providencia nach.
Die chilenische Hauptstadt hatte sich gewaltig verändert, seit ich im September 1973 das letzte Mal hier gewesen war. Santiago – oder zumindest der Stadtteil, wo mein Hotel lag – hatte sich in eine moderne, prosperierende, fast fröhliche Metropole verwandelt, die aussah wie die Städte in der Ersten Welt. Das Santiago, in das ich im Januar 1970 als vermeintlicher Fotograf und Verkäufer von Fotoapparaten gekommen war, war niedrig, grau und rückständig gewesen. Die Einwohner waren bis aufs Blut zerstritten: Die einen wollten, dass Chile so weitermachte wie bisher, die anderen wünschten sich, inspiriert von der kubanischen Revolution, nichts sehnlicher, als die herkömmlichen Spielregeln auf drastische Weise zu verändern. Die Grube für die zukünftige Metro, die sich wie ein endloses Band durch Santiago zog, war damals die perfekte Metapher für die tiefe Spaltung des Landes.
In dieser Zeit begann das von gewaltigen sozialen Unterschieden und großer Chancenungleichheit geprägte Land den revolutionären Forderungen der Arbeiter und Bauern nachzugeben, ermuntert von einer Linken, die die alte Ordnung hinwegfegen und eine sozialistische Utopie errichten wollte. Ihr unumstrittener Anführer war Salvador Allende, ein Mann, der bei der politischen Mitte und der Rechten Misstrauen und Furcht hervorrief. Als ich zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter in Santiago eintraf und wir ein Haus französischen Stils in der Calle Pedro de Valdivia bezogen, befand sich das Land unmittelbar vor den Präsidentschaftswahlen, die Allende schließlich am vierten September gewinnen sollte. Dieser Arzt mit Schnurrbart und schwarzer Hornbrille weckte grenzenlose Erwartungen bei den Armen, die eine Verstaatlichung der Kupferminen und die Enteignung von Fabriken, Banken und Ländereien forderten. Das wiederum löste Panik bei den Wohlhabenden und in Washington aus, wo man besorgt war, das Land könnte sich mit der Sowjetunion verbünden und zu einem zweiten Kuba werden. Um das zu verhindern, schickte die Firma Hunderte von getarnten Experten nach Chile, unter anderem mich. Aber jetzt, mehr als zwanzig Jahre nach meiner klammheimlichen Abreise – sagte ich mir, während ich am Schreibtisch saß und auf die von Bäumen gesäumte Straße hinuntersah –, war ich weder in dieses Land zurückgekehrt, um seine Politik zu analysieren, Agenten anzuwerben oder die amerikanische Botschaft zu beschützen, die heute ein Granitbunker am Río Mapocho war, noch, um irgendwen davon zu überzeugen, dass ein Sozialist am Aufstieg an die Macht gehindert werden musste.
Ich öffnete eine Flasche Scotch, lockerte den Krawattenknoten, lehnte mich im Bett zurück und trank mit zitternden Händen einen Schluck, während ich noch einmal das alte Foto betrachtete, das Victoria zusammen mit einigen vermutlich chilenischen Freunden zeigte. Im Moment der Aufnahme, 1972 oder ‘73, war sie etwa neunzehn, zwanzig Jahre alt und studierte Archäologie an der Universidad de Chile. Ich war damals nicht viel älter als vierzig, meine hübsche Audrey lebte noch. Wir führten eine glückliche Ehe, auch wenn ich mich die meiste Zeit um die Belange der Firma kümmern musste, eine Laufbahn, die mich faszinierte, seit ich in meiner Kindheit in Minnesota die ersten Filme über den Zweiten Weltkrieg gesehen hatte.
Auf dem Foto lächelt Victoria. Sie hat sanfte Augen, einen großen Mund und volle Lippen. Sie neigt den Kopf zur Seite, so dass ihr langes blondes Haar auf eine ihrer Schultern fällt. Ich mag es, wie sie auf dem Bild aussieht. Sie ist die Schönste von den Vieren. Sie trägt einen Parka und strahlt Sorglosigkeit aus, genau wie ihre Begleiter: eine junge Frau mit einem breitkrempigen Hut à la Joan Báez und zwei junge Männer mit dunkler Mähne, mediterranem Aussehen und Jacken mit hochgeklapptem Kragen. Sie machen Späße vor der Kamera eines unbekannten Fotografen, der nicht die richtige Einstellung und Schärfe findet, in einer Straße, die ich nicht kenne.
Wahrscheinlich sind es Kommilitonen von der Universität; für Schüler des Nido de Águilas, dieser exklusiven Privatschule, auf der Victoria ihr letztes Schuljahr verbracht hatte, sehen sie zu alt aus. Nach der Schule hatte sie begonnen, Archäologie an der Universidad de Chile zu studieren, was für Audrey und mich ziemlich überraschend kam. Wir hätten es lieber gesehen, wenn sie nach Minnesota zurückgekehrt oder nach Virginia gezogen wäre, in die Nähe des Headquarters der Firma.
Ich kann mich erinnern, dass der Fachbereich für Anthropologie und Archäologie in einer alten, zweistöckigen Villa im Stadtteil Macul untergebracht war. Ein Provisorium, das wie so vieles in diesem Land zu einem Dauerzustand wurde. Victoria hatte erzählt, dass die Büros und Seminarräume im Winter nach dem Paraffin rochen, mit dem man das Gebäude notdürftig heizte, während ein kalter, stetiger Regen auf die Hauptstadt niederging.
Ich betrachtete das Heft mit dem vergilbten Umschlag, auf dem neben dem Schwarz-Weiß-Porträt von Lenin mehrere Angaben auf Russisch stehen. Es ist ein etwa hundert Seiten umfassendes Tagebuch auf Spanisch, das wegen der ungelenken, mit den Jahren stark verblassten Bleistiftschrift nur schwer zu entziffern ist. In den siebziger Jahren hatte ich die Sprache noch beherrscht, ich konnte mich verteidigen, wie es hier so schön heißt, doch leider habe ich sie im Laufe meiner späteren Einsätze in Osteuropa nach und nach verlernt.
Aber ich werde mich nicht davon entmutigen lassen. Ich muss Victorias Auftrag erledigen, koste es, was es wolle. Was das betrifft, bin ich noch immer ein disziplinierter Geheimagent. Ich habe begonnen, das Tagebuch, so gut es geht, selbst zu übersetzen, ein Tagebuch, dessen Autor ich nicht kenne, den Victoria aber gut gekannt haben muss, sonst hätte sie das Heft nicht so lange aufbewahrt. Also beschloss ich, es mithilfe meines rudimentären Spanischs und des Wörterbuchs, das ich mir in Minneapolis gekauft hatte, auf eigene Faust zu erforschen.
Victorias Brief liegt ebenfalls auf dem Schreibtisch. Ein bitterer, überraschender Brief, der mir schlaflose Nächte und viele schmerzhafte Augenblicke bereitet hat. Sie möchte, dass ich ihr einen unglaublichen, erschütternden, fast unerhörten Gefallen tue: Ich soll einem gewissen Héctor Aníbal, einem Chilenen, den sie während unserer Zeit in Santiago kennengelernt hatte, einen Teil ihrer Asche bringen, und zwar ohne Toms Wissen.
Nichts liegt mir ferner als Scheinheiligkeit, aber ich hätte nie erwartet, dass meine Tochter damals einen Freund hatte. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, und sie hatte auch nichts von einer, wie soll ich sagen, leichtfertigen Frau an sich. Bis ich den Brief las. Ich dachte immer, sie wäre eine treue Ehefrau, die an ihren religiösen Überzeugungen hängt, eine glückliche Frau an der Seite ihres Mannes, eine besorgte Mutter, deren Tochter in Notre Dame Jura studiert. Besonders glücklich sah sie nie aus, das muss ich zugeben, aber etwas mehr Dankbarkeit hätte ich schon erwartet für ihren anständigen, sie treu umsorgenden Ehemann mit der vielversprechenden Stelle bei einer Bank, ihre intelligente, gesunde Tochter, ihren angenehmen Job bei einer Frauenzeitschrift und unser Haus in einer wohlhabenden gated community in der Vorstadt von Minneapolis. Dass sich hinter all dem ein Geheimnis verbarg, das sie am Ende mit mir teilte, hätte ich nie vermutet.
Und jetzt ist es meine Aufgabe, diesen Héctor Aníbal zu finden. Zuerst dachte ich, Aníbal wäre der Nachname, aber als ich im Telefonbuch nachschlug, stellte ich fest, dass es sich nur um einen Vornamen handeln konnte. Offenbar hatte Victoria im Endstadium ihrer Krankheit vergessen, mir das zu sagen. Ihre Krankheit hatte immer häufiger Fieber und Bewusstseinstrübungen zur Folge gehabt, eine Art Trancezustand, der sich in den letzten Tagen ihres Lebens so sehr verschlimmerte, dass sie Erinnerungen mit Albträumen und die Realität mit der Fantasie verwechselte. Es kam mir wie ein makabrer Scherz vor, aber meine Tochter hatte in ihrem Brief die Hälfte vergessen, bevor sie für immer von uns ging.
Als Tom in der Bank war, fuhr ich noch einmal zu dem leeren Haus. Vergeblich wühlte ich in Schubladen, Schränken und Schachteln, inspizierte Briefe und Widmungen in Büchern und Kalendern, um irgendeine Spur zu finden, die mich weitergebracht hätte. Natürlich erzählte ich Tom nichts davon, meine Fragen hätten ihn bloß misstrauisch gemacht.
Jetzt, während ich wie eine gestürzte Statue im Bett meines Hotelzimmers in Santiago liege und Radio Oasis Morir un poco spielt, ein Lied aus einem chilenischen Film, das mich in die siebziger Jahre in dieser Stadt zurückversetzt, befällt mich zum ersten Mal das unerträgliche Gefühl, Victorias letzten Wunsch nicht erfüllen zu können.
6
Uno busca lleno de esperanzas
el camino que los sueños
prometieron a sus ansias.
Uno
Enrique Santos Discépolo, Mariano Mores
Als mich die Wachen vor der großen Tür daran hindern wollten, den Regierungspalast zu betreten, brauchte ich nur zu sagen, dass mich der Präsident höchstpersönlich herbestellt hatte, und schon bot man mir einen Sessel in einem Raum links vom Eingang an. Einen Moment später begleitete mich eine Frau über eine Treppe, die sich wie eine Schlucht im Inneren der Moneda hinaufschlängelte, in den ersten Stock.
An der ersten Tür stand ein weiterer Militärpolizist und neben ihm ein Mann in Anzug und Krawatte, genau wie der, der mir die Einladung in die Bäckerei gebracht hatte. Die Frau führte mich durch einen langen Flur, und wir betraten einen großen Empfangssaal mit Gemälden, Teppichen und Vorhängen, ganz zu schweigen von dem bronzenen Kronleuchter an der Decke. Ständig hetzten irgendwelche gut gekleideten Leute mit gerunzelter Stirn, besorgter Miene und Dokumenten unter dem Arm durch den Raum.
»Nehmen Sie doch bitte Platz«, forderte mich die Frau auf, bevor sie durch eine große Tür verschwand. Noch nie war jemand aus meiner Familie von einem Staatspräsidenten in den Regierungspalast oder sonst wohin eingeladen worden, dachte ich stolz.
Nach einer Weile kam die Frau zurück. Sie bat mich, ihr zu folgen. Wir durchquerten mehrere Zimmer, und plötzlich, ohne die geringste Vorwarnung, stand ich im Büro des Präsidenten – oder besser gesagt, vor dem Präsidenten selbst. Er saß hinter einem Schreibtisch mit mehreren Telefonen und einem Stapel Dokumente, die er aufmerksam durchsah.
»Setz dich, Cachafaz, ich unterzeichne nur schnell noch diese Papiere.« Er schaute nur kurz von den Dokumenten auf.
In aller Ruhe konnte ich ihn von meinem mit Samt bezogenen Stuhl aus beobachten. Seine Brillengläser glänzten makellos, seine Haut war immer noch rosig, aber sein Schnurrbart begann oben langsam grau zu werden. Er hatte einen gepflegten Haarschnitt, die Haare nach hinten gekämmt, die Locken mit Haarfestiger kaschiert, und jedes Mal, wenn er seine Unterschrift ans Ende einer Seite setzte, schabten seine goldenen Manschettenknöpfe über die abgerundete Schreibtischkante. Er war ein eleganter Mann. Der dunkle Anzug aus feinster Wolle, das weiße Hemd und die mit einer goldenen Nadel fixierte Seidenkrawatte standen ihm gut. Er sah richtig bürgerlich aus.
Er ist ja schließlich auch der Staatspräsident, sagte ich mir, während ich ihn ungläubig betrachtete und mir in die Hand kniff, um mich zu vergewissern, dass ich nicht träumte. Er war das Machtzentrum dieses Landes. Jetzt beugte er sich noch ein Stückchen weiter über den Tisch, den Rücken leicht gekrümmt, die Schultern gerade, und überflog mit dem offenen Füllfederhalter in der Hand die Papiere, bevor er sie schließlich absegnete. Ich ließ meinen Blick über die Wände des Büros schweifen, dessen Fenster auf die Plaza de la Constitución hinausgingen. Es war merkwürdig, einen Präsidenten aus der Nähe zu beobachten, sagte ich mir – ich weiß nicht, ob erfreut oder gerührt. Erst recht, weil ich einer so wichtigen Persönlichkeit mitten bei der Arbeit zusehen konnte, als wäre ich ein Ölgemälde an der Wand. Die Arbeit eines Präsidenten ist ganz schön kompliziert. Man muss nicht nur viel reden, bei Einweihungen Bänder durchschneiden, Reden halten und Befehle geben, sondern auch das tun, was ich von meinem Stuhl aus beobachten konnte: seine Unterschrift unter ein Papier kritzeln wie ein Schüler, der fleißig seine Hausaufgaben macht, Anrufe beantworten, ständig irgendwelche Leute empfangen.
»Ich habe dich herbestellt, Cachafaz«, begann er einen Moment später mit seiner tiefen, nasalen Stimme, während er aufstand und mir die Hand reichte und eine Sekretärin die Dokumente von seinem Schreibtisch nahm und mit ihnen durch eine schmale Tür verschwand, »weil ich nie wieder etwas vom Schuster Demarchi gehört habe. Und du musst wissen, seine Lektionen in Anarchismus und Marxismus haben mein Leben geprägt.«
»Sie haben sich schon als Schüler immer von den anderen abgehoben.« Ich fühlte mich etwas unbehaglich, weil ich nicht glaubte, dass das der einzige Grund war, warum er mich aus der Bäckerei geholt und in der Moneda empfangen hatte. »Sie waren stets der Beste.«
»Demarchis Unterricht in seiner hellen, nach Schuhcreme und Farbe riechenden Werkstatt auf dem Cerro Cordillera wird für mich immer unvergesslich bleiben.« Der Präsident ließ sich auf einem weinroten Sofa nieder und forderte mich mit einer Handbewegung auf, in einem ähnlichen Sessel Platz zu nehmen. Ich kam mir vor wie im Schloss von Versailles, wie ich es aus Filmen kannte.
»Die Werkstatt war in der Calle Sócrates, in der Nähe vom Sitz des Gewerkschaftsverbands«, sagte ich.
»Ich habe dort zum ersten Mal von Proudhon und Malatesta gehört«, fügte der Präsident hinzu. »Wie jung wir damals waren … Tee oder Kaffee?«
Kaum hörbar tauchte hinter mir ein weiß gekleideter Diener auf. Ich bestellte einen Kaffee, weil es schon seit längerem keinen mehr in meinem Viertel gab. Zum Glück hatte wenigstens der Präsident noch welchen.
»Seitdem ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen«, fuhr er fort. »Wir waren fast noch Kinder und lebten irgendwo zwischen Zinnsoldaten und den ersten politischen Demonstrationen.« Er knöpfte sich einen Knopf seines Jacketts auf. »Aber wir wollten alles von den Arbeitern lernen und wissen, wie man eine Revolution macht. Was ist aus den anderen geworden?«
»Danilo ist vor zehn Jahren gestorben, Alkohol und Armut. Nicht mal von seiner Beerdigung habe ich was mitbekommen.«
»Und wer war der Vierte, so ein Halbblonder mit blauen Augen?«
»Der Pelluco, Herr Präsident. Von dem habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Seit er aus Valparaíso weg ist, um im Norden als Bergarbeiter zu arbeiten.«
Schweigend tranken wir den Kaffee aus Porzellantassen, die das chilenische Wappen auf einem blauen Streifen schmückte. Der Präsident trug schwarze, spitz zulaufende, sorgfältig geputzte Schuhe. Ich nahm einen zweiten Kaffee, aber diesmal schüttete ich mir selber drei Teelöffel Pulver in die Tasse und nahm bei der Gelegenheit gleich mehrere Würfel Zucker, die mittlerweile ebenfalls Mangelware waren. Der Präsident erkundigte sich nach meiner Bäckerei, und weil ich nicht auf den Mund gefallen bin und sage, was ich denke, erzählte ich ihm freiheraus, dass es überhaupt nicht gut lief, weil es schlicht und einfach kein Mehl gab.
»Es gibt kein Mehl? Nichts?«
»Nichts.«
Während er etwas auf einer Visitenkarte notierte, vielleicht, was ich gesagt hatte, versicherte er mir, dass sich die Lage dank des verstärkten Vorgehens der Bevölkerung gegen den Schwarzmarkt schon bald bessern würde, was mich natürlich beruhigte. Ich erklärte ihm gerade, wie man den Teig für Hallulla-Brot im Unterschied zu dem von Colisa-Brot knetete, als ein großer, schmächtiger Mann mit Ziegenbart, der aussah wie Don Quijote, den Raum betrat und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Der Präsident überlegte einen Moment, stand auf und sagte:
»Es tut mir leid, Cachafaz, aber ich muss gehen. Die Lastwagenfahrer sind in einen landesweiten Streik gegen die Volksregierung getreten. Sie sind zum Äußersten bereit. Wenn du etwas brauchst, ruf einfach diese Nummer an« – er reichte mir eine Visitenkarte – »und erklär, worum es geht. Beim nächsten Mal plaudern wir in Ruhe über unseren Freund, den anarchistischen Schuster.«
7
It’s only words,
and words are all I have
to take your heart away.
Words
Bee Gees
Das Leben besteht aus Erinnerungen, nicht aus den alltäglichen Erlebnissen und auch nicht aus unseren Träumen und Sehnsüchten. Das ist die Wahrheit, dachte ich an dem Morgen, als ich das Hotel Los Españoles verließ, um mich im Café Tavelli mit Margot Husemann zu treffen. Margot war mit einem Industriellen aus der Metallbranche verheiratet und die Mutter von Ema, einer ehemaligen Schülerin des Nido de Águilas, die einen Jahrgang über Victoria gewesen war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!