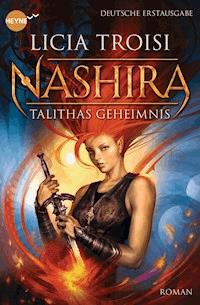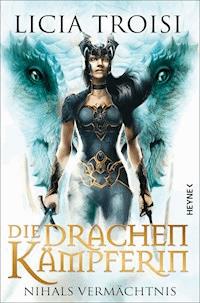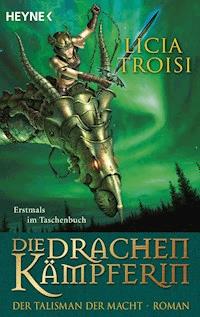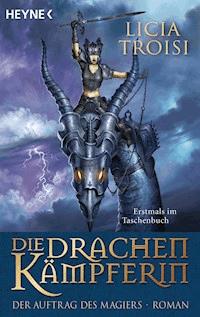9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dominium-Reihe
- Sprache: Deutsch
Einst war die junge Kriegerin Myra aufgebrochen, um an der Seite des charismatischen Anführers Acrab gegen Not und Unterdrückung zu kämpfen und dem Tränenreich die Freiheit zu bringen. Dafür hatte sie alles aufgegeben – nur um zu entdecken, dass Acrab sie betrogen hat. War alles, wofür Myra gelitten hat, eine Lüge? Jetzt steht sie vor der bittersten Entscheidung ihres Lebens: Wird sie fliehen, um der Gefahr zu entkommen? Oder wird sie gegen den Mann in den Krieg ziehen, für den sie immer noch heimliche Gefühle hegt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
LICIA TROISI
DER FEUERKÖNIG
DIE DOMINIUM-SAGA
ROMAN
Aus dem Italienischen übersetzt
von Bruno Genzler
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Einst war die junge Kriegerin Myra aufgebrochen, um an der Seite des charismatischen Anführers Acrab gegen Not und Unterdrückung zu kämpfen und dem Dominium der Tränen die Freiheit zu bringen. Dafür hatte sie alles aufgegeben – nur um zu entdecken, dass Acrab sie betrogen hat. War alles, wofür Myra gelitten hat, eine Lüge? Jetzt steht sie vor der bittersten Entscheidung ihres Lebens: Wird sie fliehen, um der Gefahr zu entkommen? Oder wird sie gegen den Mann in den Krieg ziehen, für den sie immer noch heimliche Gefühle hegt?
Die Autorin
Licia Troisi, 1980 in Rom/Ostia geboren, ist eine der bekanntesten Fantasy-Autorinnen weltweit. Sie studierte in Rom Physik und Astrophysik, bevor sie für die italienische Raumfahrtagentur in Frascati arbeitete. Das Schreiben gehörte jedoch schon immer zu ihren großen Leidenschaften und ihr erster Fantasy-Zyklus um Die Drachenkämpferin wurde auf Anhieb ein internationaler Bestseller. Darauf folgten Die Schattenkämpferin, Die Feuerkämpferin, Drachenschwester und Nashira. Nach Die Eiskriegerin legt sie nun mit Der Feuerkönig den zweiten Band ihres großen neuen Fantasy-Zyklus Die Dominium-Saga vor. Licia Troisi ist verheiratet und hat eine Tochter.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der italienischen Originalausgabe:
LA SAGA DEL DOMINIO – IL FUOCO DI ACRAB
Deutsche Erstausgabe 02/2019
Redaktion: Ulrike Schimming
Copyright © 2017 Mondadori Libri S.p.A., Milano
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT GbR, München,
Umschlagillustration: Elif Siebenpfeiffer
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-23477-5V002
www.heyne.de
DER
FEUERKÖNIG
ERSTER TEIL
DER MÖRDER
Achtunddreißig Jahre zuvor
Katifa zitterte. Ihre schlimmsten Ängste schienen Wirklichkeit zu werden. Das Unheil hatte Gestalt angenommen, stand in Fleisch und Blut vor ihr, real, greifbar. Das Unheil, wie sie es sich in den vergangenen neun Monaten häufig ausgemalt hatte.
Philagrios war bei ihr, hatte sie aber noch nicht einmal angesehen, als die Mönche in den Raum eingedrungen waren. Mit gesenktem Kopf, stumm und abweisend stand er da und ließ es zu, dass sie sich allein all dem stellen musste, was sie nun erwartete.
Wie anders war er doch zu ihr in den langen Nächten zuvor gewesen, in denen er sich in ihre ärmliche Unterkunft geschlichen und sie mit Liebkosungen verwöhnt und mit Hoffnungen erfüllt hatte.
»Eines Tages gehen wir von hier fort und bauen uns ein neues Leben auf, ein Leben, in dem keine anderen Menschen mehr über uns bestimmen können.«
»Werden wir Kinder haben?«
»Gewiss, ganz viele sogar.«
Simgez aber, Katifas mütterliche Freundin, hatte sie aus ihren Träumen reißen wollen: Solche Versprechungen von Mönchen sind nichts wert, hatte sie gesagt. »Hat dein Philagrios nicht ein Keuschheitsgelübde abgelegt, bevor er dir ewige Treue schwor?«
Doch Katifa war fast noch ein Kind: Gerade einmal sechzehn war sie, sechzehn Jahre, von denen sie dreizehn in den Diensten des Klosters Kurrah verbracht hatte, und an die anderen drei hatte sie nur vage Erinnerungen, Erinnerungen an Hunger, Not und Verzweiflung. So fiel es ihr leicht, sich in Philagrios’ süßen Worten zu verlieren und daran zu glauben, dass sie Wirklichkeit werden könnten.
Doch dann waren ihre Tage ausgeblieben, und langsam begann ihr Bauch, dicker und dicker zu werden.
»Du bist schwanger«, hatte Simgez ihr gesagt.
Katifa musste nicht einmal überlegen. Denn tief in ihrem Herzen hatte sie immer gewusst, was sie wollte: eine große Familie und ein einfaches, friedliches Leben.
»Ein Kind kann man nicht wegwerfen«, antwortete sie Simgez, die ihr die einfachste Lösung vorgeschlagen hatte, jene Lösung, mit der sich zahlreiche andere Frauen in ihrer Situation in diesem Kloster schon beholfen hatten.
»Dann werden sie dich töten.«
Katifa hatte Philagrios eingeweiht. Naiv wie sie war, hatte sie geglaubt, dass so alles gut würde: Sie würden das Kloster verlassen und zusammen nach Alkak ziehen, dem Land, aus dem sie stammte. Wovon sie leben sollten, daran dachte sie nicht, und auch nicht daran, dass sie gesündigt hatten und man ihnen nicht vergeben würde. Ein gemeinsames Kind würde alles verändern, glaubte sie. Abends streichelte sie sich über den Bauch. Sie fühlte sich stark und zu allem bereit.
Doch Philagrios verhielt sich anders, als sie es erwartet hatte. Man müsse noch abwarten, druckste er herum, der geeignete Moment zur Flucht sei noch nicht gekommen, es komme darauf an, alles gut vorzubereiten, damit weder ihr noch ihm etwas passieren könne. Und dann fragte er noch, ob sie das Kind wirklich behalten wolle. Da verstand Katifa.
Sie werde es auch ohne ihn schaffen, sagte sie, aber er ergriff ihre Hände und versicherte ihr, dass sie auf ihn zählen könne, er werde für sie da sein und ihr helfen. »Ich muss nur alles in die Wege leiten.«
Und so verscheuchte sie ihre Zweifel und glaubte ihm.
Währenddessen schritt ihre Schwangerschaft voran. Mit weiten Kleidern und eng geschnürten Binden verbarg sie ihren immer runderen Bauch und ließ sich von anderen die Arbeiten abnehmen, zu denen sie nicht mehr in der Lage war. Und dann, in den letzten Tagen, versteckte sie sich in einer kleinen, etwas abgelegenen Zelle und lebte dort wie eine Gefangene, mit dem winzigen Geschöpf, das sich in ihr bewegte, als einziger Gesellschaft.
Dann gebar sie, ein Tuch im Mund, auf das sie biss. Dennoch schrie sie, und die Schmerzen schienen ihr unerträglich. Wie aber sollte sie diese Schreie in der Stille des Klosters rechtfertigen? Simgez hatte ihr immer wieder eingeschärft, leise zu sein, während sie allein ihr Kind zur Welt brachte.
Zwei Tage nach der Geburt packte sie ihre Sachen. Und das obwohl sie sich immer noch sehr schwach fühlte und dem Säugling eine lange beschwerliche Reise eigentlich nicht zuzumuten war: Denn Kurrah lag sehr abgelegen, fern von den ohnehin wenigen Dörfern Phoinikas, die über das ganze Land verteilt waren. Aber sie hatte keine andere Wahl.
Es grenzte an Wahnsinn, doch bevor sie aufbrach, wagte sie noch einen letzten Versuch und begab sich zu Philagrios. In den Monaten zuvor hatte er sie kein einziges Mal besucht, dennoch hoffte sie, dass Vatergefühle in ihm erwachen würden, wenn er das Kind erst sähe, und er sie begleiten würde.
Doch in seinem Raum fand sie nicht nur Philagrios vor, sondern auch seinen Meister. Und alles war aus.
Nun hielt Simgez den Säugling im Arm. Hoch und heilig hatte diese geschworen, keinen Verdacht geschöpft und immer geglaubt zu haben, dass Katifa nur dicker geworden sei.
»Niemand von uns hat etwas geahnt.«
»Das werden wir noch sehen«, erwiderte der Klostervorsteher in eisigem Ton.
Alle Mönche des Rates waren versammelt. Katifa spürte ihre vorwurfsvollen, angewiderten Blicke, dabei hatte Simgez ihr erzählt, dass sich einer von ihnen in jungen Jahren oft nachts zu ihr geschlichen habe. Und alle wussten, dass das Keuschheitsgelübde von allen Regeln am häufigsten missachtet wurde. Wichtig war nur, dass dies im Verborgenen geschah. Katifas Schuld bestand nicht darin, sich einem Mönch hingegeben zu haben. Verwerflich war, von einem besseren Leben zu träumen, ihr Kind zu lieben und es behalten zu wollen.
Der Klostervorsteher, ein alter Mann mit Buckel, faltigem Gesicht und einem geschorenen Schädel, der mit einem so dichten, mittlerweile verwachsenen Netz aus Tätowierungen überzogen war, dass man die Linien kaum noch auseinanderhalten konnte, trat zu Philagrios. Lange blieb er reglos vor dem jungen Mönch stehen und musterte ihn mit seinen pechschwarzen Augen.
»Du weißt, dass das Gelübde, das du abgelegt hast, heilig ist?«, begann er dann.
»Ja, Herr.« Philagrios schluchzte.
»Warum hast du dann dagegen verstoßen?«
Der Mönch versuchte zu antworten, doch sein Meister kam ihm zuvor. »Philagrios ist noch jung, und er weiß, dass er einen schweren Fehler begangen hat«, sagte er mit fester, sicherer Stimme. Anders als sein Schüler schien er von der Situation wenig beeindruckt. »Aber Ihr wisst ja, wie solche Mädchen sind und mit welcher Raffinesse sie junge Männer wie Philagrios zu umgarnen verstehen.«
Katifa hätte gern erwidert, dass es Philagrios war, der den ersten Schritt getan hatte, und dass sie ihn keineswegs ›umgarnt‹ hatte, wusste aber, dass es sinnlos war. In einem Kloster galt das Leben eines Mönches viel, das einer Magd hingegen nichts.
Der Klostervorsteher trat auf sie zu. Sein Blick war so durchdringend, dass sie sich wie entblößt von ihm fühlte. »Wolltest du nur deine Gelüste befriedigen oder hofftest du, Philagrios erpressen zu können? Wolltest du ihn zwingen, an deiner Seite das Kloster zu verlassen, damit er sich um dich und deinen Bastard kümmert?«
Katifa hatte den Kopf gesenkt, weinte aber nicht. Diese Genugtuung wollte sie dem Alten nicht gönnen. Philagrios hingegen, der wie ein feiger, reuiger Junge dastand, tat ihr nur noch leid.
»Nichts von all dem wirst du erreichen. Das ist dir doch klar?«, fuhr der Klostervorsteher fort und wandte sich wieder Philagrios zu. »Hier ist kein Platz mehr für dich«, erklärte er streng. »Du wirst in ein anderes Kloster gehen und dort Novize bleiben, ohne je in den Kreis der Ordensbrüder aufgenommen zu werden.«
Philagrios schlug die Hände vor das Gesicht und begann, haltlos zu weinen.
»Du und dein Kind aber«, wandte sich der Alte nun wieder Katifa zu, »ihr sollt im Wald ausgesetzt werden.«
Das war mehr als eine Strafe. Denn um in den Orden aufgenommen zu werden, mussten die Novizen ein Jahr im Schattenwald zubringen, und die meisten überlebten dieses Jahr nicht. Sie verhungerten oder wurden von einem der Daralmeks gerissen, den entsetzlichen Baumdrachen, die in diesem Wald hausten. Katifa würde niemals lebend von dort zurückkehren.
»Ihr verurteilt mich zum Tode!«, rief sie entsetzt, während der Alte sich schon abwandte und, gefolgt von den Mönchen des Rates, den Raum verließ. »Und mit mir ein unschuldiges Kind!«
»Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du die Beine breitgemacht hast«, entgegnete der Alte, während er sich noch einmal zu ihr umdrehte.
Zwei Mönche packten sie. Nur noch wenige Sekunden blieben ihr, um ihr Leben oder zumindest das ihres Kindes zu retten. Wie ein wildes Tier im Käfig sah sie sich um, und ihr Blick traf den ihres Sohnes.
Da fasste sie den Entschluss.
»Ich will ihn Urak weihen!«
Der Klostervorsteher blieb stehen.
»Ich will ihn Urak weihen!«, rief Katifa laut, rief es wieder und wieder, bis ein Handrücken sie im Gesicht traf.
Schlagartig wurde es still.
Jetzt erst drehte der Klostervorsteher sich zu ihr um. »Dein Sohn ist ein Kind der Sünde.«
»Ich werde für ihn büßen«, erklärte Katifa mit fester Stimme.
Simgez, nur wenig von ihr entfernt mit dem Kind auf dem Arm, schüttelte heftig den Kopf.
Der Klostervorsteher aber trat wieder auf sie zu und kam so nah an sie heran, dass seine Nase fast ihr Gesicht streifte. »Das wird dich nicht retten.«
»Aber ihn.«
»Ein Mönch kann er nie werden. Er ist gezeichnet.«
»Aber er wird leben.«
Der Alte blickte sie lange an, und zum ersten Mal erkannte Katifa in seinem Blick etwas anderes als Überdruss und Verachtung. Respekt. »Offenbar ist zumindest einer von euch beiden bereit, für sein Tun einzustehen«, sagte er zu Philagrios, der mit verheultem Gesicht stumm im hinteren Teil des Raumes stand.
Schließlich löste der Mönch sich von der jungen Magd und erklärte: »Das Kind wird im Kloster verbleiben, denn es wurde unserem Gott geweiht, und seine Mutter wird die Last seiner Schuld allein auf sich nehmen. Morgen bei Tagesanbruch soll sie zum Nest geführt werden.«
Katifa erschauderte. Das Nest. Ein tief im Schattenwald verborgener Ort, an dem die Baumdrachen ihren Nachwuchs aufzogen und ihre Beute verzehrten. Sie sollte den Drachen geopfert werden.
Kurz überkam sie die Furcht. So oder so, sie war verloren, war es schon lange, schon seit jenem Augenblick, als Philagrios sich in ihre Kammer geschlichen und sie seinen Lügen Glauben geschenkt hatte. Doch etwas von ihr würde bleiben, und wenn sie ihr Kind rettete, wäre ihr Leben nicht sinnlos gewesen.
»Schafft sie fort.«
»Wartet! Einen Moment noch!«, rief Katifa, wobei sie sich im Griff der Mönche hin und her wand.
Der Klostervorsteher kniff die Augen zusammen. »Du hast bekommen, worum du gebeten hast«, erklärte er mürrisch, »stelle meine Geduld nicht weiter auf die Probe.«
»Ich möchte mich von meinem Sohn verabschieden.«
Der Klostervorsteher zögerte einen Moment und hob dann eine Hand.
Simgez nickte und brachte ihr den Säugling. Er war winzig, schien aber alles, was um ihn herum vor sich ging, genau zu erfassen. Seine dunklen, leicht mandelförmigen Augen waren weit geöffnet und auf sie gerichtet. Er weinte nicht und zappelte nicht. Ruhig und für einen Säugling unvorstellbar eindringlich sah er sie an.
Katifa streichelte ihm über die Wange und küsste ihn. Dann wandte sie sich an Simgez. »Egal, welchen Namen man ihm auch geben wird: Dies ist Acrab. A-crab«, wiederholte sie. Es war der Name ihres Vaters, der sie zehn Jahre zuvor zum Kloster gebracht und ihr ein schönes Leben versprochen hatte. »Auch ohne uns«, hatte er gesagt, wobei er sie ein letztes Mal fest an sich gedrückt hatte.
Während man sie hinausführte, blickte Katifa zurück zu Simgez und Acrab auf ihrem Arm. Fest prägte sie sich sein Gesicht ein und dachte an all die Nächte, die sie mit ihm verbracht hatte: Sie hatte dagelegen und ihren Bauch gestreichelt, hatte sich auf die Bewegungen ihres ungeborenen Kindes konzentriert, mit ihm geredet und ihm versichert, dass alles gut würde, und ihm leise das einzige Gute-Nacht-Lied vorgesungen, das sie kannte.
»Du sollst ein schönes Leben haben, auch ohne mich«, flüsterte sie, während sich die Tür für immer hinter ihr schloss.
1
26. Dezember
Draußen hatte es zu schneien begonnen. Still wie immer lag das Kloster Kurrah da, eine Ruine, nicht mehr als einige von einem Brand geschwärzte Mauern, die sich steil über dem Abhang auf einem Hügel erhoben. Nichts schien anders als sonst. Dabei vollzog sich im tiefsten Innern der Ruine, in einem unterirdischen Raum, den das Feuer und die Zeit verschont hatten, ein Kampf auf Leben und Tod.
»Bleib bei mir, bleib bei mir …«, wiederholte Kyllen verzweifelt.
Myra lag bewusstlos in seinen Armen, während er die Hände auf die klaffende Wunde presste, die sich plötzlich in ihrem Bauch aufgetan hatte.
Mehr konnte er nicht tun. Der Raum, in dem sie sich befanden, war eine aus dem Sandstein herausgeschlagene Höhle, und so gab es hier keine Elementale, die er für seine Magie hätte nutzen können. Doch selbst wenn, es hätte ihm auch nichts genützt. Denn im Umkreis dieses Klosters versagten seine Kräfte. Das hatte er gemerkt, als sie die halb zerstörte Brücke über den tiefen Graben vor den Klostermauern überwinden mussten und er keinen einzigen Elemental hatte herbeirufen können. Dieser Ort schien alle abzuweisen, alle außer Myra.
Aber wieso lag sie nun sterbend am Boden? Kyllen verstand es nicht. Was war ihr bloß zugestoßen?
Sie hatte das Schwert berührt, Phylaitek, jene Waffe, derentwegen sie zu diesem Kloster aufgebrochen waren. Es sollte zeigen, ob sie der Befreier war, jene legendäre Gestalt, die dazu ausersehen war, die Blutsklaverei zu beenden und die Elementale von der Knechtschaft durch die Blutmagier zu befreien. Und gleichzeitig hoffte Myra, auf diese Weise zu erfahren, wer zwölf Jahre zuvor, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, ihren Vater ermordet hatte.
Als sie das Schwert ergriffen hatte, war sie auf der Stelle bewusstlos niedergesunken. Und kurz darauf hatte sich diese klaffende Wunde, aus der das Blut strömte, aufgetan.
Kyllen hatte Mühe, nicht in Panik zu geraten. Er war Magier, und seine Aufgabe war es, die Welt und die Naturgesetze zu verstehen und sie zum Wohle der Menschheit zu nutzen. Durch sein Wissen und seine Fähigkeit, Neues richtig zu deuten, hatte er seinen Weg in dieser Welt gefunden und Sicherheit und Selbstvertrauen gewonnen, die ihn bislang auch in Momenten größter Verwirrung nie im Stich gelassen hatten. Auf diese Weise war auch sein Entschluss zustande gekommen, die Kongregation der Reinen, der er sich angeschlossen hatte, wieder zu verlassen, als seine Zweifel an der Politik dieser Organisation und insbesondere an der ihres Vorstehers, des sogenannten Unbefleckten, immer größer geworden waren.
Doch nun blieb ihm nichts mehr, woran er sich halten konnte. All sein Wissen reichte nicht aus zu erklären, was geschehen war. Er hatte Myra versprochen, nicht von ihrer Seite zu weichen und sie zu beschützen, und jetzt konnte er nichts mehr tun, außer ihren Namen zu rufen und zu versuchen, mit den Händen das Blut zurückzuhalten, das aus ihrem Bauch strömte.
Marjane, die neben ihm stand, reichte ihm einige Stoffstreifen, die sie von ihrem Umhang abgerissen hatte. »Versuch’s mal damit«, sagte die junge Thyrren atemlos.
Kyllen nahm die Streifen und begann, mit Marjanes Hilfe, die Wunde zu verbinden, die sich, lang und tief, über Myras gesamten Bauch bis zum Rücken zog. Eine durch eine Schwertklinge verursachte Wunde, hätte Kyllen gedacht, wenn es dort einen bewaffneten Gegner gegeben hätte. Aber so war es nicht. In dem Raum war kein Feind, sondern nur sie drei sowie Phylaitek im immer schwächer werdenden Griff von Myras Hand.
Solch eine Wunde überlebt man nicht, schoss es ihm durch den Kopf, und sein Herz und seine Hände erstarrten zu Eis.
»Was ist?«, fragte Marjane.
Kyllen schluckte. »Mach weiter«, sagte er nur, und Marjane riss weitere breitere Stoffstreifen von ihrem Umhang, presste sie zusammengelegt auf die Wunde und befestigte sie mit den Binden. Fast ihr gesamtes junges Leben lang war sie Sklavin in einer Gladiatorenschule gewesen. Erst Myra hatte sie befreit und sich schließlich bereit erklärt, sie auf ihrer Reise mitzunehmen. Mit der Versorgung von Wunden kannte Marjane sich bestens aus. Doch der Blutfluss hörte nicht auf.
Wieder beugte Kyllen sich über Myra. »Wag es nicht zu sterben, hörst du? Wag es ja nicht. Ich habe nicht den weiten Weg mit dir zurückgelegt, um dich sterben zu sehen.«
»Du musst etwas tun! Was ist denn mit deiner Magie?«, rief Marjane verzweifelt.
»Hier drinnen funktioniert die nicht.«
»Dann bleibt uns nur eine Möglichkeit.« Marjane lief um die leblos daliegende Myra herum und ergriff ihre Füße. »Fass mal mit an!«
Die junge Thyrren schien weit weniger hilflos als der Magier zu sein. Aber er begriff nun, packte Myra, legte ihr die Arme auf der Brust zusammen und hob sie an. Sie hielt immer noch das Schwert, vielleicht ein gutes Zeichen.
So gelangten sie ins Freie. Die Welt draußen schien alle Farben eingebüßt zu haben. Es gab nur noch das Schwarz des versengten Holzes, das Grau des gefrorenen Bodens und das Weiß des Schnees. Vor diesem Hintergrund wirkte das Rot von Myras Blut, das langsam auf den Boden tropfte, noch greller.
Sie hasteten weiter, stießen aber auf ein schier unüberwindliches Hindernis: die zerstörte Brücke über den Klostergraben. Es war eine Hängebrücke aus Holzbohlen, von denen einige noch an dem letzten gespannten Seil über dem Abgrund baumelten. Auf dem Hinweg hatten sie sich an diesem Seil entlang gehangelt und den Graben überwunden.
»Icenwharth!«, rief Marjane nach Myras Drachen, wobei sie sich über den Abgrund beugte.
Keine Antwort.
Unterdessen prüfte Kyllen den magischen Gehalt um sich herum. Zwar regten die Blutpforten an seinem Körper sich, nicht aber die Elementale, die er ebenfalls für einen Heilzauber brauchte. Es war, als gäbe es hier überhaupt keine Elementale. Dieser Ort schien wahrhaft tot, alles Leben, gleich welcher Form, erloschen.
»Ich schaffe es nicht«, stöhnte Kyllen.
Da zuckte ein letztes Mal der Körper, der auf seinen Knien ruhte, ganz schwach. Myras Gesicht war noch weißer geworden, so weiß wie der Schnee um sie herum. Ihre Brust hob und senkte sich nicht mehr, und als er zwei Finger auf ihre Halsschlagader legte, spürte er keinen Puls.
Die Zeit blieb stehen. »Nein …«
Rasch legte er den Mund auf ihre Lippen, gerade so wie sie es einen Monat zuvor bei ihm getan hatte, als sie ihn aus dem Meer retten konnte. Sie waren eiskalt.
Marjane drehte sich um, sah zu ihm, dann auf Myra. »Kyllen …«
»So darf es nicht enden …«
Er legte die Hände auf Myras Brust, gleich über dem Herzen, schloss die Augen und konzentrierte sich, öffnete so weit wie möglich alle Sinne und versuchte, irgendeinen Elemental zu erreichen. In dieser Situation hätte er einen solchen Geist sogar unterworfen, obwohl das seinen Überzeugungen als Reiner widersprach. Alles hätte er getan, um Myra zu retten.
So kniete er da, schrie ihren Namen und mühte sich verzweifelt, auch nur den winzigsten Hauch Magie aus den Fingern entströmen zu lassen. Myras Leib aber blieb kalt, aus der Wunde floss kein Blut mehr, und ihre Lippen begannen sich violett zu färben. Da ging sein Schreien in ein krampfartiges, herzzerreißendes, hilfloses Weinen über.
Marjane erstarrte. Myra konnte nicht tot sein. Diese Frau hatte sie von den Ketten der Sklaverei befreit und vor einem noch schlimmeren Schicksal bewahrt, und sie hatte sich ihr angeschlossen, in der stillen Hoffnung, eines Tages zumindest ein wenig so werden zu können wie sie.
Doch gerade als die Erkenntnis, dass das Undenkbare eintrat, sich Bahn brach, und mit ihr der Schmerz, geschah etwas: Das Schwert auf Myras Brust begann in einem immer stärker werdenden violetten Licht zu leuchten, während die Intarsien, von denen die Klinge durchzogen war, Wärme abstrahlten.
Marjane machte Kyllen darauf aufmerksam. Er riss sich von dem lähmenden Schmerz los. Nun sah auch er dieses Licht, das heller und heller wurde, und bald alles erfasste, sodass sich die Umrisse des Schwertes langsam auflösten und in blendender Helligkeit verloren. Auch Myras Gestalt war in all dem Licht kaum noch auszumachen.
Kyllen sprang auf, doch Marjane hielt ihn zurück und deutete auf einen Punkt jenseits des Abgrunds: Dort stand Icenwharth. Sie hatte nach ihm gerufen, und offenbar hatte er ihren Ruf doch vernommen. Reglos verharrte der Drache, die Flügel angelegt, und sah sie mit seinem Auge an, das so rot war wie die von Myra.
Und aus dieser Richtung kamen sie: Zunächst schien es nur eine Nebelwolke zu sein oder Schnee, den eine Windbö herantrug. Doch je näher es kam, desto deutlicher wurden sie. Ein Vogelschwarm, schoss es Kyllen durch den Sinn, wobei er spürte, dass noch etwas anderes dahintersteckte, etwas Besonderes und gleichzeitig Vertrautes. Die Vögel umschwirrten Icenwharth, sodass er nicht mehr zu sehen war, kamen immer näher herangeflogen und überwanden den Abgrund.
Und plötzlich öffneten sich alle Blutpforten des jungen Magiers, so schmerzhaft, dass er sich stöhnend krümmte. Doch als er den Blick wieder hob, erkannte er sie endlich.
Elementale. Hunderte, Tausende von Elementalen der verschiedensten Gattungen in einem einzigen Schwarm. Manche winzig, andere größer, manche im Wasser beheimatet, andere auf dem Land, wieder andere in der Luft oder im Holz. Manche Arten hatte Kyllen noch nie gesehen und konnte sie nicht einordnen. Sie flatterten umher, teilten sich in kleinere Schwärme, die sich mal verdichteten, dann wieder auflösten, mit ihren hauchzarten Gestalten, den durchsichtigen Flügeln, die in der Luft vibrierten, den großen glänzenden Augen, deren Blicke sich hin und wieder, jedoch fast gleichgültig, auf Marjane und Kyllen richteten.
Denn etwas anderes hatte sie hergeführt.
Schon umkreisten sie in rasender Geschwindigkeit Myra, die mittlerweile in einem strahlend hellen Lichtkegel lag, wirbelten, angestrahlt von diesem Licht, um sie herum, ein schillernder Strudel, in dem sich ihre Körper auflösten, bevor sie vollständig eintauchten in dieses Licht, das Myra verströmte.
Hingerissen verfolgten Kyllen und Marjane dieses Schauspiel. Sie verstanden nicht, was da vor sich ging, ließen sich aber verzaubern, von dieser Kraft, dieser Schönheit.
Da bemerkte der junge Magier, dass Blut aus seinen geöffneten Blutpforten troff. Jeder Kristall in seiner Haut glühte und strahlte. Sie ist der Befreier, dachte er, sie ist es tatsächlich.
Und so ungeheuerlich diese Erkenntnis auch war, wünschte sich ein Teil von ihm doch nichts anderes, als dass Myra sich erholte. Seite an Seite hatten sie das Dominium durchquert, und dabei war sie ihm so eng ans Herz gewachsen, dass es zu schlagen aufhören würde, wenn er sie verlöre.
Immer schneller umkreisten die Wesen Myras Leib, während das Licht immer gleißender wurde. Mittlerweile waren keine Konturen mehr auszumachen: weder von Myras Gestalt noch von dem Schwert oder den Elementalen selbst. Alles löste sich in einem Chaos auf, das Leben und Wiedergeburt schenkte. Noch heftiger wurde der Schmerz, den die Blutpforten Kyllen bereiteten, und so musste der junge Magier die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut zu schreien.
Doch ein anderes Brüllen erhob sich, ein gewaltiges Brüllen, das Icenwharth ausstieß. Und das Licht explodierte.
Der Blitz erfasste Kyllen und Marjane, und alles wurde weiß. Die Grenzen zwischen der Welt und ihren Körpern lösten sich auf, und einen Augenblick lang überkam sie ein Wohlgefühl, das sie nicht für möglich gehalten hätten. Doch selbst in diesem Moment, in dem alles verschwand, was sie einmal waren, und bevor das Schwindelgefühl sie überwältigte, beherrschte Kyllen ein Gedanke: Solange nur Myra gerettet wird. Solange nur Myra gerettet wird.
»Es war alles nur ein Traum«, hörte sie eine Stimme von irgendwoher.
Myra wusste, wem diese Stimme gehörte. Seit acht Jahren bestimmte sie ihr Leben, und sie hätte sie unter tausend anderen wiedererkannt.
Sie schlug die Augen auf und sah ihn im ewigen Eis Asgarös, jenem Ort, der enger als jeder andere mit ihrer Geschichte und ihrem gemeinsamen Weg verbunden war.
»Schwörst du es?«, fragte sie, und ihre Stimme klang nicht so rau wie nach dem endlos langen Schrei, als sie die Ermordung ihres Vaters miterlebt hatte. Diese Heiserkeit war ihr immer geblieben, doch nun war ihre Stimme wieder heil und gesund, so wie zuvor schon, nachdem sie das Schwert Phylaitek berührt und dann gegen diesen Elementale hatte kämpfen müssen an jenem Ort, wo Raum und Zeit aufgehoben waren. Es war eine Stimme, die sie von sich nicht kannte, weiblich und melodiös.
Acrab lächelte sie an. »Ja, ich schwöre es dir. Es war nur ein Traum. Alles. Deine lange Reise, die Suche … alles.«
»Dann warst du es gar nicht«, murmelte sie.
Acrab schüttelte den Kopf. »Nein, wie hätte ich das tun können?«
Auch Myra lächelte. »Ich bin so froh. Denn wenn das gestimmt hätte, wäre ich … wäre ich …«
Im Widerschein des Eises schien das Licht noch greller zu werden. Der klare Himmel wurde milchig weiß, und Myra spürte ihren Körper wieder. Ihr war, als stürze sie, von einer schweren Last niedergezogen. Alles tat ihr weh. Allein die Augen zu öffnen bedeutete eine enorme Anstrengung für sie, und als es ihr gelang, sah sie, dass es heftig schneite.
Asgarö, dachte sie und erwartete, in Acrabs Gesicht zu sehen. Doch stattdessen erblickte sie einen jungen Mann mit der Andeutung eines Bartes und weißen Haaren, die seitlich kurz geschnitten und nur auf der Schädelmitte zu einem längeren Haarstreifen frisiert waren. Seine Augen glänzten, und als er sah, dass sie blinzelte, nahm er sie stürmisch in den Arm.
»Du lebst«, hörte sie ihn flüstern.
Sie gab sich seiner Umarmung hin, die sich warm anfühlte und ihr guttat.
Nach und fügten sich die Mosaiksteine zu einem Bild zusammen: Dies war nicht Asgarö, und Acrab war nicht bei ihr. Sie war mit Kyllen und Marjane unterwegs, die sie auf ihrer Reise begleitet hatten.
Und das bedeutete, dass es doch kein Traum war, wie Acrab ihr gerade in dieser seltsamen Vision versichert hatte. Ihre lange Fahrt, ihre Suche nach der Wahrheit … es stimmte alles.
Vor allem aber hatte sie wirklich gegen diesen Elemental gekämpft und genau gesehen, wie ihr Vater ermordet wurde.
Erschüttert schloss sie die Augen.
Denn der Mann, der seine Klinge im Rücken ihres Vaters Fadi versenkt hatte, jener Mann, den der Elemental ihr gezeigt hatte, war Acrab.
2
26. Dezember, nachts
Notdürftig richteten sie sich in den Klosterruinen ein. Marjane hatte unter den Trümmern einen Raum entdeckt, der ähnlich gut erhalten war wie jener unterirdische Bereich, in dem Phylaitek aufbewahrt wurde. Dieser Raum war rund und hatte unversehrte Holzwände, die nur vom Feuer eingeschwärzt waren. Auch das Dach, ebenfalls aus Holz, war an mehreren Stellen von den Flammen zerfressen worden. Die junge Thyrren stopfte diese Löcher so gut es ging mit den restlichen Stoffresten ihres Umhangs. Dann entzündete sie ein Feuer, ohne Holz und nur mit der Mixtur, jener von Acrab entwickelten Flüssigkeit, die selbst im Wasser brannte und die Myra auf der Reise mit sich führte.
Diese war völlig erschöpft und konnte sich kaum bewegen. Die Wunde am Bauch blutete zwar nicht mehr und schien sogar schon, wie durch ein Wunder, auf dem Weg der Heilung, so als habe eine unbekannte Kraft sie kauterisiert, aber Myra war am Ende ihrer Kräfte. Doch das war es nicht allein: Nicht nur ihr Körper war wie gelähmt, auch ihr Kopf versagte.
Unfähig einen klaren Gedanken zu fassen, hätte sie nicht sagen können, wie lange dieser Kampf auf Leben und Tod gegen den Elemental gedauert hatte: Manchmal meinte sie, es seien nur Minuten gewesen, andere Male, ihr ganzes Leben lang. Kyllen behauptete, es könne nicht länger als eine Stunde gewesen sein, musste aber einräumen, dass mit dem Auftauchen der Elementale das gewohnte Verstreichen der Zeit durcheinandergeraten war.
Myra fühlte sich, als sei sie gestorben und wieder auferstanden.
Und Kyllen erklärte ihr, dass es genau so gewesen war, und erzählte, was sich in der realen Welt zugetragen hatte, bis zu dem Moment, als der gewaltige Schwarm der Elementale herangebraust war. »Du bist der Befreier, Myra, eine andere Erklärung gibt es nicht«, schloss er.
Ohne Gefühlsregung nahm Myra die Nachricht auf. Sie konnte einfach nicht vergessen, was sie gesehen hatte, bekam Acrabs Bild nicht aus dem Kopf, das Bild jenes Mannes, dem sie alles verdankte, was sie ausmachte, der ihr das Leben gerettet und sie zu dem gemacht hatte, was sie heute war, und dann den Anblick, wie eben dieser Mann seine Klinge tief im Körper ihres Vaters versenkte.
»Du weißt, dass es stimmt, dass es sich so zugetragen hat«, hatte der Elemental zu ihr gesagt. Doch ein Teil von ihr klammerte sich weiterhin an die Hoffnung, es möge sich doch als falsch erweisen. Vielleicht handelte es sich um einen Trick, um die Vorspiegelung eines Trugbildes, so wie jene, die sie vor dem Kampf gesehen hatte. Vielleicht wollte jemand sie in die Irre führen, um ihre Entschlossenheit zu erschüttern.
Oder es war doch die Wahrheit, ein weiteres entsetzliches Vermächtnis Phylaiteks, das sie nie mehr würde abschütteln können.
»Alles in Ordnung?«, fragte Marjane mit einem Lächeln, während sie ihr eine Schale mit Suppe reichte.
»Nein, nichts ist in Ordnung.« Myra zuckte zusammen. Zum ersten Mal, seit sie wieder zu sich gekommen war, hatte sie etwas lauter gesprochen, und ihre Stimme, die seit dem Tod ihres Vaters mehr ein Krächzen gewesen war, klang nun völlig normal.
Marjane starrte sie mit großen Augen an. »Deine Stimme …«
Auch Kyllen trat hinzu. »Rede …«
Myra fühlte sich unwohl und wandte das Gesicht ab.
»Entschuldige, du hast recht, ich wollte nicht grob sein … Aber essen solltest du etwas.« Und damit reichte er ihr noch einmal die Schale.
»Ich hab keinen Hunger«, erwiderte sie, und plötzlich verabscheute sie ihre neue Stimme, die sich so weiblich, so wohlklingend anhörte. Auch schmerzte ihr die Kehle nicht mehr, wenn sie sprach, und die Worte kamen ihr mit einer Leichtigkeit über die Lippen, die sie nicht mehr kannte. Ihre krächzende Stimme war der Preis, den sie für Fadis Tod entrichtet hatte, als sie, während er sterbend zusammenbrach, so laut geschrien hatte, dass sich ihre Stimmbänder nie mehr davon erholt hatten. Diese Wunde war alles gewesen, was ihr von ihrem Vater geblieben war. Und nun war auch sie verloren.
Myra fuhr herum und stieß Kyllen dabei die Schale aus der Hand. Dampfend ergoss sich die Suppe über die Erde. Ein Stich in der Seite ließ Myra aufstöhnen.
Kyllen beugte sich über sie. »Vorsicht …«
»Lass mich in Ruhe«, fuhr sie ihn an und stieß ihn zurück.
Kyllen und Marjane sahen sie verwirrt an. Offenbar verstanden sie nicht, was mit ihr los war.
»Ich muss allein sein«, murmelte sie, drehte sich um und kauerte sich auf der Seite zusammen.
Kurz darauf hörte sie, dass sich ihre Reisegefährten entfernten. Sie wollte die beiden nicht kränken, aber sie konnte nicht anders. Sie musste wirklich allein sein, allein mit allem, was sie bedrängte.
Sie versuchte zu schlafen, doch sobald sie die Augen schloss, hatte sie wieder das Bild vor sich, wie Acrab ihren Vater tötete. Immer wieder. Es ließ sie einfach nicht los. Es war fast wieder so wie nach den Morden an Fadi und Tallia, als der Schock keinen anderen Gedanken zugelassen und sie vollkommen beherrscht hatte. Aber schließlich hatte sie nicht nur dieses Bild wiedergesehen, sondern auch dieses entsetzliche Ereignis noch einmal durchlebt, daher war es kein Wunder, dass es sie so vollkommen beherrschte.
Mühsam setzte sie sich auf und blickte sich um. Ein wenig abseits schliefen Kyllen und Marjane nebeneinander und hatten sich mit seinem Umhang zugedeckt. Gerührt betrachtete Myra sie. Ihre Gefährten. Sie bedeuteten ihr viel, doch im Moment fühlte sie sich nicht mit ihnen vereint. Die beiden hätten nicht verstanden, was in ihr vorging. Sie waren nicht dabei gewesen, als der Elemental sie gezwungen hatte, die Ermordung ihres Vaters durch Acrabs Hand mitzuerleben.
Sie stand auf, Stiche durchbohrten ihre Seite. Sie tastete sich an der Wand entlang zum Ausgang. Eisige Luft erfasste sie, als sie die Holzplatte zurückschob, die ihn verschloss. Humpelnd, unter heftigen Schmerzen, schleppte sie sich ins Freie. Der Schnee fiel in dichten Flocken, die ein leichter Wind durcheinander wirbelte.
Da sah sie ihn: Am Boden mitten im Schnee liegend, der die Nacht ein wenig erhellte, zeichnete sich seine mächtige düstere Gestalt vor dem grauen Himmel ab.
Icenwharth, ihr Drache.
Mit unsicheren Schritten trat sie zu ihm und ließ sich keuchend neben ihm nieder. Als er ihr die Schnauze zuwandte, legte sie den Kopf auf seine Schuppen und spürte seine gewaltigen Atemzüge und sein gigantisches Herz, das ruhig und langsam schlug. Und schon schmiegte Icenwharth sich an sie, und so lagen sie wieder beieinander, wie Myra es von den langen Nächten ihrer gemeinsamen Reise her kannte. Damals hatten sie irgendwann gespürt, dass sie zusammengehörten, sie und der Drache, zwei Einzelgänger mit gebrochenen Seelen in den eisigen Landen des Dominiums der Tränen. Und so spürte Myra auch jetzt wieder, dass nur er sie verstand.
»Was soll ich bloß tun?«, fragte sie ihn, während sie über sein Schuppenkleid streichelte. »Was nur?«
Icenwharth schnaubte. Gewiss, eine Antwort konnte er ihr nicht geben, aber er war da, und das war mehr wert als alles andere. Er war da, bei ihr, und würde es immer sein.
So lag Myra neben dem Drachenleib und ließ sich von ihm wärmen. Irgendwann schloss sie die Augen, und eine Weile fühlte sie sich, wenn auch nicht versöhnt, zumindest doch beruhigt. Ihr Geist löste sich von den quälenden Gedanken, und langsam überkam sie der Schlaf.
Doch da war etwas. Sie sprang auf.
Zog die Walud-Klingen, die sie an der Seite trug, und fuhr herum.
Es war Kyllen, der die Hände beschwichtigend ausstreckte. »Schon gut, schon gut, ich bin’s nur.«
Allein diese rasche Bewegung hatte Myra erschöpft. Ihr schwindelte, und sie drohte zu fallen.
Sofort war Kyllen bei ihr und stützte sie. »Warum hörst du nicht auf mich? Du bist nicht in der Verfassung, um …«, schimpfte er, doch weiter kam er nicht.
Myra hatte die Augen wieder geöffnet, die mit einem Mal in einem violetten Licht erstrahlten. Und beide beobachteten, wie sich aus dem Schnee am Boden einige winzige, durchscheinende Elementale erhoben, zu einer Stelle an Myras Bauch schwebten, wo der Verband von frischem Blut getränkt war, und sich daranmachten, die Wunde vollständig zu verschließen.
»Wir müssen reden«, sagte Kyllen.
Gemeinsam kehrten sie in den runden Raum zurück, wo der Magier noch einmal die Wunde untersuchte, die die Elementale gut versorgt hatten. Als er sie wieder verbunden hatte, blickte er auf und sah Myra eindringlich an.
»Was ist denn?«, fragte Myra, wobei sie verlegen den Blick abwandte.
»Als die Elementale um dich herum diesen Strudel bildeten und dann diese Lichtexplosion herbeiführten, haben Marjane und ich das Bewusstsein verloren. Als wir wieder zu uns kamen, lagst du immer noch bewusstlos am Boden, aber du hast wieder geatmet und warst längst nicht mehr so bleich. Offenbar ging es dir schon viel besser. Aber Phylaitek war verschwunden.«
Darüber hatte auch Myra sich schon Gedanken gemacht, aber die schlimmeren Erlebnisse hatten sie verdrängt.
»Ich habe mich gefragt, wohin es verschwunden sein könnte. Und jetzt glaube ich, die Antwort zu kennen. Es steckt in dir drinnen«, fuhr Kyllen fort. Er zeigte auf Myras Gesicht. »Die Farbe deiner Augen hat sich verändert.«
Myra zog einen Dolch aus ihrem Stiefelschaft und betrachtete ihr Spiegelbild auf der Klinge. Zunächst kamen ihr die Augen so wie immer vor. Doch dann sah sie, dass nun ein violett schimmernder Ring ihre Pupillen umschloss, eine Iris, die am inneren und auch am äußeren Rand in das gewohnte Rot überging.
»Was ist geschehen, während du für uns nur bewusstlos dalagst?«
Myra zögerte einige Augenblicke. Wollte sie tatsächlich darüber reden und es so Wirklichkeit werden lassen?
Beide Namen, Acrab und Graffias, bedeuten ›Skorpion‹, hatte Kyllen ihr einige Abende zuvor erklärt.
Und dann erzählte sie ihm alles: Von dem Kampf gegen den Elemental und dass sie gegen sich selbst als kleines Mädchen kämpfen und dieses Mädchen töten musste. Und schließlich von der entsetzlichsten Tatsache, die der Elemental ihr gezeigt hatte.
Schließlich schwieg sie. Sie war sich nicht sicher, ob es gut war, Kyllen in alles einzuweihen, doch zwischen ihnen, dem Magier und ihr, gab es so etwas wie ein Vertrauensverhältnis, und es wäre nicht richtig gewesen, ihm solch wichtige Dinge zu verheimlichen.
»Und wie denkst du darüber?«, fragte Kyllen sie.
Myra zögerte immer noch. Nach ihrem Bericht stand ihr das Bild, wie Acrab ihren Vater tötete, noch lebhafter vor Augen. Sie bekam es einfach nicht aus dem Kopf.
»Es war bloß eine Vision«, sagte sie schließlich. »Nichts von all dem, was heute passiert ist, ist real.«
»Das stimmt so nicht«, entgegnete Kyllen und fuhr fort, während er sie eindringlich anblickte: »Eins steht nun wirklich fest: Du bist der Befreier.«
»Das interessiert mich nicht.«
»Das sollte es aber. Schließlich ist das der Grund, weshalb dein Vater sterben musste. War es nicht das, was du herausfinden wolltest? Die Wahrheit?«
»Ich wollte wissen, wer meinen Vater getötet hat.«
Kyllen bemühte sich, seine Worte genau abzuwägen: »Das ist Vergangenheit, Myra. Den Täter zu kennen, bringt dir deinen Vater auch nicht zurück. Er ist tot, und das schon lange. Danach hat sich noch sehr viel mehr zugetragen. Auch wenn du mit absoluter Sicherheit wüsstest, wer es getan hat, würde es dir kaum weiterhelfen.«
Myra kniff verdrossen die Lippen zusammen und antwortete schließlich: »Glaubst du wirklich, ich könnte damit leben, dass vielleicht mein ganzes bisheriges Leben auf einer Lüge aufgebaut war? Offenbar hast du keine Vorstellung, was mir Acrab bedeutet. Er hat mir das Leben gerettet, damals in der Arena, wo mein Todesurteil vollstreckt werden sollte, nachdem ich einen der Mörder meines Vaters getötet hatte. Zehn Jahre war ich erst alt, und ich habe dem Mann in einer finsteren Gasse aufgelauert und zugestochen. Acrab hat meinen Henker, diesen Gladiator Vesnis, außer Gefecht gesetzt und erreicht, dass er mich mitnehmen durfte. So ging ich mit ihm. Später hat er dann sein Leben aufs Spiel gesetzt, um den Mann zu beseitigen, den er, wie er sagte, für den Auftraggeber des Mordes an meinem Vater hielt. Gemeinsam sind wir in das Schlafgemach dieses reichen Grundbesitzers eingedrungen, und auch ihn habe ich erstochen. Doch bei der Aktion wurde Acrab verwundet, und bevor er das Bewusstsein verlor, dort am Ufer des Kanals, wohin ich ihn geschleppt hatte, sagte er noch zu mir: ›Ich habe es für dich getan, Myra, damit du wieder sprechen kannst.‹ Und tatsächlich gewann ich nach dieser Tat meine Stimme zurück, auch wenn es nur ein Krächzen war und nicht dieser Wohlklang wie jetzt plötzlich wieder, den ich verachte. Acrab hat mich zu kämpfen gelehrt, hat eine Kriegerin aus mir gemacht und mir unzählige weitere Male das Leben gerettet. Acrab gibt diesem Leben überhaupt erst einen Sinn, er ist seit Jahren das, wofür ich lebe. Er war mir Vater und Mutter zugleich, war mir Herr und Meister, war alles, was ich auf der Welt habe.« Myra hielt inne und verschnaufte einige Sekunden.
Kyllen schwieg und sah sie nur an.
»Die Sache ist immer noch offen«, fuhr Myra fort. »Bis jetzt habe ich noch nichts herausgefunden. Alles, was ich entdeckt habe, wirft nur noch mehr Fragen auf. Meine Reise geht also weiter. Es gibt eine nächste Etappe.«
Marjane lag in ihrer Ecke, war aber wach und hatte zugehört. Sie wartete gespannt, wie Myra fortfahren würde.
Auch Kyllen rührte sich nicht und blickte Myra nur weiter an. Er glaubte zu wissen, was sie sagen würde, und dass sie ihm so vertraut war, machte ihm das Herz schwer.
»Ich muss zurück in das Land, in dem alles begann. Das Land, wo ich zu Hause bin. Nach Biaswad.«
3
Acrab
Ruhig lag der Wald da. Kein Windhauch regte sich, und die dicke Schneeschicht verschluckte auch noch die wenigen anderen Geräusche, die man hätte hören können: das ferne Heulen eines Wolfes, ein Ast, der im Frost zerbrach.
Acrab rührte sich nicht und genoss diesen Moment gespannter Ruhe vor der Schlacht. Wie hatte ihm das gefehlt: die Konzentration bis in die feinsten Muskelfasern, das Blut, das schneller durch die Adern schoss, die Erregung und die Furcht in den Augen der Feinde.
»Noch habt ihr Zeit, euch zurückzuziehen«, rief er schließlich. »Ihr habt mein Wort. Ich würde euch kein Haar krümmen.«
Der Anführer des Haufens, dem er gegenüberstand, lächelte höhnisch. Aber Acrab sah deutlich die Angst, die sich hinter dieser Miene verbarg. »Wir sind fünf gegen einen«, rief der Mann.
»Als käme es darauf an.« Und mit diesen Worte sprang Acrab vor und stürzte sich auf den Anführer, denn so lautete die Regel: Schlag den Kopf ab, und der Körper sinkt in den Staub. Aber das schien auch der Mann zu wissen, der ihn bedrohte. Er wich zurück, und seine Leute umringten Acrab und griffen ihn an.
Doch der war darauf gefasst. Blitzschnell drehte er sich einmal um sich selbst und ließ sein Schwert herumfahren. Er traf einen zu seiner Linken, versenkte die Klinge bis zum Heft und stieß ihn mit einem Tritt zu Boden. Dann rannte er zu einem mächtigen Baumstamm, lehnte sich dagegen, sodass er im Rücken gedeckt war. Einen Moment lang standen seine Gegner nur verwirrt da.
»Es ist nur einer, verflucht noch mal!«, rief der Anführer und griff selbst an.
Mit einem weit ausholenden Schlag hielt Acrab ihn auf Distanz, während zwei seiner Kumpane ebenfalls gegen ihn vorrückten. Plötzlich spürte er einen Luftzug zu seiner Linken.
Blitzschnell zog er seinen Dolch und hielt im letzten Moment die feindliche Klinge auf. Doch nun saß er fest.
Mit einem brutalen Grinsen stürzte sich der Anführer wieder auf ihn. Das Schwert in der Rechten, den Dolch in der Linken ließ Acrab beide Klingen gleichzeitig herumwirbeln und befreite sich aus der Falle. Dann warf er sich, den Dolch vorgereckt, auf den Anführer, der zurückwich. Aber er war nicht schnell genug, sodass ihm die Klinge in die Schulter fuhr.
Während er sich aus dem Kampfgeschehen zurückzog, rief er: »Tötet ihn! Verflucht noch mal! Tötet ihn!«
Und gemeinsam warfen die drei, die noch übrig waren, sich wieder in den Kampf. Daran gewöhnt, mit einer Waffe in jeder Hand zu kämpfen, trat Acrab ihnen entgegen. Doch drei Gegner auf einmal waren auch für ihn zu viel. Den ersten verwundete er, doch der zweite traf seinen Arm und riss ihm die Haut bis aufs Fleisch auf. Unwillkürlich wich Acrab zurück und verlor die Konzentration. Der nächste Hieb drohte mit aller Macht von oben auf ihn niederzufahren, und er begriff, dass er ihm nicht mehr würde ausweichen können. Blitzartig durchfuhr ihn der Gedanke: So darf es nicht enden, nicht durch einen dummen Hinterhalt.Nicht bei all dem, was ich noch vorhabe.
Doch dieser Hieb traf nicht, denn eine andere Klinge hielt ihn auf. Der Mann, der sie führte, zog weiter durch, und der Kopf des Angreifers flog davon.
Fassungslos verfolgten die anderen beiden die Szene, und Acrab nutzte ihre Verwirrung und stieß einem der beiden die Klinge ins Herz. Den letzten machte Gotín mit einem Hieb nieder. Dann trat er auf den Anführer zu, der gekrümmt etwas abseits stand, während das Blut, das aus dessen Schulter rann, den Schnee am Boden rot färbte.
»Nein, lass ihn!«, rief Acrab. »Den brauche ich noch.«
Gotín blieb stehen, hielt aber seine Waffe weiter auf den Mann gerichtet, während er sich zu Acrab umdrehte. »Alles in Ordnung?«
»Ja, es ist nur ein Kratzer.«
»Ich habe ja gesagt, es ist besser, sich hier nicht allein rumzutreiben …«
»Was willst du? Ich lebe doch noch.«
»Aber es sah nicht gut für dich aus.«
»Umso besser, dass du mich rausgehauen hast.« Acrab lächelte.
Gotín gelang es nicht, das Lächeln zu erwidern. Der Schreck, fast seinen Herrn verloren zu haben, saß ihm noch in den Gliedern.
»Es ist alles in Ordnung, glaub mir.«
Gotín seufzte. »Und was machen wir mit ihm?«
Der Gefangene sah die beiden hasserfüllt an. Die Klinge, die ihn getroffen hatte, schien die Bänder in seiner Schulter durchschnitten zu haben, denn sein rechter Arm hing schlaff herunter.
»Fessle ihn und gib acht, dass euch niemand sieht. Alles Weitere erfährst du später.«
Gotín nickte. Dann warf er einen Blick auf Acrabs Wunde. »Lass das lieber von jemandem untersuchen. Du solltest mehr auf der Hut sein.«
»Diese lange Kampfpause zehrt an mir«, erwiderte Acrab. »Etwas Ablenkung von Zeit zu Zeit tut mir ganz gut. Aber jetzt komm. Du weißt, wir haben noch etwas vor.«
Ohne Hast legte Acrab die Kleider ab und stieg in die große Metallwanne, die Gotín für ihn in seinem Gemach hatte füllen lassen.
Während draußen der Sturm tobte, genoss er die Wärme, die ihn umgab. Den Heiler hatte er schon aufgesucht. Dieser hatte seine Wunde gereinigt, mit einem Kräuterumschlag versorgt und fest verbunden.
Acrab versuchte, sich zu entspannen. Es war seit Wochen das erste Mal, dass er sich eine Ruhepause gönnte. Dabei hätte er eigentlich Zeit dazu gehabt. Das Königreich Ostar war eingenommen, jetzt galt es nur, diese Herrschaft zu festigen und die nächste Eroberung vorzubereiten. Doch Ruhe war etwas, was Acrab nicht gut bekam. Deswegen hatte er sich auch entschlossen seinem großen Plan zugewandt. Dieses Projekt nahm all seine Kräfte in Anspruch. Jede freie Minute verbrachte er im Wald oder in den unterirdischen Räumen des Palastes, um den Fortgang der Arbeiten zu überwachen. Er schlief nur so viel wie unbedingt nötig und aß sehr wenig. In gewisser Hinsicht war der Überfall der Rebellen an diesem Morgen tatsächlich eine willkommene Ablenkung gewesen.
Er schloss die Augen. Die Anspannung ließ mehr und mehr nach. Er stand kurz davor, den nächsten großen Schritt zu machen, und wie immer erregte ihn das mehr, als dass es ihn sorgte.
Doch in diesem Moment fast vollkommener Entspannung sah er sie vor sich. Myra. Ihre roten Augen, ihr weißes Haar, und im Gesicht einen Ausdruck, den er nicht an ihr kannte, wie von einem urzeitlichen blinden Zorn verzerrt.
Ihr Bild nahm ihn völlig gefangen. Er stieg aus der Wanne und blieb daneben stehen, während das Wasser auf seiner Haut verdampfte. Kurz erblickte er sich im Spiegel. Er war dünn geworden, so dünn, wie er noch nie gewesen war, es sei denn in den finstersten Zeiten seines Lebens. Zwar waren auch seine schlanken Muskeln noch zu erkennen, doch von dem athletischen, starken Körper, wie er ihn noch vor wenigen Monaten besessen hatte, war kaum etwas übrig. Etwas verzehrte ihn von innen. Die Besessenheit für das, was er aufbaute, für seinen großen Plan, gewiss, aber das allein war es nicht.
Sie war es, die Gedanken an sie, die Tatsache, dass er sie vermisste.
Myra war fern, jagte irgendwo irgendwelchen Dämonen nach. Wie oft hatte er sich vorgenommen, sie aus seinem Geist zu tilgen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ohne Erfolg. Er brauchte sie, brauchte sie aus so vielen Gründen und auf so vielerlei Weisen, dass er es kaum hätte erklären können. Myra war gleichzeitig der Eckstein und der Schwachpunkt seiner gesamten Strategie, sie war es, von der alles abhing.
Und er durfte sie nicht verlieren, nicht nach allem, was er investiert hatte. Sie ist dein, und wird es immer sein, sagte er sich. Konzentrier dich nur auf deine Mission. Myra wird zurückkehren, und dann wird alles so wie früher sein.
Doch das zuvor empfundene Wohlgefühl war dahin. Er verzog das Gesicht und begann, sich fertig zu machen.
Zwei Monate zuvor, kurz nach Myras Verschwinden, hatte er Ostar erobert. Alles war so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte, und entwickelte sich zufriedenstellend weiter. Der einzige Zwischenfall war der Tod der Königin Detmarinde gewesen, die er geheiratet hatte. Er hatte die Nerven verloren und sie getötet. Es war das erste Signal, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Nach Jahren striktester Kontrolle über alles, was ihn umgab, über seine Untergebenen, aber auch über seinen Körper und seinen Geist, hatte er Schwäche gezeigt. Aber immerhin war es ihm gelungen, alle Spuren zu beseitigen. Und alles ging wieder seinen gewünschten Gang. So wie immer eigentlich.
Der Tag, der vor ihm lag, würde nicht nur bestätigen, dass alles nach Plan verlief, sondern ihn auch seinem großen Ziel einen guten Schritt näherbringen. Und dieses Ziel war die Eroberung des gesamten Dominiums.
Allein zog er sich weiter an. Früher hatte Myra ihm beim Ankleiden geholfen, doch sie war fort, und er hatte niemanden, der sie hätte ersetzen können.
Seine Rüstung, die er für gewöhnlich im Kampf trug, legte er heute nicht an, sondern wählte eine andere, die er sich kürzlich erst hatte schmieden lassen. Sie war vollständig schwarz und mit kleinen hellen Intarsien versehen, die eine kalte Sonne darstellten. Diese hatte er sich zu seinem Wahrzeichen erwählt, schien sie ihm doch den Weg, den er bisher gegangen war, sowie den, der noch vor ihm lag, hervorragend zu symbolisieren: Wie die Sonne am Himmel würde er einen neuen Morgen bringen, eine neue Zeit, die aber so streng wie die Winter im Norden des Dominiums sein würde. Schließlich warf er sich den Mantel über. Blutrot war er. Seine Untertanen würden glauben, dass er an das flammend rote Haar Detmarindes erinnern sollte, und genau das hatte er geplant, als er sich für dieses Kleidungstück aus schwerem Samt entschieden hatte. Nur wenige hatten Zweifel an den Todesumständen ihrer Königin geäußert, darunter die Rebellen, die ihn heute Morgen in die Enge getrieben hatten.
»Für Detmarinde, die du so erbarmungslos getötet hast«, hatte der Anführer gerufen.
Acrab öffnete die Tür seines Gemachs und stieß auf Gotín, der im Gang auf ihn wartete.
Er blieb bei ihm stehen. »Wie sehe ich aus?«
»Perfekt.«
»Dann lass uns gehen.«
Ihr erster Gang führte sie in den Tempel. Es war noch nicht lange her, dass er Detmarinde dort zum Traualtar geleitet hatte. Er sah sie wieder vor sich in ihrem Brautgewand und erlebte auch den Augenblick wieder, als sich vor den Anblick der Königin Myras Bild geschoben hatte. Schnell versuchte er, diese Erinnerung zu verscheuchen, und schritt zwischen zwei Reihen ehrerbietig blickender Höflinge das Hauptschiff entlang bis zum Altar aus purem Eis.
Dort kniete er nieder und versank im Gebet. Nicht, dass er an einen Gott geglaubt hätte. Im Himmel wie auf Erden herrschten Chaos und Wahnsinn, davon war er überzeugt, und nur den Stärksten war es gegeben, eine sinnvolle Ordnung zu schaffen. Aber es wäre unmöglich gewesen, sich das Dominium der Tränen zu unterwerfen, ohne sich fromm zu geben, und so tat er das, was alle von ihm erwarteten.
Nach einigen Minuten erhob er sich und machte sich auf zu seinem zweiten Ziel.
Er hatte ein kleines Mausoleum für seine tote Gattin errichten lassen. Weil er wusste, wie sehr das Volk seine Königin geliebt hatte, schien es ihm eine gute Idee, einen Ort zu schaffen, wo seine Untertanen die Tote verehren konnten, einen Ort, an dem auch er sich zeigte, so oft es ihm möglich war.
Häufig wurden verstorbene Ostarer einfach dem Fluss übergeben. Für Detmarinde aber hatte Acrab sich etwas Besonderes überlegt: Bei der Beisetzung war dem Fluss Vak nur eine Strähne ihres feuerroten Haares überantwortet worden, die man auf einem mit Kyliroth-Früchten beladenen Boot deponiert hatte, den Früchten jener leuchtenden Pflanzen, die für Farbtupfer im ewigen Eis von Asgarö sorgten. Acrab hatte einige seiner Männer ausgesandt, sie dort zu ernten, um das leere Grab damit zu schmücken.
Die sterbliche Hülle seiner Gattin aber hatte er von einigen Blutmagiern in Eis konservieren lassen, um sie so in einer kleinen Krypta unter dem Palast, die zu jeder Stunde, Tag und Nacht, geöffnet war, ihren Untertanen zu präsentieren. Er hatte angeordnet, dass die tote Königin im besten Licht gezeigt werde. Also hatte man die Leiche geschminkt und frisiert, hatte ihr ein Kleid angezogen, das eigens für diesen Anlass geschneidert worden war, und ihr eine Strähne von seinem, Acrabs, Haar zwischen die Finger gesteckt.
Ihr Haar in der Obhut des Flusses, der Lebensader Ostars, sein Haar in ihrer Hand, als Zeichen ewiger Zugehörigkeit.
In beiden Ländern, Ostar und Asgarö, war man gerührt von Acrabs trauernder Hingabe.
Gemessenen Schritts betrat er nun den Raum. Er war allein. Einige Fackeln, die mit der blauen Flamme der Mixtur brannten, erhellten die Eishöhle. In eine Wand eingelassen, sah er den Leichnam der Königin. Selbst tot war dieser Körper immer so schön wie damals, als er in ihren Palast eingedrungen war und ihr Königreich an sich gerissen hatte. Eine makellose, kühle Schönheit. Acrab erinnerte sich an die Hartnäckigkeit, mit der Detmarinde sich immer wieder geweigert hatte, die Todesurteile, die er ihr vorlegte, zu unterzeichnen.
»Du dachtest, du hättest mich gebrochen, dabei bin ich nur stärker geworden. An dem Tag, als du hier eingedrungen bist und mir alles genommen hast, war ich vielleicht nur eine verwöhnte Prinzessin. Aber ich bin eine andere geworden. Jetzt bin ich wirklich eine Königin, Acrab. Und das ist dein Verdienst«, hatte sie noch zu ihm gesagt, bevor er sie getötet hatte. Und dieses Majestätische strahlte ihr Leichnam aus.
Acrab legte eine Hand an das Eis und dachte einen Moment lang, dass vielleicht alles anders gekommen wäre, hätte er sie unter anderen Umständen kennengelernt. Detmarinde hatte sich nichts zuschulden kommen lassen, außer der Tatsache, ihm im Weg zu stehen. Daher musste er sie töten. Ihm war keine andere Wahl geblieben. Schließlich tat er alles, was getan werden musste, für sein großes Ziel, auch wenn es ungerecht war, auch wenn es ihn selbst schmerzte und er mit diesem Schmerz leben musste.
»Es tut mir leid«, flüsterte er, vertrieb dann aber das Mitgefühl aus seinem Herzen und betrachtete diesen Körper als das, was er war: ein Leichnam, totes, seelenloses Fleisch, ein Trugbild nur.
Er wandte sich ab, verließ den Raum und ließ die Prozession seiner Untertanen, ein jeder mit einer Gabe für die Verstorbene in Händen, eintreten.
Später, nach dem üblichen Abendmahl, trat Acrab auf den Balkon hinaus, von dem aus er sich sowohl nach der Einnahme Ostars als auch zusammen mit Detmarinde gleich nach der Trauung dem Volk gezeigt hatte.
Mit Applaus und Hochrufen empfing ihn die Menge und rief seinen Namen. Er ließ es eine Weile geschehen, hob dann die Hand, und es kehrte Stille ein.
»Heute ist ein trauriger Tag«, begann er, »gleichzeitig aber auch ein glücklicher. Ich werde niemals vergessen, wie viel mir Detmarinde bedeutet, wie viel sie mir geschenkt hat, in den wenigen gemeinsamen Monaten, die uns vergönnt waren. Deswegen wollen wir heute gemeinsam ihrer gedenken.« Gerührter Applaus brandete auf, den Acrab erst vollständig versiegen ließ, bevor er fortfuhr. »Doch vor einiger Zeit habe ich euch ein Versprechen gegeben. Ich versprach, dass ich euch Gerechtigkeit und Wohlstand bringen werde. Dass sich das Dominium grundlegend verändern würde und dass diese Veränderungen von hier, von Ostar, ausgehen würden. Nun denn, ich denke, dass die Zeit reif dafür ist.« Er machte eine wohlüberlegte Pause und ließ den Blick über die Menge schweifen. »In den zurückliegenden Wochen werdet ihr euch gefragt haben, wozu die Einschränkungen nötig waren, die ihr alle gespürt habt. Ihr werdet euch gefragt haben, wo sich eure Söhne aufhalten, warum ich sie an den Waffen ausbilden ließ. Ich bat euch, mir zu vertrauen, und das habt ihr getan, mit einer Hingabe, die mich immer noch zutiefst berührt. Nun aber sollt ihr dafür belohnt werden und die Wahrheit erfahren.«
Acrab gab Gotín ein Zeichen, und der trat vor und stieß einen Mann vor sich her, der mit einer orangefarbenen Jacke und einer roten Hose bekleidet war. Sein geschorener Schädel war über und über mit Tätowierungen bedeckt. Wer ihn von Nahem sah, hätte an seinen Gesichtszügen erkannt, dass es sich, trotz seiner Aufmachung, die ihn als phoinikischen Mönch erscheinen ließ, um einen Landsmann, einen Ostarer handelte. Das Volk unter dem Balkon aber stand weit genug entfernt, um von dem Schwindel nichts zu merken.
Der Mann wand sich und versuchte offensichtlich, etwas zu sagen, aber vorsichtshalber hatte man ihm ein Mittel verabreicht und einen Knebel in den Mund gesteckt.
Währenddessen ließ Acrab sich von Gotín etwas reichen, das er hochreckte und der Menge zeigte: ein Glasfläschchen, leer.
»Ich hatte geglaubt, eine plötzliche Krankheit habe meine Gattin dahingerafft, die Kälte des beginnenden Winters oder etwas Ähnliches sei schuld an ihrem Tod«, fuhr Acrab fort. »Leider erleben wir es ja zu häufig, dass unsere Kinder, unsere Geschwister, unsere Ehefrauen scheinbar grundlos sterben.« Er reckte das Fläschchen noch höher in die Luft. »Aber es war etwas anderes: Es war Gift.« Ein Raunen durchlief die Menge. »Ich habe nicht geruht und Nachforschungen angestellt, und so konnte der Täter schließlich ausfindig gemacht werden.«
Gotín schleuderte den als Mönch verkleideten Mann gegen die Brüstung, und Acrab packte seinen Kopf und zog ihn zurück. Obwohl man ihn ruhiggestellt hatte, warf sich der Mann immer noch wild hin und her und versuchte zu reden.
»Glaubt nicht, dass es sich um einen wahnsinnigen Einzeltäter handelt. Es war nicht sein eigener Plan, hierherzukommen und dieses Verbrechen zu verüben«, rief Acrab mit immer lauterer Stimme. »Nein, er gehorchte einem Befehl!«
Die Menge war erschüttert. Ostar war doch ein friedliebendes Land, und niemand konnte begreifen, warum jemand im fernen Phoinika einen Meuchelmörder aussenden sollte, um ihre Königin zu töten.
»Wisst ihr, was man in den anderen Ländern des Dominiums über euch Ostarer denkt? Dass ihr Blutsauger seid, und Gotteslästerer.« Tatsächlich erschienen die Mühlen, die in Ostar betrieben wurden, den anderen Völkern des Kontinents verdächtig eng verwandt mit jener verfluchten Technik, die Jahrhunderte zuvor den Ersten zum Verhängnis geworden war und die Hundert Tage des Schattens ausgelöst hatte, jene Katastrophe, durch die das Dominium in diese eiskalte Welt verwandelt worden war, die es nun war. »Solange ihr euch ruhig verhieltet, hat man in den anderen Ländern darüber hinweggesehen. Doch nun stehe ich an eurer Seite und habe euch eine bessere Welt versprochen. Deswegen hält man uns für gefährlich.«
Acrab zog sein Schwert, und mit einer blitzschnellen Bewegung schnitt er dem vermeintlichen Mönch die Kehle durch. Ein Schauder durchlief die Menge. Die Leute waren erschrocken, Acrab spürte es und freute sich darüber. Wer Angst hatte, gehorchte und tat, was verlangt wurde.
»Doch wir lassen uns nicht einschüchtern! Ich wusste, dass es so kommen würde und habe vorgesorgt. Denn eben dazu haben meine Befehle gedient, die euch unverständlich erschienen: uns auf alles vorzubereiten.« Acrab hielt wieder inne. »Ja, wir ziehen in den Krieg. Weil man uns den Krieg erklärt hat! Wir ziehen in den Krieg, denn wenn wir jetzt nicht selbst angreifen, werden unsere Feinde es tun.« Noch einmal hielt er kurz inne und wartete, um die Abläufe perfekt aufeinander abzustimmen. Dann fuhr er fort: »Ich weiß, ihr denkt, dass wir nicht stark genug sind. Aber so ist es nicht. So ist es ganz und gar nicht!«, schrie er.
Und in diesem Moment begann ein mächtiges Dröhnen, das allen in die Glieder fuhr, noch bevor es die Ohren erreichte. Es war, als breche die Erde auf. Die Menge wogte, einige schrien panisch auf, nur Acrab rührte sich nicht, während die marmorne Brüstung unter seinen Händen bebte.