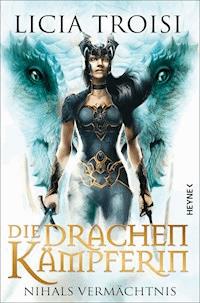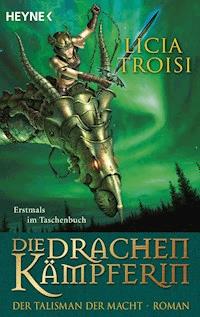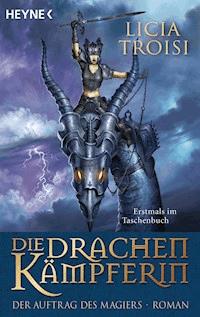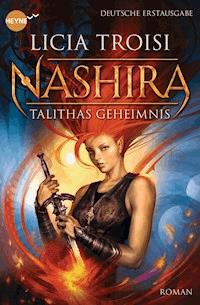
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nashira
- Sprache: Deutsch
»Der hellste Stern am Himmel der Fantasy!« Il Messaggero
Die junge Talitha und ihr treuer Diener Saiph entdecken ein furchtbares Geheimnis: Das Königreich Nashira ist dem Untergang geweiht, sobald die beiden Sonnen, die dem Land Licht spenden, den Zyklus ihrer Transformation vollendet haben. Außer ihnen weiß nur die mächtige Priesterkaste um das bevorstehende Unglück. Doch die Priesterinnen, aus deren Kloster Talitha geflohen ist, setzen alles daran, Talitha und Saiph zum Schweigen zu bringen. Völlig auf sich allein gestellt, versuchen die beiden, ihren Häschern zu entrinnen – und gleichzeitig den Retter zu finden, von dem die alten Legenden erzählen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Licia Troisi
Nashira – Talithas Geheimnis
Licia Troisi
NASHIRA
TALITHAS GEHEIMNIS
Roman
Aus dem Italienischen
von Bruno Genzler
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel
I Regni di Nashira. Le spade dei ribelli
bei Mondadori, Mailand
Copyright © 2012 by Licia Troisi und
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung einer Illustration von © Paolo Barbieri
Redaktion: Ulrike Schimming
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-10296-8
www.heyne-fliegt.de
Danke, Carlo,
für alles, was du mir vermacht hast.
Prolog
Die ersten Strahlen der beiden Sonnen weckten Grele in ihrem Bett. Zumindest das hatte sich in ihrem Leben nicht verändert: Wie auch in ihrem alten Zimmer, das sie im Kloster bewohnt hatte, war auch ihre neue Zelle nach Osten ausgerichtet, sodass schon im Morgengrauen das Licht der Sonnen sie streifte. Eine chaotische, notdürftige Ansammlung von Holzhütten bildete seit einiger Zeit den provisorischen Sitz des Klosters. Graf Megassa, der Herr von Messe und Vater des Mädchens, das für ihr, Greles, Unglück verantwortlich war, hatte es in aller Eile und auf eigene Kosten errichten lassen. Unweigerlich dachte sie jedes Mal daran, wenn sie die Fußbodenbretter unter ihren Füßen knarren hörte. Alles um sie herum kündete ihr von Talitha und von dem, was diese ihr angetan hatte.
Widerwillig setzte sie sich auf. Jeden Morgen erinnerte sie sich daran, wie schön früher das Aufwachen für sie gewesen war, welch tiefes Wohlgefühl sich eingestellt hatte, wenn sie im Licht von Miraval und Cetus die Augen aufschlug. Sie, die Herrin des Klosters – so hatte sie sich immer gesehen und an dieser selbstverständlichen Tatsache auch nicht gezweifelt, als Talitha zu ihnen gekommen war, der alle eine glänzende Zukunft prophezeiten. Denn als Tochter von Jane, dem König des Reichs des Herbstes, war sie, Grele, die aussichtsreichste Novizin des ganzen Klosters. Außerdem war sie die Lieblingsschülerin der einflussreichsten Priesterin, Schwester Dorothea. Lange und beharrlich hatte sie auf diese Stellung hingearbeitet und war sicher gewesen, nichts auf der Welt könne ihre Ernennung zur Kleinen Mutter verhindern.
Ihr Gesicht verzog sich zu einem verbitterten Lächeln, während sie ihre Kombattantinnengewänder anlegte. Wie naiv sie doch gewesen war. Damals hätte sie nie gedacht, dass in Talitha ein solches Maß an Bosheit, an Niedertracht steckte.
Sie dachte an den Moment, als sie die andere das letzte Mal gesehen hatte. Von Flammen umringt hatte Talitha vor ihr gestanden und auf sie, die im Todeskampf am Boden lag, hinabgeschaut. Dann hatte sie sich abgewandt und war verschwunden, hatte sie dort liegen lassen, damit sie in dem Feuer umkam, das Talitha im Kloster gelegt hatte.
Grele wusch sich das Gesicht mit ein wenig Wasser aus dem kleinen Keramikbecken, das im Zimmer stand. Dieses Becken war eines der wenigen Dinge, die sie aus dem alten Kloster hatte retten und mitnehmen können. Doch es war gesprungen und von einem tiefen Riss durchzogen, den ein Handwerker notdürftig und hässlich gekittet hatte.
Das Becken ist wie ich: nur noch ein Schatten dessen, was es einmal war, dachte sie wütend.
Mit einer unwirschen Geste schüttete sie sich einen Schwall Wasser ins Gesicht, und ein heftiger Schmerz durchfuhr sie, denn ihre Gesichtshaut war nach den Verbrennungen, die sie im Feuer erlitten hatte, äußerst empfindlich.
»Geh darüber hinweg«, hatte eine Mitschwester zu ihr gesagt, »denk nur daran, dass du noch lebst. Andere hatten weniger Glück als du.«
Das war leichter gesagt als getan. Keinen Augenblick ließen die Schmerzen sie in Ruhe, so als schwele im Fleisch, unter dem hässlichen, glänzend glatten Schleier der Narben, immer noch ein Feuer, das sich nicht löschen ließ. Sie brauchte es nur mit den Fingerspitzen zu berühren, und die Qualen jener Nacht kehrten zurück.
Heftige Schmerzensschauer schüttelten sie, während ihr das Wasser über die verunstaltete Wange rann. Die eine Hälfte ihres Gesichtes war immer noch schön und zeigte die stolzen, fein ausgeprägten Züge eines Mädchens in der Blüte ihrer Jahre. Doch die andere Hälfte war entstellt. Was ihr Gesicht so hässlich machte, schienen noch nicht einmal die Narben zu sein. Es war vielmehr, als hätten die Flammen ihr Fleisch eingeschmolzen, das nun an den Wangenknochen wie Wachs an einer Kerze hing. Umgeben von der erschlafften Haut, klaffte ein rundes aufgerissenes Auge, ein Auge, das Grele seit jener Nacht nicht mehr schließen konnte.
Lange hatte sie nicht den Mut gefunden, sich im Spiegel anzuschauen. Doch seit sie sich zum ersten Mal dazu durchgerungen hatte, betrachtete sie sich nun jeden Morgen sehr lange. Der Abscheu, den ihr dieser groteske Anblick einflößte, war ein willkommener Stachel für ihren Hass und erinnerte sie daran, dass sie niemals Frieden finden würde, bevor nicht dieses Mädchen vernichtet war, das sie so zugerichtet hatte.
Aus diesem Grund hatte sie, in Erwartung, ihr Noviziat zu beenden und Priesterin zu werden, die Kampfkunst der Kombattantinnen erlernt. Das würde ihr die Rache erleichtern und hatte zudem den Vorteil, dass sie in den Reihen der Kombattantinnen stets eine Maske tragen konnte. Denn diese entstellte Gesichtshälfte zeugte von einer Schwäche, war der sichtbare Beleg einer Niederlage, die sie vor den Augen der Welt verbergen wollte.
Sie zog sich das enge Gewand über den Schultern zurecht. Früher wäre dieser raue Stoff ihrer zarten Haut unerträglich gewesen. Doch heute mochte sie es, dieses Kratzen am ganzen Leib. Es war eine Unbequemlichkeit, die jetzt zu ihr und ihrer Lage passte.
Gerade als sie die Tür öffnen wollte, kam ihr jemand zuvor. Schwester Maleka, ihre Ausbilderin, trat ein. Im Unterschied zu den anderen Kombattantinnen, denen ein Schweigegelübde auferlegt war, durfte sie das Wort an ihre Schülerin richten.
»Du hast Besuch. Er erwartet dich im Tempel«, sagte sie.
Grele fragte nicht, um wen es sich handele, obwohl diese Mitteilung sie erstaunte. Denn noch nie hatte irgendwer sie besucht, nicht in der glücklichen Zeit vor der Zerstörung des Klosters und auch nicht danach. Selbst ihr Vater hatte einen Besuch nicht für nötig erachtet: Nachdem er erfahren hatte, dass sie die Feuersbrunst lebend überstanden hatte, schien es ihm zu genügen, dass sie sich in den kundigen Händen der Heilerinnen befand.
So machte sie sich auf den Weg zum Tempel, bei dem es sich um gerade einmal eine größere Holzhütte mit einem Satteldach handelte. Im hinteren Teil war die Tafel mit dem Antlitz der Göttin Mira aufgestellt, der auf wunderbare Weise das Feuer nichts hatte anhaben können. Aber das Bild wirkte in der neuen Umgebung zwischen schmucklosen Wänden und den zusammengeschusterten Bänken völlig fremd.
Der Gast, der sie zu sehen wünschte, stand in der Mitte des Raumes, das Gesicht zur Tafel gerichtet.
Grele räusperte sich. Der Mann drehte sich um, und sofort brandete eine Welle des Hasses in ihr auf. Es war Megassa, der Vater von Talitha.
Grele dachte keine Sekunde lang nach, sondern sprang mit ausgestreckter Hand auf den Mann zu und wollte ihn am Hals packen. So hatte sie es gelernt. Doch Megassa wich aus, ergriff ihren Oberarm und hielt ihn fest. »Das war ja nicht anders zu erwarten …«, zischte er.
»Warum seid Ihr gekommen?«, knurrte Grele zurück.
»Weil uns beide so einiges verbindet.«
Grele starrte ihn misstrauisch an.
»Durch das Feuer haben wir beide viel verloren«, fuhr der Graf fort. »Man hat uns beide verraten, auf hinterhältigste Weise, und beide hassen wir aus tiefstem Herzen ein und dieselbe Person.«
Grele wand sich in seinem Griff, und endlich ließ Megassa ihren Arm los. Doch ihr entging nicht, dass er eine Hand zum Heft seines Schwertes führte, und so beherrschte sie sich lieber.
»Hättet Ihr sie nicht gedrängt, wäre sie niemals ins Kloster gegangen«, sagte sie nach einer Weile.
»Mag sein, dass ich da etwas falsch eingeschätzt habe«, erwiderte Megassa.
Grele blickte ihn weiter argwöhnisch an. »Warum seid Ihr gekommen? Was wollt Ihr hier?«
»Dich.«
»Mich? Habe ich durch Eure Tochter nicht schon genug verloren? Wollt Ihr es noch einmal sehen? Wer gibt mir mein Gesicht zurück? Ihr?« Und damit nahm sie die Maske ab, die ihre Züge verbarg.
Megassa widerstand dem Impuls, den Blick abzuwenden, und schaute sie unverwandt an.
»Es ist nicht alles verloren. Das ist es nie. Wir sind für unser Geschick selbst verantwortlich, und kein Sturz ist so tief, dass man sich nicht wieder aus dem Abgrund erheben könnte. Du wirst zurückerhalten, was du verloren hast. Und sogar mehr, du musst es nur wollen. Du und ich gemeinsam, wir werden uns zurückerobern, was uns zusteht, und gnadenlos Rache nehmen.«
Mit aller Kraft ballte Grele die Fäuste. »Sie ist Blut von Eurem Blut. Wer garantiert mir, dass Ihr Euer Wort haltet?«
»Sie ist nicht mehr Blut von meinem Blut. Nach dem, was sie getan hat, ist sie nicht mehr würdig, den Namen unserer Familie zu tragen. Verbünde dich mit mir, dann werde ich dir zeigen, wie erbarmungslos Rache sein kann.«
Grele sah Megassa in die Augen, suchte nach einer Bestätigung dessen, was er sagte, und das hasserfüllte Funkeln, das sie in seinem Blick wahrnahm, überzeugte sie mehr als tausend Worte.
»Wie sieht Euer Plan aus?«, sagte sie schließlich.
Megassa lächelte, ein brutales Lächeln.
Erster Teil
1
Flink und sicher bewegten sich die Hände des Ketzers. Talitha konnte nicht anders, als ihnen bewundernd zuzusehen, diesen langen schneeweißen Fingern, die die Kräuter verrührten und zerstießen und dann die Masse auf Saiphs Körper strichen.
Mit wachsbleichem Gesicht lag der junge Sklave da und rührte sich nicht. Bei den Kämpfen in Orea war er vom Schwert eines Soldaten Megassas durchbohrt worden, hatte viel Blut verloren und war nur knapp dem Tod entronnen.
Als der Ketzer sie fand, hatte er die Situation sofort erkannt. Kriegserfahren wie er war, konnte er auf den ersten Blick einschätzen, wie schlimm es um Saiph stand.
»Die Wunde ist sehr tief. Wie hast du ihn bis jetzt behandelt?«, hatte er Talitha gefragt, während er den Einstich in der Rippengegend untersuchte. Fehlerlos redete er in der Sprache Talarias, jedoch in einem Tonfall, den Talitha noch nie gehört hatte.
»Ich habe einen Zauber versucht«, antwortete sie mit zitternder Stimme, wobei sie ihm den Luftkristall zeigte, den sie um den Hals trug.
»Das wird nicht reichen«, hatte der Ketzer knapp geantwortet, sich dann, ohne ein weiteres Wort, Saiph auf die Schultern geladen und ihn aus dem Stollen getragen. Talitha folgte ihm.
Der Ketzer wohnte in einer Höhle inmitten des Eisgebirges. Ein düsterer Gang führte hinein, der so eng und niedrig war, dass sogar Talitha, obwohl von zierlicher Gestalt, den Kopf tief einziehen musste, um sich nicht zu stoßen. Die Behausung, von nahezu rundem Grundriss, bestand aus einem einzigen Raum, der ins Eis hineingeschlagen war.
»Ist das dein Werk?«, fragte Talitha voller Bewunderung.
»Mehr oder weniger«, antwortete der Ketzer.
Der Raum war zwar klein, aber es fehlte an nichts: In einer Ecke erkannte man ein mit Tierfellen überzogenes Lager und auf der gegenüberliegenden Seite eine kleine Feuerstelle, über der in einem Kessel eine Suppe köchelte. Es gab sogar einige Regale, direkt ins Eis geschlagen, voller Gläser und Fläschchen verschiedensten Inhalts sowie ziemlich viele Bücher. Erhellt wurde die Eishöhle durch einen Luftkristall von mittlerer Größe, der an der Decke befestigt war.
Der Ketzer hatte Saiph sofort auf dem Bett niedergelegt und ihn mit den Fellen zugedeckt, dann hatte er sich der Zubereitung der Heilkräuter gewidmet. Währenddessen stand Talitha da und staunte ihn ungläubig an. War dieser über den Mörser gebeugte Alte, der das Leben ihres engsten Freundes zu retten versuchte, tatsächlich jener Mann, nach dem sie monatelang gesucht hatten? Und warum hatte er Verbas Schwert für sich beansprucht, als gehöre es ihm? War er wirklich der Ewige, jenes legendäre Wesen, das den Krieg zwischen Mira und Cetus überlebt haben sollte? Und zu welcher Rasse gehörte er? Eigentümlich und fremd waren seine Haut und die Proportionen seiner Gliedmaßen. Was Talitha besonders beeindruckte, war sein Rücken. Unter seinem Gewand waren zwischen den Schulterblättern zwei Schwellungen zu erahnen, die dort den rauen, mit geronnenem Blut besudelten Stoff wölbten. So als sei ihm etwas amputiert worden.
»Gib mir den Luftkristallanhänger«, sagte er.
Er hatte die Masse auf Saiphs Wunde verstrichen, und Talitha, die versunken zugeschaut hatte, schrak auf. Sofort reichte sie ihm den Anhänger, und der Ketzer führte ihn zum Munde und besprach ihn, kaum vernehmlich, mit einigen Worten einer Talitha unbekannten Sprache. Kurz darauf erstrahlte der Anhänger in einem magischen Licht. Der Ketzer legte ihn auf die Salbe über der Wundstelle, die am tiefsten zu sein schien, und umwickelte Saiphs Oberkörper mit einigen Binden.
»Deine Resonanz scheint sehr stark zu sein …«, murmelte Talitha. »Du kannst mit dem Luftkristall sicher große Zauber vollbringen.«
Der Ketzer antwortete nicht, stand auf und trat zur Feuerstelle. Talitha beugte sich über Saiph und betrachtete sein Gesicht. Es wirkte immer noch erschreckend blass, doch atmete er schon ruhiger.
»Wird er durchkommen?«, fragte sie.
Der Ketzer zuckte mit den Achseln. »Es war gut, wie du die Blutung gestoppt hast. Aber er hat dennoch viel Blut verloren. Außerdem könnte sich die Wunde entzünden.«
»Schafft er es oder nicht?«, fragte Talitha noch einmal.
»Die Heilkunst kennt keine exakten Vorhersagen. Wir müssen abwarten, wie er die Nacht übersteht.«
Von einer Kelle, die er in den Kessel getaucht hatte, schlürfte der Ketzer ein wenig Suppe, griff dann zu zwei Holzschalen, füllte sie und stellte eine davon vor Talitha hin.
Sie rührte die Suppe nicht an. Zu sehr entsetzte sie der Gedanke, vielleicht ohne Saiph weiterleben zu müssen. Es war unvorstellbar. Seit Kindertagen war er immer an ihrer Seite gewesen. Obwohl er ihr Sklave war, waren sie gemeinsam aufgewachsen, und bei allem, was sich in ihrem Leben ereignet hatte, war er in irgendeiner Form dabei gewesen. Besonders nach dem Tod ihrer Schwester Lebitha. Seitdem war er das Einzige, was ihr auf der Welt geblieben war.
Laut schlürfend löffelte der Ketzer seine Suppe. »Du solltest dich auch stärken. Du hast mit Sicherheit einen anstrengenden Tag hinter dir«, sagte er.
»Ich bekomme keinen Bissen hinunter, mein Magen ist wie zugeschnürt«, murmelte Talitha.
»Dann musst du dich zwingen. Glaub mir, du siehst auch nicht gesund aus, und das Letzte, was dein Freund brauchen kann, ist eine Begleiterin, die selbst zusammenbricht. Du musst jetzt für ihn da sein.«
Talitha warf noch einen Blick auf Saiph und gab sich dann einen Ruck. Sie griff zu der Schale und schnüffelte daran. Der Geruch war nicht schlecht, die Suppe schien gut gewürzt zu sein. Und so nahm sie den Löffel und tauchte ihn langsam hinein.
»Als wir uns begegnet sind, habe ich dir eine Frage gestellt und stelle sie dir jetzt noch einmal: Wie kommst du zu meinem Schwert?«, sagte der Ketzer nach einer Weile.
Talitha schluckte etwas Suppe hinunter und antwortete dann, während sie den Blick auf ihn richtete: »Das kann nicht dein Schwert sein.«
»Wieso? Was verlangst du? Dass ich dir eine Besitzurkunde vorlege?«
»Seit Ewigkeiten, so haben mir die Priesterinnen es erzählt, befand sich dieses Schwert immer in einem Schrein im Kloster von Messe.«
Der Ketzer lachte auf. »Und du glaubst tatsächlich, was dir die Priesterinnen weismachen wollen? Es war eine von ihnen, die mir die Waffe geraubt hat. So eine ganz junge, die die Krieger deiner Rasse im Krieg segnete. ›Mira ist mit uns! Mira beschützt uns‹, rief sie in einem fort. Ja gewiss … Mira ist immer mit allen. Aber am Ende verliert doch eine Seite, und die andere gewinnt«, erklärte er spöttisch.
Talitha erwiderte nichts und löffelte die Suppe weiter. Lange schwieg sie.
»Du sprichst vom Antiken Krieg, nicht wahr«, sagte sie schließlich.
»Ja, so nennt ihr ihn wohl«, antwortete der Ketzer.
»Der wurde vor siebenhundert Jahren ausgetragen!«
»Ja, das kann ungefähr stimmen.«
»Niemand überlebt siebenhundert Jahre.«
»Dann musst du wohl mit einem Geist reden.«
Talitha sprang auf. »Wer bist du? Und woher kommst du?«
Der Ketzer richtete den Löffel auf sie. »Setz dich!«
»Monatelang habe ich nach dir gesucht«, rief Talitha aufgebracht. »Saiph hätte den Versuch, dich zu finden, fast mit dem Leben bezahlt, und du sitzt einfach da, isst deine Suppe und erzählst mir etwas von einem Krieg, der sich vor Hunderten von Jahren zugetragen hat!«
»Warum hast du mich denn gesucht?«
»Weil du erkannt hast, was mit unseren Sonnen geschieht. Weil dir klar ist, dass unsere Welt dem Untergang entgegengeht. Und weil du weißt, wie sich das verhindern lässt.«
Der Ketzer blickte Talitha an, und zum ersten Mal blitzte so etwas wie Interesse in seinen Augen auf. »Wenn ich dir deine Fragen beantworten soll, will ich zunächst einmal Antworten von dir hören. Ich hatte dich gefragt, wie du an dieses Schwert gekommen bist«, sagte er und zeigte auf die Waffe, die schärfer und funkelnder als je zuvor im kalten Licht, das den Raum erhellte, an der Höhlenwand lehnte.
Talitha setzte sich wieder und legte die flache Hand an die Stirn. Diese Begegnung lief nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte.
»Ich habe es mir einfach genommen, im Kloster von Messe«, gab sie schließlich zu und berichtete dann ausführlich, wie sich die ganze Geschichte zugetragen hatte, erzählte von den Monaten im Noviziat, zu dem ihr Vater sie nach dem Tod seiner Erstgeborenen, ihrer Schwester Lebitha, genötigt hatte, von dem Geheimnis, das die Priesterinnen dort im Kloster hüteten und das Lebitha das Leben kostete, von dem Feuer, das sie gelegt und in dem das Kloster niedergebrannt war, von ihrer Flucht und ihrer langen Wanderung auf der Suche nach ihm, dem Ketzer, dem Einzigen, der wusste, was Cetus’ Erstarken entgegenzusetzen wäre, und schließlich auch von der Treibjagd, mit der ihr Vater und die Priesterinnen sie überall in Talaria verfolgten.
»Ich verstehe«, sagte der Ketzer, als sie geendet hatte. »Deswegen bist du also geflohen, und deswegen wurde Orea dem Erdboden gleichgemacht.«
»Ja, so ist es …« Talitha spürte, wie der Hass wieder in ihr aufstieg, der sie auch schon angesichts der brennenden Stadt überkommen hatte. Angesichts dieses bohrenden Gefühls verblasste alles andere.
»Ein Wunder, dass ihr entkommen seid. Sie hatten ganz Orea umzingelt.«
»Du hast den Kampf wohl aufmerksam verfolgt«, bemerkte Talitha.
»Ja. Und sie werden euch nun überall suchen«, sagte der Ketzer.
»Das sind wir gewohnt. Aber ich habe dir nun alles erzählt. Sagst du mir jetzt, wer du bist?«
»Wie heißt das Schwert, das du trägst?«
»Verbas Schwert.«
»Eben. Und so lautet auch mein Name. Verba. Ich war es, der es geschmiedet hat.«
»Unmöglich. Dann müsstest du ja über siebenhundert Jahre alt sein.«
»Nein, fünfzigtausend. So ungefähr. Nach so langer Zeit kann man sich schon mal um ein Jährchen vertun«, sagte Verba.
»Niemand kann so lange leben …«
»Ich schon.«
Talitha schwieg. Irgendwie spürte sie, dass dieser seltsame Mann die Wahrheit sagte. »Was bist du?«, raunte sie.
»Ich bin ein Relikt der Vergangenheit. Ein Mann, der schon längst nicht mehr leben sollte, jedenfalls nicht hier an diesem Ort.«
»Du bist weder Talarit noch Femtit. Welcher Rasse gehörst du an?«
»Auch wenn ich es dir sagte, du könntest nichts damit anfangen.«
»Verrate es mir trotzdem.«
»Ich bin ein Shylar«, murmelte der Ketzer, wobei er das fremde Wort rau und zischend aussprach.
»Gibt es noch mehr Angehörige deiner Rasse?«
Verba zögerte einen Moment. »Nein. Alle starben.«
»Und wodurch?«
»Sie starben eben. Was hat es für einen Sinn zu wissen, wie sie gestorben sind? Das würde an der Tatsache nichts ändern«, brauste er auf.
»Als man dich gefangen genommen hatte, wurdest du auch verhört. Da hast du davon gesprochen, was uns allen droht …«
»Ja, das habe ich«, sagte Verba und sah sie mit stechendem Blick an.
»Und dass die Bedrohung mit den beiden Sonnen zusammenhängt, die über Nashira scheinen.«
»Ja, so ist es.«
»Das heißt, sie werden tatsächlich alles verbrennen … Cetus wird uns alle umbringen«, stöhnte Talitha.
»Ja.«
»Aber wie können wir ihn daran hindern?«
Verba sah sie lange an. Seine Augen waren von reinstem Azurblau und so klar wie tiefe Abgründe, in denen man sich leicht verlieren konnte. Etwas Unergründliches, längst Vergessenes lag darin, eine eigene, fremde Welt, die Talitha Angst einflößte.
»Ich kann dir nicht helfen.«
»Kannst du nicht, oder willst du nicht?«
Verba schwieg und schaute sie weiter an. Talitha überlegte, dass er, kräftig wie er war, sie mit einem Schlag töten könnte, wenn ihm der Sinn danach stand. Und sie fragte sich, ob er nicht genau darüber nachgrübelte, während er sie mit diesem entsetzlichen Blick anstarrte. »Erzähl mir doch, was du weißt«, versuchte sie es noch einmal.
Verba schüttelte den Kopf. »Es gab einmal eine Zeit, da habe ich mich für euer Schicksal interessiert. Aber ich habe zu viele Gräueltaten von eurer Seite gesehen. Ihr könnt es nicht lassen, einander bis aufs Mark auszubeuten oder gleich niederzumetzeln. Ja, ich habe euch beobachtet und kann dir versichern, aus der Ferne wirkt ihr nur grotesk mit euren theatralischen Versuchen, euch gegenseitig zu überleben, während ihr Tag für Tag unaufhaltsam dem sicheren Ende näher kommt. Und ich werde euch weiter beobachten. Mehr nicht. Denn mehr könnte ich nicht tun. Sobald es deinem Freund besser geht, werdet ihr beide von hier verschwinden.«
Mit diesen Worten nahm er ihr die Schüssel aus den Händen und kippte die restliche Suppe in die Flamme, die zischend erlosch. Dann wickelte er sich in seine Decke und schien augenblicklich eingeschlafen.
Unfähig sich zu rühren, saß Talitha da und ließ ihren Tränen freien Lauf. Es war alles sinnlos … Alles, was ich versucht habe, war vergeblich.
Mit dem Rücken zu ihr lag Verba starrköpfig auf seinem Lager, kniff die Augen fest zusammen und bemühte sich, an etwas anderes zu denken, damit sein Geist nicht von Mitleid getrübt wurde. Doch während Talitha weinte und weinte, wollte der Schlaf in dieser Nacht einfach nicht kommen.
2
Als Talitha erwachte, wurde der Raum ein wenig von dem Licht erhellt, das durch den Höhlenzugang fiel. Offenbar standen die Sonnen schon höher am Himmel. Am Abend waren ihr, ohne dass sie es gemerkt hatte, irgendwann die Augen zugefallen, und jetzt war ihr Kopf so schwer, dass sie meinte, eine halbe Ewigkeit geschlafen zu haben. Doch einen Moment später begriff sie, was geschehen war, während sie geschlafen hatte: Verba war auf und davon.
Er hatte alles mitgenommen, was er tragen konnte: In dem Regal in der Eiswand befanden sich nur noch drei Gläser mit Heilkräutern, einige Lebensmittel sowie ein Buch. Wenigstens hat er mir das Schwert dagelassen, dachte sie mit einem bitteren Lächeln. Auf dem Tisch fand sie ein Pergamentblatt; darauf stand, wie und über welchen Zeitraum sie Saiph noch behandeln sollte, und darunter nur die Bemerkung:
Habe ihn eben noch einmal untersucht. Er wird durchkommen.
Keine Zeile zu den Gründen für sein Verschwinden, kein Wort, das auf ihr Streitgespräch vom Vorabend Bezug genommen hätte. Still und leise hatte er sich aus dem Staub gemacht, ganz ähnlich wie er damals aus der Festung in Danyria verschwunden war. Er hatte ihnen nur so weit geholfen, wie es für Saiphs Überleben unbedingt notwendig war, dann war er verschwunden.
Eine blinde Wut überkam sie, und sie knüllte das Blatt zusammen. Nach all den Gefahren, denen sie sich ausgesetzt hatten, um diesen Mann zu finden, ließ er sie im Stich, ohne ihnen auch nur irgendetwas zu erklären. Aber wieso war sie eigentlich nicht aufgewacht, als er in der Höhle seine Sachen zusammengepackt hatte? Er musste ihr ein Schlafmittel in die Suppe getan haben, anders konnte sie sich das nicht erklären. Jedenfalls hatte sie wie eine Tote geschlafen und nichts bemerkt.
Obwohl sie wusste, dass es keinen Sinn mehr hatte, rannte sie hinaus. Von Verba keine Spur, weder auf der gefrorenen Fläche, die sich vor der Höhle ausbreitete, noch am Horizont. Das Versteck lag an einem steilen Hang der Ausläufer des Eisgebirges, und zu Talithas Füßen breitete sich das Reich des Winters wie eine exakte, fein gearbeitete Landkarte unter der Glocke eines grauen Himmels aus. In der Ferne brannte Orea immer noch. Der Rauch war so dicht, dass er sogar das Geäst des Talareths, der die Stadt überwölbte, durchdrang und immer weiter aufstieg, bis er sich zwischen den Wolken verlor. Talitha musste an all das Elend denken, mit dem sie in den vergangenen Wochen, auf ihrer Wanderung, in Berührung gekommen war. Vielleicht war der Umstand, dass Cetus immer greller wurde und das ewige Gleichgewicht mit seiner Zwillingssonne ganz aus den Fugen zu geraten drohte, nur die Folge dessen, was sich auf der Erde zutrug: Hungersnöte, Gewalttaten, Ausbeutung der Sklaven, all das nahm täglich schlimmere Ausmaße an. Oder war es vielleicht immer schon so gewesen, und sie hatte es nur nicht bemerkt, in ihrem goldenen Käfig, in dem sie am Hof ihres Vaters gelebt hatte?
Sie schaute sich um und erkannte, dass auch über einigen Ansiedlungen im Umland Rauch aufstieg: Offensichtlich fraß sich das Feuer immer weiter. Ihr zog sich der Magen zusammen. Sie seufzte, und dabei stieg eine dichte, weiße Atemwolke vor ihrem Mund auf. Es war entsetzlich kalt. So kehrte sie in die Höhle zurück und widerstand dem Impuls, Verba zu verfolgen und ihn aufzuspüren, egal wo er sich verstecken mochte. Es war völlig ausgeschlossen, sich mit Saiph auf den Weg zu machen, aber ebenso, ihn allein zurückzulassen. Und außerdem: Selbst wenn es ihr gelänge, Verba wiederzufinden, wie sollte sie ihn dazu bringen, mit ihr gemeinsame Sache zu machen? Wenn es stimmte, was er ihr erzählt hatte, und aus irgendeinem Grund glaubte sie seinen Worten, so unglaublich sie klangen, dann hatte sie nichts in der Hand, was ihn umstimmen würde. Womit sollte man auch einen Mann, der seit Jahrtausenden alles überlebt hatte, beeindrucken?
Seine Anweisungen auf dem Pergamentblatt waren präzise. Fünf Tage lang befolgte Talitha jeden einzelnen Punkt und zeigte sich als vorbildliche Heilerin. In regelmäßigen Abständen nahm sie Saiph den Verband ab, reinigte die Wunde und behandelte sie so, wie Verba es aufgeschrieben hatte. Dabei wurde der Luftkristall nach und nach immer schwächer. Sie musste daran denken, wie schwierig es gewesen war, diesen Anhänger zu bekommen, und einen Moment lang kam ihr auch Melkise in den Sinn, der Kopfgeldjäger, der sie geschnappt hatte und sie an Megassa ausliefern wollte. Sie fragte sich, was wohl aus ihm geworden war, und aus Grif, dem Femtitenjungen, den er bei sich aufgenommen hatte. Kurz hatte sie auch wieder dessen Augen vor sich, die sie so angsterfüllt angeschaut hatten, während sie ihn mit einem Zauber behandelt hatte. Fast bis zum Tod hatte er gekämpft, um seinem Herrn treu zu dienen. Und Saiph war ihm ähnlich, ihr treuer Freund, der immer noch bewusstlos in dieser Höhle lag.
Wenn sie nicht Saiph pflegte oder sich etwas zu essen machte, durchstöberte Talitha Verbas Unterschlupf, auf der Suche nach irgendeinem Anhaltspunkt, wohin er aufgebrochen sein könnte. Oder sie saß, eingewickelt in mehrere Schichten Tierfelle, vor der Höhle und wartete auf seine Wiederkehr. Vergeblich.
Orea brannte nicht mehr, aber nachts war die Finsternis mit Dutzenden und Aberdutzenden von Lichtern getüpfelt, neue Brände, die sich längs der Baumpfade ausbreiteten, diesen hölzernen Stegen, die die einzelnen Ansiedlungen Talarias miteinander verbanden. Irgendwann begriff Talitha, dass es sich dabei um die Folgen von Femtiten-Aufständen handeln musste und von Kämpfen, die die Sklaven gegen die regulären Truppen führten. Mit dem Herzen ganz bei den Unterdrückten, die sich endlich wehrten, beobachtete sie mit Sorge die Drachenformationen, diese winzigen Punkte, die sie unter den Talareth-Kronen kaum noch ausmachen konnte. Wenn sie überlegte, dass vielleicht ihr Vater dort im Sattel saß, hoffte sie inständig, dass er abstürzen möge, bezweifelte aber, dass ihr solch ein Glück beschieden sein würde. Im Grunde war ihr klar, dass ihr Vater sie nicht in Ruhe lassen, dass er sie jagen und nicht rasten würde, bis er sie endlich wieder in der Hand hatte.
Unter den Kräutern, die Verba für sie zurückgelassen hatte, fand Talitha auch die Mixtur, mit der sie sich, auf dem Weg zu den Eisminen, die Haare gefärbt hatte. Seitdem waren sie ein gutes Stück nachgewachsen, und immer deutlicher war ein roter Ansatz zu erkennen. Sie färbte die Haare wieder grün, mit der Farbe, mit der sie unter den Femtiten nicht auffiel, und ging dabei so eifrig zu Werke, als könne sie nicht schnell genug alle Spuren ihrer Vergangenheit beseitigen. Rot war die Farbe ihrer Rasse und verkündete unmissverständlich: Sie war eine Talaritin, mochte es ihr auch noch so unerträglich sein. Sie hasste ihre Rasse so sehr, dass sie bereit war, sie mit allen Mitteln zu bekämpfen.
Sie nahm Verbas Schwert und löste die Stofflappen, mit denen sie das Heft umwickelt hatte. Die Waffe erstrahlte in ihrem vollen Glanz. Stolz betrachtete sie sie in dem rötlichen Licht des Sonnenuntergangs, mit dem Cetus und Miraval die Wolken übergossen. Die Schneide sah aus wie in Blut getaucht.
An den Tagen, während sie auf Saiphs Genesung wartete, nahm Talitha manchmal auch das Buch zur Hand, das Verba in der Eishöhle zurückgelassen hatte. Es war eigentlich nicht mehr als ein kleines Heft, das in abgegriffenes Leder gebunden war. Es schien uralt zu sein: Einige Seiten wirkten wie von der Zeit aufgelöst, andere waren unleserlich geworden. Aber wo noch etwas zu lesen war, konnte sie immer Verbas Handschrift erkennen, mit der er ihr das Pergamentblatt beschrieben hatte. Doch so sehr sich Talitha bemühte, ein paar Worte zu verstehen, es gelang ihr nicht. Diese Sprache war ihr völlig fremd.
Während sie wieder einmal dasaß und überlegte, ob sie es behalten oder aus Enttäuschung verbrennen sollte, schlug Saiph die Augen auf.
Im ersten Moment hatte er das Gefühl, wieder ein kleiner Junge zu sein, so wie damals, als er neben seiner Mutter in ihrer kleinen Kammer im Palast des Grafen Megassa erwacht war. Der begrenzte Raum zwang sie zu einer Nähe, die Saiph liebte. Und er mochte es, wenn er vor ihr wach wurde, denn dann hatte er Zeit, die Umarmung seiner Mutter zu genießen, ihre Wärme, ihren Duft. Mit geschlossenen Augen lag er dann da, presste sich eng an sie und kostete jeden Augenblick in vollen Zügen aus. Diese wenigen Glücksmomente am Morgen schenkten ihm genügend Kraft, mit der er alles überstand.
Während er nun langsam wieder zu sich kam, war Saiph ganz erfüllt von diesem Gefühl, das er an jenen so lange zurückliegenden, halb vergessenen Morgen empfunden hatte.
Wenn dies der Tod ist, will ich mich nicht groß beschweren, dachte er, und der Name seiner Mutter kam ihm in den Sinn, und er hauchte ihn, atemlos. Doch das Gefühl hielt nicht lange an.
Nach und nach spürte er seinen Körper. Es war eine seltsame Empfindung, die von allen Gliedern ausging und ihm langsam in den Kopf hinaufzog, ähnlich einer unerträglichen Last, einer zu scharfen, zu starken Wahrnehmung seiner selbst, wie er sie noch nie zuvor erlebt hatte. Er wollte sich aufrichten, doch die Anstrengung verschlug ihm den Atem. Er sank zurück, seine Muskeln entspannten sich, und er fühlte sich etwas besser, doch die Last, die ihn niederdrückte, wollte nicht weichen. Sie quälte ihn. Allein die Augen zu öffnen fiel ihm schwer, und schon diese einfache Bewegung sorgte dafür, dass ihm der Schädel scheinbar platzte.
Über ihm spannte sich ein bläulich glänzendes Gewölbe, das ein kalt schimmerndes Licht zurückwarf. Ein Stück eines Luftkristalls. Saiph murmelte irgendetwas, woraufhin Talitha in seinem Blickfeld auftauchte.
»Guten Morgen«, sagte sie und lächelte.
Ihr Haar, das wieder in blassem Grün gefärbt war, sah zerzaust aus, und ihr Lächeln hatte etwas Gequältes, so als sei es nicht wirklich aufrichtig.
»W… wo … sind wir hier? Was ist geschehen?«
»Ach, du hast eine ganze Menge verpasst«, antwortete Talitha immer noch lächelnd. »Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnerst?
»Orea«, antwortete Saiph, dem das Sprechen schwerfiel. Dieses seltsame Gefühl in der Kehle war noch beklemmender geworden.
Talitha erzählte ihm von Verba und was alles während seiner Bewusstlosigkeit vorgefallen war, nur konnte Saiph ihr kaum folgen. Zwar hörte er heraus, dass es überaus wichtige Mitteilungen waren, doch diese unbekannten körperlichen Empfindungen waren so stark, dass er sich auf nichts anderes besinnen konnte.
»Aber sag doch mal, wie fühlst du dich überhaupt?«, fragte Talitha schließlich, die seinen ungewöhnlichen Zustand bemerkt hatte.
»Merkwürdig, sehr sehr merkwürdig …«, murmelte er.
»Was meinst du damit?«
»Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht erklären. Aber … es wird wohl damit zu tun haben, dass ich noch so schwach bin. Mach dir keine Gedanken, ich bin sicher bald wieder auf den Beinen.«
Er sagte das, ohne selbst daran zu glauben, doch Talitha schien es zu beruhigen. Sie legte ihm eine Hand auf die Brust. »Dann ruh dich gut aus, und denk erst einmal nur an dich, ja? Verba hat mir alles Notwendige aufgeschrieben. Er meint, dass es noch ein paar Tage dauern wird.«
Saiph nickte. »Weißt du … ich dachte … nein, ich war sicher, dass ich tot bin.«
Talithas Blick verdüsterte sich. »Ich hatte große Angst um dich. Aber ich habe dir immer wieder gesagt, während ich dich hier heraufgeschleift habe: Wann du stirbst, das entscheide immer noch ich.«
Zur Bekräftigung streckte sie den Zeigefinger aus und berührte dabei, unabsichtlich, eine seiner verletzten Rippen. Saiph riss den Mund auf und schrie so laut, dass Talitha überrascht zurückschreckte.
»Was ist?«, fragte sie.
»Ich hab es gespürt … so als würde ich … ich weiß nicht … mit dem Strafstock geschlagen. Aber es war doch anders … durchdringender … Ach, ich kann es nicht erklären. So etwas habe ich noch nie erlebt.«
Noch einmal, nun sanfter, berührte ihn Talitha mit der Fingerspitze an der empfindlichen Stelle. Sofort strahlte die Empfindung in Saiphs ganzen Körper aus, wenn auch nicht so stark wie beim ersten Mal. »Es ist wieder genauso«, stöhnte er.
Talithas Blick hellte sich auf. Aber diese Eingebung war so ungeheuerlich, dass sie selbst sie gleich wieder verwarf, obwohl es auf der Hand lag. Auf irgendeine geheimnisvolle und unerklärliche Weise hatte Saiph die Fähigkeit erlangt, die Femtiten eigentlich verschlossen war: Er empfand Schmerz.
3
Saiph hatte nie geglaubt, dass körperliche Schmerzen so stark sein könnten. Bis zu diesem Zeitpunkt war er sicher gewesen, dass es nichts Schlimmeres als den Strafstock gäbe und dass jeder Talarit zutiefst schockiert wäre, wenn er einmal am eigenen Leibe verspüren würde, was ein Femtit auszuhalten hatte, der damit geprügelt wurde. Doch dieses Gemisch aus Empfindungen, das seinen Körper nun in der Gewalt hatte, war etwas völlig anderes als der psychische Schmerz, den der Luftkristall am Ende des Strafstocks den Femtiten verursachte. Sein ganzes Leben lang waren Körper und Geist für ihn vollkommen voneinander getrennt gewesen. Nun jedoch lehrte ihn die bis dahin unbekannte Wahrnehmung, dass das Fleisch mit dem Geist unlösbar zu einem großen Ganzen verbunden war. Denn der Schmerz hinderte ihn sogar daran, einen klaren Gedanken zu fassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!