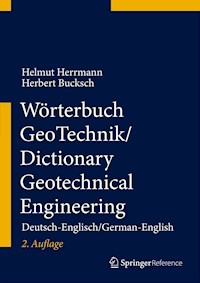Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wer hat nicht einmal davon geträumt, als Zeitreisender in der Vergangenheit unterwegs zu sein. Für Jacques Berger, einem Touristen, wird dies unfreiwillig zum Albtraum. Es verschlägt ihn ins 19. Jahrhundert in ein verschlafenes Dorf namens Rennes-le-Château. Dort lernt er Abbé Bérenger Sauniére kennen, der gerade dabei ist, mit zwei Amtskollegen geheimnisvolle Dokumente zu entschlüsseln. Kurz danach ist nichts mehr wie vorher und das Unheil nimmt seinen Lauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
Jacques Berger und seine Frau Claudia, zwei deutsche Touristen, verbringen einen idyllischen Urlaub im Roussillon. Beide sind sehr an der Geschichte Südfrankreichs interessiert, deshalb beschließen sie, eines Tages nach Rennes-le-Château, einem Dorf in der Nähe der Pyrenäen aufzubrechen. Sie möchten dort auf den Spuren des Abbé Bérenger Saunière wandeln, der um 1900 dort lebte und wirkte. Neben einem angeblichen Goldschatz soll dieser bei der Renovierung seiner Kirche auch geheimnisvolle Dokumente entdeckt haben. Während des Aufenthaltes in diesem Dorf gerät Berger durch einen mysteriösen Zeitsprung in dieses Jahrhundert und lernt Saunière kennen. Dieser ist gerade dabei, mit seinen beiden Amtskollegen aus den Nachbardörfern, die besagten Dokumente zu entschlüsseln und bringt dadurch sich und andere in große Gefahr.
Der Autor:
Helmut Herrmann, geb. 1956, lebt in Nürnberg und schreibt Kurzgeschichten und Romane. Mit der Dilogie „Der Fluch von Rennes-le-Château“ stellt er sein erstes Werk vor. Vor allem hat es ihm dabei der Mythos um Abbé Bérenger Saunière angetan.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Homps (Südfrankreich) 2012
Rennes-le-Château 1897
Besprechung
Rückkehr zur Villa
Erneute Zusammenkunft
Im Tour Magdala
Zwischenspiel
Wieder in Saunières Turm
In der Villa
Waschtag
Abreise
Rennes-le-Château
Coustaussa
PROLOG
Er wollte dem Tod entfliehen, aber jetzt war er ihm näher als jemals zuvor. Auf keinen Fall durfte er aufgeben, immer nur nach oben blicken. Gleichzeitig riefen sie ihm von unten etwas zu, aber das Rauschen des tosenden Wasserfalls übertönte alles. Ein falscher Tritt und sein Leben wäre keinen Pfifferling mehr wert.
„Oh Vater im Himmel“, betete er verzweifelt, „hilf mir, dies zu überstehen.“ Die einzige Antwort darauf kam von einem Raubvogel, keine zehn Meter von ihm entfernt.
Er nahm jetzt all seinen Mut zusammen und tastete sich mit den Füßen weiter nach unten, dabei immer Ausschau nach einem Felsvorsprung haltend, auf dem er halbwegs sicheren Tritt finden konnte. Da passierte es – er rutschte ab mit dem rechten Fuß und gleichzeitig verlor er seinen Schuh. Seine Hände schwitzten, sein Herz klopfte wie verrückt, dennoch krallte er sich wie ein Tier an der Wand fest und bekam buchstäblich in letzter Sekunde noch ein Stück Fels zu fassen. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten seine drei Kameraden nur noch gelähmt vor Entsetzen zusehen können, wie sein junger Körper vor ihnen auf dem Boden zerschmettert wäre.
Nach einer quälenden Stunde, die ihm wie eine halbe Ewigkeit vorkam, kam er endlich unten an.
Wie ein Pilger, der heiligen Boden betritt, warf Philippe sich nieder, um diesen zu küssen. Nie mehr wollte er so etwas erleben, schwor er sich. Sie blickten gemeinsam noch ein letztes Mal nach oben, woher sie noch vor wenigen Augenblicken gekommen waren und wo sich ihnen die Burg wie ein Adlerhorst darbot, dann drängte Hugon, neben Amiel einer der Ältesten zum Aufbruch. Er erinnerte sie daran, was der eigentliche Grund ihrer Flucht sei, sie mussten dieses Holzbehältnis unbedingt noch heute finden. Die Angreifer konnten jeden Moment von ihrer Flucht erfahren haben und dann gnade ihnen Gott. Die Lasset-Schlucht, in der sie sich befanden, war keinesfalls mehr sicher.
Sie rannten um ihr Leben und erreichten nach wenigen Kilometern in einem Waldgebiet genau die Stelle, wie man sie ihnen in der Burg beschrieben hatte. Nachdem sie das Kästchen ausgegraben hatten, öffneten sie es und stellten erleichtert fest, dass sich neben etwas Geld, das für ihre weitere Flucht reichen sollte, auch die Dokumente noch darin befanden.
Weil sie ziemlich erschöpft waren, legten sie eine kurze Pause ein. Da! Das Knacken eines Asts war zu hören, was war das? Sie konnten nicht lokalisieren, aus welcher Richtung es kam. War es ein Tier, war es ein Mensch?
Ihnen lief ein eiskalter Schauer den Rücken hinab. „Weiter, weiter, macht schnell“, flüsterte jetzt Amiel ungeduldig. Er hatte Recht, sie durften sich nicht länger hier aufhalten, Hauptsache, das Behältnis war in ihrem Besitz, das Einzige was zählte, und sie durften es nicht dem Feind in die Hände fallen lassen. Dessen Inhalt war das gesamte Vermächtnis ihrer Glaubensbrüder und ihn galt es in Sicherheit zu bringen.
Zu allem Überfluss begann auch noch das Wetter umzuschlagen. Würde es zu regnen beginnen, würde sich der teilweise abschüssige Pfad, auf dem sie sich befanden, in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln. Dies hätte ihnen gerade noch gefehlt. Durch die vorhergehende Kletterpartie in den steilen Felswänden der Schlucht hatten sie viel Zeit und Kraft eingebüßt.
Sie mussten versuchen, in Caussou, das war das nächstgelegene Dorf, eine Übernachtungsmöglichkeit zu bekommen, auch wenn sie nicht wussten, ob die Kreuzfahrer dort ebenfalls schon präsent waren. Ihnen blieb nichts übrig, als dieses Risiko einzugehen.
Sie hatten Glück. Kurz bevor der Regen immer näher kam, sahen sie das erste Bauernhaus. Sie eilten darauf zu und diskutierten mit dessen Besitzer bis er sie in seiner Scheune übernachten ließ. Hauptsache, sie waren im Trockenen und konnten sich endlich ausruhen. Sogar zum Essen bekamen sie dort etwas, wenn auch nur Brot und Käse – aber immerhin, es war mehr als sie erwarten durften.
Ihr weiterer Weg führte sie durch einzelne Dörfer, die sich fast in keinerlei Weise voneinander unterschieden. Überall fand man die für diese Gegend typischen Natursteinhäuser vor, die sich in ihrer Bauweise bis in die heutige Zeit erhalten haben. Zur großen Erleichterung der Gefährten passierte nichts mehr Nennenswertes. Meist zogen sie schweigend ihres Weges dahin, keiner von ihnen wagte es dabei, das eigentliche Ziel ihrer Mission infrage zu stellen. Man hielt sich mit etwaigen Gefühlsäußerungen, seien es Zweifel am Gelingen oder einfach nur Erschöpfung, zurück, ganz so, wie man es von ihnen als Angehörige ihrer Glaubensgemeinschaft schon immer erwartet hatte.
So vergingen die Tage, ihr erklärtes Ziel jedoch stand fest. In der Burg auf dem Montségur, wo sie noch vor wenigen Tagen gelebt hatten, hatte man sie instruiert, die Schriftrollen unbedingt zur Burg Usson zu bringen. Dort wäre man noch sicher, weil zwischen beiden Burgherren verwandtschaftliche Beziehungen bestünden.
Jeder von ihnen freute sich darauf, endlich wieder einmal ein festes Dach über dem Kopf zu haben, in richtigen Betten zu schlafen und als abschließende Pflichtübung einen ihrer Gottesdienste zu besuchen. Sie waren zwar als Angehörige des albigensischen Glaubens zu anspruchslosen Menschen erzogen worden, aber nach den Strapazen, die sie durchgestanden hatten, war dies das Mindeste, was sie sich vorstellen konnten.
Als sie dort ankamen, wurde ihre Hoffnung jäh zerstört. Bereits bei ihrer Ankunft im Dorf unterhalb der Burg befiel sie eine dunkle Vorahnung. Ein vorsichtiger Blick nach oben ließ zusätzlich nichts Gutes ahnen, gespenstisch und verlassen lag sie auf einem steilen Felsen.
Ein unbestimmtes Gefühl der Angst und Verzweiflung ergriff von ihnen Besitz. Hugon fasste sich ein Herz und ging auf einen der Dorfbewohner zu, die Anderen folgten ihm. Dieser, ein schon etwas älterer Mann, bestätigte dann auch ihre Vermutung.
„Ihr kommt zu spät“, meinte er. Er zeigte nach oben. „Dort oben ist niemand mehr. Die meisten haben die Burg über Nacht verlassen. Einen Tag später waren die Kreuzfahrer da. Jeder, der sich noch in ihrem Inneren aufhielt, wurde von ihnen umgebracht.“
Die jungen Leute ließen ihre Köpfe hängen, teilweise hatten sie Tränen in den Augen. All ihre Hoffnung schien dahin zu sein.
Der Einzige, der ihnen noch Mut zu machen versuchte, war Hugon: „Uns bleibt nichts übrig, als uns bis zur Burg Queribus durchzuschlagen.“
„Dass uns dort dasselbe Schicksal wie hier erwartet, nein danke“, meldete sich jetzt Peytavi zu Wort, der bisher Schweigsamste unter ihnen.
Amiel widersprach: „Tatsache ist, dass wir nicht hierbleiben können. Anscheinend wissen sie ja nun, was wir vorhaben.“
„Du meinst, dass sie vielleicht hier irgendwo in der Nähe auf uns warten?“ Hugon sah ihn dabei fragend an und Amiel nickte nur bestätigend.
„Das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Denn sonst hätten sie uns ja gleich hier umbringen können. Wie gesagt, unsere einzige Möglichkeit besteht noch darin, dass wir die Burg Queribus aufsuchen. Also was ist, kommt Ihr mit?“
Damit konnte Hugon seine Gefährten überzeugen, dieses riskante Vorhaben umzusetzen.
Wenig später setzten sie ihre Flucht fort. Sie wussten, dass unterwegs noch viele Gefahren auf sie lauern würden, denn nicht nur die Kreuzfahrer bereiteten ihnen Kopfzerbrechen, es waren auch einfache Wegelagerer, die vor allem in der Dämmerung ihrem Handwerk nachzugehen pflegten und nicht davor zurück schreckten, Wanderer wegen einiger Münzen umzubringen. Auch gab es Wölfe und reißende Bäche, die ihnen unter Umständen zu schaffen machen würden. Dabei drangen sie immer weiter in diese hügelige Landschaft, die den Pyrenäen vorgelagert war, vor. Man gelangte nach Quillan, von dort der Aude entlang nach Axat und erreichte glücklicherweise nach wenigen und nicht nennenswerten Zwischenfällen Couiza, wo man sich dafür entschied, die weniger von Reisenden frequentierte Straße nach Perpignan einzuschlagen. Einzig ihr Glaube an Gott, der sie bisher nicht verlassen hatte, half ihnen weiter, dies alles durchzustehen. Sie hatten wieder Mut gefasst und wurden dadurch zuversichtlich, es doch noch bis an ihr Ziel zu schaffen. Der nächste Ort, den sie erreichten, war Rennes-le-Château, wo das Vermächtnis der Katharer mehrere Jahrhunderte später einen blutigen Tribut fordern sollte.
HOMPS (SÜDFRANKREICH) 2012
Es war gegen sieben Uhr morgens, als eine abwechselnd von Sturm und Regen gepeitschte Nacht sich ihrem Ende zuneigte. Noch etwas benommen richtete ich mich in unserem französischen Bett auf, in dem wir beide, meine Ehefrau Claudia und ich, nun schon seit zwei Tagen nächtigten.
Zwar war es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig für uns, aber ich hatte in relativ kurzer Zeit gelernt, mein Terrain darin zu verteidigen. Aber wir waren beide nicht so dick und hatten deshalb immer noch genügend Platz für uns.
Leise, auf Zehenspitzen, schlich ich mich jetzt aus dem Schlafzimmer und schloss die Türe hinter mir so geräuschlos, wie es ging. Danach schlurfte ich durch den langen Gang bis zur Wohnküche. Dort angekommen schob ich die Vorhänge an der großen Fensterfront zur Seite. Dann öffnete ich die Terrassentür und ließ frische Luft herein. Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen und die ersten Sonnenstrahlen durchbrachen die Wolkendecke. Es versprach, ein wunderschöner Tag zu werden. Zum Glück, denn ich wollte keinesfalls zu Hause bleiben. Im Urlaub verspürte ich immer einen ausgesprochenen Bewegungsdrang. Schließlich waren wir in Frankreich, meinem Lieblingsurlaubsland. Der Ort, für den wir uns entschieden, hieß Homps und lag direkt am Canal du Midi. Unser Traum war es eigentlich gewesen, auf dieser beliebten Wasserstraße eine Fahrt mit dem Hausboot zu unternehmen. Aber da es sich empfahl, diese Vergnügungstour nach Möglichkeit mit mehr als zwei Personen zu bestreiten, verwarfen wir unser ursprüngliches Vorhaben. So konnten wir wenigstens am Ufer des Kanals ab und zu spazieren gehen.
Unser Dorf lag etwa 35 Kilometer südöstlich von Carcassonne und gehörte zum Languedoc. Bei einem Spaziergang durch das Dorf kam man an einem Gebäude vorbei, das entfernt an eine Scheune erinnerte. Dessen Tore standen weit offen und es roch intensiv nach gepressten Trauben. Offensichtlich lieferten hier die Winzer der Umgebung ihre süßen Früchte aus dem Weinbaugebiet ab, um sie weiter bearbeiten zu lassen. Da ich immer über mein Urlaubsziel informiert sein wollte, hatte ich gelesen, dass man diese Gegend als Minervois bezeichnete und es sich hier um eine der bekanntesten Weinregionen Südfrankreichs handelte.
Wenn man diesen Geruch nach vergorenem Alkohol einatmete, lief man bereits Gefahr, alleine vom Vorbeigehen schon betrunken zu werden.
Unsere Wohnung befand sich zum Glück etwas außerhalb des Dorfes, trotzdem konnten wir das Ortszentrum innerhalb von höchstens zehn Minuten bequem zu Fuß erreichen. Was uns aber am meisten begeisterte, war ein herrlicher Duft von Lavendel, Thymian, Rosmarin und anderen mediterranen Gewürzen, der einem sofort in die Nase stieg, wenn man zur Haustür hinausging. In der gesamten Ferienwohnanlage befanden sich Beete mit all diesen Pflanzen. Es war eine wahre Freude.
Unser Urlaubsort war eigentlich ein ziemlich gottverlassenes Dorf mit überwiegend älteren Einwohnern. Das Einzige, was hier für Abwechslung sorgte, waren die Bootsfahrer auf dem Canal du Midi. Das Tollste für uns war jedoch das berühmte Cassoulet, eines der französischen Nationalgerichte überhaupt, das es in den Restaurants zu essen gab. Es schmeckte hervorragend und man konnte schon fast süchtig danach werden.
Es war immer noch sehr früh und ich begab mich auf die Terrasse unserer Ferienwohnung, um die herbstliche Morgenluft durch meine Lunge hindurch strömen zu lassen.
Da unsere Wohnung eingebettet zwischen den angrenzenden Ferienhäusern lag, hatte man zwar keinen besonders anspruchsvollen landschaftlichen Ausblick, aber dafür herrschte eine ausgesprochene Ruhe.
Der Grund dafür lag auf der Hand: Ende September, befanden sich nicht mehr viele Urlauber in dieser Gegend und so konnten wir getrost unsere Seele baumeln lassen, nur ab und zu von einem idyllischen Vogelgezwitscher unterbrochen.
Während ich also dies alles genoss, hörte ich, dass sich im vorderen Teil unseres Appartements die Schlafzimmertür öffnete und Claudia schlaftrunken und behäbig in Richtung Küche schlich. Ohne große Eile aktivierte sie die Kaffeemaschine und deckte für uns beide den Frühstückstisch. Dann begab sie sich zu mir ins Freie und wünschte mir einen guten Morgen. „Dass heute so ein schönes Wetter ist, hätte ich nicht erwartet. Das war ja ein furchtbarer Sturm heute Nacht. Und dann noch dieser blöde Regen. Ich habe fast kein Auge zugemacht“, beschwerte sie sich, „Aber lass uns erst mal reingehen und frühstücken.“
Als wir dann beim Essen saßen, verriet sie mir, dass sie wieder einmal einen ihrer seltsamen Träume gehabt hätte.
„Stell dir vor“, begann sie, „wir wären in ein kleines völlig fremdes Dorf gefahren. Und dann hätten wir dort die alten Häuser besichtigt.“ Sie spielte währenddessen nervös mit ihrer Uhr am Handgelenk.
„Und dann wärst du plötzlich ohne jeglichen Grund ohnmächtig geworden und von einem Moment auf den anderen vor meinen Augen verschwunden. Ich habe dann überall nach dir gesucht – aber ohne Erfolg. Du bliebst wie vom Erdboden verschluckt“. Völlig schockiert sei sie dann anschließend aus dem Schlaf aufgewacht, verriet sie mir, um gleichzeitig beruhigt festzustellen, dass ich selig schlummernd nach wie vor neben ihr im Bett gelegen habe.
„Cauchemar“, murmelte ich.
„Was?“
„Cauchemar“, wiederholte ich, „du hattest einen Alptraum.“
Aber keine Angst, so schnell wirst du mich schon nicht los“, stichelte ich weiter. „Aber jetzt mal was anderes: Was schlägst du eigentlich für heute vor?“
Sie überlegte nun kurz: „Wir könnten ja in dieses mysteriöse Rennes-le-Château fahren, was meinst du? Ist das eigentlich weit von hier?“ „Also, auf der Karte schaut es nicht besonders weit aus, aber ich gebe es mal in unser Navigationsgerät ein, dann wissen wir mehr.“ Ich gab Start und Ziel ein und nach wenigen Augenblicken zeigte es eine Entfernung von 80 Kilometern an.
„80 Kilometer!“, brüllte ich jetzt durch die Wohnung, da sie schon wieder im Schlafzimmer verschwunden war, um die Betten zu machen. Weil ich keine Lust hatte, weiter zu brüllen, nahm ich das Navi in die Hand und ging zu ihr ins Schlafzimmer. „Ich denke, so in etwa ein- bis eineinhalb Stunden sind wir dort. Wir können ja vorher noch kurz zum Supermarkt runtergehen und etwas Verpflegung und Getränke für unterwegs kaufen. Was meinst du?“
Sie stimmte mir zu.
Wir verließen unsere Bleibe und begaben uns durch den Hinterausgang der Ferienanlage auf kurzem Fußweg hinunter an den Canal du Midi. Ein weiteres Mal überlegte ich mir, dass ich zu gerne selbst mit Claudia darauf entlanggefahren wäre. Aber gerade wenn man nur zu zweit ist, ist die Gefahr, sich die Hände beim Vertäuen des Bootes aufzuschürfen oder sie sich einzuzwängen, zu hoch. Aber vielleicht können wir irgendwann noch eine solche Bootsfahrt mit Freunden bewältigen. Wer weiß? Dennoch schlug mein Herz immer schneller, wenn wieder eines der Boote in die Anlegestelle von Homps einfuhr.
Wir kauften nur das Nötigste, vor allem aber Getränke für unterwegs und beeilten uns, dass wir möglichst schnell wieder nach Hause kamen. Dort packten wir eine Flasche Mineralwasser, ein paar mit Wurst belegte Scheiben Baguette, den Fotoapparat und natürlich eine gut gefüllte Geldbörse in unseren Rucksack und schlossen sämtliche Fenster in der Wohnung.
Dann fuhren wir endlich mit unserem Leihauto los, einem Peugeot mit den für französische Autos typischen „Kampfspuren“. Man muss der Leihwagenfirma aber zugutehalten, dass sie uns bei der Übergabe fragten, ob uns diese paar Kratzer etwas ausmachen würden. Wir verneinten dies und genossen dabei mehr die inneren Werte, womit ich den Fahrkomfort meine, denn dieser war vollkommen akzeptabel.
Wir fuhren zunächst parallel zum Canal du Midi auf der Landstraße nach Trèbes. Dort überquerten wir sowohl den Canal du Midi als auch die Aude. Wir verließen die Stadt und folgten der nördlichen Umgehungsstraße nach Carcassonne, einer der größten mittelalterlichen Festungsstädte in Europa. Claudia und ich sahen die Stadt bereits von der Landstraße aus. Unwirklich wie in einem Märchen lag sie vor uns und ihre Dächer schimmerten golden glänzend in der Sonne. Eine gewaltige Stadtmauer umschlang sie wie ein Lindwurm, der seine Beute nicht mehr hergeben wollte.
Kurz nach dieser Traumstadt bog nun unsere Straße nach Süden in Richtung Limoux ab und führte direkt in die nicht mehr fernen Pyrenäen hinein.
Wir fuhren immer wieder durch einen Kreisverkehr und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass unsere französischen Nachbarn unbestrittene Weltmeister in Sachen „Giratoire“ sind. Was mich betrifft, hatte ich jedenfalls noch nie so viele davon überquert wie in diesem Land. Wir befanden uns jetzt bereits in den Corbières, dem hügeligen Vorland der Pyrenäen, und es dauerte nicht mehr lange, bis wir Limoux erreichten.
Die Stadt war für uns enttäuschend. Wir hatten gehofft, etwas von der altehrwürdigen Westgotenstadt Rhedae zu entdecken, aber es gab keine Hinweise mehr auf ihre ruhmreiche Vergangenheit. Für uns eher langweilig, sodass wir schnell weiterreisten.
Von Limoux aus war es nicht mehr weit nach Couiza, das sich bereits am Eingangstor zu den Pyrenäen befand. Die Landstraße dorthin führte durch prächtige Alleen, welche südliches Flair vermittelten.
Wegen der Kürze der Strecke brauchten wir auch keine Pause und kamen deshalb zügig voran.
Die Gegend wurde immer hügeliger.
Als wir Couiza erreichten, wies uns das Navigationsgerät darauf hin, dass wir die Abbiegung nach links in Richtung Rennes-le-Château nehmen müssten. Sie führte uns über eine teilweise etwas steilere Serpentinenstraße hinauf bis an den Fuß des Ortes, wo wir eine größere freie Fläche erkannten.
Auf dieser befand sich ein Besucherparkplatz, auf welchem jedoch gähnende Leere herrschte. Offensichtlich waren wir die einzigen Besucher um diese Zeit und so hatte ich die Qual der Wahl, wo ich das Auto abstellen sollte.
Wir stiegen aus und Claudia stützte sich am Auto ab. „Das waren etwas zu viele Serpentinen.“ Sie war auffallend blass im Gesicht und ich schlug mir vor die Stirn. Wieder einmal hatte ich vergessen, dass meine Frau nicht schwindelfrei war. An der frischen Luft änderte sich dies aber wieder ziemlich schnell. Außerdem bot sich uns bereits vom Parkplatz aus ein fantastischer Ausblick auf das umliegende Hügelland. Immerhin hatten die Berge hier auch schon eine ziemlich ansprechende Höhe, so zum Beispiel der südöstlich von uns gelegene Pic de Bugarach.
Claudia ging es etwas besser und wir machten uns auf den Weg, die zum Ort hinführende Straße hochzulaufen. Dabei warf sie mir hin und wieder immer noch strafende Blicke zu.
Unmittelbar am Ortseingang empfing uns eine Tafel, auf welcher der wohl berühmteste Einwohner des Ortes und seine heimliche Geliebte abgebildet waren: Abbè Bérenger Saunière und seine Haushälterin Marie Dénarnaud. Natürlich waren sie der Grund unseres Besuches im Dorf. Sie sind auch die Ursache, weshalb der ganze Ort vor allem im Sommer von einigen Zehntausend sensationsgierigen Esoterikern, seriösen und unseriösen Wissenschaftlern und immer wieder auch Schatzsuchern überlaufen ist.
Dieser Geistliche lebte von 1885 bis 1917 in Rennes-le-Château und wohnte dort in einem luxuriösen Pfarrhaus zusammen mit seiner um viele Jahre jüngeren Haushälterin, welche erst in den 1950er Jahren verstarb. Er kam damals als junger Mann aus dem Priesterseminar heraus in dieses abgelegene und vollkommen unbedeutende Dorf. Als er seine zukünftige Wirkungsstätte erblickte, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen. Die Kirche war nur noch eine Ruine. Das Dach war fast nicht mehr vorhanden und ein Gottesdienst konnte nur abgehalten werden, wenn es nicht gerade regnete. Saunières größtes Problem bestand also darin, auf möglichst schnellem Weg Geldmittel aufzutreiben, mit deren Hilfe er das Gotteshaus zumindest notdürftig renovieren könnte. Nach einiger Zeit bekam er diese tatsächlich durch Spenden zusammen und begann mit Hilfe der örtlichen Handwerker mit dem Wiederaufbau.
Eines Tages, es war um die Mittagszeit, entdeckte einer seiner Helfer in der Verschalung der Kirchenwände einige merkwürdige Schriftrollen und verständigte sofort den Geistlichen. Saunière begutachtete sie etwas und schickte die Männer daraufhin kurzentschlossen nach Hause. Der Pfarrer schloss sich dann über Nacht in seiner Kirche ein und versuchte angestrengt hinter den Zusammenhang der Sätze auf den Papieren zu kommen, jedoch gelang es ihm nicht. Er hatte zwar als Priester Latein lernen müssen und die Dokumente waren auch zumindest teilweise in dieser Sprache, jedoch ergab die Anordnung der Worte keinen Sinn.
Deshalb nahm er die Papiere mit ins Pfarrhaus und sperrte sie in den Schrank seines Arbeitszimmers ein. Dann erzählte er seiner Haushälterin von dem Fund und gab ihr sogleich den Auftrag, den Abbè Henri Boudet aus Rennes-les-Bains, einen sehr geschätzten Kollegen von ihm, zu holen.
Als dieser eintraf, schlossen sich die beiden Männer in Saunières Büro ein und machten sich daran, die versteckte Botschaft der Dokumente zu entschlüsseln. Allerdings war danach nichts mehr wie vorher in dieser Gegend, denn Saunière hatte nicht nur diese Schriftrollen gefunden, sondern angeblich bereits davor einen Goldschatz, auf den er stieß, als er nach der Renovierung seiner Kirche eine Bodenplatte dort entdeckte. Als er diese anhob, stieß er auf einen Geheimgang, der ihn unterirdisch in ein Labyrinth führte, in dem dieser „sagenhafte Schatz“ verborgen lag.
Mit dessen Hilfe ging es dann mit Saunière und Rennes-le-Château stetig aufwärts. Über die Herkunft des Schatzes gab es verschiedene Spekulationen. Die Erklärungsmöglichkeiten reichten von den Templern, über die Westgoten bis hin zu den Katharern. Sie alle hatten entweder in Rennes-le-Château oder in der Umgebung davon etwas verborgen. Noch in den 1950er Jahren, also einige Jahrzehnte nach Saunières Tod, kamen viele Schatzsucher in dieses Gebiet, jedoch blieb ihre Suche bis heute erfolglos. Und dies, obwohl Marie Dénarnaud den Dorfbewohnern versicherte, dass sie auf purem Gold wohnen würden.
Für einige Minuten betrachteten wir die Porträts der Beiden ziemlich ausgiebig. Dabei überkam mich ein merkwürdiges, ja fast unheimliches Gefühl, so als wäre ich für einen kurzen Augenblick in einem Gruselfilm als Darsteller gelandet. Vor allem Saunière selbst war es, dessen Gesicht mich in diesem Augenblick so faszinierte. Er hatte einen freundlichen und dennoch irgendwie stolzen Gesichtsausdruck. Mir war auch bekannt, dass er eine stattliche Erscheinung gewesen sein muss, ein Frauenschwarm, wenn man so will. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass er aus Montazels stammte, einem weiteren Dorf hier ganz in der Nähe und die typischen spanischen Einflüsse äußerten sich sicherlich nicht nur in den Namen der Orte in dieser Gegend. Die Menschen hatten auch schon fast einen iberischen Charakter. Das jedenfalls konnte ich mir gut vorstellen. Da war es bestimmt für ihn ein Leichtes gewesen, seiner Haushälterin den Kopf zu verdrehen.
Zu diesem merkwürdigen und unheimlichen Gefühl kam noch etwas Anderes. Als ich mich nämlich umdrehte und die Häuser am Ortseingang von Rennes-le-Château betrachtete, bekam ich plötzlich für kurze Zeit eine gänzlich andere Wahrnehmung, so, als würden sie aus einem anderen Jahrhundert stammen. Was war mit mir los? Aber dann normalisierte sich alles wieder und wir folgten weiter der Hauptstraße des Dorfes. Wir kamen in der Dorfmitte an. Fast kein Mensch, außer ein paar Touristen wie wir, war unterwegs. Die wenigen Läden, die wir erkennen konnten, schienen geöffnet zu sein. Ein großer Hund trabte uns gemächlich entgegen, blickte uns kurz an und legte sich dann einfach mit ausgestreckten Gliedmaßen quer über die Straße. Wahrscheinlich wollte er Siesta halten, nur der Ort war dafür etwas ungewöhnlich.
Ein Autofahrer fuhr hinter uns langsam die Straße herauf. Als er den Hund sah, hupte er, um ihn von seinem Liegeplatz zu verscheuchen, dieser machte jedoch keinerlei Anstalten, sich wegzubewegen. Erst als einer der Dorfbewohner zufällig vorbeikam und ihn mit einem energischen „Allez! Allez!“ von der Straße scheuchte, konnte der Autofahrer seine Fahrt fortsetzen. Gleich danach legte sich der Hund wieder auf die Fahrbahn, als ginge ihn das alles gar nichts an.
„Tja, das ist eben das südfranzösische Dorfleben“, kommentierte ich. Claudia grinste bestätigend. Es verdeutlichte uns auf anschauliche Weise, dass die Mentalität in dieser Region nicht nur alleine von den Menschen Besitz ergriffen hatte.
Wir setzten unseren Weg fort und kamen zu einem freien Platz, an dessen Ende sich eine hüfthohe Steinmauer befand. Auf diesem Dorfplatz gab es mehrere Parkplätze, einige Bäume, unter denen sich Sitzbänke befanden und nicht zuletzt das Rathaus, das wir zumindest an seiner Beflaggung als solches identifizierten. In diesem war nicht nur der Amtssitz des Bürgermeisters, sondern auch die Touristeninformation untergebracht. Ein nicht zu übersehendes großes "i" wies darauf hin.
Wir schlenderten weiter zu einer Steinmauer. Dort angekommen, genossen wir einen herrlichen Ausblick auf das unter uns liegende Hügelland und die sich etwas weiter befindlichen Gipfel der Pyrenäen, die bereits mit Schnee bedeckt waren. Claudia beschloss, die Toilette in der Tourist-Info aufzusuchen und ich versprach ihr, hier inzwischen die Stellung zu halten.
Nachdem sie verschwunden war, beobachtete ich leicht belustigt, wie ein Kleinwagen angefahren und auf einem der Parkplätze zum Stehen kam. Kurz darauf quälte sich langsam aber stetig eine mehrköpfige Familie aus dessen Innerem. Wenige Minuten später verließ meine Ehefrau wieder das Rathaus.
Danach beschlossen wir, die Villa Bethania, das eigentliche von Saunière erbaute Pfarrhaus, und die daran sich anschließende Kirche mit dem klangvollen Namen „Sainte Marie-Madeleine“ zu besichtigen. Als wir davor standen, ragte sie in ihrer ganzen Herrlichkeit als zweistöckiger Prachtbau vor uns auf. Es nötigte uns ein befremdetes Kopfschütteln ab, da es uns so ganz und gar nicht in das gesamte, von Natursteinhäusern geprägte Bild des kleinen Dorfes zu passen schien. Trotzdem diente sie Saunière als Pfarrhaus, in dem er nicht nur für seine Esoterikerfreunde, sondern auch für die Bewohner des Dorfes ein paar Mal im Jahr Bankette abhielt. An der Eingangstüre konnten wir feststellen, dass es inzwischen zu einem Museum umfunktioniert wurde, das wir allerdings nicht besuchten. Ich hatte mich vor unserer Reise ausgiebig über den Ort und seine berühmten Bewohner informiert. Deshalb erinnerte ich mich, dass der Abbè aber meistens gar nicht in der Villa anzutreffen war, sondern ein paar hundert Meter weiter im ebenfalls von ihm erbauten Tour Magdala, einem Turm mit 22 Zinnen auf dessen Dach. Dort hatte er sich sein Büro und eine beachtliche Bibliothek eingerichtet, welche ihm auch oft als Schlafstätte diente. Die wenigsten Menschen durften ihn in diesem Gebäude stören, wenn er seine zahlreichen Studien von irgendwelchen Dokumenten abhielt. Zu ihnen gehörten seine beiden Freunde und Amtskollegen Henri Boudet aus Rennes-les-Bains und Abbè Antoine Gelis aus Coustaussa. Mit Letzterem hatte es eine besondere Bewandtnis, welche mir aber bei der Ankunft in Rennes-le-Château partout nicht mehr einfallen wollte. Saunières Turm wollten wir uns zu diesem Zeitpunkt jedoch als absolute Krönung unserer Reise aufsparen.
Nach der Besichtigung der Villa Bethania besuchten wir endlich Saunières Kirche. Was uns dabei als erstes interessierte, war eine Art monumentaler Grabstein, der sich in der Nähe des Eingangs befand. Auf ihm fanden wir den Namen des damaligen Bischofs von Carcassonne, Mgr. Felix Arzene Billard. Über ihn wusste ich noch, dass er ein väterlicher Freund und Gönner Saunières war. Es war mir entfallen, welche genaue Rolle dieser Mann im Zusammenhang mit den Ereignissen in Rennes-le-Château spielte. Sicherlich, ich hatte das eine oder andere Buch darüber gelesen, wusste auch, dass Saunière sehr reich war, was dazu führte, dass man, wie schon erwähnt, mit Schaufeln bewaffnet nach dem Tod des Pfarrers und seiner Haushälterin alles umzugraben begann.
Aber so etwas selbst zu tun, konnte ich mir bei all den Gedanken daran nie vorstellen. Heutzutage würde man bestimmt Ärger mit den französischen Behörden bekommen, dachte ich mir. Vor allem ich, als ausländischer hergelaufener Tourist würde den „Schatz von Rennes-le-Château“ finden, welch unvorstellbarer Gedanke für die französische Volksseele. Trotzdem konnte ich es mir nicht verkneifen, eine Bemerkung in dieser Richtung loszulassen.
Claudia stemmte daraufhin die Arme abenteuerlustig in ihre Hüften und meinte: „Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, eine Grabungserlaubnis zu erhalten. Wir könnten doch einfach mal unverbindlich auf dem Rathaus nachfragen.“
„Klar, die haben ja nur extra auf uns damit gewartet, auf ein paar weitere Schatzsucher aus dem Ausland.“
„Darf ich dich daran erinnern, dass wir sowieso schon längst einen Metalldetektor kaufen wollten“, meinte sie kampfeslustig.
„Tut mir leid, aber ich komme mir dabei reichlich blöde vor, wenn ich damit durchs halbe Dorf laufen würde.“
„Feigling“, entgegnete sie resigniert. Aber wie gesagt, das waren eben nur augenblickliche Gedankenspiele, die zumindest ich schnell wieder verwarf.
Jetzt folgte das eigentliche Highlight, die Besichtigung der Dorfkirche, welche unbestreitbar das älteste Gebäude von Rennes-le-Château war. Von der Originalgrundmauer selbst war aber nicht viel vorhanden. Schon Saunière hatte sie nämlich mit Hilfe seines beträchtlichen Vermögens fast vollständig erneuern lassen.
Als wir nun vor dem Portal der Kirche standen, bekam ich wiederum dieses seltsame Gefühl, welches mich vor kurzer Zeit schon einmal heimgesucht hatte.
Zugleich musste ich dabei an den Geistlichen denken, wobei ich mich ernsthaft fragte, ob einiges zu seiner Zeit tatsächlich mit rechten Dingen zugegangen sei. Stand er möglicherweise sogar mit dem Teufel in Verbindung, gleichsam einer faust` schen Figur? Schließlich war er ein armer Dorfpfarrer und wurde über Nacht reich. Ging dies wirklich mit rechten Dingen zu? Auch Claudia fühlte sich anscheinend komisch, denn sie ergriff plötzlich meinen rechten Arm und sagte mit zitternder Stimme: „Ich habe plötzlich ein ganz komisches Gefühl im Bauch, so als wäre hier etwas Unheimliches geschehen.“ Ich fragte sie, ob es vielleicht immer noch die Nachwirkungen der anstrengenden Serpentinenfahrt gewesen sein könnten.
„Nein, das ist etwas Anderes, irgendwie Unbegreifliches“, kam ihre Antwort. Ich wusste von ihr, dass sie für so etwas noch viel empfänglicher war als ich. Immer mehr begann ich zu verstehen, warum die ganze Gegend hier ein großer Anziehungspunkt besonders für Esoteriker zu sein schien. Bisher waren es für mich als rational denkenden Menschen immer irgendwelche Spinner, die an so etwas glaubten. Aber mehr und mehr begann ich jetzt meine Meinung zu ändern, denn auch ich spürte die Ausstrahlung dieses Ortes, die mich an Übersinnliches glauben ließ.
Wenn wir nicht schon etwas darüber gelesen hätten, wären wir spätestens beim Betreten der Kirche noch mehr erschrocken gewesen. Auf der linken Seite des Eingangs stand eine lebensgroße Statue des altbiblischen Dämons Asmodis. In voller Lebensgröße ragte er vor uns auf, ein Weihwasserbecken auf dem Rücken tragend. Aus kalten, toten Augen funkelte er uns teuflisch grinsend an. Es war eine von mehreren Merkwürdigkeiten des Gotteshauses und stellte auch bestimmt eine gewisse Einmaligkeit in puncto Inventar einer christlichen Kirche in dieser Gegend dar.
Die spannende Frage aber war: Was macht ein Geschöpf des Teufels an einem geweihten Ort der Christenheit?
Nun, hierüber gab es jede Menge Spekulationen, aber die unumstößliche Tatsache bestand darin, dass es tatsächlich Saunière selbst war, der diese Figur in seiner Kirche aufstellen ließ. Welche Beziehung hatte der Geistliche zu diesem Geschöpf? Hatte es ihm gar den Weg zu unermesslichem Reichtum gewiesen? Konnte es so etwas überhaupt geben? Wer war Asmodis?
Ich erinnerte mich: Asmodis war der Erbauer des berühmten Tempels von König Salomo, dem legendären biblischen Herrscher aus dem Alten Testament, so stand es jedenfalls geschrieben. Er verkörpert die Laster des Zorns, der Begierde und der Wollust. Seinem Beschwörer konnte er angeblich wahre und vollständige Antworten auf alle Fragen des Lebens geben und ihn unbesiegbar machen. Zudem bewachte er Schätze und half bei der Schatzsuche. Es bestand also Grund zu der Annahme, dass der Pfarrer von Rennes-le-Château ihn genau aus diesem Grund am Eingang seiner Kirche postiert hatte, als Hüter eines Schatzes, welcher dort verborgen sei. Eine Art Schatz waren auch die bei den Renovierungsarbeiten gefundenen Dokumente.
Für uns jedenfalls war dies allemal wert, ein Foto davon zu machen. Aber gerade, als ich durch die Fotolinse blickte, ließ mir dieser stechende Blick meine wenigen Haare zu Berge stehen und führte einen weiteren Schweißausbruch herbei. Die aus der Teufelsfratze heraustretenden Augäpfel taten dazu ihr Übriges. Schon lange nicht mehr war mir so gruselig zumute.
Als wir uns davon endlich losgerissen hatten, sahen wir uns weiter in diesem Gotteshaus um.
Da standen sich im Altarraum zum Beispiel die Statuen von Maria und Josef gegenüber und beide hielten jeweils ein Kind in ihren Händen, eine sehr befremdliche Szene mit einer seltsamen Symbolik. Es gab zwar Vermutungen, dass Jesus noch Geschwister hatte, aber stand dies in unmittelbarem Zusammenhang damit? Wir wussten es nicht.
Ein weiteres Detail der Inneneinrichtung fiel uns auf: Ein aus einer Schnitzerei bestehendes Altarbild stellte eine offensichtlich weinende Maria Magdalena dar, welche in einer Art Höhle vor einem aus zwei natürlichen Ästen bestehendem Kreuz kniet. Der eine dieser Äste blüht noch, während der andere bereits abgestorben zu sein scheint. Alles dieses kam uns sehr merkwürdig und dabei vor allem gewöhnungsbedürftig vor.
Der eigentliche Höhepunkt sollte aber noch in der Form eines dreidimensionalen Gemäldes folgen, das sich im Eingangsbereich befand. Es trug den bezeichnenden Namen „Berg der Seligpreisung“. Nun muss ich zugeben, dass mir Kunst im Allgemeinen und die Darstellung biblischer Szenen im Speziellen nicht so sehr vertraut sind. Außerdem kannte ich die Landschaften Südfrankreichs bisher nicht besonders. Mir war nur lediglich bekannt, dass es in Saunières Kirche sehr viele kleine Ungereimtheiten geben sollte. Für mich als Betrachter, der davorstand, stellte dies alles nichts Ungewöhnliches dar.
Was uns aber als Laien auffiel, war eine fast bedrückende Dunkelheit, welche in der Kirche herrschte, und dies, obwohl draußen herrliches Wetter herrschte.
So empfing uns auch ein wunderbarer Herbsttag mit fast ungebrochenem Sonnenschein, als wir das Gotteshaus wieder verlassen hatten. Eine angenehme Wärme empfing uns und wir waren irgendwie froh, die Besichtigung hinter uns gebracht zu haben.
„Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich wieder wesentlich besser“, meinte meine Ehefrau.
„Stimmt, ich bin auch ganz froh, wieder draußen zu sein. Obwohl, interessant war es auf jeden Fall“. Sie pflichtete mir bei und unsere Aufmerksamkeit fiel als Nächstes auf den angrenzenden Friedhof. Diesen wollten wir sogleich besichtigen, aber er war von einer hohen Mauer umgeben und die Eingangstüre verschlossen. Probehalber drückte ich auf die Türklinke, aber es war umsonst. Enttäuscht kehrten wir ihr den Rücken zu und standen kurze Zeit später wieder auf der Straße.
Bei unserer Ankunft am Dorfplatz hatten wir noch flüchtig registriert, dass sich dort auch ein Souvenirladen befand. Deshalb bummelten wir wieder die Straße hoch in Richtung Aussichtspunkt, um diesen aufzusuchen. Es war der einzige weit und breit und ich stellte mir das Gedränge vor, welches darin im Sommer zur Zeit des Touristenansturms herrschen würde. Er war hauptsächlich bestückt mit Büchern in mehreren Sprachen, teilweise mit esoterischem Inhalt, aber auch mit verschiedenen Hochglanzfotografien. Auf den üblichen Firlefanz, den man in jeder von Touristen überlaufenen Stadt, beispielsweise in Deutschland, vorfinden konnte, hatte man großzügigerweise verzichtet.
Jetzt jedenfalls hatten wir ihn fast ganz alleine für uns und so ging ich natürlich gleich zielstrebig auf all die Bücher zu, die dort standen. Bücher haben mich seit jeher schon immer magisch angezogen und so fing ich unverzüglich an, in jedem davon ausgiebig zu blättern. Mir war es dabei egal, ob sie in englischer, französischer oder sogar in deutscher Sprache verfasst waren.
Gegenstand der meisten davon waren natürlich Rennes-le-Château und seine beiden berühmtesten Einwohner. Mittlerweile füllte sich der Laden einigermaßen mit weiteren Touristen und die Besitzerin versuchte, da sie einigermaßen englisch sprechen konnte, diese in ein Verkaufsgespräch zu verwickeln. Sie musste natürlich auch einige Fragen über Saunière und die Dénarnaud beantworten, welche mich natürlich auch aufhorchen ließen. Das meiste davon wusste ich allerdings schon.
Nach einer Viertelstunde verließ ich wieder den Laden und trat ins Freie, wo Claudia bereits ungeduldig auf mich wartete. Sie hatte nämlich beschlossen, sich lieber in der Sonne etwas zu wärmen und war deshalb draußen geblieben.
Wir hatten Hunger bekommen und wollten zu diesem Zweck ein Restaurant aufsuchen. Als Diabetiker musste ich aufpassen, um Hunger – und damit Unterzucker – gar nicht erst aufkommen zu lassen. Nicht, dass ich am Ende noch umkippte.
Die Suche nach einem Restaurant gestaltete sich etwas schwieriger, da wir der Hauptstraße folgend zunächst kein Lokal fanden. Stattdessen fanden wir den Hund wieder, den wir am Anfang unseres Aufenthalts zurückgelassen hatten. Amüsiert stellten wir fest, dass er sich seit dem letzten Mal keinen Zentimeter von der Straße herunter bewegt hatte. Als ich ihn jedoch filmen wollte, musste ich mir erst ein paar mal meine schwitzenden Hände an der Hose abwischen. Wie ich dann den Fotoapparat in die Hand nahm, begann ich leicht zu zittern.
Zwar gingen wir jetzt wieder weiter und es kam am Ortseingang tatsächlich das langersehnte Restaurant in Sicht, aber ich begann zu torkeln, als wäre ich betrunken. Ein bisher nie erlebtes Schwindelgefühl setzte bei mir ein und alles drehte sich um mich herum. Alles flimmerte nur noch vor meinen Augen und ich wollte mich noch irgendwo festhalten. Jedoch griff ich ins Leere, dann wurde es mir endgültig schwarz vor den Augen und ich verlor das Bewusstsein.
RENNES-LE-CHÂTEAU 1897
Nach einiger Zeit öffnete ich wieder die Augen und helles Tageslicht blendete mich. Zuerst nahm ich noch alles verschwommen wahr, wurde dann aber wieder klarer im Kopf.
Dann sah ich absolut Seltsames: An den Häusern fehlten die Briefkästen, es existierten nur noch altmodische Straßenlaternen und die Dorfstraße war nicht mehr geteert.
Was hatte das zu bedeuten?
Ich saß auf dem Boden an einem Gartenzaun angelehnt. Ein Hund stand vor mir, irgendwie sah er mich komisch an, so als wollte er fragen, ob es mir besser geht. Als er dann aber bemerkte, dass ich wieder zu mir gekommen war, wedelte er erfreut mit dem Schwanz. Dann fuchtelte mir jemand mit der Hand vor meinen Augen.
Ich versuchte, aufzustehen, aber ein furchtbarer Schmerz im Genick hinderte mich daran. Augenblicklich wusste ich, dass es sich nur um einen früheren Bandscheibenvorfall handeln konnte, der mir jetzt erneut wieder zusetzte.
Neben mir ertönte eine Männerstimme mit leicht okzitanischem Akzent: „Geht es Ihnen wieder gut, Monsieur?“ Zum Glück kamen mir in diesem Moment meine ausreichenden Französischkenntnisse zugute. Trotzdem antwortete ich zunächst mit einem noch sehr unsicheren „Oui“. Ganz vorsichtig und langsam hob ich jetzt den Kopf und erblickte einen freundlich lächelnden Mann, der unmittelbar neben mir stand.
„Können Sie aufstehen? Wenn nicht, ist es auch kein Problem. Ich werde meiner Frau auf jeden Fall sagen, dass sie den Doktor holen soll. Er stammt zwar aus Couiza, aber Sie haben Glück, dass er gerade Hausbesuche hier macht. Ach, entschuldigen Sie, ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Lucien Dubois und mir gehört sozusagen der Gartenzaun samt dem sich dahinter befindlichen Anwesen, vor dem Sie sitzen“.
Ich konnte dies alles noch immer nicht begreifen. Ich wusste nur, dass es mir schwarz vor den Augen geworden war und ich offensichtlich ohnmächtig wurde.
Und vor allem: Wo war Claudia abgeblieben? Sie war doch noch vorher da und jetzt auf einmal verschwunden.
Ich sah Monsieur Dubois an: „Haben Sie vielleicht meine Frau gesehen? Holt sie Hilfe?“
„Hier war keine Frau. Mein Hund Toto hat sie gefunden. Sie haben mutterseelenallein hier gelegen und waren bewusstlos“.
Es war für mich alles unbegreiflich. Claudia musste doch irgendwo sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mich alleine hier in Rennes-le-Château zurückließ. War ich überhaupt noch in diesem Dorf?
„Eine Frage hätte ich noch: Wie spät ist es eigentlich?“
„Es ist ziemlich genau zwölf Uhr“, er blickte dabei auf eine Taschenuhr, die er herausgezogen hatte.
„Jetzt hätte ich aber auch noch eine Frage an Sie: Mit wem haben Toto und ich eigentlich das Vergnügen?“
Immerhin fiel mir zumindest mein Name gleich wieder ein: „Ich heiße Berger, Jacques Berger.“
„Der Name Berger klingt aber nicht gerade französisch und Ihrem Akzent nach darf ich wohl annehmen, dass Sie eventuell aus einem anderen Land kommen könnten. Habe ich recht?“
Gut kombiniert, dachte ich mir. „Das stimmt. Ich bin Deutscher und meine momentan nicht vorhandene Ehefrau und ich sind als Touristen hierher gefahren, um uns Ihr Dorf anzuschauen. Ich habe schon viel über Rennes-le-Château gelesen, speziell über Abbé Saunière und seine Haushälterin.“
„Über unseren Pfarrer? Wie kann es sowas geben, dass man im Ausland über ihn Bescheid weiß?“ Ich war einigermaßen verblüfft angesichts dieser Äußerung. Unsere Unterhaltung wurde aber abrupt unterbrochen, als eine Frau und ein Mann mit einem kleinen schwarzen Köfferchen, wahrscheinlich die Ehefrau von Monsieur Dubois und der Arzt, in flottem Schritt um die Ecke kamen und vor mir zum Stehen kamen.
Was mir dabei an allen drei Personen auffiel war, dass alle fremdartig gekleidet waren, sozusagen ziemlich altmodisch.