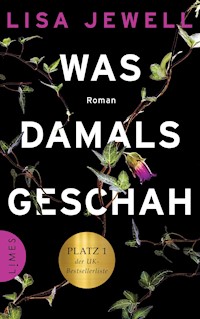3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Haus. Eine Familie. Und das tragische Geheimnis, das zwischen ihnen steht ...
In einem gemütlichen Cottage in England verbringen die vier Bird-Geschwister eine idyllische Kindheit voller Wärme und Harmonie. Bis zu jenem schrecklichen Osterwochenende, nach dem nichts mehr ist wie zuvor. Die Jahre vergehen, und bald schon scheint es, als wären sie nie eine Familie gewesen ... Doch dann erreicht die in alle Himmelsrichtungen zerstreuten Birds eine Nachricht, die sie in das Haus zurückkehren lässt, in dem sie aufgewachsen sind. Endlich sollen sie die Wahrheit über das erfahren, was an jenem Osterfest vor vielen Jahren wirklich geschah ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem TitelThe House We Grew Up In bei Century, London
1. Auflage
© Lisa Jewell 2013
© der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung und -illustration: www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15819-4
www.limes-verlag.de
Für Guy und Celia Gordon, in Liebe
1
Dienstag, 2. November 2010
Hi Jim!
Ich muss zugeben, dass ich bei dir nicht mit so einem gewöhnlichen Namen wie Jim gerechnet hätte. Die Barbour-Jacke und die schicke Weste, die du auf dem Foto trägst, lassen dich eher wie einen Rupert oder einen Henry wirken. Irgendetwas Seriöses mit zwei Silben jedenfalls! Apropos Silben: Du hast nach meinem Namen gefragt. Nein, ich heiße nicht wirklich Rainbowbelle. Natürlich nicht! Ich heiße Lorelei, drei Silben. Meine Eltern haben uns alle nach Sagengestalten benannt. Meine Schwester heißt Pandora. Es gab noch eine Athena, aber die kam tot zur Welt.
Ich bin fünfundsechzig und lebe in einem der hübschesten Orte der Cotswolds in einem großen, verrückten Haus voller Dinge, die ich meine Schätze nenne – meine Kinder bezeichnen sie als Schrott. Vermutlich haben wir alle recht.
Es sind übrigens vier Kinder. Megan ist vierzig, Bethan achtunddreißig, und die Zwillinge Rory und Rhys sind fünfunddreißig. Oh, und hauptsächlich dank der Fortpflanzungsfreude meiner ältesten Tochter bin ich mehrfache Großmutter!
Hast du ebenfalls Kinder? Du hast es nicht erwähnt, also wohl eher nicht. Normalerweise erzählen die Leute doch vor allem von ihren Kindern, stimmt’s? Leider sehe ich meine nicht sehr oft, sie sind alle sehr beschäftigt. Und was mich betrifft, so habe ich mich in letzter Zeit, wie soll ich sagen, ziemlich abgeschottet. Vor etwa vier Jahren verlor ich meine große Liebe, und man könnte sagen, dass mein Leben seitdem ein wenig aus den Fugen geraten ist.
Wie auch immer, was könnte ich dir sonst von mir erzählen? Ich bin ein Naturmensch und liebe das Landleben, ich mag Kinder und schwimme gern. Für mein Alter bin ich noch ganz schön fit, und dass ich über die Jahre hinweg meine Figur behalten habe, dafür bin ich dankbar. Schließlich mutieren eine Menge Frauen in den Wechseljahren zu molligen Mammuts! Außerdem habe ich nach wie vor langes Haar. Nichts macht eine Frau älter als ein Haarschnitt!!
Jetzt genug von mir. Erzähl mir mehr von dir! Du schreibst, dass du verwitwet bist. Tut mir sehr leid, das zu hören. Und wo im Norden lebst du? Auf dem Bild bist du mit einem Hund zu sehen. Einem schönen Retriever. Wie heißt er denn? Wir hatten auch einen Hund, als die Kinder klein waren, doch nachdem sie alle aus dem Haus waren, sah ich keinen Grund mehr, Haustiere zu halten.
Ich werde sehen, was ich wegen der Fotografien machen kann. Ich hab’s nicht so mit Technik, aber es gibt bestimmt etwas, das ich dir schicken kann. Ich tue mein Bestes.
Also dann, danke noch mal, Jim, dass du dich bei mir gemeldet hast. Das Internet ist wirklich eine wunderbare Sache, besonders für Oldtimer wie uns, meinst du nicht? Ohne wäre ich echt verloren. Ich würde mich sehr freuen, wieder von dir zu hören – falls du mich allerdings schrecklich findest, fühl dich bitte zu nichts verpflichtet!
Mit schönen Grüßen und besten Wünschen
Lorelei Bird
April 2011
Die schwüle Hitze war ein Schock nach der Kälte der letzten beiden Stunden im klimatisierten Auto. Meg schlug die Wagentür hinter sich zu, schob die Ärmel ihrer Baumwolltunika hoch, nahm die Sonnenbrille ab und betrachtete das Haus. »Meine Güte.«
Molly, eine lindgrüne Ray-Ban auf der Nase, trat neben sie und wollte ihren Augen nicht trauen. »O mein Gott.«
Einen Moment lang standen sie Seite an Seite da. Molly hatte ihre Mutter sehr zu ihrer Freude inzwischen größenmäßig eingeholt, maß jetzt ebenfalls gut einen Meter siebzig und hatte die Figur eines Models. Ihre gebräunten Beine steckten in Jeans-Hotpants, das hellbraune Haar war auf dem Kopf zu einem kunstvollen Dutt zusammengebunden, und über einem pinkfarbenen Trägershirt trug sie ein weißes Baumwollhemd. Ihre Fuß- und Handgelenke, um die sich Freundschaftsbänder und Haargummis schlangen, waren superschmal. Meg dagegen war eher stämmig, weshalb sie zu der leichten dreiviertellangen Hose ein kleidsames gestreiftes Longsleeve gewählt hatte. Silberne Flipflops mit Pailletten sowie eine Last-Minute-Pediküre demonstrierten, dass sie modebewusst war.
Eine Mutter und ihre einzige Tochter im Spätstadium eines genauso albtraum- wie klischeehaften Pubertätsdebakels, das mehr als drei Jahre angedauert hatte und an dessen Ende sie beinahe Freundinnen geworden waren. Hoffentlich. Jemand hatte Meg gesagt, dass sie ihre Tochter erst wirklich mit neunzehn zurückbekommen würde. Bis dahin waren es immerhin noch vier Jahre.
»Es ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Viel schlimmer.« Meg schüttelte den Kopf und machte einen zögerlichen Schritt auf das Haus zu. Da stand es, Stein für Stein genau wie an dem Tag vor vierzig Jahren, als sie geboren worden war. Drei Fenster schauten unten zur Straße hin, oben vier, und es gab zwei Eingangstüren, eine auf jeder Seite. Am Seiteneingang rechts hing ein Schild, das vor langer Zeit von einem mittlerweile längst verstorbenen hiesigen Kunsthandwerker angefertigt worden war: eine ovale Tafel, die zwei schnäbelnde Turteltauben darstellte und darüber die Worte Familie Bird.
Hinter dem grün gestrichenen Gartentor links neben dem Haus ging es über einen Kiesweg zum Hintereingang. Ein Aufkleber verkündete, dass hier Neighbourhood Watch aufpasse – was immer aus dieser Nachbarschaftswache geworden sein mochte, dachte Meg gedankenverloren. Und ein zweiter verriet, dass die Bewohner des Hauses Mitglieder der Vogelschutzorganisation Royal Society for the Protection of Birds waren. Ein drittes Schild wies darauf hin, dass Hausieren unerwünscht sei. Alles genauso, wie es immer gewesen war. Außer …
»Das ist das schrecklichste Haus, das ich je gesehen habe«, sagte Molly. »Es ist noch schlimmer als die aus den Fernsehsendungen.«
»Wir waren ja nicht mal drinnen, also spar dir lieber ein wenig Entsetzen auf.«
»Und mir die Nase zuhalten, was?«
»Ja, wahrscheinlich.«
Die Fenster, die ihrer Erinnerung zufolge auch früher niemand häufig geputzt hatte, waren so verschmutzt, dass sie vollkommen blind und eigentlich schwarz wirkten. Die einst hellen gelblich braunen Mauern aus Gloucestershire-Kalkstein waren schmutzig und verwittert, sodass sich die Farbe kaum noch erkennen ließ. Vom früheren Charme des landestypischen Cottage war nichts mehr zu erkennen. Verwahrlosung und Verfall hingegen waren offensichtlich.
Das grüne Gartentor hing bloß noch an einem Nagel in seiner Angel, und auf dem Kiesweg lag wahllos allerlei Schrott, der zur Mülldeponie gehörte: zwei alte Kinderwagen, ein rostiges Fahrrad, ein vertrockneter Christbaum in einem zerbrochenen Topf, eine Kiste voller Zeitschriften, die aufgeweicht waren vom Regen vergangener Tage und auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Größe aufgequollen waren. Das ganze Anwesen wirkte, als sei ihm seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten weder Aufmerksamkeit noch Pflege zuteilgeworden.
Und damit war es zum Schandfleck geworden. Denn das idyllische Dorf, inzwischen eine bevorzugte Adresse für großstadtmüde, wohlhabende Londoner, hatte sich während dieser Zeit herausgeputzt, sodass das Bird-Haus wie ein fauler Zahn wirkte, der dringend gezogen werden musste.
»Oje, ist das peinlich«, meinte Molly und schob naserümpfend ihre Ray-Ban ins Haar. »Was müssen die anderen im Ort bloß denken?«
Meg zog die Augenbrauen hoch. »Hm. Schätzungsweise ist unser Ruf, vor allem der meiner Mutter, seit einer Ewigkeit dahin. Also dürfte sich kaum noch jemand wundern.« Sie hielt inne und sah ihre Tochter an. »Komm, lass uns reingehen, oder? Bringen wir’s hinter uns.«
Molly lächelte gequält und nickte.
April 1981
Megan schob den Efeu zur Seite und bohrte ihren Finger in einen kleinen Spalt in der Hauswand. »Habe noch eins gefunden«, rief sie Bethan und den Zwillingen zu.
»Oh, gut gemacht, Meggy«, lobte ihre Mutter sie, die in einer Schürze mit Erdbeermuster auf den Stufen der Hintertreppe stand und das Geschehen mit einem zufriedenen Lächeln beobachtete. »Bravo!«
Ihre Tochter fischte das kleine, in Folie verpackte Ei aus der Mauer und ließ es in ihren Korb fallen. »Es ist rosa«, sagte sie herausfordernd zu ihrer jüngeren Schwester.
»Mir doch egal«, erwiderte Beth. »Ich habe schon drei schöne Eier in Rosa.«
Die Ältere blickte hinauf zum Himmel. Er war wolkenlos, tiefblau, und es war warm wie im Juli. Ihre Mutter hatte gesagt, dass sie sich mit der Suche beeilen müssten, weil sonst die Schokolade schmelzen würde. Meg ließ den Blick über den Garten wandern. Die Eier im Holzstoß hatte sie bereits alle gefunden und sie mit leichtem Ekel vorsichtig zwischen den gummiartigen Asseln herausgezogen. In den Beeten mit Osterglocken und Hyazinthen, die die Wege um das Gewächshaus säumten, waren weitere versteckt gewesen, und eines hatte sie sogar in den Zweigen des Kirschbaums vor der Küchentür entdeckt. Sie zählte ihre Ausbeute: zwölf Stück. Bethan und die Zwillinge suchten nach wie vor in der Nähe des Hauses. Vermutlich vergeblich, dachte Megan und hüpfte in den hinteren Teil des Gartens. Wenn überhaupt, würde sie dort fündig werden.
Nach und nach verklangen die Stimmen ihrer Geschwister und ihrer Mutter zu einem leisen Murmeln. Hier unten war es wärmer, die Luft mild und dunstig. Der Rasen wies Streifen vom gestrigen Mähen auf, und die kleinen Haufen zusammengerechter Grasabfälle vertrockneten schon in der Sonne, die viel zu heiß brannte für diese Jahreszeit. Ein Kamelienstrauch, vom frühen Sommereinbruch zum vorzeitigen Blühen verleitet, warf bereits die ersten Blüten ab. Welkend lagen sie auf dem Rasen, wurden braun und hässlich. Megan ging zu der von Flechten überzogenen Sonnenuhr, wo sie drei weitere in Folie gewickelte Eier erspähte und sie in ihren Korb warf.
Hinter sich hörte sie Bethan mit ihren Riemchenschuhen die Treppe zum tiefer gelegenen Gartenbereich heruntertrippeln. Megan drehte sich um und lächelte. Beim Anblick ihrer Schwester erfüllte sie tiefe Liebe. Sie war zwar manchmal ihre schlimmste Feindin, meist aber ihre beste Freundin.
Meg und Beth sahen sich ausgesprochen ähnlich. Sie hatten beide das »Bird-Gesicht«, wie ihre Mutter das nannte. Genau wie ihr Dad und Tante Lorna und Granny Bird. Gerundete Wangen, eine hohe Stirn und ein breites Lächeln. Der einzige Unterschied zwischen den Mädchen bestand darin, dass Megans Haar braun und lockig war wie das ihrer Mutter und Bethans glatt und schwarz wie das ihres Vaters. Rory und Rhys hingegen, die Zwillinge, kamen nach Lorelei und hatten »Douglas-Gesichter«. Eine niedrige Stirn, lange Nasen, schöne volle Lippen und eng stehende blaue Augen, die neugierig unter einem Vorhang aus blonden Haaren hervorlugten.
»So hübsche Kinder«, pflegten die Leute zu sagen. »Sie müssen schrecklich stolz sein, Mrs. Bird – was für perfekte kleine Engel.«
Ihre Mutter antwortete dann immer mit liebevoller Stimme: »Sie sollten sie mal zu Hause erleben«, und verdrehte dabei die Augen, während sie Rory mit einer Hand durchs Haar fuhr und mit der anderen Rhys festhielt.
»Wie viele hast du?«, rief Meg ihrer Schwester zu.
»Elf. Und du?«
»Fünfzehn.«
Lorelei erschien mit den Zwillingen im Schlepptau am Treppenabsatz. »Die Jungs haben jeder neun. Ich denke, wir haben es fast geschafft«, meinte sie. »Haltet nach Gelb Ausschau«, fügte sie mit einem vielsagenden Augenzwinkern hinzu.
Rory und Rhys ließen ihre Hand los und rannten zur Rutsche am Ende des Gartens, die ein gelbes Geländer hatte. Bethan eilte zu einem umgedrehten Eimer, der eigentlich orange war. Nur Megan wusste genau, was ihre Mutter gemeint hatte. Den Johanniskrautstock direkt vor ihnen. Sie ging darauf zu und musterte Büschel für Büschel die gelben Blüten, die fette Hummeln summend umschwirrten, bis ihr Blick auf eine Reihe Terrakottatöpfe am Boden fiel, die von Ostereiern und kleinen gelben Flauschküken nur so überquollen.
Sie wollte gerade alles an sich raffen, als ihre Mutter sie mit ihren weichen, trockenen Händen an der Schulter berührte. »Teil sie mit den Kleinen«, flüsterte sie sanft. »Sei fair.«
Meg wollte protestieren, atmete schließlich jedoch tief durch und nickte. »Hier«, rief sie ihren Geschwistern zu. »Schaut! Hier sind noch massenhaft Eier.«
Alle drei kamen sofort zu dem Johanniskrautstock gerannt, wo die Mutter inzwischen vier gleich große Haufen gemacht hatte und jedem der Kinder einen gab. »Die Eier fangen bereits an zu schmelzen«, sagte sie und schleckte sich etwas Schokolade vom Daumen. »Wir bringen sie besser rein.«
Die Kühle im Haus war nach der Hitze draußen wie ein Schock. Legte sich auf Megs nackte sommersprossige Haut wie ein kalter Waschlappen. Am Küchentisch goss Dad gerade Fruchtsaft in Becher. Der Hund döste auf der Fensterbank. Die gelben Küchenwände waren über und über bedeckt mit Kinderzeichnungen. Megan fuhr mit dem Finger über die Ränder eines Bildes, das sie mit ungefähr vier Jahren gemalt hatte. Es erstaunte sie immer wieder, dass es seit nunmehr sechs Jahren mit demselben Stück Tesafilm am selben Platz an der Wand hing. Sie konnte sich kaum noch daran erinnern, einmal vier Jahre alt gewesen zu sein – geschweige denn daran, am Küchentisch dieses Bild gemalt zu haben. Es zeigte zwei Strichmännchen mit wirren Haaren, groteskem Lächeln und Händen doppelt so groß wie ihre Körper schwerelos in einem Universum, in dem alles schwebte: die Menschen ebenso wie die Tiere und die stacheligen blauen Bäume. Darunter stand »Megan und Mummy«.
Die Flut der Kinderkunstwerke war ein Gesprächsthema für alle, die zu Besuch kamen. Sie bedeckten nicht nur sämtliche Wände, sondern ebenfalls Schränke und Türen, kurz: jede Ecke bis in die Vorratskammer. Dad hatte gelegentlich versucht, einige davon abzunehmen, um »die Wand auf den neuesten Stand zu bringen«, wie er es ausdrückte. Aber dann antwortete Mum jedes Mal mit ihrem frechen Kleinmädchenlächeln: »Nur über meine Leiche.«
Daraufhin hatte Dad sich etwas Neues ausgedacht. Sobald er mitbekam, dass eines seiner Kinder mal wieder ein Kunstwerk produzierte, schnappte er es sich rechtzeitig. »Das ist so schön geworden, dass ich es lieber gleich in meinem Spezialordner aufbewahre«, sagte er und ließ es irgendwo verschwinden, bevor Mum es an die Wand hängen konnte.
Jetzt band sie ihr störrisches Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen und legte ihre Schürze ab. »Ihr dürft so viele Eier essen, wie ihr wollt, solange ihr mir versprecht, noch Platz fürs Mittagessen zu lassen. Und vergesst nicht, die Folien für die Bastelkiste aufzuheben.«
Die »Bastelkiste« war ein weiteres Schreckgespenst für Dad. Ursprünglich hatte es sich um eine einzige und dazu kleine Plastikbox gehandelt, in der fein säuberlich Pailletten, Pfeifenreiniger und Blattgoldbogen gesammelt wurden. Doch über die Jahre war daraus eine Armada riesiger Plastikkisten geworden, die sich in dem großen Flurschrank stapelten und in denen sich ein wüstes Durcheinander aus alten Bändern, Wollknäueln und Bonbonpapier häufte: aus leeren Papprollen vom Klopapier, aus in Streifen geschnittener alter Unterwäsche und gebrauchtem Geschenk- und Packpapier.
Megan war mit ihren fast elf Jahren beinahe aus dem Bastelalter hinaus, Bethan besaß nicht die Kreativität der älteren Schwester, und die Jungs streiften ohnehin lieber im Garten herum oder tobten durchs Haus, statt sich mit einer Klebertube und Bastelmaterial zu beschäftigen. Trotzdem vermochte nichts Lorelei davon abzuhalten, die Bastelkisten weiter mit allem möglichen Krimskrams aufzufüllen.
Resolut nahm sie den Kindern auch diesmal das Stanniolpapier ab, sobald sie die Eier ausgewickelt hatten, und strich es mit zufriedenem Gesicht behutsam glatt. »So hübsch«, sagte sie, »wie kleine Stücke vom Regenbogen. Sie werden mich immer an heute erinnern. An diesen perfekten Tag mit meinen wundervollen Kindern, als die Sonne nicht aufhörte zu scheinen und die ganze Welt in Ordnung war.«
Sie betrachtete jedes ihrer Kinder nacheinander mit ihrem typischen Lächeln, fuhr Rhys durchs Haar und strich es ihm aus dem Gesicht. »Meine wundervollen Kinder«, wiederholte sie, und obwohl ihre Worte alle vier einschlossen, heftete sich ihr Blick besonders auf ihren Letztgeborenen.
Rhys war das kleinste von Loreleis Kindern gewesen. Megan und Bethan hatten beide über vier Kilo gewogen, Rory als erster Zwilling immerhin stattliche dreieinhalb. Und dann war, wie ihre Mutter oft und gern erzählte, noch der arme Rhys nachgekommen, mit seinen knapp zwei Kilo kaum schwerer als eine gerupfte Wachtel, blau angelaufen und schrumpelig und gerade so in der Lage, eigenständig zu atmen. Man hatte ihn in einen Brutkasten gesteckt –»ihn leicht getoastet«, wie sie das zu nennen pflegte –, bis er kräftig genug war, um nach Hause zu dürfen.
Lorelei machte sich noch heute mehr Sorgen um ihn als um ihre anderen drei Kinder. Gerade sechs Jahre alt, war er nicht nur kleiner als Rory, sondern auch kleiner als die meisten Kinder in seiner Klasse, war immer blass und neigte zu Erkältungen und Magenbeschwerden. Außerhalb des Hauses klammerte er sich an seine Mutter, heulte wie ein Baby, wenn er sich wehtat, und spielte, anders als sein Bruder, nicht gern mit anderen Kindern. Glücklich schien er nur zu Hause zu sein, den Bruder zur einen, die Mutter zur anderen Seite. Megan wusste nicht recht, was sie mit ihm anfangen sollte. Manchmal wünschte sie sich, er wäre nie geboren worden. Sie war davon überzeugt, die Familie würde ohne ihn besser dran sein. Er passte einfach nicht zu ihnen. Alle Birds waren lustig und gesellig, für jeden Quatsch zu haben und fröhlich. Rhys zog sie bloß runter.
Unbedacht zerknüllte Megan die Goldfolie des großen Ostereis, das sie im Kirschbaum gefunden hatte, und zuckte leicht zusammen, als ihre Mutter ihr einen Klaps auf die Finger gab. »Die Folie«, rief Lorelei. »Folie!«
Megan öffnete sofort ihre Faust, und ihre Mutter nahm mit einem Lächeln das zerknüllte Papier entgegen. »Danke, mein Schatz«, sagte sie liebevoll und betrachtete das Stanniol. »Schau, so hübsch, so glänzend – so ein Glück.«
Eine Woche Osterferien lag noch vor ihnen. Die Hitzewelle hielt an, und die Bird-Kinder betraten tagsüber das Haus nur, um einen Becher Saft zu trinken, ein Brot zu essen oder um auf die Toilette zu gehen.
Freunde kamen. Eltern und Kinder machten einen Ausflug an den Strand in Weston-super-Mare, und am letzten Ferienwochenende erhielten sie Besuch von Loreleis Schwester Pandora und deren Söhnen im Teenageralter. Dad füllte das Planschbecken, und die Erwachsenen tranken Unmengen von erfrischendem Pimm’s-Cocktail mit Eiswürfeln, Früchten und Ginger Ale. Cousin Tom spielte David-Bowie-Songs auf seiner über und über mit Stickern beklebten Gitarre. Rory bohrte mit einem Stock ein Loch ins Planschbecken, sodass das Wasser den Rasen überflutete und ihn in eine matschige Fläche verwandelte.
Dad meinte: »Tja, das war’s dann wohl«, während Mum das schlaffe Planschbecken zusammenraffte.
Sie hielt es im Arm wie ein verletztes Kind und trug es in die Garage. »Dad wird es reparieren«, murmelte sie, doch Colin schüttelte den Kopf.
»Du und ich, wir wissen beide, dass ich es nicht reparieren werde. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Sonst läge das vom letzten Jahr nicht mehr kaputt herum.«
Lorelei lächelte bloß und warf ihm quer durch den Garten einen Handkuss zu, woraufhin Dad seufzte. »Tja, dann haben wir jetzt drei Planschbecken mit Loch in der Garage – dieses Haus entwickelt sich zur Müllhalde«, sagte er und verdrehte die Augen.
Pandora lächelte: »Genau wie unser Vater. Er konnte auch nie etwas wegwerfen.«
Ben, der zweite Cousin, grinste seine Mutter an: »Erzähl uns noch mal, was Lorelei alles gesammelt hat, als sie klein war.«
Pandora runzelte kurz die Stirn. »Herbstlaub. Aufreißlaschen von Getränkedosen. Die Etiketten von neuen Kleidungsstücken. Kinokarten. Die Silberfolie von Mums Zigarettenschachteln.«
»Und Haare«, rief Ben vergnügt. »Vergiss die Haare nicht.«
»Ja«, meinte Pandora, »immer wenn sich jemand aus der Familie die Haare schneiden ließ, wollte Lorelei sie behalten. Sie hatte eine Einkaufstüte voll damit unter ihrem Bett. Es war ein bisschen gruselig.«
Die Erwachsenen und Jugendlichen lachten, und Megan beobachtete sie neugierig. Sie hatte die Geschichte schon öfter gehört – jedes Mal, wenn die Tante da war, schien es ihr –, aber immer hörte sie sich anders an. Und je älter sie wurde, desto weniger lustig klang es in ihren Ohren. Vielmehr fand sie diese Marotte ihrer Mutter von Mal zu Mal befremdlicher. Sie war jetzt so alt wie Lorelei damals, als sie diese seltsamen Sammlungen anlegte, und sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, abgeschnittene Haare zu horten. Das war für sie genauso abartig, wie etwa samstags in die Schule zu gehen.
»Lacht ihr über mich?«, fragte ihre Mutter gutmütig, als sie aus der Garage zurückkam.
»Nein, nein, nein«, erwiderte Ben. »Überhaupt nicht. Wir reden ganz nett über dich.«
»Hm«, meinte Lorelei und wischte sich die feuchten Hände an ihrem langen Jeansrock ab. »Das wage ich zu bezweifeln.«
Und dann streckte sie die Arme nach oben, wobei sie ihre unrasierten Achselhöhlen voll üppiger brauner Locken zeigte, und verkündete: »Schaut euch bloß den Himmel an, schaut ihn euch an. Dieses Blau. Am liebsten würde ich mir ein paar Hände voll schnappen und sie in meine Tasche stecken.«
In diesem Moment sah Megan einen seltsamen Ausdruck über das Gesicht ihres Vaters huschen. Liebevoll und besorgt zugleich. Als dränge es ihn, etwas Unaussprechliches zu sagen.
Doch sein Gesicht wurde sogleich wieder weich, und lächelnd sagte er: »Wenn es nach meiner Frau ginge, dann wären ihre Taschen voll mit allen Dingen dieser Welt.«
»O ja«, rief Lorelei strahlend. »Das wären sie. Absolut. Und zwar prallvoll.«
Pandora hatte selbst gemachte Schmetterlingskuchen mitgebracht, die mit Schlagsahne und winzigen Zuckerküken verziert waren.
Lorelei servierte sie im Garten, ebenso Scones mit Clotted Cream und Erdbeeren, dazu gab es Tee oder noch mehr Pimm’s-Cocktail. Die Zwillinge rannten immer wieder zum Gartenschlauch, um ihre Wasserpistolen aufzufüllen, die sie nach zahllosen Ermahnungen allerdings lediglich aufeinander richteten und nicht mehr auf die anderen. Tom und Ben hatten sich in den hinteren Teil des Gartens zurückgezogen, um in der Hängematte zu rauchen und sich schmutzige Witze zu erzählen. Megan und Bethan saßen bei den Erwachsenen und lauschten interessiert, worüber die sich unterhielten.
Wenn Megan später als Erwachsene nach ihrer Kindheit gefragt wurde, waren es Nachmittage wie dieser, die sie veranlassten zu sagen: »Meine Kindheit war perfekt.«
Und das war sie. Perfekt.
Sie wohnten in einem gelben Haus, das in einem Bilderbuchdorf in den Cotswolds stand und von einem weitläufigen, ursprünglichen Garten mit vielen Büschen und Sträuchern umgeben war. Die Mutter, ein hübsches Blumenkind namens Lorelei mit langem, schwer zu bändigendem Haar und strahlend grünen Augen, behandelte ihre Kinder wie kostbare Edelsteine. Ihr Vater Colin war ein netter, schlaksiger Mann, der mit seinem glatten dunklen Haar und der eulenartigen Rundbrille aussah wie ein Pennäler. Die Kinder besuchten die Dorfschule, jeden Abend nahm die Familie gemeinsam selbst gekochte Mahlzeiten ein, und die Verwandtschaft war warmherzig und klug.
Zwar konnte man sich keine Reisen ins Ausland leisten, aber für Feiern und neue Planschbecken war genug Geld da. Und das reichte, denn schließlich lebte man im Paradies. Das hatte Megan bereits als Kind gewusst. Weil, wie sie sich rückblickend erinnerte, ihre Mutter ihr das gesagt hatte. Lorelei lebte vollkommen im Hier und Jetzt und brachte jeden Augenblick zum Leuchten. Keiner in der Familie durfte je vergessen, wie glücklich sie alle waren. Nicht mal eine Sekunde lang.
Genau in diesem Moment schob sich eine Wolke vor die Sonne. Lorelei lachte und zeigte darauf und rief: »Schaut! Schaut euch die Wolke an. Wunderbar, oder? Sie sieht aus wie ein Elefant.«
April 2011
Der Schlüssel befand sich exakt dort, wo Lorelei ihn seit jeher zu hinterlegen pflegte: hinter einem Wasserrohr unter dem gesprungenen Blumentopf vor dem Küchenfenster. Megan angelte ihn heraus und wischte sich die klebrigen Spinnweben von den Fingerspitzen. »Igitt.«
Man konnte das Haus seit Jahren schon nicht mehr durch die beiden Vordertüren betreten. Die Familie benutzte ohnehin stets die Küchentür auf der Rückseite, und so hatte Lorelei angefangen, die beiden Hausflure als zusätzlichen »Stauraum« zu nutzen. Es gab zwei, weil sich in dem Cottage ursprünglich eine zusätzliche Einliegerwohnung mit eigenem Eingang befunden hatte.
»Gut«, sagte Meg, als sie die Hintertür erreichten, »dann wollen wir mal. Tief durchatmen.« Sie warf ihrer Tochter ein tapferes Lächeln zu und sah zu ihrer Freude, dass diese es erwiderte.
»Alles okay mit dir, Mum?«
Meg nickte. Natürlich war sie okay. Sie war immer okay. Einer musste das ja sein, und sie war nun mal diejenige, die dieses Los gezogen hatte. »Alles gut, Liebes, danke.«
Molly sah sie eigenartig an, ergriff dann ihre Hand und drückte sie leicht. Die sanfte Kraft, die in dieser vertraulichen Geste lag, ließ Meg beinahe zusammenzucken. Ihre Tochter fasste sie an. Die einzigen Berührungen, an die sie zurückdenken konnte, waren der Schlag einer Handfläche auf ihrer Wange, der Tritt eines Fußes gegen ihr Schienbein, das Kratzen von Fingernägeln an ihrem Arm. So schlimm war ihr Verhältnis zueinander gewesen. Wirklich alles, wovor man sie im Zusammenhang mit pubertierenden Mädchen gewarnt hatte, war eingetreten, und zwar in der schlimmsten Form. Erst seit Kurzem hatte es begonnen, besser zu werden. In letzter Zeit schien es so, als würde ihre Tochter sie wieder mögen.
»Danke, mein Schatz«, sagte sie noch einmal.
»Du weißt, dass du mit mir darüber reden kannst, oder? Und dass ich dir zuhöre. Ich helfe dir gern. Immerhin hast du gerade deine Mutter verloren. Wenn ich meine Mutter verlieren würde …« Mollys Augen füllten sich mit Tränen. »O Gott, na ja, du verstehst schon.«
Meg lachte. »Ja, Schätzchen, das ist lieb von dir. Aber ehrlich, ich bin okay. Wirklich.«
Molly drückte erneut ihre Hand, bevor sie sie losließ. Holte theatralisch Luft und wies dann mit einem Kopfnicken auf den Schlüssel in Megs Hand. Ihre Mutter atmete ebenfalls tief durch und steckte ihn ins Schloss, sperrte auf und öffnete die Tür.
März 1986
Regenwolken hingen dunkel und schwer am Himmel, und in der Ferne hörte man Donnergrollen. Die Sandsteinplatten vor dem Hintereingang waren noch immer nassgrau vom letzten Schauer, und dicke Regentropfen hingen zitternd an Blättern und Frühlingsblüten. Hinter den Wolken jedoch waren ein paar Streifen Blau zu erkennen und am Horizont die ersten Anzeichen eines Regenbogens.
Lorelei stand barfuß vor der Küchentür, eingewickelt in eine lange, bunte Angorastrickjacke, das hüftlange Haar hochgesteckt und von drei großen Schildpattkämmen gehalten.
»Sieh nur, Meggy«, sagte sie und drehte sich um. »Ein Regenbogen. Schnell. Komm nach draußen.«
Meg blickte von ihren Büchern auf, die vor ihr auf dem Küchentisch ausgebreitet lagen. »Eine Minute«, sagte sie.
»Nein. In einer Minute ist er schon wieder weg. Du musst ihn dir jetzt gleich ansehen.«
»Okay«, willigte Meg gottergeben ein und legte ihren Stift auf dem Notizblock ab. Als sie sich zu ihrer Mutter nach draußen gesellte, spürte sie, wie die Nässe von den Steinplatten durch ihre Schaffellpantoffeln drang.
»Beth«, rief Lorelei. »Jungs! Kommt schnell!«
»Sie schauen fern und können dich nicht hören.«
»Geh und hol sie, ja, Schatz?«
»Sie werden nicht wollen.«
»Natürlich werden sie das. Schnell, Liebling, lauf rein und sag es ihnen.«
Meg wusste, dass es keinen Zweck hatte, Einwände zu erheben, und machte sich widerwillig auf den Weg ins Wohnzimmer. Ihre drei Geschwister saßen in einer Reihe auf dem abgewetzten Sofa, während der Hund träge zwischen ihnen lag. Sie sahen sich eine Kindersendung an und knabberten Karottenstifte.
»Mum bewundert gerade einen Regenbogen«, sagte sie mit einem schiefen Grinsen. »Sie will, dass ihr kommt und ihn euch anseht.«
Niemand schenkte ihr Beachtung, also kehrte sie mit der Nachricht zu ihrer Mutter zurück. Es wäre sowieso zu spät gewesen.
»Jammerschade«, sagte Lorelei nämlich und deutete betrübt zum Himmel hoch. »Jetzt ist er bereits weg. Für immer verschwunden. Unwiederbringlich …« Sie wischte eine kleine Träne, die ihr seitlich am Nasenflügel hinunterrann, mit der geballten Faust weg, wie Kinder es tun. »So ein Jammer«, murmelte sie, »einen Regenbogen zu verpassen …« Dann zwang sie sich zu einem Lächeln und sagte: »Na ja, wenigstens hat ihn eine von euch gesehen. Dann kannst du ihn den anderen immer noch beschreiben.«
Meg lächelte gequält. Als würde sie, dachte sie bei sich, mit ihren Geschwistern beisammensitzen und sich mit ihnen über das Rot und das Gelb, das Pink und das Grün, über die Schönheit und Pracht in Violett, Orange und Blau, über das Geheimnis der fernen spektralfarbenen Streifen unterhalten.
»Ja«, antwortete sie. »Vielleicht später.«
Obwohl es am nächsten Tag nach wie vor regnete, bestand Lorelei darauf, dass die Eiersuche wie gehabt stattfand.
»Lass uns die Eier drinnen verstecken«, schlug Colin behutsam vor.
»Kommt gar nicht in die Tüte«, gab Lorelei zurück. »Ostersonntag bedeutet Eiersuche im Garten. Regen hin oder her. Stimmt’s, Kinder?«
Meg blickte durch die bleiverglasten Küchenfenster, gegen die der Regen prasselte, missmutig in den Garten. Sie dachte an ihre Haare, die sie heute Morgen zu einer neuen Frisur aufgetürmt und mit Unmengen von Haarspray fixiert hatte. Dachte an den matschigen Rasen und an das kalte, nasse Gras, an ihre Segeltuchpumps und ihre Röhrenjeans, in die sie am Morgen nur mit Mühe hineingekommen war. Und vor allem dachte sie an die Verabredung nächste Woche, zu der sie ebendiese Jeans tragen wollte, und hoffte bloß, dass sie dann noch hineinpasste und überdies den Pickel an ihrem Kinn los war, der ihr Erscheinungsbild beeinträchtigte.
Die Zwillinge hingegen schlüpften bereits in ihre Gummistiefel und Regenjacken, während Lorelei draußen im Regen herumrannte und die Eier versteckte. Meg beobachtete sie durchs Fenster. Ihre Mutter sah aus wie ein Gespenst, groß und schlank in einer dünnen cremefarbenen Kittelbluse, ausgebleichten Jeans, grünen Gummistiefeln und einem Schlapphut aus Stroh. Die Haare hingen ihr klatschnass am Rücken herunter, und durch den nassen Stoff begannen sich ihre kleinen Brüste abzuzeichnen. Ihr Gesicht strahlte vor Freude, als sie von Stelle zu Stelle hüpfte und Eier aus einem Strohkörbchen verteilte, das sie in der Armbeuge hielt. Die Zwillinge warteten voll angespannter Erwartung im Hausflur. Mit ihren elf Jahren ließen sie sich nach wie vor von Loreleis Begeisterung und kindlichem Eifer mitreißen. Sie waren nach wie vor ihre Babys, gerade noch.
»Auf die Plätze, fertig, los«, rief sie einen Augenblick später, und die Jungs flitzten hinaus in den Garten, gemächlicher gefolgt von Bethan in einem rosa gepunkteten Regenmantel und passenden Gummistiefeln.
»Meggy?« Ihre Mutter starrte sie erwartungsvoll an. »Keine Eier?«
»Ich lasse sie den anderen«, antwortete Meg in der Hoffnung, dass der Hinweis auf geschwisterliches Entgegenkommen sie vor weiterem Drängen bewahren würde.
»Es ist genug für alle da. Tonnenweise.«
Meg zuckte mit den Schultern. »Ich will nicht, dass meine Haare nass werden.«
»Ach du meine Güte. Das ist doch keine Entschuldigung. Setz einen Regenschutz auf, hier …« Lorelei zog einen Plastikhut aus einer Schublade und drückte ihn der Tochter in die Hand.
Meg starrte entsetzt darauf. »Den setze ich nicht auf.«
»Warum denn nicht um Himmels willen?«
»Weil das eine Kopfbedeckung für Großmütter ist.«
»Gar nicht. Das ist mein Hut.«
»Eben.«
Lorelei warf den Kopf zurück und lachte leicht gekränkt. »O mein Liebling, eines Tages wirst du, so Gott will, ebenfalls vierzig sein, und ich verspreche dir, du wirst dich keinen Tag älter fühlen als achtzehn. Nicht einen Tag. Jetzt setz den Hut auf und komm, hab ein bisschen Spaß mit den Kleinen.« Ihr Gesicht wurde für einen Moment ernst. »Stell dir vor, wenn einem von uns etwas zustoßen würde und es nächstes Jahr keine Eiersuche gäbe – stell dir vor, wenn alles aufhören würde, so perfekt zu sein, dann würdest du dir wünschen, dass du heute mitgemacht hättest …«
Megan starrte in die Augen ihrer Mutter, in diese grünen Tiefen. Ihr Blick war bestimmt. Das Mädchen zwang sich zu einem Lächeln. »Okay«, sagte sie gedehnt, um zu verdeutlichen, welch großes Opfer sie damit brachte.
Die elf Eier, die sie an diesem Morgen fand, überließ sie alle ihren Geschwistern.
Pandora und ihr Mann Laurence kamen gegen Mittag an. Ohne ihre beiden mittlerweile erwachsenen Söhne, dafür mit einem neuen Hündchen im Schlepptau. Kurz darauf tauchte auch Colins Schwester Lorna mit einer Einkaufstasche voller Ostereier auf. Als Nächstes erschienen ihre Nachbarn Bob und Jenny samt drei kleinen Kindern. Lorelei brutzelte in ihrem Herd eine Lammhaxe, die sie anschließend mit viel zu vielen glasierten Karotten – »Ist das nicht ein herrlicher Orangeton?« – und nicht ansatzweise genug gerösteten Kartoffeln servierte.
Die Kinder saßen an einem Picknicktisch in einer Ecke der Küche, während die Erwachsenen sich rund um den Holztisch in der Mitte versammelt hatten. Megan fühlte sich verloren zwischen diesen beiden Gruppen: zu alt für den Kindertisch, zu jung für die Erwachsenen – und im ganzen Raum keine einzige Person, die ihren raffinierten Lidstrich bewundert hätte oder ihre neue Strickjacke mit den Lederknöpfen oder die Tatsache, dass sie endlich auf vierundfünfzig Kilo runter war.
Zwar überlegte sie, Vegetarierin zu werden, mochte aber keine Karotten, und so stocherte sie geziert an der einen gerösteten Kartoffel herum, die ihr die Mutter mit den Worten »Gäste zuerst, Schatz!« zugeteilt hatte, starrte durch das Fenster in den unaufhörlichen Regen und träumte davon, von hier zu fliehen.
Megan stellte sich vor, die unsichtbaren Wände um sie herum würden zerbersten, wenn sie mit der Faust dagegenschlug. Sie malte sich frische Luft aus, helles Licht und sehr, sehr viel Platz. Ein Zimmer mit vier kahlen Wänden, ein quadratisches Bett mit reinen weißen Laken, ein großes Fenster mit einfachen Vorhängen wie in Demi Moores Zimmer in St. Elmo’s Fire. Eine blitzblanke Küche, funkelnde Töpfe, ein weißes Badezimmer und einen ruhigen Mann mit sauberen Fingernägeln und einer silbernen Gitarre.
Dann sah sie sich in ihrer Wirklichkeit um, betrachtete die fünfzehn Jahre Kinderkunst, die liebevoll an die Wand gehängt, geheftet und geklebt worden war, und plötzlich kippte der Gedanke an Flucht in ihrem Herzen. Sie verließ den Kindertisch und setzte sich auf die Knie ihres Vaters am Tisch der Erwachsenen, gab sich der Hoffnung hin, das süße Gefühl ihrer Kindertage würde wiederkehren. Er schlang seinen Arm um ihre Taille, und Megan lächelte ihrer Mutter über den Tisch hinweg zu.
»Weißt du, Lorrie, deine Küche ist wirklich der schönste Platz an so einem ungemütlichen Tag wie heute«, sagte Jenny, die Nachbarin, und legte den Arm um ihre Freundin. »Nein, wirklich. So warm. So einladend. Sollte ich mich jemals auf einem verschneiten Berg wiederfinden und kurz vorm Erfrieren sein, dann würde ich vermutlich von diesem Platz hier halluzinieren. Von Lorries wundervoller Küche.«
»Danke«, sagte Lorelei und küsste sie auf die Wange. »Meggy findet, das Haus ist ein einziges Durcheinander, oder, Liebling?«
»Ist es ja auch«, erwiderte Megan.
Lorelei lachte. »Jedem Tierchen sein Pläsierchen, stimmt’s?«
Meg runzelte die Stirn und verdrehte die Augen. »Ich verstehe einfach nicht, warum du so viel Zeug aufheben musst. Ich meine, das da verstehe ich ja noch«, sie deutete auf die Zeichnungen. »Aber warum haben wir zum Beispiel neunzehn Geschirrtücher?«
Lorelei machte eine wegwerfende Handbewegung. »Wir haben überhaupt keine neunzehn Geschirrtücher.«
»Haben wir sehr wohl, Mum. Ich habe sie neulich gezählt. Bloß so zum Spaß. Schau!« Megan sprang auf und riss eine Küchenschublade auf, zog ein Geschirrtuch nach dem anderen heraus und hielt sie hoch. »Geschirrtücher mit Löchern, Geschirrtücher mit Brandflecken, fleckige Geschirrtücher, fadenscheinige Geschirrtücher. Und, man glaubt es kaum, nagelneue schöne Geschirrtücher.«
Pandora lachte. »Ich muss gestehen, Lorrie, das da habe ich dir gekauft, weil mir beim letzten Mal, als ich hier war, deine verschlissenen Geschirrtücher aufgefallen sind.«
»Egal«, fuhr Megan theatralisch fort und redete sich in Eifer. »Werfen wir die alten Tücher etwa weg? Nein! Das tun wir nicht. Wir waschen sie und trocknen sie, und dann legen wir sie zusammen und räumen sie wieder in diese Schublade, in der sich mittlerweile ganze neunzehn Geschirrtücher befinden.«
»Tja, Liebling«, sagte ihre Mutter steif. »Ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass du in drei Monaten deine mittlere Reife machst, würde ich meinen, du wüsstest Wichtigeres mit deiner Zeit anzufangen, als Geschirrtücher zu zählen.«
»Bitte, lass mich eins wegschmeißen, Mum. Bitte! Ich flehe dich an. Wie wär’s mit diesem hier?« Sie hielt ein unansehnliches graues Tuch hoch, das über die gesamte Länge einen Riss hatte.
»Nein«, rief Lorelei. »Auf keinen Fall. Das geht noch als Lappen.«
»Mum«, wandte Megan verzweifelt ein, »wir haben eine schwarze Tüte an der Treppe hängen, die vor Lappen fast platzt. Lappen, die wir nie benutzen. Wir brauchen keine zusätzlichen Lappen.«
»Leg es zurück«, sagte ihre Mutter, und ihre fröhlichen Augen verdunkelten sich einen Moment lang. »Bitte. Leg es einfach zurück. Ich sortiere das demnächst mal aus. Wenn ihr alle wieder in der Schule seid.«
»Das machst du sowieso nicht, oder? Du weißt das, und ich weiß das. Wenn ich in zehn Jahren zu Besuch herkomme, sind bestimmt dreißig Geschirrtücher in der Schublade. Inklusive diesem hier.« Sie schleuderte ihrer Mutter das Tuch auf den Schoß.
»Lass gut sein, Meg«, sagte Jenny nervös. »Hör auf, deine liebe Mutter zu terrorisieren.«
Megan stöhnte, sah sich um und merkte, dass alle aufgehört hatten, sich zu unterhalten, und sie mit unterschiedlichen Stufen des Unbehagens anschauten. Beth warf ihr über den Tisch hinweg vorwurfsvolle Blicke zu, ihr Vater starrte auf seine Schuhe, während ihre Mutter verlegen lächelte und sich die spitzen Ellenbogen rieb.
»Es sind doch bloß Geschirrtücher«, sagte Rhys.
»Ja«, bekräftigte Lorelei fröhlich. »Genauso ist es, Rhys, es sind bloß Geschirrtücher. Also, wer will noch Karotten? Es sind haufenweise da.«
Megan ging hinauf in ihr Zimmer, hörte sich die Hits der Woche im Radio an und hoffte, dass der Sound ihrer Lieblingsband Simple Minds sie beruhigen würde.
April 2011
Sollte das etwa die Küche sein? Zumindest ließ sie sich nicht als solche erkennen. Der Raum war dunkel, gespenstisch dunkel, und nichts von dem schönen, hellen Frühlingstag drang von draußen herein mit Ausnahme eines schmalen Lichtstreifs, der durch eine Lücke in den Stapeln vor den Fenstern fiel. Meg tastete an der Wand zu ihrer Linken nach dem Lichtschalter, doch die Lampe ging nicht an. Was kaum überraschte. Sie schaltete die Taschenlampenfunktion in ihrem Handy ein.
»Du lieber Himmel.« Molly schlug eine Hand vor den Mund, die schwarz geschminkten Augen vor Entsetzen weit aufgerissen. Mit der anderen Hand griff sie nach dem Arm ihrer Mutter und klammerte sich daran fest.
Megan seufzte. »O Mum.«
Ihre Tochter lockerte den Griff und nahm die Hand vom Mund. »Ich weiß noch, wie wir hier gefrühstückt haben«, sagte sie. »Es gab einen großen Tisch. Da. Mit Bänken. Und die Gläser mit Cornflakes und Müsli standen da drüben, sie hatten Korkdeckel. Und draußen vor dem Fenster konnte man einen Baum sehen …«
Sie wandten sich dorthin, wo die Fenster sein mussten, nur taten sie sich schwer, sie hinter den aufgestapelten Dingen auszumachen. Es war verwirrend. In dem Haus ergab nichts mehr einen Sinn.
»Wie wollen wir in die restlichen Zimmer kommen?«, fragte Molly skeptisch.
Meg seufzte erneut und schwenkte das Handy zu der Stelle im hinteren Teil des Raumes, wo sich die Tür zum Flur befand, aber auch dort gab es nichts als Wände. Wände innerhalb von Wänden. Wie ein Labyrinth. Man wusste nicht, wo das Zimmer anfing und wo es aufhörte. Endlich wurde eine Lücke von etwa dreißig Zentimetern sichtbar. Megan leuchtete nach unten und sah Bodenfliesen. Die Fliesen ihrer Kindheit. Bisher das einzig vertraute Merkmal.
»Ich denke«, sagte sie und richtete die Lampe wieder auf die Lücke, »wir müssen hier lang.«
»Machst du Witze?«
»Ich fürchte nein.«
»Ich krieg eine Panikattacke, wenn ich da durch muss.«
»Ich vermutlich auch. Allerdings bin ich mir nicht mal sicher, ob ich durch dieses Nadelöhr passe. Sieh nur, wie eng das ist.«
»Tja, allein gehe ich da nicht rein. Keine Chance.«
Meg straffte die Schultern. Sie hatte vor Jahren fast zwanzig Kilo abgenommen und brauchte längst nicht mehr Kleidergröße vierundvierzig – trotzdem war sie nach wie vor eine eher kräftige Frau und keine Bohnenstange wie ihre Mutter und ihre Tochter.
»Gut«, sagte sie und zog den Bauch ein. »In Ordnung. Ich gehe voraus.«
»O Mann«, jammerte Molly und klammerte sich von hinten an Megs Shirt. »Mum, ich habe Schiss.«
»Jetzt sei nicht albern«, erwiderte Meg, die selbst Gedanken an Urzeitmonster unterdrücken musste. »Es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest. Das ist bloß Grandmas Haus. Sonst nichts.«
»Nur dass wir die Ersten sind, die seit Jahren einen Fuß hineinsetzen. Ich meine, scheiße, hier könnte alles Mögliche sein. Ratten! Mum, was ist mit Ratten?!«
»Alles halb so wild, Liebes. Es wird schon keine Ratten geben. Grandma hat praktisch nicht mehr zu Hause gegessen, folglich gibt es hier kein Futter für sie. Komm endlich. Halt dich einfach an mir fest und atme tief durch.«
Die Wände schienen Meg von beiden Seiten zu umschließen. Sie fühlten sich fest und gleichförmig an, aber bei genauerem Hinsehen erkannte sie im schwachen Licht Details: hier ein Hemdbündchen, ein zerfetztes Netz, die Ecke eines Buches, eine zugeknotete schwarze Tüte. Alles, was Lorelei aufgehäuft und zusammengeschoben hatte im Laufe der zahllosen Tage, Monate, Jahre, die sie hier mutterseelenallein verbrachte und sich weigerte, Besuch oder Hilfe zu akzeptieren.
»Alles okay, Liebes?«, flüsterte Meg in die Dunkelheit hinter ihr.
»Ja, ich glaube schon. Ist es noch weit?«
Meg empfand ein tief sitzendes Unbehagen, und ihr Herz krampfte sich zusammen. »Nur ein kleines Stück«, antwortete sie dennoch betont munter.
»Und was ist am anderen Ende?«
»Bin mir nicht ganz sicher. Hoffentlich eine Tür.«
Gleich darauf machte der enge Durchgang eine Fünfundvierzig-Grad-Kurve, und es wurde ein wenig heller. Megan erkannte eine Öffnung. »Wir sind da«, sagte sie. »Wir haben’s geschafft.«
Hatte sie allerdings mit Luft und Licht gerechnet, so sah sie sich enttäuscht, als sie sich aus der klaustrophobischen Enge schob. Denn der eine Tunnel mündete gleich hinter der Tür zum Hausflur in den nächsten. Vor ihrem inneren Auge sah Megan sich bereits, wie sie sich durch immer enger werdende Gänge in immer tiefere Winkel des Hauses vorzwängte, bis sie am Ende stecken blieb und nicht einmal mehr kehrtmachen konnte.
Sie unterdrückte den Drang zu schreien. »Gut, wenigstens ist es hier nicht mehr ganz so dunkel.«
Das Fenster über dem Treppenabsatz war lediglich teilweise versperrt und warf einen Schimmer staubig blauen Lichts über die aufgetürmten Wände aus Müll. Zumindest so viel, dass Megan sich ein wenig zu orientieren vermochte. Geradeaus befand sich die Tür zu einem kleineren Raum, links von ihr die zum Wohnzimmer und rechts die Treppe. Sie wusste all das bloß aus ihrer Erinnerung, denn nichts davon war zu sehen. Man hatte ihr gesagt, dass ihre Mutter sich zuletzt fast ausschließlich im Schlafzimmer aufgehalten habe. Vielleicht war dort ja weniger Gerümpel als im restlichen Haus, sodass sie keine Gefahr liefen, zerquetscht zu werden.
»Gut«, bekräftigte sie noch einmal, um ihre Tochter zu ermutigen. »Weiter! Bist du bereit?«
Molly nickte unsicher und klammerte sich wieder an Megs Tunika.
Sie schoben sich seitwärts durch einen Tunnel, gelangten, fast wie auf einer Straße, an eine planvoll angelegte Kreuzung, an der sie rechts abbogen. Meg ertastete mit den Zehen den Treppenläufer und stieg vorsichtig die Stufen hinauf, die sie aus alter Gewohnheit abzählte. Elf bis zum Treppenabsatz. Dann eine Hundertachtzig-Grad-Kehre und weitere zwölf bis zum ersten Stock.
Oben angekommen, drehte sie sich zu Molly um und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Hier ist es zum Glück ziemlich hell«, sagte sie und deutete auf das nur bis zur Hälfte zugestellte Flurfenster. »Man kann sogar in den Garten sehen.« Molly stellte sich neben sie, und sie saugten das Bild in sich auf wie Verdurstende den Anblick von Wasser in der Wüste. Staubpartikel glitzerten in der Mittagssonne, Spinnweben hingen von den Holzbalken an der Decke und von den alten Lampenschirmen. Hier oben roch es modriger, muffiger. Unten hatte es überwiegend nach altem Papier und Staub und nach stickiger Luft gerochen – hier stiegen ihnen zusätzlich körperliche Ausdünstungen und der Geruch nach ungewaschenen Sachen in die Nase.
Molly hielt sich erneut die Hand vors Gesicht und schauderte zusammen. »Eklig«, meinte sie. »Gut, dass man solche Orte im Fernsehen nicht riechen kann. Sonst würde sich niemand diese Sendungen anschauen. Echt.«
»Es ist weniger schlimm als befürchtet. Wenn man bedenkt, wie lange sie so gelebt hat.«
»Es ist widerlich.«
Megan zuckte mit den Schultern. Sie vermochte dem nichts entgegenzusetzen. »Ja, es ist die Hölle.«
»Schlimmer als das.«
»Die Hölle auf Erden.«
In der Tat war es unbeschreiblich, und Worte reichten nicht aus, um diese Erfahrung zu vermitteln. Jahrelang hatte Megan nachts wach gelegen, sich das hier vorgestellt und sich ausgemalt, was aus zweiter Hand von Sozialarbeitern und der Stadtverwaltung zu hören gewesen war. Der extremste Fall von Messietum sei das und Loreleis Leben überdies in Gefahr, jeden Augenblick an jedem Tag. Ihre Mutter pflegte das am Telefon herunterzuspielen. Bloß Getue, behauptete sie. Nichts als albernes Tamtam wegen ein paar Sachen. Außerdem könne sie so leben, wie sie wolle. Punkt.
Megan hatte versucht dagegenzuhalten: »Du wirst dich noch umbringen, weil dich eines Tages der ganze Müll erschlagen und dich unter sich begraben wird. Dann müssen sie das Haus abreißen, um deine Leiche rauszubekommen.«
Lorelei schlug all diese Mahnungen in den Wind. Damit habe sie kein Problem, entgegnete sie auf solche Einwände lachend. Aber selbst in ihren schlimmsten Vorstellungen hatte Megan sich das hier nicht ausgemalt, den schrecklichen Gestank, das Grauen, das einen in dieser Umgebung unwillkürlich befiel.
Ein langer Korridor aus Krempel führte von der Treppe in Loreleis Schlafzimmer. Meg konnte sich lebhaft daran erinnern, wann sie diesen Raum zuletzt betreten hatte. Vor sechs Jahren. Als sie noch einmal zu Ostern hergekommen war mit Molly und den Jungs. Damals befand sich das Haus bereits in einem katastrophalen Zustand. Ihre Mutter hatte in diesem Zimmer zwischen aufgestapeltem Plunder gesessen wie eine Spinne in ihrem Netz und war gerade dabei gewesen, ihre Fußnägel grün zu lackieren. Trotzdem wirkte ihr Lächeln, als sei alles in bester Ordnung.
Allein beim Gedanken daran bekam sie einen Kloß im Hals.
Sie wusste noch, wie entsetzt sie damals gewesen war, ihre Mutter bis zum Hals in all diesem Schrott begraben zu sehen. Und wie verärgert, dass sie das Haus dermaßen verkommen ließ und damit dem Klatsch der Nachbarn noch Vorschub leistete. Vor lauter Wut hatte sie Lorelei beinahe gehasst.
Doch als sie sich jetzt schrittweise in das Zimmer vorschob, sah sie nicht den Schmutz und nicht den Müll, sondern nur den Lehnstuhl, in dem ihre Mutter zu sitzen pflegte. Ein ausladendes geblümtes Ding mit billigen Kissen darin, zu beiden Seiten Tischchen, auf denen sich Nagellack, Taschenbücher, Reiswaffeln und die überdimensionalen Kopfhörer stapelten, die Lorelei zum Radiohören benutzt hatte. Trauer überfiel sie, weil der Platz nun leer war.
Es knirschte unter Mollys Schuhen, als sie sich ihren Weg über leere Verpackungen, ausrangierte Kleidungsstücke, alte Zeitungen und anderen Plunder bahnte. Das Mädchen stellte sich neben Megan in die Mitte des Zimmers. »Ich kann mich erinnern, wie sie dasaß, als wir damals hergekommen sind«, sagte sie atemlos. »Genau da. Ich hatte Angst vor ihr.«
Megan drehte sich zu ihrer Tochter um. »Angst? Ehrlich?«
»Ja, sie sah so seltsam aus in ihrem Sessel. So schmal und dürr und zugleich mit einem irgendwie wilden Blick. So jemanden wie sie hatte ich nie zuvor gesehen.«
»Arme Mum«, sagte Megan. »Hast du die heiße Schokolade ganz vergessen?«
Molly sah sie verständnislos an.
»Sie hat euch Kindern heiße Schokolade gemacht. Vor dem Schlafengehen. Ihr wart alle völlig begeistert von ihr. Weißt du das nicht mehr?«
»Keine Ahnung.« Molly zuckte mit den Schultern. »Nur der da ist mir im Gedächtnis geblieben«, sie deutete auf den Sessel. »Und wie sie dort hockte.«
Megan übermannte tiefe Traurigkeit.
»Ich versteh’s einfach nicht«, sagte Molly. »Ich meine, du bist so, na ja, normal. Eigentlich der normalste Mensch, den ich kenne. Und außerdem schrecklich sauber. Wie kann es sein, dass du aus einer solchen Umgebung stammst?«
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »Sie war nicht immer so. In früheren Zeiten, Molly, war dieses Haus sogar relativ normal. Bloß ein wenig unordentlich.«
»Und deine Mum? Grandma? War sie je normal?«
»Eine gute Frage.« Megan lächelte wehmütig. »Ich glaube, bei meiner Mutter ist das alles schrittweise gekommen.« Sie trat näher an den Sessel heran und berührte ihn zaghaft mit den Fingerspitzen. Und dann, bevor die Sauberkeitsfanatikerin in ihr sie vor Flöhen, Keimen und allem möglichen anderen warnen konnte, setzte sie sich einfach in den Sessel ihrer Mutter. Ließ den Kopf gegen die abgewetzte, schmuddelige Polsterung sinken und blickte lächelnd zu ihrer Tochter hoch. »In kleinen, winzig kleinen Schritten.«
2
Freitag, 5. November 2010
Hallo Jim!
Ich freue mich sehr, dass ich dich nicht vergrault habe, und danke dir für deine Antwort. Es war spannend, mehr über dich zu erfahren. Hatte ich doch recht, dass du eigentlich kein Jim, sondern ein James bist. Allerdings stimme ich dir zu, dass Jim viel freundlicher klingt – besonders dort oben in Gateshead. Wahrscheinlich wolltest du nicht zu sehr herausstechen! Hast du einen Akzent? Ich habe keinen besonderen, und schätzungsweise würdest du mich als etepetete bezeichnen.
Das mag daran liegen, dass ich in der Nähe von Oxford aufgewachsen bin und dort das Mädchengymnasium besuchte. Meine Eltern haben beide Bücher geschrieben, mein Vater über Medizin und meine Mutter übers Gärtnern. Bei uns war alles recht chaotisch und ein bisschen links. Niemand sah je in einen Spiegel, niemand putzte oder wischte ständig. Trotzdem wirkte keiner aus der Familie unbekümmert, im Gegenteil. Irgendeine Traurigkeit hing über allen. Zum einen wegen des toten Babys, zum anderen wegen eines Vorfalls, über den ich aber nicht reden kann. Obwohl es also eigentlich nach einer glücklichen Kindheit klingt, war es das nicht wirklich. Und dann starben meine Eltern beide jung, einer nach dem anderen. Ich war zwanzig beim Tod meines Vaters, dreiundzwanzig bei dem meiner Mutter, und ich blieb zurück mit all diesem Zeug, über das wir nie gesprochen haben. Dinge, über die wir hätten reden müssen. Doch du weißt ja, wie man in diesem Alter so ist. Man denkt, man hätte alle Zeit der Welt, oder?
Ich würde sagen, dass ich ein seltsames Kind war, ein bisschen so, wie du dich beschrieben hast. Sehr introvertiert und mit einer ziemlich blühenden Fantasie begabt. Außerdem habe ich leidenschaftlich allerlei Dinge gesammelt und fast bis zum Beginn der Pubertät ins Bett gemacht. In mancher Hinsicht war ich recht ungebärdig, wild fast – und gleichzeitig fürchterlich schüchtern. Ich wurde ständig zu irgendwelchen Therapeuten geschleppt, ohne dass einer von ihnen aus mir schlau wurde. Und dann zog ich mit achtzehn von zu Hause aus und ging zur Universität. Dort veränderte ich mich vollkommen, lebte geradezu auf und wurde zu einem neuen Menschen. Es war, als hätte es meine Kindheit nie gegeben, als hätte ich mich gehäutet.
Also, bitte schön, das bin ich. Nun ja, zumindest meine frühen Jahre. Ich schätze mal, meine Kindheitserlebnisse haben dazu geführt, dass ich später wild entschlossen war, meinen eigenen Kindern die bestmögliche Kindheit zu bieten. Es bleibt abzuwarten, ob sie der Meinung sind, dass mir das auch gelungen ist.
Erzähl mir mehr über deinen Sohn. Lebst du bei ihm? Wie alt ist er? Wie heißt er? Ich bin froh, dass du ein Kind hast. Dann haben wir mehr, worüber wir reden können.
ENDE DER LESEPROBE