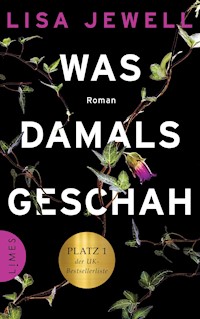8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Meisterhaft steigert Jewell die Spannung und zieht den Leser immer tiefer hinein in die lebendig erzählte Geschichte.« New York Times
An einem stürmischen Frühlingstag findet die alleinerziehende Mutter Alice am Strand vor ihrem Cottage einen Mann. Er erinnert sich weder, wie er dort hingekommen ist, noch, wie er heißt. Obwohl sie normalerweise keine mysteriösen Fremden bei sich aufnimmt, bietet Alice ihm ihre Hilfe an. Zur gleichen Zeit vermisst die frisch verheiratete Lily in London ihren Ehemann, und sie ist sicher, dass ihm etwas zugestoßen sein muss. Doch wie hängt all dies mit den Geschehnissen im Sommer 1993 zusammen? Jenem Sommer, der mit einem tragischen Ereignis endete, das auch jetzt, in der Gegenwart, noch weitreichende Konsequenzen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
An einem stürmischen Frühlingstag findet die alleinerziehende Mutter Alice am Strand vor ihrem Cottage einen Mann. Er erinnert sich weder, wie er dort hingekommen ist, noch, wie er heißt. Obwohl sie normalerweise keine mysteriösen Fremden bei sich aufnimmt, bietet Alice ihm ihre Hilfe an. Zur gleichen Zeit vermisst die frisch verheiratete Lily in London ihren Ehemann, und sie ist sicher, dass ihm etwas zugestoßen sein muss. Doch wie hängt all dies mit den Geschehnissen im Sommer 1993 zusammen? Jenem Sommer, der mit einem tragischen Ereignis endete, das auch jetzt, in der Gegenwart, noch weitreichende Konsequenzen hat …
»Meisterhaft steigert Jewell die Spannung und zieht den Leser immer tiefer hinein in die lebendig erzählte Geschichte.« New York Times
Autorin
Lisa Jewell ist eine von Großbritanniens großen Bestsellerautorinnen. Sie wurde 1968 in London geboren und arbeitete viele Jahre in der Modebranche, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in London.
Von Lisa Jewell bereits erschienen
Der Flügelschlag des Glücks · Die Liebe seines Lebens
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
LISA JEWELL
DERFREMDEAMSTRAND
Roman
Deutsch von Carola Fischer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »I Found You« bei Century, London.
Copyright der Originalausgabe © Lisa Jewell 2016
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage Umschlagdesign: Laywan Kwan Umschlagmotive: Giulia Fiori Photography/Moment Open/Getty Images; © Shutterstock.com/margo_black
AF · Herstellung: sto
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20473-0 V002 www.limes-verlag.de
Dieses Buch ist Jascha gewidmet.(Du siehst, ich liebe dich mehr als den Hund.)
ERSTER TEIL
1
Alice Lake lebt in einem Haus am Meer. Das Haus ist winzig, ein Cottage der Küstenwache, das vor über dreihundert Jahren für Menschen erbaut wurde, die sehr viel kleiner waren als sie selbst. Die Decken sind schief und wölben sich, ihr vierzehnjähriger Sohn muss den Kopf einziehen, wenn er durch die Haustür geht. Ihre Kinder waren alle noch klein, als Alice vor sechs Jahren aus London hierhergezogen ist. Jasmine war zehn, Kai acht Jahre, und Romaine war ein vier Monate altes Baby. Alice hatte sich nicht träumen lassen, dass aus Kai eines Tages ein schlaksiger Teenager von einem Meter achtzig würde. Sie hatte nicht geahnt, dass ihre Kinder irgendwann zu groß für dieses Haus sein könnten.
Alice sitzt in ihrem winzigen Zimmer im obersten Stock. Von hier aus betreibt sie ihr kleines Gewerbe. Sie macht Kunst aus alten Landkarten. Die Bilder verkauft sie im Internet. Aber auch wenn das, was sie bekommt, schwachsinnig viel Geld für ein Kunstwerk aus alten Landkarten ist, für eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern ist es das nicht. Alice verkauft mehrere Kunstwerke pro Woche. Und das Geld reicht eben gerade so.
Vor ihrem Fenster schwingt eine Reihe ausgeblichener Wimpel im stürmischen Aprilwind zwischen viktorianischen Straßenlampen hin und her. Linker Hand ist eine Helling. Farbenfrohe kleine Fischerboote liegen dort zu beiden Seiten eines Anlegers aus Beton, und der scheußliche Schaum der Nordsee prallt gegen das felsige Ufer. Dahinter liegt das Meer. Schwarz und unendlich. Alice hat immer noch große Ehrfurcht vor der Nordsee. In Brixton, wo sie früher wohnte, blickte sie nur auf Häuserwände, auf benachbarte Gärten, ein paar Hochhäuser in der Ferne unter dunstigem Himmel. Und jetzt ist da dieses riesige Meer vor ihren Augen. Wenn sie sich auf ihr Sofa setzt, sieht sie nur Meer, als ob das Wasser ein Teil des Raums wäre, als ob es jederzeit durch die Fensterrahmen dringen und sie alle ertränken könnte.
Sie schaut wieder auf ihr iPad. Auf dem Bildschirm ist ein kleiner quadratischer Raum zu sehen. Eine Katze sitzt auf einem grünen Sofa und leckt sich das Fell, auf dem Couchtisch steht eine Teekanne. Alice kann hören, wie ihre Mutter mit der Pflegekraft spricht und ihr Vater mit ihrer Mutter. Sie versteht nicht genau, was sie sagen, denn das Mikrofon der Webcam, die sie bei ihrem letzten Besuch im Wohnzimmer installiert hat, überträgt den Ton aus den anderen Räumen nicht. Aber Alice ist beruhigt, denn sie weiß, dass die Pflegekraft da ist. Ihre Eltern werden Essen bekommen und ihre Medikamente einnehmen, sie werden gewaschen und angezogen, und in den nächsten ein oder zwei Stunden muss Alice sich keine Sorgen um sie machen.
Als sie vor sechs Jahren nach Nordengland zog, hätte sie nie gedacht, dass ihre munteren, gescheiten, gerade mal siebzig Jahre alten Eltern beide innerhalb weniger Wochen an Alzheimer erkranken und Pflegefälle werden würden.
Auf Alices Laptop ist eine Bestellung eingegangen von einem Mann namens Max Fitzgibbon. Er wünscht sich aus den Karten von Cumbria, Chelsea und Saint-Tropez eine Rose, die er seiner Frau zum fünfzigsten Geburtstag schenken will. Alice hat sofort ein Bild von dem Mann vor Augen: Er sieht gut aus für sein Alter, hat silbergraues Haar und trägt einen lila Pullover mit Reißverschluss. Auch nach fünfundzwanzig Jahren Ehe ist er immer noch unsterblich in seine Frau verliebt. Das alles kann sie an seinem Namen, seiner Adresse, an der Wahl seines Geschenks ablesen. »Große, volle Englische Rosen waren schon immer ihre Lieblingsblumen« steht in dem Kommentarfeld des Bestellformulars.
Alice schaut von ihrem Laptop auf und blickt aus dem Fenster. Er ist immer noch da. Der Mann am Strand.
Seit sie heute Morgen um sieben die Vorhänge aufgezogen hat, sitzt er dort, die Arme um die Knie geschlungen, im feuchten Sand und starrt unentwegt aufs Meer hinaus. Sie hat ihn den ganzen Tag im Auge behalten, aus Angst, er könne sich umbringen wollen. Das ist schon einmal passiert. Ein junger Mann, dessen Gesicht im fahlen Mondlicht leichenblass aussah, hatte seinen Mantel am Strand liegen gelassen und war einfach verschwunden. Das ist schon drei Jahre her, doch die Erinnerung quält Alice immer noch.
Aber dieser Mann bewegt sich nicht. Er sitzt einfach nur da und starrt vor sich hin. Die Luft ist heute kalt, und es bläst ein heftiger Seewind, der einen eisigen Gischtschleier mit an Land bringt. Dennoch hat der Mann nur ein Hemd und eine Jeans an. Er hat weder eine Jacke noch eine Tasche dabei und trägt keine Mütze und auch keinen Schal. Irgendetwas an ihm ist beunruhigend: Er ist nicht verwahrlost wie ein Obdachloser und wirkt nicht so seltsam wie die Patienten der psychiatrischen Tagesklinik im Ort. Er ist auch kein Junkie, dafür sieht er zu gesund aus, und er hat keinen Alkohol dabei. Er sieht einfach nur … Alice sucht nach dem passenden Wort, und dann fällt es ihr ein. Er sieht verloren aus.
Eine Stunde später regnet es. Alice späht durch die nasse Fensterscheibe zum Strand hinunter. Er ist immer noch da. Die braunen Haare kleben ihm am Kopf, seine Schultern und Ärmel sind von der Nässe tiefdunkel. In einer halben Stunde muss sie Romaine von der Schule abholen. Im Bruchteil einer Sekunde hat sie sich entschieden.
»Hero!«, ruft sie den scheckigen Bullterrier. »Sadie!« Das ist der alte Pudel. »Griff!« Das ist der Windhund. »Gassi gehen!«
Alice hat drei Hunde, aber nur Griff, den Windhund, hat sie sich selbst ausgesucht. Der Pudel gehört ihren Eltern. Sadie ist achtzehn Jahre alt und sollte eigentlich längst tot sein. Die Hälfte ihres Fells hat sie schon verloren, ihre Beine sind kahl und sehen aus wie Vogelbeinchen, aber sie besteht darauf, mit den anderen Hunden hinauszugehen. Und Hero, der Bullterrier, gehörte ihrem früheren Untermieter. Barry verschwand eines Tages und ließ ihr alles da, auch seine gestörte Hündin. Auf der Straße muss Hero einen Maulkorb tragen, denn sonst fällt sie Kinderwagen und Rollerfahrer an.
Während die Hunde sich um sie scharen und Alice die Leinen an ihren Halsbändern befestigt, fällt ihr Blick auf etwas am Kleiderhaken, das Barry in seiner Nacht-und-Nebel-Aktion ebenfalls vergessen hat: eine abgetragene alte Jacke. Unwillkürlich rümpft sie die Nase. In einem Moment geistiger Umnachtung – und größter Einsamkeit – hat sie einmal mit Barry geschlafen. Das bereute sie bereits, als er auf ihr lag und sie den Käsegeruch bemerkte, der aus jeder Pore seines leicht schwabbeligen Körpers strömte. Sie hielt den Atem an und machte weiter, aber seitdem brachte sie ihn immer mit diesem Geruch in Verbindung.
Vorsichtig zieht sie die Jacke vom Haken und legt sie sich über den Arm. Dann nimmt sie die Hundeleinen und einen Regenschirm und geht in Richtung Strand.
»Hier«, sagt sie und reicht dem Mann die Jacke. »Sie müffelt ein bisschen, aber sie ist regendicht. Und sie hat eine Kapuze, schauen Sie mal.«
Der Mann dreht sich langsam zu Alice um und sieht sie an.
Anscheinend hat er sie noch nicht verstanden, also redet sie einfach weiter. »Die Jacke hat Barry gehört. Mein ehemaliger Untermieter. Er war ungefähr so groß wie Sie. Aber Sie riechen besser. Natürlich weiß ich das nicht genau. Aber Sie sehen so aus, als würden Sie gut riechen.«
Der Mann schaut zu Alice und dann auf die Jacke.
»Also«, sagt sie. »Wollen Sie sie?«
Immer noch keine Antwort.
»Okay. Ich werde die Jacke hier bei Ihnen liegen lassen. Ich brauche sie nicht, und ich will sie auch nicht. Sie können sie also genauso gut behalten. Auch wenn Sie sich nur draufsetzen. Sie können sie auch in den Müll werfen, wenn Sie wollen.«
Sie legt die Jacke neben ihm ab und richtet sich auf. Sein Blick folgt ihr.
»Danke.«
»Sie können also doch sprechen?«
Er scheint überrascht. »Natürlich kann ich sprechen.«
Dem Akzent nach zu schließen, kommt er aus dem Süden. Seine Augen haben die gleiche rötlich braune Farbe wie seine Haare und die Stoppeln an seinem Kinn. Er sieht gut aus. Wenn man dunkle Typen mag.
»Schön«, sagt sie und steckt die eine Hand in ihre Jackentasche, während die andere den Knauf des Regenschirms umklammert. »Das freut mich.«
Er lächelt und greift mit einer Hand nach der feuchten Jacke. »Sind Sie sicher?«
»Wegen der Jacke? Sie würden mir einen Gefallen tun. Ganz im Ernst.«
Der Mann zieht sich die Jacke über die nassen Klamotten und fingert eine Weile am Reißverschluss herum, bevor er ihn zubekommt. »Danke«, sagt er noch einmal. »Vielen Dank.«
Alice dreht sich um und schaut, wo die Hunde abgeblieben sind. Sadie sitzt durchnässt und noch dünner als gewöhnlich neben ihr; die anderen beiden tollen am Ufer herum. Dann wendet sie sich wieder dem Mann zu. »Warum gehen Sie nicht rein bei dem Regen?«, fragt sie. »Laut Wettervorhersage wird es bis morgen früh so weiterregnen. Sie werden noch krank.«
»Wer sind Sie noch mal?«, fragt er und kneift die Augen zusammen, als ob sie ihm schon ihren Namen genannt und er ihn nur kurz vergessen hätte.
»Ich bin Alice Lake. Sie kennen mich nicht.«
»Nein«, sagt er. »Ich kenne Sie nicht.« Diese Tatsache scheint ihn zu beruhigen.
»Ich geh jetzt besser«, sagt Alice.
»Natürlich.«
Alice zieht die Leine straff, und Sadie steht mit wackligen Beinen auf, als wäre sie eine frisch geborene Giraffe. Alice ruft nach den anderen beiden Hunden, aber die beachten sie gar nicht. Sie seufzt genervt und ruft noch einmal. »Blöde Viecher«, murmelt sie bei sich. »Kommt schon!«, brüllt sie laut und läuft auf die Hunde zu. »Kommt sofort her!«
Beide Hunde rennen ins Wasser und wieder heraus; Hero ist mit einer grünlichen Schlickschicht bedeckt. Sie werden stinken. Und sie muss gleich Romaine abholen. Sie darf nicht wieder zu spät kommen. Sie war bereits gestern zu spät dran, denn sie war so vertieft in eines ihrer Landkartenbilder, dass sie die Zeit vergaß. Als sie Romaine um zehn vor vier im Schulsekretariat abholte, sah die Sekretärin sie über ihren Bildschirm hinweg an, als wäre sie ein Schmutzfleck an der Wand.
»Kommt schon, ihr Scheißer!« Mit ein paar großen Schritten ist sie bei ihnen und greift hastig nach Griff. Griff glaubt, das sei ein Spiel, und schießt freudig davon. Alice verfolgt jetzt Hero, die auch vor ihr wegrennt. Die ganze Zeit zieht sie Sadie, die kaum noch aufrecht stehen kann, an ihrem knochigen Hals mit sich. Es regnet in Strömen. Alices Jeans ist klatschnass, ihre Hände eiskalt, die Zeit rennt ihr davon. Sie macht ihrem Frust lauthals Luft und versucht es mit einem Trick, den sie bei ihren Kindern angewendet hat, als sie noch klein waren.
»Schön«, sagt sie. »Sehr schön. Dann bleibt eben hier. Seht zu, wie ihr ohne mich zurechtkommt. Bettelt beim Fleischer um ein paar Knochen. Ein schönes Leben noch!«
Die Hunde bleiben stehen und sehen Alice an. Alice dreht sich um und geht weg.
»Wollen Sie ein paar Hunde haben?«, ruft sie dem Mann zu, der immer noch im Regen am Strand sitzt. »Wollen Sie sie haben? Sie können sie meinetwegen behalten.«
Der Mann schreckt zusammen und sieht sie aus dunklen Augen an. »Ich … ich …«
Alice verdreht die Augen. »Das war nicht ernst gemeint.«
»Nein«, sagt er. »Nein, das weiß ich.«
Sie geht in Richtung Anleger, dort wo sich die Treppe in der Kaimauer befindet. Es ist jetzt halb vier. Die Hunde bleiben am Ufer stehen, blicken erst der eine zum anderen, dann beide zu Alice. Plötzlich rasen sie auf sie zu und stoppen nur Sekunden später, dreckverkrustet und stinkend, bei ihren Füßen.
Alice geht die Stufen hinauf. Als der Mann nach ihr ruft, dreht sie sich um.
»Entschuldigen Sie bitte!«, sagt er. »Entschuldigung, aber wo bin ich?«
»Was?«
»Wo bin ich? Wie heißt dieser Ort hier?«
Alice lacht. »Im Ernst?«
»Ja«, sagt er. »Im Ernst.«
»Das hier ist Ridinghouse Bay.«
Er nickt. »Richtig«, sagt er. »Vielen Dank.«
»Gehen Sie rein, ja?«, sagt Alice leise zu dem Mann. »Bitte bleiben Sie nicht länger in diesem Regen.«
Der Mann lächelt entschuldigend, und Alice winkt zum Abschied. Dann geht sie in Richtung der Schule und hofft, dass er fort sein wird, wenn sie wieder hier vorbeikommt.
Alice weiß, dass man sie in Ridinghouse Bay für einen schrägen Vogel hält. Obwohl man gerechterweise sagen muss, dass es im Ort schon ziemlich viele schräge Vögel gab, bevor sie hierherkam. Aber auch in diesem seltsamen Ort sticht Alice mit ihrem Brixton-Akzent, ihrer schroffen Art und ihrer kunterbunten Familie heraus. Mal abgesehen von den Hunden. Überall, wo sie mit ihnen auftaucht, ziehen sie ihre Show ab. Sie laufen nicht bei Fuß, sie bellen und schnappen, und sie jaulen zum Gotterbarmen, wenn sie mal kurz vor einem Laden warten müssen. Manchmal wechseln Leute die Straßenseite, wenn Alice und ihre Hunde ihnen entgegenkommen, und machen, insbesondere um die breitschultrige Hero mit ihrem Maulkorb, einen großen Bogen.
Seit sie in Ridinghouse Bay wohnt, mimt Alice die geheimnisvolle, Furcht einflößende Einzelgängerin, obwohl sie das in Wirklichkeit gar nicht ist. In London hatte sie fünf Freunde an jedem Finger, mehr als sie brauchen konnte. Sie war ein Partygirl, jemand, der anderen half, bei einer Flasche Wodka die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Sie war die Mutter, die morgens am Schultor fragte, wer noch mit Kaffee trinken kommt. Sie war immer obenauf, sie lachte am lautesten, und sie redete am meisten. Bis sie alles vermasselte.
Aber inzwischen hat sie auch hier eine Freundin gefunden, einen Menschen, der sie versteht. Alice und Derry Dynes haben sich vor achtzehn Monaten an Romaines erstem Schultag kennengelernt. Ihre Blicke trafen sich, und sie waren sich auf Anhieb sympathisch, ein Moment geteilter Freude. »Lust auf einen Kaffee?«, fragte Derry Dynes. Sie hatte Alices feuchte Augen bemerkt, die zusah, wie ihre kleine Tochter im Klassenzimmer verschwand. »Oder lieber etwas Stärkeres?«
Derry ist vielleicht fünf Jahre älter als Alice und mindestens einen Kopf kleiner. Sie hat einen Sohn im Alter von Romaine und eine erwachsene Tochter, die in Edinburgh lebt. Sie liebt Hunde und lässt sich sogar von ihnen auf den Mund küssen, und sie liebt Alice. Sie hat schnell begriffen, dass Alice öfter mal verheerende Entscheidungen trifft und die Kontrolle über ihr Leben verliert, und deshalb ist sie jetzt ihr Coach. Stundenlang sitzt Derry mit Alice zusammen und berät sie in der Auseinandersetzung mit der Schule über Romaines Lernschwierigkeiten, aber sie hält sie zum Beispiel davon ab, in die Schule zu laufen und die unfähige Sekretärin anzuschreien. Derry trinkt mit Alice zwei Flaschen Wein an einem Abend unter der Woche, aber sie bringt sie dazu, den Korken in der dritten Flasche stecken zu lassen. Sie sagt Alice, zu welchem Friseur sie gehen soll und was sie dort sagen soll: »Stufenschnitt, nicht ausgefranst, und Strähnchen.« Früher war Derry Friseurin, heute ist sie Reiki-Therapeutin. Und sie hat mehr Ahnung von Alices Finanzen als diese selbst.
Jetzt steht Derry mit ihrem Sohn Danny und Romaine eng beieinander unter einem riesigen roten Regenschirm vor der Schule.
»Danke dir. Die Hunde sind am Strand durchgedreht, ich konnte sie nicht wieder einfangen.«
Alice beugt sich vor, küsst Romaine auf die Haare und nimmt ihr die Lunchbox ab.
»Was in aller Welt hast du bei diesem Wetter am Strand gemacht?«
Alice verdreht die Augen und seufzt. »Das willst du nicht wissen.«
»Doch«, erwidert Derry, »will ich.«
»Habt ihr heute noch was vor, oder wollen wir zusammen Tee trinken?«
Derry schaut zu ihrem Sohn hinunter und sagt: »Ich sollte mit Danny in die Stadt gehen, um ihm neue Schuhe zu kaufen …«
»Na dann, kommt doch vorher bei mir vorbei. Ich will dir was zeigen.«
»Sieh mal«, sagt Alice, als sie an der Kaimauer stehen und durch den wasserfallartigen Regen schauen, der sich von ihren Regenschirmen ergießt. »Er ist immer noch da.«
»Er?«, fragt Derry.
»Ja, er dort. Ich habe ihm die Jacke gegeben. Die ist von Barry.«
Derry schaudert unwillkürlich. Auch sie erinnert sich an Barry. Alice hat ihr die Ereignisse damals sehr genau und anschaulich beschrieben. »Hatte er denn vorher keine Jacke an?«
»Nein. Er saß nur im Hemd da. Total durchnässt. Er hat mich gefragt, wo er ist.«
Die beiden Kinder ziehen sich an der Mauer hoch und blicken über den Rand.
»Er wusste nicht, wo er ist?«
»Nein. Er schien ein bisschen durcheinander zu sein.«
»Lass dich da nicht in was reinziehen«, sagt Derry.
»Wer hat denn gesagt, dass ich mich da reinziehen lasse?«
»Du hast ihm eine Jacke gegeben. Du steckst schon mittendrin.«
»Das war nur ein Akt der Menschenliebe.«
»Ja«, sagt Derry. »Genau das meine ich.«
Alice sieht ihre Freundin stirnrunzelnd an und geht von der Kaimauer weg. »Willst du wirklich einkaufen gehen?«, fragt sie. »Bei dem Wetter?«
Derry hebt den Kopf und blickt in den düsteren Himmel. »Nein, vielleicht doch nicht.«
»Ach bitte«, sagt Alice. »Kommt mit zu mir. Ich mache uns den Kamin an.«
Derry und Danny bleiben einige Stunden zu Besuch. Die Kleinen spielen im Wohnzimmer, während Derry und Alice in der Küche Tee trinken. Kurz nach vier kommt Jasmine bis auf die Haut durchnässt, mit einem triefenden Rucksack voller Lern- und Arbeitsunterlagen. Sie hatte keine Jacke und auch keinen Schirm dabei. Eine halbe Stunde später kommt Kai mit zwei Freunden aus der Schule. Alice kocht Spaghetti, und Derry kann sie gerade noch davon abhalten, eine Weinflasche zu öffnen, denn sie muss nach Hause. Um sechs gehen sie und Danny. Es regnet immer noch. Matschig braunes Regenwasser fließt in Rinnsalen die Slipanlage hinunter zum Strand und strömt sturzbachartig von den Hausdächern. Inzwischen ist auch noch ein heulender Wind aufgekommen und treibt den Regen waagerecht vor sich her, sodass er überall durch die Ritzen dringt.
Vom oberen Stockwerk ihres Hauses aus kann Alice sehen, dass der Mann immer noch da ist. Er sitzt nicht mehr mitten auf dem Strand, er hat sich nahe der Kaimauer auf einem Haufen Seile niedergelassen. Er hat den Kopf zum Himmel gewandt und die Augen geschlossen. Etwas in Alice zieht sich zusammen, wenn sie den Mann ansieht. Natürlich könnte er verrückt sein. Er könnte gefährlich sein. Aber dann fallen ihr wieder seine traurigen dunklen Bernsteinaugen ein und seine sanfte Stimme, als er sie fragte, wo er sei. Und sie ist hier in ihrem Zuhause, mit anderen Menschen. Im Kamin brennen dicke Holzscheite, hier ist es warm und trocken und sicher. Sie kann nicht hierbleiben, wenn sie weiß, dass er da draußen ist.
Sie kocht Tee und gießt ihn in eine Thermoskanne. Dann bittet sie die Großen, ein Auge auf Romaine zu haben, und geht zu ihm an den Strand.
»Hier, bitte«, sagt sie und reicht ihm die Thermoskanne.
Er nimmt sie entgegen und lächelt.
»Ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, Sie sollen reingehen.«
»Ja, daran erinnere ich mich«, sagt er.
»Gut«, erwidert sie. »Aber wie ich sehe, haben Sie nicht auf mich gehört.«
»Ich kann nicht nach drinnen gehen.«
»Sind Sie obdachlos?«
Er nickt. Dann schüttelt er den Kopf. »Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht genau.«
»Sie wissen es nicht?« Alice lacht leise auf. »Wie lange sitzen Sie denn schon hier?«
»Ich bin seit gestern Abend hier.«
»Und wo sind Sie hergekommen?«
Er dreht sich um und sieht sie an. Seine Augen sind weit aufgerissen und angsterfüllt. »Ich habe keine Ahnung.«
Alice tritt unwillkürlich einen Schritt zurück. Jetzt bereut sie, dass sie an den Strand gekommen ist. Dass sie sich da reinziehen lässt, wie Derry es ausdrückt. »Im Ernst?«, fragt sie.
Er streicht sich die feuchten Haare aus der Stirn und seufzt. »Im Ernst.« Dann gießt er sich Tee ein und hält den Becher in die Höhe. »Danke«, sagt er. »Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
Alice blickt aufs Meer hinaus. Sie weiß nicht genau, was sie sagen soll. Einerseits möchte sie einfach wieder ins warme Haus zurückgehen, andererseits spürt sie, dass sie ein bisschen bei ihm bleiben sollte. Sie stellt dem Mann noch eine Frage: »Wie heißen Sie?«
»Ich glaube«, sagt er, während er auf seinen Tee starrt. »Ich glaube, ich habe das Gedächtnis verloren. Ich meine …« Er dreht sich abrupt zu ihr. »Das wäre doch logisch, oder? Das ist die einzige logische Erklärung. Denn ich weiß nicht, wie ich heiße. Und ich muss einen Namen haben. Jeder hat doch einen Namen. Richtig?«
Alice nickt.
»Ich weiß weder, warum ich hier bin, noch, wie ich hierhergekommen bin. Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir: Ich muss das Gedächtnis verloren haben.«
»Aha«, sagt Alice. »Ja, das ist logisch. Haben Sie sich … Sind Sie verletzt?« Sie zeigt auf seinen Kopf.
Er fährt sich mit der Hand über den Kopf, dann sieht er sie an. »Nein«, antwortet er. »Sieht nicht danach aus.«
»Ist Ihnen das schon mal früher passiert? Dass Sie das Gedächtnis verloren haben, meine ich?«
»Ich kann mich nicht erinnern«, sagt er treuherzig, und sie müssen beide lachen.
»Wissen Sie, dass Sie in Nordengland sind?«, fragt Alice jetzt.
»Nein«, erwidert er. »Das wusste ich nicht.«
»Und Sie haben einen südlichen Akzent. Sind Sie von dort?«
Er zuckt die Achseln. »Ich vermute mal, ja.«
»Mensch«, sagt Alice. »Das ist ja wirklich verrückt. Sie haben sicher schon in Ihren Taschen nachgesehen, oder?«
»Ja, habe ich«, sagt er. »Ich habe auch etwas gefunden, konnte mir aber keinen Reim darauf machen.«
»Haben Sie das, was Sie gefunden haben, noch?«
»Hier.« Er lehnt sich zur Seite. »Hier ist es.« Er zieht eine Handvoll feuchtes Papier aus seiner Gesäßtasche. »Oh.«
Alice starrt erst auf den nassen Klumpen und dann in den dunkler werdenden Himmel. Kurz streicht sie sich übers Gesicht und atmet tief aus. »Okay«, sagt sie. »Ich muss verrückt sein. Nein, ich bin wirklich verrückt. Also, ich habe ein kleines Studio in meinem Garten. Normalerweise vermiete ich den Raum, aber im Augenblick steht er gerade leer. Sie können dort über Nacht bleiben. Wir trocknen diese nassen Zettel, und morgen versuchen wir, Sie wieder zusammenzupuzzeln. Sind Sie einverstanden?«
Er starrt ungläubig zu ihr hoch. »Ja«, sagt er. »Ja, bitte.«
»Ich muss Sie warnen«, sagt sie im Aufstehen. »Bei mir herrscht Chaos. Ich habe drei sehr laute, freche Kinder und drei ungehorsame Hunde. Mein Haus ist ein Saustall. Erwarten Sie also bloß keine Wunder.«
Er nickt. »Ehrlich gesagt, das ist mir ganz gleich. Und es macht mir wirklich nichts aus. Ich bin Ihnen so dankbar. Ich kann gar nicht glauben, wie freundlich Sie zu mir sind.«
Alice führt den durchnässten fremden Mann die Steinstufen zu ihrem Cottage hinauf. »Nein«, sagt sie. »Das kann ich auch nicht glauben.«
2
Lilys Magen fühlt sich hart wie Stein an. Ihr Herz schlägt schon seit Längerem so schnell, dass sie meint, jeden Moment ohnmächtig zu werden. Sie steht auf und geht zum Fenster, so wie sie es in den vergangenen dreiundzwanzigeinhalb Stunden im Abstand von wenigen Minuten immer wieder gemacht hat. In dreißig Minuten wird sie wieder bei der Polizei anrufen. So lange, haben sie gesagt, müsse Lily warten, bevor sie Carl offiziell als vermisst melden könne. Dabei wusste sie schon, dass er vermisst war, als er am Vorabend eine Stunde nach Arbeitsschluss noch nicht zu Hause war. Ein eiskalter Schauer war ihr über den Rücken gelaufen. Sie sind doch gerade erst aus den Flitterwochen zurückgekehrt. Jeden Abend ist er von der Arbeit nach Hause gerast. Manchmal ist er etwas früher gekommen, aber nie mehr als eine Minute zu spät. Er hat ihr Geschenke mitgebracht, Glückwunschkarten zu zwei Wochen Verheiratetsein oder Blumen. Er stürmte durch die Wohnungstür und rief: »Himmel, Kleines, ich hab dich so vermisst.« Dann schloss er sie verzweifelt in die Arme.
Aber nicht gestern Abend. Um sechs war er nicht da. Auch nicht um halb sieben. Oder um sieben. Jede Minute fühlte sich wie eine Stunde an. Zuerst hörte sie das Rufzeichen, bis die Voicemail ansprang, aber nach einer Stunde ertönte plötzlich nur noch ein schriller Ton. Lily fühlte sich vollkommen hilflos, und Furcht stieg in ihr auf.
Die Polizei … Na ja, bis gestern Abend hatte Lily keine Meinung über die britischen Ordnungshüter. So wie man keine Meinung über den Waschsalon um die Ecke hat, weil man noch nie da war. Aber jetzt hat Lily eine sehr entschiedene Meinung.
In zwanzig Minuten kann sie wieder bei der Polizei anrufen. Auch wenn das nichts nützen wird. Sie weiß genau, was die bei der Polizei über sie denken: dummes Mädchen, ausländischer Akzent, wahrscheinlich eine Katalogbraut. (Sie ist keine Katalogbraut. Sie hat ihren Ehemann im realen Leben persönlich kennengelernt.) Die Polizistin, mit der Lily gesprochen hat, glaubt, ihr Ehemann hätte eine Affäre und würde sie betrügen. Irgend so was. Das hört Lily an dem lustlosen Ton. »Kann es sein, dass jemand ihn nach der Arbeit abgepasst hat?«, hatte sie gefragt. »Vielleicht ist er im Pub?« Sie wusste, dass die Polizistin während des Telefonats noch etwas anderes tat, entweder blätterte sie eine Zeitschrift durch, oder sie feilte sich die Nägel.
»Nein!«, hatte sie erwidert. »Niemals! Er geht nicht in den Pub. Er kommt direkt nach Hause. Zu mir.«
Später erkannte Lily, dass es ein Fehler gewesen war, das zu sagen. Sie konnte die Frau vor sich sehen, wie sie süffisant die Augenbrauen hochzog.
Lily hat keine Ahnung, wen sie sonst anrufen könnte. Sie weiß, dass Carl eine Mutter hat, denn an ihrem Hochzeitstag hat sie mit ihr telefoniert, aber sie hat sie noch nicht persönlich kennengelernt. Sie heißt Maria oder Mary oder Marie oder so ähnlich, und sie wohnt in … also, großer Gott, Lily weiß nicht, wo Carls Mutter wohnt. Im Westen des Landes? Oder vielleicht doch im Osten? Carl hat es einmal erwähnt, aber sie kann sich nicht mehr erinnern. Er hat alle Telefonnummern in seinem Handy gespeichert. Also, was kann sie tun?
Carl hat auch noch eine Schwester. Sie heißt Suzanne. Susan? Sie ist viel älter als er und lebt in der Nähe der Mutter in einem Ort, der mit S beginnt. Die Geschwister haben sich zerstritten. Warum, hat Carl ihr nicht erzählt. Er hat noch einen Freund mit Namen Russ, der ruft regelmäßig an, um mit ihm über Fußball und das Wetter zu reden. Russ sagt immer wieder, dass er mit Carl etwas trinken gehen will, das aber im Augenblick wegen des kleinen Babys nicht schafft.
Lily ist sicher, dass Carl noch mehr Menschen kennt, aber da sie ihn erst vor ein paar Monaten getroffen hat, erst seit drei Wochen mit ihm verheiratet ist und erst seit zehn Tagen hier wohnt, kennt sie Carls Welt noch nicht gut. Sie ist auch neu in England. Sie kennt niemanden hier, und niemand kennt sie. Glücklicherweise spricht Lily fließend Englisch und hat daher keine Verständigungsprobleme. Aber trotzdem ist alles so anders hier. Und es fühlt sich seltsam an, so vollkommen allein zu sein.
Endlich ist es eine Minute nach sechs. Lily nimmt ihr Telefon in die Hand und ruft die Polizei an.
»Guten Abend«, sagt sie zu der männlichen Stimme, die den Anruf entgegennimmt. »Mein Name ist Lily Monrose. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben.«
3
»Entschuldigung«, sagt die Frau, Alice heißt sie, und lehnt sich über den kleinen Tisch, um die dunkelblauen Vorhänge aufzuziehen. »Es riecht ein bisschen muffig. Ist schon ein paar Wochen her, dass hier zuletzt jemand gewohnt hat.«
Er schaut sich um. Er steht in einem kleinen Zimmer mit einem Velux-Fenster und einer Glastür, die in Alices Garten hinausführt. Das Zimmer ist spartanisch eingerichtet. Auf einer Seite steht ein Feldbett, dann gibt es ein Spülbecken, einen Kühlschrank, einen Miniherd, ein Elektroheizgerät, einen Tisch, zwei Plastikstühle. Auf dem Boden liegt eine schmutzige Binsenmatte. Aber die Holzwände sind in einem schönen Grünton gestrichen, und es hängen dort sehr ansprechende Kunstwerke: Blumen, Gesichter und Häuser, die anscheinend aus alten Landkarten gefertigt wurden. Und neben dem Feldbett steht eine perlenverzierte Lampe. Der Gesamteindruck ist angenehm. Aber Alice hat recht, es müffelt. Eine unheilvolle Mischung von Moder und Feuchtigkeit liegt in der Luft.
»Nebenan ist eine Außentoilette. Die benutzt sonst niemand. Und tagsüber können Sie sich in unserem Badezimmer waschen. Das ist im Erdgeschoss, gleich bei der Terrasse. Kommen Sie, ich zeig es Ihnen.« Ihr Ton ist knapp und ein wenig einschüchternd.
Während er ihr auf dem Kiesweg zum Haus folgt, betrachtet er sie genau. Sie ist groß und schlank, etwas rundlich um die Hüften. Sie trägt eine enge schwarze Jeans und einen weiten Pullover. Vermutlich versucht sie, den Hüftspeck darunter zu verstecken und ihre langen Beine zu betonen. Dazu schwarze Stiefel, die ein bisschen an Doc Martens erinnern. Ihre Haare sind eine wehende honig- und schlammfarbene Mähne. Schlecht gemachte Strähnchen, fährt es ihm durch den Kopf. Dann fragt er sich, wieso er dazu überhaupt eine Meinung hat. Ist er etwa Friseur?
Die winzige Hintertür klemmt, als sie sie öffnen will, und sie tritt einmal gekonnt gegen den Sockel. Drei Stufen führen in eine schmale Küche. Links davon befindet sich ein schlichtes Badezimmer.
»Wir benutzen alle das Bad im ersten Stock, dieses hier haben Sie praktisch für sich allein. Soll ich Ihnen eine Wanne einlaufen lassen? Dann wird Ihnen wieder warm.«
Bevor er antworten kann, dreht sie schon quietschende Wasserhähne auf. Schnell schiebt sie ihre Pulloverärmel zurück, um die Temperatur zu prüfen. Sein Blick fällt auf ihre Ellbogen, und er bemerkt die faltige, schlaffe Haut. Sie muss vierzig oder fünfundvierzig Jahre alt sein, denkt er bei sich. Sie dreht sich um und lächelt. »Okay«, sagt sie. »Während das Bad einläuft, machen wir Ihnen etwas zu essen. Und legen das hier auf die Heizung.« Er gibt ihr die feuchten Brocken und Teile, die in seinen Taschen steckten, und folgt ihr wieder in die Küche: Die Wände sind magentarot angemalt, die Töpfe hängen von hoch angebrachten Stangen, die Eichenschränke sind handgefertigt, im Spülbecken stapelt sich Geschirr, und eine Pinnwand ist voller Kinderzeichnungen. An dem kleinen Tisch in der Ecke sitzt ein Mädchen im Teenageralter. Sie wirft ihm einen kurzen Blick zu und schaut dann die Frau fragend an.
»Das ist Jasmine, meine älteste Tochter. Und das hier« – sie deutet auf ihn – »ist ein fremder Mann, den ich am Strand aufgegabelt habe. Er schläft heute Nacht im Studio.«
Das Mädchen mit dem Namen Jasmine zieht eine gepiercte Augenbraue hoch und wirft ihm noch einen vernichtenden Blick zu. »Abgefahren.«
Sie hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Ihr dunkles Haar ist zu einem scheußlichen Bob gestutzt – wahrscheinlich ist das Absicht. Der Pony ist viel zu kurz, aber irgendwie rahmt dieser Schnitt ihr kantiges Gesicht, ihre vollen roten Lippen und die schweren Augen perfekt ein. Das Mädchen sieht exotisch aus, wie diese mexikanische Schauspielerin, an deren Namen er sich ums Verrecken nicht erinnern kann.
Alice reißt einen roten Kühlschrank auf und sagt zu ihm: »Ein Schinkensandwich? Brot und Pastete? Ich könnte auch überbackenen Blumenkohl aufwärmen. Da ist auch noch ein Curry von letztem Samstag. Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch? Ich bin sicher, das kann man noch essen. Currygerichte sind ja schließlich dafür da, Fleisch haltbar zu machen, nicht wahr?«
Er hat Mühe, die vielen Informationen zu verarbeiten. Eine Entscheidung zu treffen. Wahrscheinlich hat er deshalb mehr als zwölf Stunden lang am Strand gesessen. Ihm war klar, dass es verschiedene Möglichkeiten gab, aber er war nicht in der Lage, Prioritäten zu setzen. Stattdessen hatte er wie gelähmt dagesessen, bis diese entschlossene Frau gekommen war und eine Entscheidung für ihn getroffen hatte.
»Ich bin mit allem einverstanden, wirklich«, sagt er. »Egal was es ist.«
»Scheiß drauf«, sagt sie und lässt die Kühlschranktür zufallen. »Ich bestelle Pizza.«
Zunächst ist er erleichtert, weil sie ihm noch eine Entscheidung abgenommen hat. Aber dann fällt ihm ein, dass er, von ein paar losen Münzen abgesehen, kein Geld hat, und er fühlt sich unbehaglich.
»Es tut mir leid, aber ich habe kein Geld.«
»Ja, das weiß ich«, erwidert Alice. »Wir haben Ihre Taschen durchsucht. Erinnern Sie sich? Aber das ist in Ordnung, das geht auf mich. Und Jasmine …« Sie deutet mit dem Kopf in Richtung ihrer Tochter. »Sie lebt nur von Luft. Meistens muss ich ihr Essen wegwerfen. Ich bestelle einfach so viel Pizza wie immer. Als wenn Sie gar nicht da wären.«
Das Mädchen verdreht die schwarz geschminkten Augen. Er folgt Alice in ein winziges Wohnzimmer. In der Tür muss er den Kopf einziehen, um sich nicht an dem niedrigen Balken zu stoßen. Ein kleines Mädchen mit hellblonden Locken kuschelt sich an einen schlaksigen Teenagerjungen mit afrokaribischem Aussehen und schaut fern. Dann drehen sich die beiden um und mustern ihn beunruhigt.
Alice wühlt in einer Schreibtischschublade. »Diesen Mann habe ich am Strand gefunden«, sagt sie, ohne sich umzublicken. Sie holt einen Flyer hervor, gibt ihn dem Jungen und schließt die Schublade. »Wir bestellen Pizza«, sagte sie. »Such etwas aus.«
Das Gesicht des Jungen hellt sich auf. Er setzt sich aufrecht hin und löst den Arm des kleinen Mädchens von seiner Taille.
»Romaine.« Alice deutet auf das kleine Mädchen. »Und Kai.« Ihre Hand zeigt auf den hoch aufgeschossenen Teenager. »Und ja, das sind alles meine Kinder. Ich bin keine Pflegemutter. Um Himmels willen, setzen Sie sich doch endlich.«
Vorsichtig lässt er sich auf einem kleinen geblümten Sofa nieder. Ein Feuer brennt im Kamin, die gemütlichen Möbel sind mehr shabby als chic, aber geschmackvoll, dunkle Holzbalken an der Decke, grau gestrichene Wände und Wandleuchten aus Uranglas. Vor dem Fenster befindet sich eine Straßenlampe, und dahinter liegt der silbrige Schatten des Meeres. Sehr stimmungsvoll. Aber ganz offensichtlich ist Alice keine gute Hausfrau. Alles ist mit dickem Staub bedeckt, Spinnweben hängen von der Decke, in den Ecken häuft sich Krimskrams, und der Teppich wurde wahrscheinlich noch nie gesaugt.
Alice legt alles, was sie in seinen Taschen gefunden haben, auf die Heizung. »Bahnfahrkarten«, murmelt sie und löst sie vorsichtig voneinander. »Von gestern.« Sie sieht genau hin. »Die Uhrzeit kann ich nicht erkennen. Kai?« Sie reicht ihrem Sohn die feuchte Fahrkarte. »Kannst du das lesen?«
Der Junge nimmt die Fahrkarte, schaut sie sich an und gibt sie seiner Mutter zurück. »Neunzehn Uhr achtundfünfzig.«
»Der letzte Zug«, sagt Alice. »Wahrscheinlich sind Sie in Doncaster umgestiegen. Und spät hier angekommen.« Sie geht weiter die Papierfetzen durch. »Das hier ist irgendeine Quittung. Aber keine Ahnung, wofür.« Sie legt das Papier auf die Heizung.
Sie ist hübsch, findet er. Ausgeprägte Gesichtszüge, ein schöner Mund. Man sieht noch die Überreste des verschmierten Eyeliners, den sie heute Morgen benutzt hat, aber sonst ist sie ungeschminkt. Sie ist beinahe schön. Aber sie strahlt eine Härte aus, ihr Kiefer wirkt verkrampft, und wo Licht sein sollte, ist nur Schatten.
»Noch mehr Quittungen. Ein Taschentuch?« Sie hält es ihm hin. Er schüttelt den Kopf und wirft es ins Kaminfeuer. »So, das wär dann wohl alles. Kein Personalausweis. Sie sind ein vollkommenes Rätsel.«
»Wie heißt er?«, fragt Romaine.
»Ich kenne seinen Namen nicht. Und er weiß auch nicht, wie er heißt. Er hat sein Gedächtnis verloren.« Alice sagt das, als wäre es das Normalste von der ganzen Welt, aber das kleine Mädchen runzelt die Stirn.
»Wo hat er es verloren?«
Alice lacht. »Du bist doch sehr gut im Namenerfinden, Romaine. Er kann sich nicht erinnern, wie er heißt, also müssen wir ihm einen Namen geben. Wie soll er heißen?«
Das kleine Mädchen starrt ihn eine Weile lang an. Er glaubt, dass sie gleich einen kindischen, unsinnigen Namen vorschlagen wird. Sie kneift die Augen zusammen, schürzt die Lippen und spricht mit Bedacht den Namen Frank aus.
»Frank«, sagt Alice nachdenklich. »Ja. Frank. Das ist perfekt. Kluges Mädchen.« Sie streicht Romaine über die lockigen Haare. »Also, Frank.« Sie lächelt ihn an. »Ich schätze, die Wanne ist jetzt voll. Auf dem Bett liegt ein Handtuch, Seife ist auch da. Bis du im Bad fertig bist, ist die Pizza bestimmt schon da.«
Er kann sich nicht erinnern, eine Pizza ausgewählt zu haben; er ist nicht sicher, ob Frank sein richtiger Name ist. Diese Frau mit ihrer Bestimmtheit verwirrt ihn. Aber er ist sicher, dass seine Socken, seine Unterwäsche und seine Haut feucht sind, dass es ihn von innen friert und dass er sofort ein heißes Bad braucht, mehr als alles andere auf der Welt.
»Oh.« Jetzt fällt ihm etwas ein. »Trockene Kleidung. Natürlich ziehe ich auch diese Sachen gern wieder an. Oder könnte ich …«
»Kai kann dir eine Jogginghose leihen. Und ein T-Shirt. Ich lege dir Sachen neben die Hintertür.«
»Danke«, sagt er. »Vielen Dank.«
Als er aufsteht, um ins Bad zu gehen, bemerkt er, wie sie mit ihrem Sohn einen Blick austauscht, wie ihr die Maske der betonten Unbekümmertheit für einen Augenblick entgleitet. Der Junge sieht besorgt und genervt aus; er schüttelt leicht den Kopf. Sie antwortet mit einem bestimmten Nicken. Aber er kann auch Angst in ihren Augen sehen. Als ob sie ihre Entscheidung anzweifeln würde. Als ob sie sich fragt, warum er hier in ihrem Haus ist.
Schließlich könnte er irgendwer sein.
4
»Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Ehemann«, sagt Beverly, die Polizistin. »Wie alt ist er?«
Lily schiebt den Saum ihres Oberteils nach unten und glättet den Stoff auf ihrer Haut. »Er ist vierzig«, antwortet sie.
Sie kann sehen, wie sich ganz leicht eine Augenbraue der Polizeibeamtin hebt. »Und wie alt sind Sie?«
»Ich bin einundzwanzig«, sagt sie. Am liebsten würde sie schreien: Kein Grund, mich zu verurteilen. Neunzehn Jahre Altersunterschied. Wo man heute gut und gerne neunzig werden kann. Also, wo liegt das Problem?
»Und sein vollständiger Name lautet?«
»Carl John Robert Monrose.«
»Danke. Und er wohnt hier, in dieser Wohnung?«
Lily deutet auf das kleine Wohnzimmer des modernen Apartments, wo sie und Carl seit ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen auf Bali gewohnt haben.
»Ja«, sagt sie. »Natürlich!« Sie weiß, dass ihre Worte unhöflich sind. Ihr ist bewusst, dass ihre schroffe Art nicht unbedingt dem britischen Geschmack entspricht.
»Erzählen Sie mir vom gestrigen Tag. Wann haben Sie Ihren Ehemann zuletzt gesehen?«
»Er ist um sieben Uhr gegangen. Er geht jeden Morgen um diese Zeit.«
»Und wo arbeitet er?«
»In London. Für einen Finanzdienstleister.«
»Und haben Sie schon mit der Firma gesprochen?«
»Ja! Das habe ich als Allererstes getan!« Die Frau muss sie für eine komplette Idiotin halten.
»Und was hat man in der Firma gesagt?«
»Dass er zur gleichen Zeit gegangen ist wie immer. Genau das hatte ich erwartet. Carl kommt jeden Abend mit dem gleichen Zug nach Hause. Er kann nicht länger im Büro bleiben, sonst würde er den Zug verpassen.«
»In Ordnung. Und haben Sie irgendwann mit ihm gesprochen? Nachdem er das Büro verlassen hat?«
»Nein«, sagt sie. »Aber er hat mir eine SMS geschickt. Sehen Sie.« Sie schaltet ihr Telefon ein und reicht es der Polizistin. Die SMS erscheint sofort.
Weißt du, was verrückt ist? Das ist verrückt: Ich liebe dich jetzt noch mehr als heute Morgen! In einer Stunde sehe ich dich wieder! Wenn ich den Zug beschleunigen könnte, ich würde es tun! XXXXX
»Und sehen Sie hier«, sagt Lily, während sie ihre Nachrichten durchscrollt. »Diese SMS ist von vorgestern.«
Kann es wirklich wahr sein, dass ich eine Frau wie dich habe? Habe ich so viel Glück verdient?! Ich kann es kaum erwarten, dich wieder in den Armen zu halten. Noch achtundfünfzig Minuten!
»Sehen Sie«, sagt sie. »Dieser Mann will jeden Abend zu seiner Frau nach Hause gehen, das ist sein größter Wunsch. Verstehen Sie jetzt, warum ihm etwas Schlimmes passiert sein muss?«
Die Polizeibeamtin gibt Lily das Telefon zurück und seufzt. »Es hat ihn wohl voll erwischt«, sagt sie.
»Das ist nicht witzig«, sagt Lily.
»Nein.« Beverly hört augenblicklich auf zu lächeln. »So habe ich das nicht gemeint.«
Lily holt tief Luft. Ich sollte mir mehr Mühe geben, ermahnt sie sich, ich muss freundlicher sein. »Entschuldigen Sie«, sagt sie. »Ich bin gestresst. Das war das erste Mal, dass wir eine Nacht getrennt voneinander verbracht haben. Ich habe nicht geschlafen. Nicht eine einzige Minute.« Sie fuchtelt verzweifelt mit den Händen in der Luft, dann legt sie sie wieder in den Schoß.
Die Tränen in Lilys Augen erweichen die Polizistin, und sie drückt leicht Lilys Hand. »Also. Sie haben diese SMS gestern um siebzehn Uhr erhalten. Danach …?«
»Nichts. Gar nichts. Das erste Mal habe ich ihn kurz nach sechs angerufen, dann habe ich es immer wieder probiert. Irgendwann war sein Akku leer.«
Die Polizistin hält einen Moment inne. Zum ersten Mal hat Lily das Gefühl, dass die Frau mit Namen Beverly begreift, dass er tatsächlich verschwunden sein könnte und nicht einfach nur im Bett einer anderen Frau liegt.
»Wo steigt er in den Zug?«
»Victoria Station.«
»Und er nimmt immer den gleichen Zug?«
»Ja, den um 17 Uhr 06 nach East Grinstead.«
»Und wann kommt er in Oxted an?«
»Um 17 Uhr 44. Dann muss er noch fünfzehn Minuten bis zu unserer Wohnung laufen. Genau eine Minute vor sechs ist er zu Hause. Jeden Abend.«
»Und arbeiten Sie, Mrs. Monrose?«
»Nein, ich studiere.«
»Wo?«
»Hier. Es ist ein Fernstudium. Rechnungswesen. Das habe ich auch in meiner Heimat, der Ukraine, studiert. Ich habe das Studium dort abgebrochen, um mit Carl zusammen zu sein. Und jetzt mache ich es hier fertig.« Sie zuckt die Achseln.
»Und wie lange sind Sie schon hier in Großbritannien?«
»Eine Woche und drei Tage.«
»Oh«, sagt die Polizistin. »Das ist noch nicht lange.«
»Nein, nicht sehr lange.«
»Ihr Englisch ist ausgezeichnet.«
»Danke. Meine Mutter ist Übersetzerin. Sie hat dafür gesorgt, dass ich die Sprache so gut beherrsche wie sie selbst.«
Die Polizistin steckt die Kappe auf ihren Stift und sieht Lily nachdenklich an. »Wie haben Sie sich kennengelernt?«, fragt sie. »Sie und ihr Mann?«
»Über meine Mutter. Sie hat bei einer Konferenz von Finanzdienstleistungsunternehmen in Kiew gedolmetscht. Dort wurden noch Leute gesucht, die sich um die Teilnehmer kümmern. Sie wissen schon: Sightseeing, Taxis rufen, solche Sachen. Ich brauchte Geld. Meine Aufgabe war es, Carl und einige seiner Kollegen zu betreuen. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass ich ihn heiraten würde. Das war sofort klar.«
Die Polizistin starrt Lily gebannt an. »Toll«, sagt sie. »Toll.«
»Ja«, sagt Lily. »Das war echt toll.«
»Okay.« Beverly lässt den Stift in ihre Tasche gleiten und klappt ihr Notizbuch zu. »Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin nicht sicher, ob wir schon genügend Hinweise haben, um einen Vermisstenfall daraus zu machen. Aber rufen Sie mich noch mal an, wenn er heute Abend nicht nach Hause kommt.«
Lilys Hoffnungen sind zerschlagen, und ihr wird schwer ums Herz. »Wie bitte?«
»Ich bin sicher, dass sich alles aufklären wird«, sagt Beverly. »Ehrlich. In neun von zehn Fällen ist der Grund vollkommen harmlos. Bestimmt kommt er bald nach Hause.«
»Wirklich?«, sagt sie. »Das glauben Sie doch selbst nicht. Ich weiß, dass Sie mir glauben. Kommen Sie schon, helfen Sie mir.«
Die Polizeibeamtin seufzt. »Ihr Ehemann ist erwachsen. Er ist nicht hilflos. Ich kann keinen Fall eröffnen. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag: Ich werde in unserer Datenbank nachsehen, ob irgendwo jemand mitgenommen wurde, auf den seine Beschreibung passt.«
Lily hält sich die Hand ans Herz. »Mitgenommen?«
»Ja. Sie wissen schon. Auf die Wache mitgenommen. Für ein Verhör. Und ich werde seine Daten auch mit den Krankenhäusern der Umgebung abgleichen. Um zu sehen, ob er irgendwo behandelt wurde.«
»Oh Gott.« Genau das hat Lily sich die ganze letzte Nacht vorgestellt. Carl, wie er vom Bus überfahren wird, niedergestochen in einer Unterführung im Sterben liegt oder leblos im dunklen Wasser der Themse treibt.
»Das ist alles, was ich für Sie tun kann.«
Lily erkennt, dass die Polizistin ihr einen Gefallen tut, und zwingt sich zu einem Lächeln. »Danke«, sagt sie. »Ich weiß das sehr zu schätzen.«
»Ich bräuchte allerdings ein Foto. Haben Sie ein aktuelles Bild von ihm?«
»Ja, natürlich.« Lily wühlt in ihrer Handtasche, öffnet ihre Geldbörse und holt einen Schnappschuss aus dem Fotoautomaten heraus. Carl ist gut getroffen, sein Blick ist ernst. Sie gibt das Foto der Polizistin und rechnet mit einer Bemerkung, wie unglaublich gut ihr Ehemann aussieht. Vielleicht sagt sie sogar etwas über seine Ähnlichkeit mit Ben Affleck. Aber die Polizistin steckt das Foto nur in ihr Notizbuch und sagt: »Das bekommen Sie zurück, versprochen. Bitte sprechen Sie mit seinen Freunden, seiner Familie. Mit Kollegen. Vielleicht kann jemand Licht in die Sache bringen.«
Nachdem die Polizistin gegangen ist, steht Lily minutenlang am Fenster und starrt hinaus. Unten vor dem Haus ist ein kleiner Parkplatz. Carls schwarzer Audi A5 steht noch da, wo er ihn nach dem gemeinsamen Wochenendeinkauf geparkt hat. Bei dem Gedanken an Carl will sie sich am liebsten ganz klein machen und vor Schmerz heulen.
Dann dreht sie sich um und betrachtet Carls und ihr Zuhause. Carl hat es ausgesucht, eine brandneue Wohnung in einem brandneuen Wohngebiet. Niemand hat vor ihnen in der Küche gekocht oder je die Toilette benutzt. Eine brandneue Wohnung, wo sie ihr brandneues Leben beginnen konnten. Schweren Herzens beginnt Lily, Schubladen aufzuziehen und Unterlagen durchzusehen, auf der Suche nach diesem kleinen Detail, das sie nicht von ihrem Ehemann wusste. Das kleine Detail, das das Rätsel lösen könnte, wo Carl abgeblieben ist.
5
Gegen fünf hört es endlich auf zu regnen. Die aufgehende Sonne taucht den Himmel in ein silbriges Grau. Das impertinente Vogelgezwitscher und der Lärm von Booten, die die Slipanlage hinuntergelassen werden, reißen Alice aus dem Schlaf. Eine unangenehme Art aufzuwachen. Schließlich ist sie erst vor einer Stunde eingeschlafen. In der Nacht hat sie fünf Stunden in höchster Alarmbereitschaft verbracht und jede Veränderung der Hintergrundgeräusche, jede knarzende Diele des alten Hauses, jeden Schimmer Mondlicht, der sich auf der Meeresoberfläche vor ihrem Fenster spiegelte, genau registriert.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein unbekannter Mann im Studio übernachtet. Im Laufe der Jahre hat sie den Raum schon oft an Fremde vermietet. Aber zumindest wusste sie, wie diese Menschen hießen, woher sie kamen und was sie hier vorhatten. Sie waren nicht so aus dem Zusammenhang gerissen wie dieser Mann. »Frank« hat die Bühne von rechts betreten, lautlos, ohne Textbuch. Er mag reizend sein, zweifellos, aber dass sie nichts von ihm weiß, nervt. Die nassen Papierklumpen in seinen Taschen lassen nur darauf schließen, dass er am Dienstagabend mit dem Zug von King’s Cross nach Ridinghouse Bay gefahren ist. Dann hat er vor Kurzem noch dreiundzwanzig Pfund bei Robert Dyas ausgegeben und sich bei Sainsbury einen Bagel und eine Dose Cola gekauft.
Als er nach seinem Bad in Kais Klamotten in die Küche kam, wirkte er rosig und zutiefst beschämt. Sein dickes Haar war feucht und wellig, und er war barfuß. Hübsche Füße, fiel Alice auf. Sie beobachtete, wie er beim Essen den Impuls unterdrückte, die Pizza gierig hinunterzuschlingen. Sie bot ihm ein Bier an, und er blickte sie verwirrt an. Wahrscheinlich überlegte er, ob er Bier mochte oder nicht. »Probier mal«, meinte sie. »Dann wissen wir wenigstens, ob du Biertrinker bist.« Er nahm die Flasche. Die Situation war etwas unangenehm. Alice, ihre Kinder und ein großer, verstörter Mann im Kapuzenshirt eines Vierzehnjährigen aßen zusammen Pizza. Keiner wusste, was er sagen sollte.
Als er ins Bett gegangen war, bedachten ihre Kinder sie mit kühlen, missbilligenden Blicken.
»Was soll das, Mum?«, brachte Jasmine schließlich hervor.
»Hast du denn gar kein Mitleid?«, sagte sie. »Der arme Mann. Keine Jacke. Kein Geld.« Sie deutete zum Küchenfenster, auf den stürmischen Regen, der gegen die Scheibe trommelte. »Bei diesem Wetter.«
»Er hätte auch woanders hingehen können«, fügte Kai hinzu.
»Klar«, sagte sie. »Wohin zum Beispiel?«
»Keine Ahnung. Ein Bed & Breakfast?«
»Aber er hat kein Geld, Kai. Das ist doch der springende Punkt.«
»Ja, also, ich verstehe nicht, was wir damit zu tun haben.«
»Herrgott noch mal«, stöhnte Alice, obwohl sie wusste, dass ihre Kinder recht hatten. »Leute, habt ihr gar keinen Anstand? Was lernt ihr eigentlich heutzutage in der Schule?«
»Na ja, wir lernen etwas über Pädophile und Betrüger, Spanner und Vergewaltiger und …«
»Das ist nicht wahr«, warf sie ein. »Diese Dinge erfahrt ihr aus den Medien. Ich habe euch schon tausendmal gesagt: Die Menschen sind prinzipiell gut. Dieser Mann hier ist eine verlorene Seele. Ich bin der barmherzige Samariter. Morgen um diese Zeit ist er fort.«
»Schließ die Hintertür ab«, sagte Kai. »Dreh den Schlüssel zweimal um.«
In dem Moment winkte sie ab, aber nachdem sie von der Hintertür aus laut »Gute Nacht« in die Dunkelheit gerufen hatte, verriegelte sie die Tür. Dann schlief sie kaum. Immer wieder malte sie sich aus, wie eine große Männerhand fest das Kinn ihrer kleinen Romaine umklammerte, die ihre grünen Augen vor Entsetzen weit aufgerissen hatte. Oder sie meinte, die tappenden Schritte eines fremden Mannes in ihrem Wohnzimmer zu hören, der so leise wie möglich Schubladen aufzog, auf der Suche nach Gold und iPads. Oder ihre große Tochter wurde dabei beobachtet, wie sie sich geistesabwesend vor dem Fenster auszog. Obwohl ihr Fenster zur anderen Seite hinausging … und Jasmine sich nie vor dem Fenster ausziehen würde, denn sie glaubte allen Ernstes, sie sei fett. Aber dennoch.
Alice gibt den Gedanken an Schlaf auf und beschließt, jetzt gleich ihren Tag zu beginnen. Sie durchquert das Zimmer und löst das iPad vom Ladekabel, öffnet die Webcam-App und schaut sich eine Weile lang das leere Wohnzimmer ihrer Eltern an. Seit sie beide … na ja, krank sind, wie sie es nennt, um nicht dement sagen zu müssen, übergeschnappt oder total verrückt, stehen sie immer später auf. Die morgendliche Pflegekraft kommt um zehn und muss die beiden aus dem Bett schmeißen wie schlafsüchtige Teenager.
Alice schaltet das iPad aus und zieht die Vorhänge auf. Das Meer ist ruhig und glatt nach dem Regen. Als die Sonne aufgeht, schimmert die Wasserfläche rosa und gelb – so einladend wie in der Karibik. Der Jahrmarkt ist noch erleuchtet, und auch die Straßenlampen sind noch an. Die Straßen glänzen blauschwarz. Der Anblick könnte nicht schöner sein.
Alice duscht, dabei ist sie so leise wie möglich, sie möchte die Kinder nicht früher aufwecken als nötig. In ihrem Zimmer betrachtet sie sich ausgiebig im Spiegel. Normalerweise hat sie nie Zeit, sich um sich selbst Gedanken zu machen. Sie steht gerade so rechtzeitig auf, dass sie nicht nackt aus dem Haus laufen muss. Ihr fällt auf, dass ihre Haare langsam seltsam aussehen. Ihre letzten Strähnchen waren ziemlich gewagt oder, wie Jasmine es ausdrückte, gestreift. Jetzt ist auch schon wieder der Ansatz zu sehen. Und der ganze Regen am Vortag war auch nicht gerade hilfreich.
Sie wischt die übrig gebliebenen Schatten des gestrigen Eyeliners fort und sucht in der obersten Schublade der Kommode nach ihrer Schminktasche, die sie sonst nur zu besonderen Anlässen hervorholt. Das hier hat gar nichts mit dem gutaussehenden Mann in ihrem Studio zu tun. Sie bindet ihre verrückte Dachsmähne in einem Knoten zusammen, findet eine saubere Jeans, ein karierte Bluse, die locker am Bauch sitzt, aber ihre Brüste leicht betont, und ein Paar Lieblingsohrringe mit grünlich-blauen Steinen, die zu ihrer Augenfarbe passen.
Männer bezeichnen Alice häufig als sexy. Sie hat ihr gutes Aussehen nie ausgenutzt. Sie hat nie versucht, in einem engen Kleid und hohen Schuhen Eindruck zu schinden (obwohl es ihr anscheinend nicht schadet, wenn sie sich mal um ihr Aussehen bemüht). Normalerweise schert sie der Blick in den Spiegel wenig. Aber aus irgendeinem Grund ist das an diesem Morgen anders.
Romaine steht in der Tür, verwuschelte blonde Locken, die Schlafanzughose hängt im Schritt. Arm in Arm schleichen sie beide auf Zehenspitzen die enge offene Treppe in den Flur hinunter. Die Hunde begrüßen sie begeistert und schlagen mit den Schwänzen auf die Fliesen. Als sie in die Küche kommt, hält Alice unwillkürlich die Luft an. Ihre Gedanken sind bei dem Mann im Studio. Die Ungewissheit, was dieser Tag noch bringen wird, macht sie nervös. Sie füllt Fleisch in die Hundenäpfe und toastet für Romaine einen Bagel, auf den sie Erdnussbutter schmiert. Dann bereitet sie sich selbst eine große Tasse Tee zu und gibt Müsli in eine Schale. Die ganze Zeit über schielt sie zur Hintertür. Sie ist unentschlossen, fragt sich immer wieder, was nun passiert.
Um halb neun sitzen Kai und Jasmine im Schulbus, und Alice verlässt das Haus mit Romaine und den Hunden. Kein Zeichen von dem Mann. Im Studio ist es ruhig und friedlich, als ob überhaupt niemand da wäre.
Am Schultor, das gerade erst vom Hausmeister geöffnet wird, steht Derry und schaut ihnen neugierig entgegen. »Ihr seid früh dran«, sagt sie. »Und …« Sie sieht genauer hin. »… du bist geschminkt.«
»Unwichtig«, sagt Alice.
»Was ist los?«
»Der Mann ist zu uns reingekommen«, sagt Romaine. »Der nasse Mann vom Strand.«
Alice verdreht die Augen. »Er ist nicht reingekommen«, verbessert sie ihre Tochter. »Ich habe ihn hereingebeten. Damit seine Sachen trocknen, er ein Bad nimmt und etwas isst. Ich bin ziemlich sicher, dass er jetzt schon weg ist.«
Aber als sie vierzig Minuten später nach Hause kommt, sind die Vorhänge des Studios aufgezogen, und sie kann sehen, dass jemand drinnen ist. Mit einem alten Handtuch säubert sie das Fell der Hunde, überprüft kurz ihr Aussehen und setzt dann Teewasser auf.
Seine Träume in der letzten Nacht waren bemerkenswert. Nach so vielen Stunden absoluter Leere hat es ihm sehr gutgetan, in dieser Traumwelt voller Menschen, Erfahrungen und Orte zu versinken. Er klammert sich an die verblassenden Bilder, als er aufwacht, und begreift, dass er etwas geträumt hat, das helfen könnte, seine Identität zu klären. Aber die Bilder verschwimmen unaufhaltsam.
Er setzt sich im Bett auf und reibt sich mehrmals über das Gesicht. Die Vorhänge sind nur hauchdünn. Er steht auf und blickt hinaus. Das Licht draußen hat dieses besondere Schwefelblau, das typisch ist für den Morgen nach dem Regen. Er hört Geräusche an der Tür und blickt direkt in die schwarzen Augen eines Hundes. Der Hund sieht aus, als würde er gleich lächeln, aber dann fletscht er die Zähne und knurrt. Zumindest kann er sich daran erinnern, wo er hier ist. Er kann sich an Tee in einer Thermoskanne und Pizza in einem Haus erinnern, an eine große Frau mit dicken blonden Haaren und ein heißes Bad in einem verschimmelten, hellhörigen Badezimmer. Und dann fällt ihm auch wieder der Name ein, den ihm das kleine blondgelockte Mädchen gestern Abend gegeben hat: Frank.
Er muss zur Toilette, er möchte sich die Zähne putzen, aber draußen vor der Tür dreht der Hund durch, und er weiß nicht, ob er nur zum Spaß bellt. Der Hund ist ein … Er durchforscht sein Gedächtnis nach der Rasse, aber die ist ihm entfallen. Falls er die überhaupt je gekannt hat. Rowdys haben solche Hunde. Muskulöse, breitschultrige Tiere mit einer großen Schnauze.
Er schiebt die Vorhänge ganz beiseite und starrt den Hund an, um ihn so vielleicht zum Weggehen zu bewegen. Der Hund bellt noch lauter. Dann erscheint Alice in der winzigen Hintertür des Hauses. Sie wirkt ärgerlich, ruft den Hund und packt ihn schließlich am Halsband; dann sieht sie sein Gesicht hinter der Scheibe und kommt zu ihm.
»Ist dir schon wieder eingefallen, wer du bist?«, fragt sie und reicht ihm mit einer Hand eine Tasse Tee, während sie mit der anderen den Hund festhält.
Er nimmt die Tasse. »Nein, ich hab immer noch keine Ahnung. Ich habe sehr verrückte Sachen geträumt letzte Nacht, aber leider kann ich mich an nichts davon erinnern.« Er zuckt die Achseln und stellt den Teebecher auf dem Tisch neben der Tür ab.
»Dann komm ins Haus, wenn du fertig bist«, sagt sie. »Ich lass die Tür offen. Ich mache dir Frühstück.«
Im Cottage ist es ruhig, als er wenig später den Kopf einzieht und durch die Hintertür eintritt. Die Kinder sind nicht da. Alice schaut auf ein iPad und seufzt in einem fort.
»Wo sind die Kinder?«, fragt er.
Sie sieht ihn an, als ob er zurückgeblieben wäre. »In der Schule.«
»Ach ja. Natürlich.«
Alice schaltet das iPad aus und klappt die Schutzhülle über den Bildschirm. »Glaubst du, dass du Kinder hast?«
»Gütiger Himmel.« Der Gedanke ist ihm noch gar nicht gekommen. »Ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht habe ich viele Kinder. Ich weiß nicht einmal, wie alt ich bin. Wie alt schätzt du mich?«
Ihre grünblauen Augen wandern über sein Gesicht. »Du bist zwischen fünfunddreißig und fünfundvierzig Jahre alt, würde ich sagen.«
Er nickt. »Wie alt bist du?«
»So etwas darf man eine Dame nicht fragen.«
»Tut mir leid.«
»Ist schon in Ordnung. Ich bin ja keine Dame. Ich bin einundvierzig.«
»Und deine Kinder?«, fragt er. »Ihr Vater?«