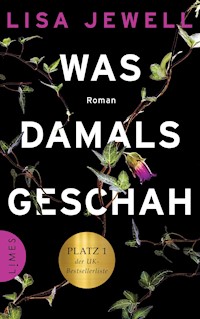6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie war die Liebe seines Lebens, aber wie gut kannte er sie wirklich?
Adrians Leben ist perfekt. Er leitet ein erfolgreiches Architekturbüro. Er ist attraktiv. Alle mögen ihn. Und er hat gerade zum dritten Mal geheiratet. Aber das ist in Ordnung, denn alle – seine Exfrauen, seine Kinder und seine neue Ehefrau Maya – sind glücklich. Doch dann stürzt Maya, offenbar stark alkoholisiert und verzweifelt, um drei Uhr morgens in London vor einen Bus und stirbt. Plötzlich beginnt Adrians scheinbar perfektes Leben sich nach und nach aufzulösen. Denn er findet heraus, dass nicht nur Maya Geheimnisse vor ihm hatte – und dass manche Geheimnisse schreckliche Konsequenzen haben können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Adrians Leben ist perfekt. Er leitet ein erfolgreiches Architekturbüro. Er ist attraktiv. Alle mögen ihn. Und er hat gerade zum dritten Mal geheiratet. Aber das ist in Ordnung, denn alle – seine Exfrauen, seine Kinder und seine neue Ehefrau Maya – sind glücklich. Doch dann stürzt Maya, offenbar stark alkoholisiert und verzweifelt, um drei Uhr morgens in London vor einen Bus und stirbt. Und plötzlich beginnt Adrians scheinbar perfektes Leben sich nach und nach aufzulösen. Denn er findet heraus, dass nicht nur Maya Geheimnisse vor ihm hatte. Und dass manche Geheimnisse schreckliche Konsequenzen haben können.
Autorin
Lisa Jewell wurde 1968 in London geboren und arbeitete viele Jahre in der Modebranche, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Nach Der Flügelschlag des Glücks ist Die Liebe seines Lebens ihr zweiter Roman bei Limes. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in London.
Lisa Jewell
Roman
Deutsch von Regina Schneider
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel The Third Wife bei Century, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © Lisa Jewell 2014
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ulrike Nikel
Umschlaggestaltung und -illustration: www.buerosued.de
AF · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19036-1V001www.limes-verlag.de
Dieses Buch ist all meinen Freunden gewidmet, die auf meinem Whiteboard stehen.
Teil eins
1
April 2011
Es hätten Feuerwerkskörper sein können – Kracher, die da funkensprühend wie Leuchtsterne und Farbgewitter vor ihren Augen explodierten. Oder auch Nordlichter, wenn es die in diesen Breiten gäbe. Aber all das war es nicht. Es waren nur die Lichter der Neonröhren und Straßenlampen, die sie unscharf und ineinander verschwimmend im Wodkanebel wahrnahm. Maya blinzelte, versuchte die Farben aus ihrem Sichtfeld zu verbannen. Vergeblich. Sie blieben dort haften, als hätte man sie auf ihre Augäpfel gemalt.
Für einen kurzen Moment schloss sie die Augen – mit dem Ergebnis, dass sie prompt das Gleichgewicht verlor und ins Wanken geriet. Blindlings tastete sie nach einem Halt, egal wonach. Erst ein unwilliges »He, Sie da« verriet ihr, dass sie sich an etwas Lebendiges klammerte.
»Tschuldigung«, murmelte Maya. »Tut mir wirklich leid.«
Das Wesen schob sie energisch von sich weg. »Schon gut.«
Doch das entsprach nicht der Wahrheit, denn der Ton war eindeutig unfreundlich. Was Maya wiederum aufregte.
»Herrgott noch mal«, rief sie lauthals in Richtung der menschlichen Silhouette, deren Geschlecht sie mit ihrem umflorten Blick beim besten Willen nicht auszumachen vermochte. »Was ist dein Problem?«
»Wie bitte?«, sagte die Person und musterte Maya von oben herab. »Ich denke mal, du bist diejenige mit dem Problem.«
Mit diesen Worten wandte sich die Frau – um eine solche handelte es sich nämlich, wie sie endlich erkannte – brüsk ab und stöckelte mit ihren roten Schuhen, die auf dem Gehweg ein arrogantes, indigniertes Klackern erzeugten, davon.
Maya starrte der verschwommenen Gestalt, die sich rasch entfernte, hinterher, und entdeckte zum Glück einen Laternenpfahl, an den sie sich lehnen konnte. Die Scheinwerfer der herannahenden Autos ließen zusätzliche Farbspiele und Lichtreflexe vor ihren Augen entstehen, verwandelten sich in immer neue Feuerwerkskörper oder in ein Spielzeug aus Kindertagen. Sie hatte mal so ein längliches Rohr voller bunter Perlen besessen, das man schütteln musste, und wenn man dann durch das Guckloch schaute, sah man die schönsten Muster.
Wie nannte man das gleich? Es fiel ihr nicht ein. Egal. Sie wusste sowieso nichts mehr. Weder wie spät es war, noch wo sie sich eigentlich befand.
Adrians Anruf. Sie hatte mit ihm gesprochen. Hatte sich bemüht, nüchtern zu klingen. Er wollte wissen, ob er sie abholen solle. Was hatte sie ihm geantwortet? Sie erinnerte sich nicht. Wusste auch nicht, wie viel Zeit seitdem vergangen war. Adrian war so lieb. Trotzdem konnte sie nicht nach Hause gehen. Denn dann müsste sie etwas tun, vor dem sie sich lieber drückte. Vorerst zumindest. Dunkel tauchte das Bild eines Pubs aus ihrem umnebelten Gedächtnis auf. Sie hatte dort mit einer Frau geredet. Ihr versprochen, nach Hause zu gehen. Das war Stunden her.
Wo war sie seitdem gewesen?
Vermutlich war sie einfach ziellos herumgelaufen. Hatte irgendwo auf einer Bank gesessen und mit fremden Leuten gesprochen. Maya begann zu kichern. Ja, das war lustig gewesen. Komische Typen. Die hatten sie doch glatt aufgefordert, mit zu ihnen nach Hause zu kommen. Party machen. Sie war drauf und dran gewesen mitzugehen – zum Glück hatte sie in letzter Minute Nein gesagt.
Ein Bus rauschte heran. Blinzelnd versuchte sie eine Nummer zu erkennen, schaffte es aber nicht. Schlingernd verlangsamte der Bus seine Fahrt, und sie merkte, dass sich links von ihr eine Bushaltestelle befand, wo Leute standen und warteten. Sie schloss wieder die Augen, klammerte sich fester an den Laternenpfahl, denn sie spürte, wie sie erneut das Gleichgewicht verlor.
Sie lächelte in sich hinein, fühlte sich, als würde sie sanft gewiegt.
Ja, das war schön. Die vielen Farben, die Dunkelheit, der Lärm, die interessanten Menschen. So etwas sollte sie öfter machen. Rausgehen. Feiern. Sich amüsieren. Eine Gruppe junger Frauen näherte sich. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie ihnen entgegen, sah jede Einzelne dreifach. Alle jung und hübsch und sexy. Sie senkte die Lider, als könnte sie das unsichtbar machen. Erst als sie vorbei waren, blickte sie wieder auf.
Liebe Schlampe, warum verschwindest du nicht einfach?
Die hässlichen Worte wirbelten durch ihren Kopf, klar und deutlich, mahnend und drohend. Ebenso wie das unbarmherzige Ich hasse sie.
Man wollte sie nicht.
Maya trat einen Schritt nach vorne.
2
»Nach Aussage des Fahrers ist Mrs. Wolfe ihm direkt vor den Bus getorkelt, als er sich der Haltestelle näherte.«
»Getorkelt?«, hakte Adrian nach.
»Nun ja. So drückte er es aus. Offenbar hat es nicht den Eindruck erweckt, als hätte sie vorgehabt, die Fahrbahn zu überqueren. Er sagte, dass sie torkelte.«
»Also war es ein Unfall?«
»Gut möglich. Aber natürlich brauchen wir den Abschlussbericht des Rechtsmediziners mit der Feststellung der Todesursache. Bislang wissen wir lediglich, dass ihr Blutalkoholspiegel sehr hoch war.« Detective Hollis warf einen prüfenden Blick auf ein Papier, das auf dem Schreibtisch vor ihm lag. »Zwei Promille. Eine gewaltige Menge, zumal für eine so zierliche Frau wie Mrs. Wolfe. Trank sie regelmäßig?«
Die Frage ließ Adrian zusammenzucken. »Äh, ja schon, wie man’s nimmt«, antwortete er zögernd. »Allerdings nicht übermäßig. Nicht mehr als jede andere dreiunddreißigjährige Lehrerin, die gestresst von einem langen Unterrichtstag heimkommt, denke ich. Ein Glas am Abend, manchmal zwei. Am Wochenende auch mal mehr.«
»Und das regelmäßig, Mr. Wolfe?«, insistierte der Detective.
Adrian stützte den Kopf in die Hände, rieb sich übers Gesicht. Er war seit halb vier in der Frühe wach, seit sein Telefon geklingelt und ihn aus einem wirren Traum gerissen hatte, in dem er mit einem Baby im Arm durch halb London geirrt war und immer wieder Mayas Namen zu rufen versuchte, ohne indes einen Ton herauszubringen.
»Halt«, sagte er. »Ihre Vermutungen gehen in die falsche Richtung. Meine Frau war keine Alkoholikerin oder in irgendeiner Weise abhängig.«
»Was dann? Warum war sie dann unterwegs und hat sich die Kante gegeben? Um ein bisschen Party zu machen? Etwas außer der Reihe zu erleben?«
»Nein, nein.« Er spürte, dass alles, was er sagte, kein Bild ergab, nichts erklärte. »Nein. Es war ganz anders. Eigentlich hat sie auf meine Kinder aufgepasst. In Islington …«
»Auf Ihre Kinder?«
»Ja.« Adrian stieß einen Seufzer aus. »Ich habe drei Kinder aus einer früheren Ehe. Meine Ex musste arbeiten, obwohl sie sich freinehmen wollte, und konnte kurzfristig niemand für die Kinder organisieren. Deshalb bat sie Maya, das zu übernehmen. Es bot sich an, weil noch Osterferien sind. Also war meine Frau tagsüber dort und wollte gegen halb sieben zurück sein. Aber sie kam nicht und ging auch nicht an ihr Telefon. Etwa alle zwei Minuten habe ich probiert, sie zu erreichen.«
»Ja, das haben wir bei der Überprüfung Ihres Handys gesehen.«
»Irgendwann nahm sie endlich ab, so gegen zehn, und da merkte ich, dass sie getrunken hatte. Sie erklärte, sie sei noch in der Stadt. Mit wem, sagte sie nicht. Angeblich wollte sie sich kurz darauf auf den Heimweg machen. Also blieb ich auf und wartete. Zwischen Mitternacht und eins probierte ich erneut, sie zu erreichen. Mehrmals. Anschließend bin ich wohl eingeschlafen. Um halb vier weckte mich dann das Telefon.«
»Wie klang sie, als Sie gegen zehn mit ihr gesprochen haben?«
»Sie klang …« Adrian kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an. »Sie klang vergnügt. Fröhlich. Angeheitert. Sie war in irgendeinem Pub aus, wie unschwer an dem Lärm im Hintergrund zu erkennen war. Wie gesagt, behauptete sie am Ende, dass sie noch austrinken und danach gleich nach Hause kommen wolle.«
»Wie es halt so ist, nicht wahr«, meinte Hollis. »Wenn man einen gewissen Pegel erreicht hat, lässt man sich leicht zu einer Menge letzter Gläser verleiten. Und die Stunden vergehen wie Minuten.« Er schwieg eine Weile. »Haben Sie wirklich keine Idee, mit wem sie dort gewesen sein könnte?«
Adrian schüttelte den Kopf.
»Okay, macht nichts«, erwiderte der Detective. »Bislang weist sowieso nichts auf verdächtige Umstände hin. Sobald sich Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergeben, müssten wir allerdings die letzten Stunden zu rekonstruieren versuchen, die Wirte der Pubs im Umkreis des Unfallorts befragen sowie die Freunde Ihrer Frau, um ein genaueres Bild zu bekommen.«
Hollis sah Adrian eindringlich an. »Eine letzte Frage, Mr. Wolfe: War zwischen Ihnen beiden alles in Ordnung?«
»Oh mein Gott, ja«, antwortete Adrian, der übermüdet und völlig durcheinander war. »Wir waren erst zwei Jahre verheiratet. Alles lief wunderbar.«
»Keine Probleme mit der anderen Familie?« Der Detective zögerte. »So etwas kann für Ehefrau Nummer zwei mitunter recht belastend sein. Sie verstehen, was ich meine?«
»Genau genommen war sie …«, setzte Adrian an. »Also, sie war meine dritte Ehefrau. Ich war vorher zweimal verheiratet.«
Sein Gegenüber zog die Brauen nach oben und musterte ihn so ungläubig, als hätte er ein Kaninchen aus dem Hut gezogen.
Für Adrian nichts Neues. Er war solche Blicke gewohnt. Sie besagten: Wie hat ein alter Sack wie du überhaupt eine Frau rumgekriegt, geschweige denn drei?
»Ich war mit allen Frauen immer gerne verheiratet«, fügte Adrian erklärend hinzu und merkte, noch bevor er den Satz zu Ende gebracht hatte, wie unpassend er klang.
»Und das lief alles ganz wunderbar, sagten Sie? Mrs. Wolfe hatte keine Schwierigkeiten mit einer solch …sagen wir mal komplizierten Situation?«
Seufzend strich Adrian sich eine Strähne seiner Haare, die er ziemlich lang trug, aus dem Gesicht.
»Es war und ist nicht kompliziert«, verteidigte er sich. »Wir sind eine große, glückliche Familie und fahren jedes Jahr alle gemeinsam in den Urlaub.«
»Alle?«
»Ja. Alle zusammen. Drei Frauen. Fünf Kinder. Jedes Jahr.«
»Und alle in einem Haus?«
»Ja. In ein und demselben Haus. Scheidungen müssen keine Katastrophe sein, wenn alle Beteiligten bereit sind, sich wie erwachsene Menschen zu benehmen.«
Der Detective nickte bedächtig. »Nun«, sagte er, »gut zu hören.«
»Wann kann ich sie sehen?«
»Weiß ich noch nicht.« Hollis schlug einen weicheren Ton an. »Ich werde mich im Büro des Rechtsmediziners erkundigen, mal sehen, wie die dort vorankommen. Jedenfalls dürfte es bald so weit sein. Sie sollten jetzt nach Hause gehen, duschen, einen Kaffee trinken …«
Adrian nickte. »Ja, das werde ich tun. Danke.«
Als er die Wohnungstür öffnete, gab es ein schrecklich misstönendes Geräusch. Der Schlüssel kratzte und knarzte im Schloss wie ein Folterinstrument, weil er ihn absichtlich langsam drehte. Adrian wollte nämlich das Betreten der Räume, in denen sie gemeinsam gelebt hatten, hinauszögern. Er wollte nicht ohne sie hier sein.
Die Katze begrüßte ihn im Flur, fordernd und sichtlich hungrig. Ausdruckslos starrte er sie an. Mayas Liebling. Mitgebracht vor drei Jahren in einer braunen Plastikbox zusammen mit ihren wenigen Habseligkeiten. Er hatte es nicht so mit Katzen, doch er akzeptierte sie in seiner Welt wie Mayas andere Sachen auch – die grellbunt geblümte Tagesdecke, den uralten CD-Player.
»Billie«, sagte er, während er die Tür hinter sich schloss und sich dann bleischwer dagegenlehnte. »Sie ist weg. Deine Mummy. Sie ist weg.«
Den Rücken fest gegen das Holz gepresst, ließ er sich langsam in die Hocke gleiten, drückte die Handballen gegen die Augenhöhlen und weinte. Die Katze kam neugierig näher, rieb sich an seinen Knien und gab ein klägliches Maunzen von sich. Er zog sie an sich, schluchzte noch heftiger.
»Sie ist tot, Miezchen. Unsere schöne, schöne Mummy. Was machen wir bloß ohne sie? Was machen wir nur?«
Die Katze wusste keine Antwort – sie hatte Hunger.
Adrian rappelte sich langsam hoch und folgte ihr in die Küche. Wühlte in Schränken und Regalen nach irgendetwas Essbarem für sie. Er hatte Billie nie gefüttert und nicht die geringste Ahnung, was sie normalerweise fraß. Schließlich öffnete er einfach eine Dose Thunfisch, die er zwischen den anderen Lebensmittelvorräten fand.
Inzwischen war es hell, die Morgensonne schien in den spartanischen, wenig anheimelnden Raum, der den größten Teil des Tages dunkel war, und tauchte ihn in ein grelles Licht, das das schmuddelige Braun der Holzdielen und den allgegenwärtigen Staub unbarmherzig zum Vorschein brachte. Ebenso die schwarzen Katzenhaare auf Billies Lieblingsplätzen, die klebrigen Ränder auf der Tischplatte, wo Maya gestern ihr morgendliches Glas Smoothie abgestellt hatte, sowie die feuchten Stellen und Risse auf Wänden und Decke.
Die Entscheidung für diese Wohnung war ein Schnellschuss gewesen. Maya musste aus ihrer Wohngemeinschaft raus, weil überraschend schnell ein Nachmieter gefunden worden war, und bei ihm drängte es damals, weil er nicht mehr allzu lange mit Caroline unter einem Dach wohnen mochte, nachdem er ihr bereits seine Scheidungsabsicht angekündigt hatte. Es war also allerhöchste Zeit gewesen, etwas Neues zu suchen. Und so hatten sie an einem schönen Vormittag drei Wohnungen besichtigt und sich dann spontan für die schlechteste in der hübschesten Straße entschieden.
Aber das war ihnen beiden in diesem Augenblick egal. Völlig egal. Weil sie verliebt waren. Und wenn man verliebt ist, sehen selbst hässliche Wohnungen hübsch aus.
Er sah Billie zu, die mäkelig von ihrem Thunfisch aß. Er würde sie weggeben müssen. Mayas Katze ohne Maya – ein unmöglicher Gedanke.
Er zog sein Handy aus der Jackentasche und starrte es eine ganze Weile unschlüssig an. Er musste Telefonate führen. Schreckliche Telefonate. Mit Mayas Eltern; mit Susie in Hove, mit Caroline in Islington und mit seinen Kindern, den großen wie den kleinen.
Was sollte er ihnen nur sagen, warum Maya mitten in der Woche angetrunken und allein durch das nächtliche, neonhelle Londoner Westend spaziert war? Er wusste es nicht. Adrian hatte keine Ahnung. Er wusste nur eines: dass sein Leben schlagartig aus der Bahn geraten und er als erwachsener Mann zum ersten Mal in seinem Leben alleine war.
3
März 2012
Die junge Frau im hellgrauen Mantel stand im Postamt und begutachtete scheinbar angelegentlich die Grußkarten. Doch während sie den Ständer langsam weiterdrehte, wanderten ihre Blicke hinüber auf die andere Seite des Raumes. Direkt zu ihm. Adrian Wolfe.
Er trug einen Tweedmantel, schwarze Jeans, klassische Boots und einen burgunderroten Schal. Von hinten sah er wie ein schlanker Zwanzigjähriger aus, von vorne hingegen wie das, was er war: ein Mann mittleren Alters. Durchaus gut aussehend mit seinen unmodisch langen Haaren und seinem sanften Hundeblick, lässig gekleidet mit einem Touch von Nachlässigkeit. Von Anfang an hatte er ihr gefallen. Seit sie ihn entdeckt hatte und ihm auf den Fersen geblieben war. Seit Wochen ging das so.
Sie beobachtete, wie er etwas aus seiner Manteltasche zog. Ein kleine, rechteckige weiße Pappe. Er sprach eine Angestellte an, die ihm die Infotafel zeigte, auf der die Kunden Gesuche und Angebote unter die Leute bringen konnten. Adrian Wolfe heftete seinen Pappzettel an, trat einen Schritt zurück, betrachtete das Ganze und ging hinaus.
Sofort verließ die Frau im grauen Mantel ihren Beobachtungsposten, um sich anzuschauen, was der Mann dort ausgehängt hatte.
Katze sucht neues Zuhause
Billie ist etwa acht Jahre alt. Sie ist schwarzweiß, gut zu haben und hat keine schlechten Angewohnheiten. Aus persönlichen Gründen bin ich nicht mehr in der Lage, mich so um sie zu kümmern, wie sie es verdient. Wenn Sie Billie kennenlernen und sehen möchten, ob sie zu Ihnen passt, rufen Sie mich bitte unter der unten angegebenen Nummer an.
Verstohlen schaute die Frau ein paarmal von links nach rechts, riss rasch den Zettel ab und ließ ihn in ihrer Handtasche verschwinden.
»Sie haart ein bisschen.«
Adrian warf einen flüchtigen Blick auf Billie, die in einer Ecke saß und die Besucherin beäugte, als wüsste sie, dass die Fremde gekommen war, um ihr möglicherweise die Chance auf ein besseres Leben zu eröffnen.
Jane, so hieß die Frau, lächelte und strich der Katze fest über den Rücken. »Das ist kein Problem. Ich habe ein Tier, das mit so etwas im Nu fertig wird.«
Adrian musterte sie irritiert. Vor seinem inneren Auge sah er sie auf einem Sofa sitzen mit einem Tiger neben sich, der mit der ganzen Billie kurzen Prozess machen würde.
Sie erkannte seine Verwirrung.
»War bloß ein Scherz«, klärte sie ihn lachend auf. »Ich besitze einen Cat-and-Dog-Staubsauger – Sie wissen schon, so einen speziell für Leute, die Haustiere halten. Einen, der Haare frisst.«
»Aha.« Er nickte, ohne wirklich zu verstehen.
»Warum möchten Sie sie denn abgeben?«
Jane wischte ein paar Katzenhaare von der Handfläche und schnipste sie auf den Boden.
Mit einem traurigen Lächeln gab Adrian die gewünschte Auskunft. Mittlerweile war er geübt darin, das eigentlich Unerträgliche für andere in erträgliche Worte zu fassen.
»Billie war die Katze meiner Frau, die vor elf Monaten gestorben ist. Jedes Mal, wenn ich Billie ansehe, denke ich, Maya müsste gleich ins Zimmer treten. Doch sie kommt nicht.« Er zuckte mit den Schultern. »So ist das. Deshalb will ich mich von Billie trennen.«
Er sah die Katze betont liebevoll an, obgleich er ihr keine besondere Zuneigung entgegenbrachte. Aber diese Seite wollte er der fremden Frau nicht offenbaren – es war nicht nett, die Katze für etwas büßen zu lassen, woran sie keine Schuld hatte.
Die Frau sah ihn mitleidig an. »Mein Gott, das ist ja furchtbar.«
Ihr blonder Pony fiel ihr in die Augen, und sie schob ihn mit ihren feingliedrigen Fingern zurück. Sämtliche Bewegungen vollführte sie in geradezu vollendeter Perfektion – wie eine ausgebildete Tänzerin oder wie jemand, der geschult war in Techniken der Körperbeherrschung. Das bemerkte Adrian in diesem Moment ebenso wie ihre schmale Taille, die ein breiter Gürtel zusätzlich betonte. Ihre Ohrringe, winzige Glasperlen, die an silbernen Häkchen baumelten, korrespondierten mit der Farbe ihres eng anliegenden blauen Jerseykleids. Beigefarbene Stiefeletten mit niedrigem Absatz und silberfarbenen Nieten und eine dazu passende Tasche ergänzten die stilsichere Aufmachung. Eine echte Schönheit. Fast schon zu perfekt.
Sie richteten beide ihre Blicke erneut auf Billie.
»Also«, sagte Adrian. »Was meinen Sie?«
»Ich finde sie süß«, erwiderte Jane, hielt dann inne und sah Adrian direkt ins Gesicht.
Jetzt erst bemerkte er, dass sie verschiedenfarbige Augen hatte: Das eine war graublau, das andere graublau mit einem bernsteinfarbenen Fleck. Er holte tief Luft. Da also war sie, dachte er bei sich, die unvollkommene Stelle in diesem vollkommenen Bild. Jede Frau, die er geliebt hatte, wies irgendeinen kleinen Makel auf. Bei Caroline war es eine Narbe im Augenbrauenbogen, bei Susie eine kleine Lücke zwischen den Zähnen, und bei Maya hatte ihn die ausgedehnte Sommersprossenlandschaft gereizt, die andere nicht schön fanden.
Die Frau unterbrach seine Gedanken und kam auf die Katze zurück. »Allerdings bin ich nicht sicher, ob es gut wäre, sie herzugeben.«
Er sah sie fragend an, wusste nicht, worauf diese Jane hinauswollte.
»Wie lange war Billie eigentlich bei Ihnen?«, erkundigte sie sich.
»Maya brachte sie mit, als wir zusammenzogen. Also sind es etwa vier Jahre.«
Adrian konnte ihr förmlich ansehen, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete, wie sie nachrechnete. Eine Frau, die innerhalb von drei Jahren eingezogen und gestorben war, echt hart. Unwahrscheinlich und tragisch. Wie in einem schlechten Film. Doch es war kein schlechter Film. Keineswegs. Es war sein Leben, sein ganz reales Leben.
»Sie ist süß, wirklich süß«, wiederholte Jane. »Trotzdem …«
Gespannt wartete Adrian auf ihre nächsten Worte, auf die Erklärung ihres Trotzdems.
»Mein Gefühl stimmt nicht so ganz.«
»Ihr Gefühl?«
Sein Blick fiel auf Billie. Zum ersten Mal überhaupt nahm er sie näher in Augenschein. Bislang war eine Katze für ihn wie die andere gewesen. Vier Beine. Schnurrhaare. Spitze Ohren. In etwa die Größe einer Aktenmappe. Nichts von der faszinierenden Vielfalt, die sich bei Hunden findet: Schlappohren bis zum Boden, Stehohren bis zum Mond, breite Schnauzen, spitze Schnauzen – die einen so klein wie Eichhörnchen, die anderen so groß wie Ponys.
»Hinsichtlich der Verbindung.«
Er rieb sich sein Kinn und bemühte sich um eine verständnisvolle Miene.
»Kann ich es mir überlegen?«, fragte sie und schob den Riemen ihrer hübschen Designerhandtasche wieder über ihre Schulter.
»Natürlich! Sie sind die Einzige, die sich gemeldet hat, und damit liegt es ganz bei Ihnen.«
Sie lächelte ihn an. »Super. Kann ich noch mal vorbeikommen? Morgen vielleicht?«
Adrian lachte. Was für eine seltsame junge Frau.
»Warum nicht. Allerdings bin ich morgen viel unterwegs, Sie sollten sich also vorher telefonisch melden. Meine Nummer haben Sie ja.«
»Mache ich.« Sie streckte ihm zum Abschied die Hand entgegen. »Ich melde mich am späten Vormittag. Dann können wir ja eine Uhrzeit ausmachen.«
»Gut.« Adrian begleitete sie zur Tür und öffnete sie.
»Aber hallo«, sagte sie im Flur und deutete auf sein Whiteboard an der Wand. »Sieht ziemlich chaotisch aus.«
»Ja, das trifft es wohl. Chaotisch wie mein Leben. Immerhin bewahrt es mich davor, völlig in diesem Chaos zu versinken.«
Sie hielt inne, ein Lächeln auf den Lippen, und fuhr mit dem Finger an einer Notiz entlang: Pearl. Zehnter Geburtstag. Beim Italiener, Strada, Upper Street, halb sieben.
»Haben Sie schon ein Geschenk?«, erkundigte sie sich.
»Ja«, erwiderte er, war ein wenig erstaunt über die Frage. »Habe ich tatsächlich.«
»Das Whiteboard zahlt sich also aus«, erwiderte sie. »Okay, dann also bis morgen. Und danke, dass ich es mir überlegen darf mit Billie. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Keine, die man überstürzen sollte.«
»Absolut, da bin ich ganz Ihrer Meinung.«
Er schloss die Tür hinter ihr und lehnte sich schwer dagegen. Das Whiteboard war Mayas Idee gewesen. Sie hatte zu den Menschen gehört, die ein Problem anpackten, sobald sie es erkannt hatten. Und seines bestand darin, dass er, obwohl er eigentlich alle glücklich sehen wollte, ständig Dinge tat, die alle unglücklich machten. Wenn es ihm wenigstens egal wäre! War es aber nicht.
Er gehörte nämlich nicht zu den Leuten, die mit einem Schulterzucken sagten: So ist es eben im Leben, niemand ist perfekt. Im Gegenteil. Jedes Mal, wenn er einen Kindergeburtstag vergaß oder eine Verabredung ins Theater oder eine Siegerehrung, fraß ihn der Selbsthass regelrecht auf. Schließlich war diese große, unkonventionelle Familie ein Resultat von Entscheidungen, die allein er gefällt hatte, und so war es auch seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass niemand zu kurz kam. Doch immer wieder fühlte sich jemand zurückgesetzt. Mal war es eine heulende Tochter, mal ein enttäuschter Sohn, mal eine verärgerte Exfrau.
»Armer Adrian«, hatte Maya ihn einmal nach einem Telefongespräch mit Caroline bedauert, bei dem es Vorwürfe hagelte, weil er nicht zum Elternsprechtag in der Schule erschienen war.
Seufzend hatte Adrian den Kopf auf Mayas Schulter gelegt. »Ich bin die totale Katastrophe. Eine menschliche Abrissbirne. Dabei möchte ich den Kindern eigentlich zeigen, dass ich jede einzelne Minute an jedem einzelnen Tag an sie denke, selbst wenn ich noch so schlecht organisiert bin.«
Eines Tages war sie daraufhin mit diesem Whiteboard angekommen. Dieser »Wandtafel der Harmonie«, wie sie es nannte. Alles Wichtige war dort fürs ganze Jahr festgehalten und farblich markiert: Geburtstage der Kinder und der Exfrauen, sogar die der ehemaligen Schwiegermütter; Absprachen, wer wo Weihnachten verbrachte, wer wann auf eine andere Schule wechselte oder seinen Studienabschluss machte, desgleichen sämtliche Ferien der drei schulpflichtigen Kinder sowie Reisen und Bewerbungsgespräche der beiden erwachsenen Sprösslinge.
Wann immer er mit einem seiner Kinder sprach, das ihm irgendetwas aus seinem Leben erzählte, egal wie belanglos es war, schrieb er es unter dem entsprechenden Datum auf: Cat schaut sich dieses Wochenende Wohnungen an. Auf diese Weise stellte er sicher, dass er nicht vergaß nachzufragen, wie es gelaufen war. Alles war auf der Tafel festgehalten, all die winzigen Details im Leben der Familien, die er gegründet und verlassen hatte.
Dabei war es nicht Adrians Absicht gewesen, sein Leben derart kompliziert einzurichten. Es hatte sich einfach ergeben. Zwei Exfrauen. Eine verstorbene Frau. Drei Söhne. Zwei Töchter. Drei Häuser. Und eine Katze. Hinzu kamen jede Menge Querverbindungen zu unzähligen Menschen, die durch diese Familien in seine Welt hineingezogen wurden: Freunde und Freundinnen seiner Kinder, Mütter und Väter von besten Freunden, Lieblingslehrer und -lehrerinnen, Schwiegermütter und Schwiegerväter, Schwägerinnen und Schwager, Großeltern, Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen, an denen seine Kinder hingen und die für sie eine große Rolle spielten. Menschen, die er nicht einfach so vergessen und aus seinem Kopf streichen konnte, als gingen sie ihn nichts mehr an, nur weil er nicht mehr verheiratet war mit Susie und Caroline.
Maya als Einzige hatte nicht wirklich etwas zurückgelassen. Jedes Mal, wenn er daran dachte, versetzte es ihm einen schmerzhaften Stich, der durch und durch ging. Ihre Eltern kannte er kaum, den Bruder hatte er lediglich kurz auf ihrer Hochzeit gesehen, die sogenannte beste Freundin schien ihn nicht zu mögen und würde ihn vermutlich für Mayas Tod verantwortlich machte. Von ihr geblieben war ihm allein diese Katze, die sich gerade auf dem Boden von einem Sonnenstrahl bescheinen ließ.
Er ging durch das Zimmer zu ihr hin, setzte sich neben sie und betrachtete sie eine Weile. Maya hatte Billie wie ihr Baby behandelt, ständig über sie gesprochen, ihr teure Leckerli und Spielsachen gekauft, mit denen sie nie spielte. Er ließ sie gewähren, doch eines Tages, kurz vor ihrer Hochzeit, hatte er ihr eröffnet, dass er sich mit ihr ein richtiges Baby wünsche.
»Nur ein ganz kleines«, hatte er gescherzt. »Eines, das in Billies Transportkiste passt.«
Adrian legte eine Hand auf den Rücken der Katze, die daraufhin verschreckt aufsprang. Kein Wunder. Er fasste sie sehr selten an. Plötzlich aber wurde sie anschmiegsamer und drehte ihm ihren Bauch zu, ein weiches Kissen aus dickem schwarzem Fell. Als er die Hand darauflegte, spürte er eine wohlige, lebendige Wärme, und einen Moment lang überkam ihn ein fast menschliches Gefühl für Billie: die »Verbindung«, von der diese Jane gesprochen hatte.
Vielleicht hatte sie ja recht, dachte er im Stillen. Vielleicht brauchte er dieses kleine warme Lebewesen, Mayas einzige Hinterlassenschaft, noch.
Doch während er diesem wehmütigen, sentimentalen Gedanken nachhing, schlug ihm die Katze, die er wohl einen Moment lang zu fest gedrückt hatte, eine Kralle in die dünne Haut an der Innenseite seines Handgelenks.
»Autsch! Scheiße«, rief er und saugte an der kleinen Wunde. »Wofür war das denn?«
Unverwandt starrte er auf sein Handgelenk, auf den Kratzer, der sich tiefrot verfärbte. Adrian wollte Blut sehen – irgendetwas, das sich heiß verströmte. Aber da kam nichts.
4
Es war Samstagabend. Wieder einmal. Der siebenundvierzigste, seit Maya gestorben war. Und es wurde nicht leichter.
Adrian fragte sich verbittert, was seine Familie wohl gerade machte. Er stellte sich vor, wie sie alle versammelt vor dem Fernseher saßen und irgendeine Samstagabendshow schauten. Welche war es noch, die gerade angesagt war? Die Kinder hatten sie mit ihm am letzten Wochenende unbedingt ansehen wollen, als sie bei ihm waren. Etwas mit … Er kriegte es nicht mehr zusammen, wusste lediglich, dass es keine dieser grauenhaften Talentshows mit heulenden Kandidaten gewesen war.
Draußen vor dem Fenster waren die Schatten bereits länger geworden, und ein leichter Regenschauer prasselte gegen die Fensterscheiben. Adrian schenkte sich ein Glas Wein ein und zog den Laptop zu sich heran.
Von seinem neunzehnten Lebensjahr an bis zu Mayas Tod hatte er nie alleine gelebt, und zum ersten Mal wurde ihm bewusst, dass ihm Freunde fehlten. Gewiss, da waren in früheren Zeiten welche gewesen, aber die gehörten zum jeweiligen Gesamtpaket seiner beiden ersten Ehen. Die gemeinsamen Freunde aus der Zeit mit Susie lebten nach wie vor alle in Sussex. Und die aus der Ära Caroline waren ausnahmslos wegen seiner Affäre mit Maya mit fliegenden Fahnen zu der betrogenen Ehefrau übergegangen.
Was im Klartext bedeutete, dass mit dem Ende seiner Beziehungen ebenfalls die jeweiligen Freundschaften beendet gewesen waren. Und was ihn und Maya betraf, so hatten sie keine Freundschaften geschlossen, weil sie beide viel zu sehr damit beschäftigt waren, jedes Mitglied der Großfamilie zufriedenzustellen.
Allerdings waren nach Mayas Tod plötzlich Leute aufgetaucht, die er schon längst nicht mehr auf dem Radar gehabt hatte. Wie zum Beispiel der etwas finster wirkende stellvertretende Rektor von Mayas Schule, mit dem er einmal auf einem Wohltätigkeitsabend ein langes, angestrengtes Gespräch geführt hatte. Oder der Exmann einer Freundin von Caroline, über dessen näselnde Stimme sie sich immer köstlich amüsiert hatten und der sich deshalb für Parodien geradezu anbot. Auch der mürrische, leicht aufbrausende Vater einer Freundin seiner Tochter Pearl stand unvermutet auf der Matte. Die meisten kannte er kaum, war ihnen lediglich begegnet, wenn er seine Kinder brachte oder abholte. Trotzdem hatten sie plötzlich begonnen, ihn aus dem Haus zu zwingen und in diverse Pubs und sogar in den einen oder anderen Nachtclub zu schleppen, wo sie ihn mit Alkohol abfüllten und ihm gänzlich unakzeptable »Damen« vorstellten. Das ist unser Freund Adrian – er hat gerade seine Frau verloren.
Es gab nach Mayas Tod in der Tat eine ganze Schar von Frauen, die sich gerne um ihn gekümmert hätten. Hauptsächlich Mütter von Schulfreunden seiner Kinder. Es waren dieselben Frauen, die ihn mit Verachtung straften, als er Caroline verließ. Jetzt scharwenzelten sie mit großen, leuchtenden Augen beflissen um ihn herum, brachten ihm Essen in Tupperdosen, die er dann gespült und mit ein paar Dankesworten wieder zurückbringen musste.
Bloß stand ihm nach solchen Spielchen absolut nicht der Sinn. Er wollte nicht vor die Tür, er wollte sich verkriechen und heulen und sich immer wieder fragen: Warum, warum, warum. Denn wieso Maya sich dermaßen abgefüllt hatte, dass sie vor einen Bus gelaufen war, darüber grübelte er nach wie vor. Er sollte damit aufhören, das wusste er, aber er schaffte es nicht.
Die junge Frau namens Jane kam am nächsten Tag noch einmal vorbei. Diesmal trug sie ihr blondes Haar offen – in weich gefönten Wellen floss es ihr über die Schultern, und von der Seite her fielen ihr Strähnen ihres gescheitelten Ponys sanft ins Gesicht, als würde sie durch einen Vorhang spähen. Kurz bevor sie kam, hatte Adrian Dinge getan, über die er gar nicht weiter nachdenken mochte. Dass er etwa mit Mayas Handspiegel an ein Fenster getreten war, um im hellen Licht sein Gesicht bis ins allerkleinste Detail zu betrachten.
Als er Maya kennengelernt hatte, war sie dreißig, er vierundvierzig gewesen. Ein jung gebliebener Mittvierziger, wie er fand: dichtes dunkelbraunes Haar, haselnussbraune Augen, lustige Lachfältchen. Vier Jahre waren seitdem vergangen.
Gewiss, an allem nagte der Zahn der Zeit. Bei ihm allerdings kamen Trauer und Schmerz hinzu und prägten seine Züge. Ohnehin konnte in diesem Alter, der Nahtstelle zwischen den beiden großen Lebensabschnitten, das äußere Erscheinungsbild stark wechseln, täglich oder gar stündlich anders aussehen. Mal scharf, mal unscharf, mal jung, mal alt. Wie die verfremdenden Spiegelbilder in einem Panoptikum oder wie kunstvoll retuschiert trat einem das eigene Gesicht entgegen.
Nach Mayas Tod jedoch hatte das Bild aufgehört, sich je nach Befinden zu verändern, war plötzlich statisch geworden. Und aus dem Spiegel hatte ihn nur noch das Gesicht eines in die Jahre gekommenen Mannes angeschaut, der deutlich älter aussah, als er es wahrhaben mochte. Seitdem vermied er es nach Möglichkeit, in den Spiegel zu schauen. Nun aber wollte er es mal wieder wissen. Wegen Jane.
Adrian erschrak bei seinem Anblick.
Er sah eine Kiefer- und Kinnpartie, die den Gesetzen der Schwerkraft zu folgen begann. Er sah Falten und Furchen an Hals und Nacken, die ihn an vom steten Wechsel der Gezeiten und von immer wiederkehrenden Sturmfluten wie gefräst aussehende Strände erinnerten. Er sah gelbliche Tränensäcke unter seinen Augen, die ebenso wie seine Haare jeden Glanz verloren hatten.
Am Ende der kritischen Musterung bemühte er sich um eine Generalüberholung. Unter der Dusche massierte er sein Gesicht mit dem Inhalt von Tuben und Fläschchen, die noch von Maya stammten, wusch sein Haar zweimal mit duftendem Shampoo und gab zum allerersten Mal in seinem Leben eine Spülung hinzu, die Geschmeidigkeit und neuen Glanz versprach. Anschließend fönte er die Haare und fand, dass sich das Ergebnis sehen ließ. Jetzt musste er nur noch das grüne Hemd bügeln, von dem Maya einmal gesagt hatte, dass es seine braunen Augen besonders zur Geltung bringe. Fertig.
Er verfluchte seine Trödelei, als er mit Entsetzen feststellte, dass ihm gerade mal sieben Minuten bis zur verabredeten Zeit um halb zwölf blieben. »Alter Volltrottel«, brummte er vor sich hin. »Wie kannst du bloß?« Er befüllte den Wasserkocher und schob ein paar Dinge auf den Küchenschränken hin und her, damit es gefälliger aussah. »Achtundvierzig«, murmelte er. »Du bist achtundvierzig, Witwer und total neben der Spur.«
Und dann war sie da. Zeitlos schön stand sie in der Tür mit ihren verschiedenfarbigen Augen hinter dem Ponyvorhang und duftete nach Jasmin, ihre schicke kleine Handtasche fest an sich gepresst. Sie trug einen hellen Mantel, der mit einem einzelnen, übergroßen Knopf geschlossen wurde.
»Kommen Sie herein.«
»Tut mir wirklich leid«, sagte sie und trat selbstsicher in den Flur. »Sie denken bestimmt, ich bin verrückt.«
»Wieso? Nein, ganz und gar nicht.«
»Natürlich denken Sie das. Wer verlangt schon mehrere Besichtigungstermine für eine Katze? Als Nächstes frage ich noch, ob ich Billie mal probehalber zum Essen ausführen darf.«
Adrian sah Jane an und lachte. »Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst, dass sie tadellose Manieren hat. Meistens zumindest.«
Jane ging auf die Katze zu, die an ihrem Stammplatz auf der Rückenlehne des Sofas neben dem Fenster lag und neugierig den Kopf hob.
»Hallo Süße«, sprach Jane sie an und kraulte sie unterm Kinn.
»Darf ich Ihnen einen Tee anbieten?«, fragte Adrian. »Einen Kaffee? Oder ein Wasser?«
»Kaffee bitte«, antwortete sie. »Hatte gestern eine recht lange Nacht.«
Adrian nickte. Sie sah gar nicht aus wie jemand, der nicht genug Schlaf bekommen hatte und der generell gerne die Nacht zum Tag machte.
»Schwarz?«
Sie lächelte. »Ja bitte.«
Als Adrian mit dem Kaffee zurück ins Zimmer kam, saß Jane auf dem Sofa, die Katze auf dem Schoß, und hielt ein gerahmtes Foto seiner Kinder in der Hand.
»Hübsche Kinder. Alles Ihre?«
Er warf einen kurzen Blick darauf. Otis, Pearl und Beau waren darauf zu sehen mit Südwester und Gummistiefeln, steckten knietief in einem Bach irgendwo in Südwestengland. Der Himmel hinter ihnen war metallgrau, das Wasser unter ihnen stahlblau, und ihre farbige Kleidung hob sich vor dem monotonen Hintergrund leuchtend ab – fast so, als wären die Kinder als Ausschneidebildchen aufgeklebt. Beau hatte seinen Arm um Pearls Taille geschlungen, und Pearls Kopf ruhte auf Otis’ Schulter. Alle drei lachten natürlich und entspannt in die Kamera. Maya hatte das Foto gemacht. Die Kinder ließen sich gerne von ihr fotografieren.
Adrian stellte die Tasse auf den Couchtisch. »Ja«, sagte er dann. »Alles meine.«
»Wie heißen sie?«
Er strich mit dem Finger über das Bild. »Das ist Otis, er ist zwölf; Pearl ist …«
»Fast zehn.« Lächelnd blickte sie zu ihm auf.
»Stimmt genau. Sie wird bald zehn. Und dieser kleine Zwerg hier, Beau, ist gerade fünf geworden.«
»Süß.« Sie stellte den Rahmen vorsichtig zurück auf den Tisch und griff nach der Tasse. »Aber sie leben nicht bei Ihnen?«
»Sie wollen ganz schön viel wissen«, erwiderte er, während er sich ihr gegenüber in einen Sessel setzte.
»Ich bin neugierig, sagen Sie es ruhig.«
»Also gut. Sie sind neugierig.«
Sie lachte. »Entschuldigen Sie bitte – es ist bloß so, dass ich das Leben anderer Leute einfach spannend finde. Immer schon.«
»Ist okay. Geht mir genauso.« Er holte tief Luft und strich sich über das frisch rasierte Kinn. »Nein«, sagte er. »Sie leben nicht bei mir, sondern bei ihrer Mutter in einem fünfstöckigen viktorianischen Stadthaus in Islington.«
»Wow!« Jane ließ ihre Blicke durch das bescheidene Wohnzimmer schweifen – die Exfrau hatte zweifellos das bessere Geschäft gemacht.
»Das klappt gut«, fügte er schnell hinzu. Er hasste es, bedauert zu werden. Mitleid war das Letzte, was er gebrauchen konnte. »Es gibt genug Platz für alle, wenn sie jedes zweite Wochenende kommen. Beau schläft bei mir, Pearl und Otis im Gästezimmer. Alles prima.«
»Und mit Ihrer verstorbenen Frau hatten Sie keine Kinder?«
»Nein.« Adrian schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Obwohl ich bei Gott nicht wüsste, was ich jetzt mit einem Baby anfangen sollte. Ich hätte wohl oder übel meine Arbeit aufgeben müssen. Und die ganze fragile Familienkonstellation wäre zusammengebrochen.«
»Warum haben Sie das Haus in Islington nicht behalten, da wäre viel Platz gewesen …«
Adrian seufzte. »Ich habe es Caroline überlassen – und das kleine Landhaus in Hove Susie.«
Sie hob fragend eine Braue.
»Exfrau Nummer eins«, erklärte er. »Die Mutter meiner beiden ältesten Kinder. Hier …« Er stand auf, nahm ein anderes gerahmtes Foto und reichte es ihr. »Cat und Luke. Meine beiden Großen.«
Sie starrte mit weit aufgerissenen Augen auf das Foto. »Sie produzieren offenbar ausgesprochen besondere Kinder«, meinte sie anerkennend. »Wie alt sind die beiden?«
ENDE DER LESEPROBE