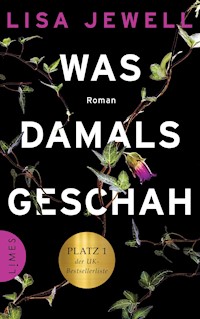Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ronin-Hörverlag, ein Imprint von Omondi GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Family
- Sprache: Deutsch
Meet the Lamb Family…. London. Juni 2019: Am Ufer der Themse wird ein Beutel mit einem grausigen Fund entdeckt. Menschliche Knochen. An den Tatort gerufen schickt DCI Samuel Owusu die Knochen zur gerichtsmedizinischen Untersuchung. Mit dem Ergebnis, es handelt sich um die Knochen einer jungen Frau, die vor vielen Jahren durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde. In dem Beutel befinden sich auch eine Reihe von weiteren Hinweisen, darunter auch die Samen eines seltenen Baumes, die Samuel Owusu zu einem Herrenhaus in Chelsea führen. Zu einem Haus in dem vor fast dreißig Jahre drei Menschen tagelang tot in der Küche lagen und ein Baby im Obergeschoss auf jemanden wartete, der es abholen würde. Die Hinweise führen auch zu einem Geschwisterpaar in Chicago, das auf der Suche nach der einzigen Person ist, die ihrer Vergangenheit einen Sinn geben kann. Auch Rachel Rimmer hat einen Schock erlitten: Ihr Mann Michael wurde tot im Keller seines Hauses in Frankreich aufgefunden. Alles deutet auf einen Eindringling hin, und die französische Polizei bittet sie, dringend zu kommen, um Fragen über Michael und seine Vergangenheit zu beantworten, die sie nur ungern beantworten möchte. Vier Todesfälle. Ein ungelöstes Rätsel. Eine Familie, deren Geheimnisse nicht für immer begraben bleiben können... * #1 UK SUNDAY TIMES BESTSELLER * * A NEW YORK TIMES BSETSELLER * Ein Buch, dass Fragen beantwortet, von denen man nicht mal selbst wusste, dass man sie hatte! Ein meisterhafter Thriller über verdrehte Ehen, zerrüttete Familien und tödliche Besessenheit. Ein atemberaubender und berührender Roman über den Aufwand, den wir betreiben, um die zu schützen, die wir lieben, und um die Wahrheit aufzudecken. Lisa Jewell ist eine großartige Autorin auf höchstem Niveau.“ Karin Slaugher
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Family Remains« bei Century, Penguin Random House UK, London.
Dies ist ein fiktives Werk. Alle in diesem Roman dargestellten Personen, Organisationen und Ereignisse sind entweder ein Produkt der Fantasie des Autors oder werden fiktiv verwendet.
Der Inhalt dieses Buchs/E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtlich Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieser Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Unsere Bücher können in großen Mengen für Werbe-, Bildungs- oder Geschäftszwecke gekauft werden. Bitte wende dich an deinen Buchhändler vor Ort oder an [email protected]
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe 2024
Copyright der Originalausgabe Copyright © 2022 by Lisa Jewell
All rights reserved.
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe: Ronin Hörverlag, Heusteg 47, 91056 Erlangen
Übersetzung: Franca Tödter und Noah Sievernich
Umschlaggestaltung: by wayan-design unter Verwendung von Motiven von Depositphotos © Iakov (Iakov Kalinin), © Andrey_Kuzmin (Andrey Kuzmin) und Shutterstock © Guivuan Chen
Redaktion: Noah Sievernich
Satz und E-Book-Konvertierung: wayan-design.de
Druck und Bindung: siblog Gmbh, Körnerstraße 68, 04107 Leipzig Printed in Germany
ISBN: 978-3-96154-706-7 (Printausgabe)
ISBN: 978-3-96154-605-3 (E-Book)
Für Informationen wende dich an Ronin Hörverlag, Heusteg 47, 91056 Erlangen
www.ronin-hoerverlag.de
WAS NICHT VERGESSEN WURDE
Lisa Jewell
Auch von Lisa Jewell
Ralph's Party Thirtynothing One-Hit Wonder Vince & Joy
A Friend of the Family
31 Dream Street
The Truth About Melody Browne
After the Party
The Making of Us
Before I Met You
The House We Grew Up In
The Third Wife
The Girls
I Found You
Then She Was Gone
Watching You The Family Upstairs
Invisible Girl
The Night She Disappeared
Dieses Buch ist dem Andenken an Steve Simmonds gewidmet
Inhalt
WAS NICHT VERGESSEN WURDE
DIE FAMILIEN VOM CHEYNE WALK 16
Prolog
TEIL EINS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
TEIL ZWEI
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
TEIL DREI
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
TEIL VIER
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
TEIL FÜNF
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Epilog
Danksagung
DIE FAMILIEN VOM CHEYNE WALK 16
Die Lambs
Henry Lamb Senior und Martina Lamb.
Henry Lamb Jr., ihr Sohn, der sich auch Phineas Thomson nennt.
Lucy Lamb, ihre Tochter, ehemals verheiratet mit Michael Rimmer; Mutter von Libby, Marco und Stella.
Libby Jones, Lucys Tochter, früher Serenity Lamb; in einer Beziehung mit dem Journalisten Miller Roe.
Die Thomsens
David Thomsen und Sally Thomsen.
Clemency Thomsen, ihre Tochter, die jetzt in Cornwall lebt.
Phineas Thomsen, ihr Sohn, der auch Finn Thomsen genannt wird, lebt jetzt in Botswana.
Birdie Dunlop-Evers, Musikerin.
Justin Redding, der Freund von Birdie.
Prolog
Juni 2019 – Samuel
»Jason Mott?«
»Ja. Hier. Das bin ich.«
Ich starre auf den jungen Mann hinunter, der knöcheltief unter mir im Schlamm des Themseufers steht. Er hat sandfarbenes Haar, das in Vorhängen zu beiden Seiten eines weichen, sommersprossigen Gesichts herabhängt. Er trägt kniehohe Gummistiefel und eine khakifarbene Weste mit vielen Taschen und ist von einem Kreis gaffender Menschen umgeben. Ich gehe zu ihm und versuche, meine Schuhe vom Schlamm fernzuhalten.
»Guten Morgen«, sage ich. »Ich bin DI Samuel Owusu. Das ist Saffron Brown aus unserem Forensik-Team.«
Ich sehe, dass Jason Mott sich sehr bemüht, nicht so auszusehen, als wäre er aufgeregt, in der Gegenwart von zwei echten Polizisten zu sein – und scheitert.
»Ich habe gehört, Sie haben etwas gefunden. Vielleicht können Sie mir das erklären?«
Er nickt eifrig. »Ja. Also. Wie ich schon am Telefon sagte. Ich bin ein Mudlarking-Guide. Ein Profi. Und ich war heute Morgen mit meiner Gruppe hier draußen, und dieser junge Bursche hier«, er zeigt auf einen Jungen, der etwa zwölf Jahre alt scheint, »hat herumgestöbert und diese Tüte geöffnet.« Er zeigt auf eine schwarze Mülltüte, die auf den Kieseln liegt. »Ich meine, Regel Nummer eins beim Mudlarking ist: Nichts anfassen, aber die Tüte lag einfach da, als hätte sie jemand fallen lassen, also war es wohl okay, dass er sie öffnete.«
Obwohl ich keine Ahnung von den Regeln des Mudlarkings habe, werfe ich dem Jungen einen beruhigenden Blick zu, und er scheint erleichtert zu sein.
»Wie auch immer. Ich weiß es nicht, ich meine, ich bin kein Forensikexperte…« Jason Mott lächelt Saffron nervös an und ich sehe, wie er ein wenig errötet. »Aber ich fand, dass sie aussahen, als könnten sie, Sie wissen schon, menschliche Knochen sein.«
Ich taste mich über die Kieselsteine zu der Tüte vor und öffne sie etwas. Saffron folgt mir und späht über meine Schulter. Das Erste, was wir sehen, ist ein menschlicher Kieferknochen. Ich drehe mich um und schaue sie an. Sie nickt. Dann zieht sie ihre Handschuhe an und rollt eine Plastikfolie aus.
»Gut«, sage ich, stehe auf und blicke auf die Gruppe, die sich im Schlamm versammelt hat. »Wir müssen diesen Bereich räumen. Ich bitte Sie um Ihre Mithilfe.«
Einen Moment lang rührt sich niemand. Dann tritt Jason Mott in Aktion und schafft es, alle vom Strand weg und zurück ans Flussufer zu treiben, wo sie alle stehen und weiter gaffen. Ich sehe ein paar Handys aufblitzen und rufe: »Bitte. Nicht filmen. Dies ist eine sehr heikle Polizeiangelegenheit. Ich danke Ihnen.«
Die Handys verschwinden.
Jason Mott bleibt auf halber Höhe der Stufen zum Flussufer stehen und dreht sich zu mir um. »Sind sie…?«, beginnt er. »Sind sie menschlich?«
»Es hat den Anschein«, antworte ich. »Aber wir werden es nicht genau wissen, bis sie untersucht worden sind. Vielen Dank, Mr. Mott, für Ihre Hilfe.« Ich lächle freundlich und hoffe, dass er das als Signal wahrnimmt, sich mit Fragen zurückzuhalten und zu gehen. Saffron wendet sich wieder den Knochen zu und beginnt, sie aus dem Beutel zu nehmen und auf der Plastikfolie auszubreiten.
»Klein«, sagt sie. »Möglicherweise ein Kind. Oder ein kleiner Erwachsener.«
»Aber definitiv ein Mensch?«
»Ja, definitiv menschlich.«
Ich höre eine Stimme vom Flussufer herrufen. Es ist Jason Mott.
Ich seufze und wende mich ihm ruhig zu.
»Haben Sie eine Ahnung, wie alt sie sind?«, ruft er nach unten. »Nur vom Sehen?«
Saffron lächelt mich trocken an. Dann wendet sie sich an Jason. »Keine Ahnung. Geben Sie Ihre Daten dem PC beim Auto. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.«
»Danke. Vielen Dank. Das ist großartig.«
Einen Moment später zieht Saffron einen kleinen Schädel aus der schwarzen Tüte.
Sie dreht ihn auf der Plastikfolie um.
»Da«, sagt sie. »Schau. Siehst du das? Eine Haarrissfraktur.« Ich bücke mich. Und da ist sie. Die wahrscheinliche Todesursache.
Mein Blick schweift den Strand auf und ab und die Flussbiegung entlang, als ob der Mörder in diesem Moment mit dem Mordwerkzeug in der Hand davonlaufen könnte. Dann blicke ich wieder auf den winzigen aschgrauen Schädel und mein Herz füllt sich mit Traurigkeit und Entschlossenheit zugleich.
In diesem kleinen Sack mit Knochen steckt eine ganze Welt. Ich spüre, wie sich die Tür zu dieser Welt öffnet, und trete ein.
TEIL EINS
Kapitel 1
Juli 2018
Schlaftrunken starrte Rachel auf das Display ihres Handys. Eine französische Nummer. Das Handy rutschte ihr aus der Hand und fiel auf den Boden. Sie nahm es wieder auf und starrte mit großen Augen auf die Nummer, das Adrenalin schoss durch sie hindurch, obwohl es kaum sieben Uhr morgens war.
Schließlich drückte sie auf die Antworttaste. »Hallo?«
»Bonjour, guten Morgen. Hier ist Kommissarin Avril Loubet von der Police Municipale in Nizza. Sind Sie Mrs. Rachel Rimmer?«
»Ja«, antwortete sie. »Am Apparat.«
»Mrs. Rimmer. Ich fürchte, ich rufe Sie mit einer sehr bedrückenden Nachricht an. Bitte, sagen Sie mir. Sind Sie allein?«
»Ja. Ja, das bin ich.«
»Gibt es jemanden, den Sie bitten können, jetzt bei Ihnen zu sein?«
»Mein Vater. Er wohnt in der Nähe. Aber bitte. Sagen Sie es mir einfach.«
»Nun, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Leiche Ihres Mannes, Michael Rimmer, heute früh von seiner Haushaltshilfe im Keller seines Hauses in Antibes entdeckt wurde.«
Rachel entfuhr ein Geräusch; ein schweres Einatmen mit einem Zischen, wie ein Dampfzug. »Oh«, sagte sie. »Nein!«
»Es tut mir sehr leid. Aber ja. Und es sieht so aus, als wäre er vor einigen Tagen ermordet worden, durch eine Stichwunde. Er ist mindestens seit dem Wochenende tot.«
Rachel setzte sich aufrecht hin und hielt das Handy an ihr anderes Ohr. »Ist es – wissen Sie warum? Oder wer?«
»Die Tatortbeamten sind vor Ort. Wir werden jedes Beweisstück, das wir finden können, freilegen. Aber es scheint, dass Mr. Rimmers Überwachungskamera nicht lief und seine Hintertür unverschlossen war. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt nichts Genaueres sagen kann, Mrs. Rimmer. Es tut mir wirklich sehr leid.«
Rachel schaltete ihr Handy aus und ließ es auf ihren Schoß fallen.
Sie starrte einen Moment lang ausdruckslos zum Fenster, wo die Sommersonne sich durch die Schlitze der Jalousie zwängte. Sie seufzte schwer. Dann zog sie ihre Schlafmaske herunter, drehte sich auf die Seite und schlief wieder ein.
Kapitel 2
Juni 2019
Ich bin Henry Lamb. Ich bin zweiundvierzig Jahre alt. Ich wohne in der besten Wohnung eines hübschen Art-Déco-Blocks gleich um die Ecke der Harley Street. Woher weiß ich, dass es die beste Wohnung ist? Weil der Portier es mir gesagt hat. Wenn er ein Paket hochbringt – er muss keine Pakete hochbringen, aber er ist neugierig, also tut er es – schaut er mir über die Schulter und seine Augen leuchten angesichts des Ausschnitts meiner Inneneinrichtung, den er von meiner Haustür aus sehen kann. Ich habe einen Designer beauftragt. Ich habe einen exquisiten Geschmack, aber ich weiß einfach nicht, wie man geschmackvolle Dinge visuell harmonisch zusammenstellt. Nein. Ich bin nicht gut darin, visuelle Harmonie zu schaffen. Das ist in Ordnung. Ich bin in vielen anderen Dingen gut.
Ich lebe derzeit – ganz ausdrücklich – nicht allein. Ich dachte immer, ich wäre einsam, bevor sie kamen. Ich kehrte nach Hause zurück in meine makellose, teuer renovierte Wohnung, zu meinen schmollenden Perserkatzen, und ich dachte: Oh, es wäre so schön, jemanden zu haben, mit dem ich über meinen Tag reden könnte. Oder es wäre so schön, wenn jemand in der Küche stünde und mir ein leckeres Essen zubereiten würde, den Deckel von einer kalten Flasche abschrauben würde oder, noch besser, mir etwas in einem Cocktailglas mischen würde. Ich habe mich lange Zeit sehr selbst bemitleidet. Aber seit gut einem Jahr habe ich Hausgäste – meine Schwester Lucy und ihre beiden Kinder – und bin nie allein. Ständig sind Leute in meiner Küche, aber sie mixen mir keine Cocktails oder schälen Austern, sie fragen mich nicht nach meinem Tag. Sie benutzen meinen Panini-Maker, um das zu machen, was sie Toasties nennen, sie kochen heiße Schokolade im falschen Topf, sie werfen nicht recycelbare Abfälle in meine Recycling-Tonne und umgekehrt. Sie schauen laute, unverständliche Sachen auf den Handys, die ich ihnen gekauft habe, und schreien sich gegenseitig an, obwohl es wirklich nicht nötig ist. Und dann ist da noch der Hund. Ein Jack-Russell-Terrier, den meine Schwester vor fünf Jahren auf den Straßen von Nizza gefunden hat, als sie in Mülltonnen stöberte. Er heißt Fitz und er liebt mich. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich bin ja auch eigentlich ein Hundemensch und habe mir die Katzen nur zugelegt, weil sie für selbstsüchtige Menschen leichter zu versorgen sind. Ich habe online einen Test gemacht – welche ist Ihre ideale Katzenrasse? – dreißig Fragen beantwortet, und das Ergebnis lautete: Perserkatze. Ich glaube, der Test war richtig. Als Kind hatte ich nur eine einzige Katze gekannt, ein bösartiges Wesen mit scharfen Krallen. Aber diese Perserkatzen sind eine ganz andere Welt. Sie verlangen, dass man sie liebt. Man hat keine andere Wahl. Aber sie mögen Fitz, den Hund, nicht und sie mögen nicht, dass ich Fitz, den Hund, mag, und die Atmosphäre zwischen den Tieren ist entsetzlich.
Meine Schwester zog letztes Jahr aus Gründen ein, die ich kaum zu beschreiben vermag. Die einfache Version ist, dass sie obdachlos war.
Für die kompliziertere Version müsste ich einen Aufsatz schreiben. Die halbkomplizierte Version lautet: Als ich zehn Jahre alt war, wurde unser (sehr großes) Elternhaus von einem sadistischen Betrüger und seiner Familie infiltriert. Im Laufe von mehr als fünf Jahren übernahm der Betrüger die Kontrolle über den Verstand meiner Eltern und beraubte sie systematisch ihres gesamten Besitzes. Er benutzte unser Haus als sein persönliches Gefängnis und seinen Spielplatz und war rücksichtslos in seinen Bestrebungen, von allen in seiner Umgebung genau das zu bekommen, was er wollte, einschließlich seiner eigenen Frau und seiner Kinder. In jenen Jahren geschahen zahllose unaussprechliche Dinge. Darunter etwa, dass meine Schwester mit dreizehn schwanger wurde, mit vierzehn ein Kind bekam und mit fünfzehn ihr zehn Monate altes Baby in London zurückließ und nach Südfrankreich floh. Sie bekam zwei weitere Kinder von zwei weiteren Männern, ernährte und kleidete sie mit Geld, das sie als Straßenmusikerin in Nizza verdiente, schlief ein paar Nächte auf der Straße und beschloss dann, nach Hause zu kommen, als sie (neben vielen anderen Dingen) spürte, dass sie eine große Erbschaft aus einem Treuhandfond erhalten könnte, den unsere Eltern eingerichtet hatten, als wir noch Kinder waren.
Die gute Nachricht ist, dass der Treuhandfond letzte Woche endlich ausgezahlt wurde, und jetzt – eine Trompetenfanfare wäre hier vielleicht angebracht – sind sie und ich beide Millionäre, was bedeutet, dass sie sich ein eigenes Haus kaufen und mit ihren Kindern und ihrem Hund ausziehen kann, und dass ich wieder allein sein werde.
Und dann werde ich mich der nächsten Phase meines Lebens stellen müssen.
Zweiundvierzig ist ein seltsames Alter. Weder jung noch alt. Wenn ich heterosexuell wäre, würde ich jetzt vermutlich verzweifelt versuchen, in letzter Minute eine Frau mit funktionierenden Eierstöcken zu finden. Da ich aber nicht heterosexuell bin und auch nicht zu der Sorte Mann gehöre, mit der andere Männer eine lange und bedeutungsvolle Beziehung eingehen wollen, lässt mich das in der denkbar schlechtesten Position zurück – ein nicht liebenswerter schwuler Mann mit verwelktem Aussehen.
Töte mich jetzt.
Aber es gibt einen Schimmer von etwas Neuem. Das Geld ist schön, aber das Geld ist nicht das, was schimmert. Das, was schimmert, ist ein verlorenes Puzzlestück aus meiner Vergangenheit. Ein Mann, den ich liebe, seit wir beide Jungen in meinem Horrorhaus der Kindheit waren. Ein Mann, der jetzt dreiundvierzig Jahre alt ist, einen ziemlich ungepflegten Bart und tiefe Lachfalten im Gesicht hat und als Wildhüter in Botswana arbeitet. Ein Mann, der – Überraschung – der Sohn des Betrügers ist, der meine Kindheit ruiniert hat. Und auch – zweiter Handlungsstrang – der Vater meiner Nichte, Libby. Ja, Phineas hat Lucy geschwängert, als er sechzehn und sie dreizehn war, und ja, das ist in vielerlei Hinsicht falsch, und man könnte meinen, dass mich das von ihm abschrecken würde, und eine Zeit lang tat es das auch. Aber wir haben uns alle in diesem Haus schlecht benommen, keiner von uns ist ohne einen blauen Fleck davongekommen. Ich habe gelernt, unsere Sünden als Überlebensstrategien zu akzeptieren.
Ich habe Phineas Thomsen nicht mehr gesehen, seit ich sechzehn und er achtzehn Jahre alt war. Aber letzte Woche, auf der Geburtstagsfeier meiner Nichte, erzählte uns der Freund meiner Nichte, ein Enthüllungsjournalist, dass er ihn für sie aufgespürt hatte. Eine Art emotionales Geburtstagsgeschenk für seine Freundin. Schau, ich habe deinen lang vermissten Vater ans Licht gezerrt!
Und nun sitze ich hier, an einem strahlenden Mittwochmorgen im Juni, zurückgezogen in der Stille meines Schlafzimmers, den Laptop aufgeklappt, meine Finger streicheln das Touchpad und führen den Cursor sanft über die Website des Wildreservats, in dem er arbeitet. Das Wildreservat, das ich sehr, sehr bald besuchen werde.
Phin Thomsen, so kannte ich ihn, als wir als Kinder zusammenwohnten.
Finn Thomsen ist das Pseudonym, hinter dem er sich all die Jahre versteckt hat.
Ich war so nah dran. Ein F für ein Ph. All die Jahre hätte ich ihn finden können, wenn ich nur daran gedacht hätte, mit dem Alphabet herumzuspielen. Wie klug von ihm. So schlau. Phin war immer der klügste Mensch, den ich kannte. Na ja, abgesehen von mir natürlich.
Ich zucke zusammen, als es leise an meiner Zimmertür klopft.
Ich seufze. »Ja?«
»Henry, ich bin's. Darf ich reinkommen?«
Es ist meine Schwester. Ich seufze erneut und klappe meinen Laptop zu. »Ja, sicher.«
Sie öffnet die Tür gerade so weit, dass sie hindurchschlüpfen kann, und schließt sie dann vorsichtig hinter sich.
Lucy ist eine gutaussehende Frau. Als ich sie letztes Jahr zum ersten Mal seit Teenagertagen sah, war ich überrascht, wie schön sie ist. Sie hat ein Gesicht, das Geschichten erzählt, sie sieht aus wie vierzig, sie pflegt sich kaum, sie kleidet sich wie ein Eimer voller Lumpen, aber irgendwie sieht sie trotzdem immer schöner aus als jede andere Frau im Raum. Es ist etwas an dem Zusammenspiel ihrer bernsteinfarbenen Augen mit den schmutzig-goldenen Strähnen in ihrem Haar, an ihrer Schwerelosigkeit, an der honigsüßen Stimme, an der Art, wie sie sich bewegt und hält und Dinge berührt und einen ansieht. Mein Vater sah aus wie eine Schweinefleischpastete auf Beinen, und meine glückliche Schwester hat alle Blicke von unserer eleganten halbtürkischen Mutter abgelenkt und auf sich gezogen. Ich bin irgendwo zwischen den beiden Lagern gelandet. Glücklicherweise habe ich den Körperbau meiner Mutter, aber leider mehr als einen gerechten Anteil der groben Gesichtszüge meines Vaters. Ich habe mein Bestes getan mit dem, was die Natur mir gegeben hat. Mit Geld kann man keine Liebe kaufen, aber man kann einen gemeißelten Kiefer, perfekt ausgerichtete Zähne und aufgeplusterte Lippen erstehen.
Mein Schlafzimmer ist erfüllt vom Duft des Öls, das meine Schwester für ihr Haar verwendet. Es stammt aus einer braunen Glasflasche, die aussieht, als hätte sie sie auf einem Bauernmarkt gekauft.
»Ich wollte mit dir reden«, sagt sie und schiebt eine Hose von einem Stuhl in der Ecke meines Zimmers, damit sie sich setzen kann. »Wegen letzter Woche, bei Libbys Geburtstagsessen?«
Ich fixiere sie mit ihrem Ja, ich höre zu, bitte fahre fort-Blick.
»Was du zu Libby und Miller gesagt hast…«
Libby ist die Tochter, die Lucy mit Phin hatte, als sie vierzehn war. Miller ist Libbys Freund, der Journalist. Ich nicke.
»Dass du mit ihnen nach Botswana gehst.«
Ich nicke wieder. Ich weiß, was jetzt kommt.
»War das dein Ernst?«
»Ja. Natürlich war ich das.«
»Hältst du es für eine gute Idee?«
»Ja, ich halte es für eine wunderbare Idee. Warum sollte ich nicht?«
»Ich weiß nicht. Ich meine, es sollte ein romantischer Urlaub sein, nur für die beiden…«
Ich schmunzle. »Er sprach davon, seine Mutter mitzunehmen. So romantisch kann das nicht gemeint gewesen sein.«
Natürlich rede ich Blödsinn, aber ich fühle mich in der Defensive. Miller will Libby nach Botswana bringen, um sie mit dem Vater wiederzuvereinen, den sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hat. Aber Phin ist auch ein Teil von mir. Nicht nur ein Teil von mir, sondern fast alles von mir. Ich habe buchstäblich (und ich verwende das Wort buchstäblich hier im wahrsten Sinne des Wortes) mindestens einmal pro Stunde an Phin gedacht, jede Stunde, seit ich sechzehn Jahre alt bin. Wie könnte ich jetzt nicht zu ihm gehen wollen, genau jetzt?
»Ich werde ihnen nicht in die Quere kommen«, biete ich an. »Ich werde sie ihr eigenes Ding machen lassen.«
»Richtig«, sagt Lucy , immer noch zweifelnd. »Und was wirst du tun?«
»Ich werde…« Ich halte inne. Was werde ich tun? Ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach bei Phin sein.
Und danach – nun, wir werden sehen, nicht wahr?
Kapitel 3
August 2016
Rachel lernte Michael im Spätsommer 2016 in einer Apotheke in Martha's Vineyard kennen. Sie wartete auf ein Rezept für die Pille danach, das ihr von einem sehr jungen und etwas voreingenommenen Mann ausgestellt werden sollte. Michael ging vor ihr her und begrüßte den Apotheker mit einem forschen: »Ist es schon fertig?«
Der voreingenommene Apotheker blinzelte langsam und sagte: »Nein, Sir, das ist es nicht. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Es dauert nicht mehr lange.«
Michael setzte sich auf den Platz neben Rachel. Er verschränkte die Arme und seufzte. Sie konnte spüren, dass er mit ihr reden wollte, und dieses Gefühl bestätigte sich.
»Dieser Kerl«, murmelte er, »ist einfach eine Wonne«.
Sie lachte und drehte sich um, um ihn zu betrachten. Um die vierzig, in ihren Augen aber eher dreißig. Gebräunt, natürlich. Am Ende eines langen Martha's Vineyard Sommers gab es niemanden mehr, der nicht gebräunt war. Ein Haarschnitt war allerdings mal wieder fällig. Wahrscheinlich wartete er, bis er wieder in der Stadt war.
»Er ist ein wenig voreingenommen«, antwortete sie leise flüsternd. »Ja«, stimmte er zu, »ja. Seltsam, bei einem so jungen Mann.«
Rachel war sich damals des gerade erst abgeduschten Schweißes eines Jungen namens Aiden bewusst gewesen, der noch immer an ihrer Haut klebte. Die empfindlichen Stellen an ihren Oberschenkelinnenseiten, wo sich seine Hüftknochen in ihr Fleisch gebohrt hatten, der zuckrige Geruch seines Bieratems, der sich in den Winkeln und Spalten ihres Körpers festgesetzt hatte. Und jetzt war sie hier und flirtete mit einem Mann, der alt genug war, um Aidens Vater zu sein, während sie auf eine Notfallverhütung wartete.
Für Rachel war es jetzt wirklich Zeit, nach Hause zu gehen. Der Sommer war verzweifelt und schmutzig gewesen, und sie war verbraucht und erschöpft.
Der Apotheker zog eine Papiertüte aus einer Halterung auf dem Karussell hinter ihm und schaute auf das Etikett. »Miss Rachel Gold?«, rief er. »Ich habe Ihr Rezept.«
»Oh.« Sie lächelte Michael an. »Das bin ich. Ich hoffe, du musst nicht zu lange warten.«
»Vordränglerin«, sagte Michael mit einem sardonischen Lächeln.
Sie tippte ihre PIN in das Kartenlesegerät ein und nahm die Tüte aus der Hand des Apothekers. Als sie sich umdrehte, um zu gehen, sah Michael sie immer noch an.
»Woher kommst du?«, fragte er.
»England.«
»Ja, natürlich, aber wo in England?«
»London.«
»Und wo in London?«
»Kennst du London?«
»Ich habe eine Wohnung in Fulham.«
»Oh«, sagte sie. »Ok. Ich wohne in Camden Town.«
»Wo?«
»Ähm.« Sie lachte.
»Entschuldigung. Ich bin ein Anglophiler. Ich bin besessen von diesem Ort. Keine weiteren Fragen. Ich halte dich nicht weiter auf, Rachel Gold.«
Sie hob ihre andere Hand zum vagen Abschied und ging schnell durch den Laden, durch die Tür und auf die Straße.
Zwei Monate später aß Rachel an ihrem Schreibtisch im Atelier zu Mittag, als in ihrem Posteingang eine E-Mail mit dem Titel Vom amerikanischen Anglophilen zur englischen Vordränglerin erschien.
Sie brauchte ein oder zwei Sekunden, um die scheinbar unzusammenhängenden Wörter zu entschlüsseln. Dann öffnete sie die E-Mail:
Hallo Rachel Gold,
Hier ist Michael. Wir haben uns im August in einer Apotheke in Martha's Vineyard getroffen. Du hast nach Holzrauch und Bier gerochen. Auf eine gute Art. Ich werde ein paar Monate in London bleiben und wollte wissen, ob du mir einen Ort in Camden empfehlen kannst, den ich erkunden kann. Ich war seit meiner Teenagerzeit nicht mehr in der Gegend – ich wollte Haschisch kaufen und habe stattdessen einen gestreiften Rucksack und eine Bong gekauft. Ich bin mir aber sicher, dass der Ort mehr zu bieten hat als den Markt und die Drogendealer, und ich würde mich über eine Insiderin freuen, die ihre Sicht der Dinge schildert. Wenn du beim Erscheinen dieses Schreibens in deinem Posteingang entsetzt aufschreckst, lösche es bitte, ignoriere es oder rufe die Polizei (Nein, rufe nicht die Polizei!). Aber ansonsten würde ich mich freuen, von dir zu hören. Und meine leicht überspitzte Kenntnis der Londoner Postleitzahlen hat mich übrigens zu deiner E-Mail-Adresse geführt. Ich habe ‚Rachel Gold‘ gegoogelt, dann ‚NW1‘, und da tauchtest du auf deiner Website auf. Wie treffend, dass eine Schmuckdesignerin den Nachnamen Gold trägt. Wenn mein Nachname nur Diamond wäre, wären wir das perfekte Paar. So aber heiße ich Rimmer. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Wie auch immer, ich werde von dir hören, wenn ich von dir höre, und wenn nicht, werde ich etwas von deiner Website kaufen und es meiner Mutter zum Geburtstag schenken. Du bist sehr, sehr talentiert.
Mit freundlichen Grüßen, Michael xo
Rachel saß einen Moment lang mit angehaltenem Atem da und überlegte, ob sie lächeln oder eine Grimasse schneiden sollte. Sie rief sich das Gesicht des Mannes wieder ins Gedächtnis, aber sie konnte es nicht ganz zuordnen. Das Gesicht von Michael C. Hall tauchte immer wieder auf und verschwamm. Am Ende seiner E-Mail stand jedoch ein Firmenname. MCR International. Sie googelte danach und fand eine anonyme Website für eine Art Logistik-/Transportunternehmen mit einer Adresse in Antibes in Südfrankreich. Sie googelte Michael Rimmer Antibes und fand ihn schließlich auf einer Website für Lokalnachrichten, wo er auf einer Party zur Eröffnung eines neuen Restaurants eine Champagnerflöte hielt. Sie vergrößerte sein Gesicht und starrte es eine Weile auf ihrem Bildschirm an. Er sah nicht aus wie Michael C. Hall. Er sah … einfach gut aus – so würde sie es beschreiben. Einfach gutaussehend.
Aber die Art und Weise, wie sein weißes T-Shirt auf den Bund einer blauen Jeans traf, hatte etwas Sexuelles. Nicht in die Hose gesteckt. Nicht heruntergezogen. Sie streiften nur die Ränder des jeweils anderen. Eine Art von Einladung. Sie fand es überraschend und plötzlich erregend, und als ihr Blick wieder auf sein Gesicht fiel, sah er mehr als nur gut aus. Er sah hart aus. Fast grausam. Aber das machte Rachel bei einem Mann nichts aus. Es konnte zu ihren Gunsten wirken, wenn sie es wollte.
Sie schloss ihre E-Mails wieder. Sie würde antworten. Sie würde sich mit ihm treffen. Sie würde Sex mit ihm haben. All das wusste sie. Aber jetzt noch nicht. Sie würde ihn noch eine Weile warten lassen. Sie hatte es schließlich nicht eilig.
Kapitel 4
Juni 2019
Am nächsten Morgen gehe ich joggen. Ich muss ehrlich sein und sagen, dass ich wirklich nicht gerne laufe. Aber ich mag es auch nicht, ins Fitnessstudio zu gehen und all die perfekten Jungs zu sehen, die nicht einmal einen Blick in meine Richtung werfen. Früher war das Fitnessstudio mein Spielplatz, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ziehe ich mich an, halte den Blick gesenkt, beiße die Zähne zusammen, bis ich diese beruhigende, befriedigende Verbindung zwischen meinen Füßen, dem Boden, meinen Gedanken und dem Takt der Musik in meinen Ohren spüre, und das tue ich so lange, bis ich eine ganze Runde durch den Regent's Park gedreht habe. Dann gehört der Tag mir.
Aber heute klappt es nicht. Mein Atem rattert durch meine Lungen und ich möchte immer wieder anhalten, mich hinsetzen. Es fühlt sich falsch an. Alles fühlt sich falsch an, seit ich herausgefunden habe, dass Phin noch existiert.
Meine Füße setzen so hart auf dem Asphalt auf, dass ich dessen Unebenheiten durch die Sohlen meiner Turnschuhe fast spüren kann. Plötzlich taucht die Sonne durch einen weichen Vorhang aus Juniwolken auf und versengt meine Sicht. Ich ziehe meine Sonnenbrille auf und höre endlich auf zu laufen.
Ich habe mich verirrt. Und nur Phin kann mich zurückführen.
Ich rufe Libby an, als ich nach Hause komme.
Die reizende Libby. »Hallo, du!«
Sie ist genau die Art von Mensch, die Hallo, du sagt. Ich erwidere es so ausgiebig, wie es mir möglich ist. »Hallo, du!«
»Was gibt's Neues?«
»Neu? Oh, eigentlich nichts. Ich war nur joggen. Und duschen. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was wir neulich bei deinem Geburtstagsessen besprochen haben.«
»Die Safari?«
»Ja, die Safari. Lucy sagt, ich soll nicht mitkommen.«
»Oh. Warum?«
»Sie glaubt, dass du und Miller eine romantische Auszeit nur für euch beide wollt.«
»Oh, nein, Unsinn. Natürlich kannst du kommen, gerne sogar. Aber wir sind auf ein Problem gestoßen.«
»Ein Problem?«
»Ja. Miller rief neulich in der Lodge an, um sich nach einer zusätzlichen Person zu erkundigen, und offenbar hat Phin…« Sie hält inne.
»Ja?«
»Er ist weg.«
Ich setze mich schwer auf den nächstgelegenen Stuhl, mein Kiefer hängt schlaff herunter. »Weg?«
»Ja. Er sagte, er habe einen Notfall in der Familie und wisse nicht, wann er zurück sein würde.«
»Aber …« Ich halte inne. Ich bin wütend. Libbys Freund Miller ist ein angesehener Enthüllungsjournalist. Er hat ein Jahr seines Lebens damit verbracht, Phin aufzuspüren (nicht für mich, versteht sich, sondern für Libby), und dann, fünf Sekunden nachdem es ihm endlich gelungen ist, hat Miller offensichtlich etwas völlig Dummes getan, was dazu geführt hat, dass Phin die Flucht ergriffen hat. Das journalistische Äquivalent dazu, bei einer Hirschjagd auf einen Zweig zu treten.
»Ich verstehe das nicht«, sage ich und versuche, ruhig zu klingen. »Was ist schiefgelaufen?«
Libby seufzt und ich stelle mir vor, wie sie die Spitzen ihrer Wimpern berührt, wie sie es oft tut, wenn sie redet. »Wir wissen es nicht. Miller hätte nicht diskreter sein können, als er die Buchung vornahm. Das Einzige, was wir für möglich halten, ist, dass Phin meinen Namen irgendwie wiedererkannt hat. Wir nahmen an, dass er mich nur unter meinem Geburtsnamen kennen würde. Aber vielleicht kennt er auch meinen Adoptivnamen. Irgendwie.«
»Ich gehe natürlich davon aus, dass Miller seine Buchungen unter einem Pseudonym vorgenommen hat.«
Es herrscht eine kurze Stille. Ich seufze und fahre mir mit der Hand durch mein nasses Haar. »Er muss es doch getan haben, oder?«
»Ich weiß es nicht. Ich meine, warum sollte er das müssen?«
»Weil er einen fünftausend Wörter langen Artikel über unsere Familie geschrieben hat, der erst vor vier Jahren in einem großen Magazin erschienen ist. Und vielleicht tut Phin mehr, als nur auf Jeeps zu sitzen und herrlich auszusehen. Vielleicht benutzt er ja auch das Internet?« Ich halte mir den Mund zu. Böse, böse, böse. Sei nicht böse zu Libby. »Tut mir leid«, sage ich. »Tut mir leid. Es ist einfach nur frustrierend. Das ist alles. Ich dachte nur…«
»Ich weiß«, sagt sie. »Ich weiß.«
Aber sie weiß es nicht. Sie weiß es überhaupt nicht.
»Also«, sage ich, »was hast du vor zu tun? Wollt ihr immer noch gehen?«
»Ich weiß nicht«, antwortet sie. »Wir denken darüber nach. Wir könnten es verschieben.«
»Oder ihr könntet…«, beginne ich, als mir eine mögliche Lösung in den Kopf kommt, »… herausfinden, wo er hingegangen ist?«
»Ja. Miller arbeitet ein bisschen an dem Typen mit den Reservierungen herum. Mal sehen, was er ihm entlocken kann. Aber anscheinend weiß dort niemand wirklich viel über Phin Thomsen.«
Ich schließe das Gespräch ab. Dinge, die ich nicht mit Libby besprechen kann, schwirren zerstreut durch meinen Kopf, und ich brauche Ruhe, um sie Gestalt annehmen zu lassen.
Ich besuche erneut die Website von Phins Wildreservat. Es ist ein sehr angesehenes Wildreservat. International bekannt. Unanfechtbare ökologische und soziale Referenzen. Phin würde natürlich nur an einem solchen Ort arbeiten.
Als er fünfzehn Jahre alt war, sagte er mir, dass er eines Tages Safari-Guide werden wolle. Ich habe keine Ahnung, welchen Weg er aus dem Haus des Schreckens, in dem wir aufgewachsen sind, genommen hat, um dorthin zu gelangen, aber er hat es geschafft. Wollte ich damals, als ich noch ein Kind war, der Gründungspartner eines trendigen Unternehmens für Softwaredesignlösungen sein? Nein, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte alles werden, was das Leben mir zuwarf. Ich wollte das sein, was ich sein würde, nachdem ich all die normalen Dinge getan hatte, die Menschen tun, die nicht in einem Horrorhaus aufgewachsen sind und dann ihr junges Erwachsenenalter damit verbracht haben, allein in einem Wohnheim zu leben, ohne akademische Qualifikationen, ohne Freunde und ohne Familie. So etwas wollte ich sein. Aber in der Geschichte, die dieses sich drehende Rolodex des endlosen und unendlichen Universum mir gegeben hat, bin ich hier, und ich sollte froh und dankbar sein. Und in gewisser Weise bin ich das auch. Ich schätze, in einem anderen dieser Universen hätte ich vielleicht, wie mein Vater vor mir, dagesessen und wäre fett geworden, während ich darauf wartete, dass meine Eltern starben, damit ich mein Erbe antreten konnte. Ich hätte ein Leben voller Langeweile und Trägheit führen können. Aber ich hatte keine andere Wahl, als zu arbeiten, und ich habe mein Leben erfolgreich gemeistert, und ich denke, das ist doch eine gute Sache, oder?
Aber Phin, natürlich, Phin wusste schon damals, was er wollte. Er wartete nicht darauf, vom Universum geformt zu werden. Er formte das Universum nach seinem Willen.
Ich mache mich auf den Weg zur Arbeit und stelle fest, dass ich während einer Telefonkonferenz und zwei Besprechungen immer noch unkonzentriert bin. Ich schnauze Leute an, die ich noch nie angeschnauzt habe, und spüre dann erst den Selbsthass in mir. Als ich an diesem Abend um sieben nach Hause komme, sitzt mein Neffe Marco mit einem Schulfreund auf dem Sofa, einem netten Jungen, den ich schon einmal getroffen habe und gegenüber dem ich mich nett zu sein bemüht habe. Er steht auf, als ich reinkomme, und sagt: »Hallo Henry, Marco hat gesagt, es ist okay, wenn ich komme. Ich hoffe, es macht dir nichts aus.« Sein Name ist Alf und er ist reizend. Aber im Moment will ich ihn nicht auf meinem Sofa haben, und ich schenke ihm nicht einmal ein Lächeln. Ich grunze: »Bitte sagt mir, dass ihr nicht vorhabt zu kochen?«
Alf wirft Marco einen unsicheren Blick zu, dann schütteln sie beide den Kopf. »Nein«, sagt Alf, »nein, wir wollten nur abhängen.«
Ich nicke knapp und gehe in mein Zimmer.
Ich weiß, was ich tun werde. Und ich muss wirklich etwas tun, sonst explodiere ich. Ich kann nicht herumsitzen und darauf warten, dass der schwerfällige Miller Roe die Sache in Ordnung bringt. Ich muss es selbst in Ordnung bringen.
Ich gehe auf Booking.com und buche mir einen viertägigen All-inclusive-Aufenthalt in der Chobe Game Lodge in Botswana.
Für eine Person.
Kapitel 5
Oktober 2016
Mit ihren zweiunddreißig Jahren versuchte Rachel, sich nicht zu sehr mit der Tatsache zu befassen, dass ihre gesamte erwachsene Existenz eine Illusion war. Ihre Wohnung gehörte ihrem Vater, der auch ihr Geschäft finanzierte. Es hatte sich so allmählich entwickelt, dieses Vertrauen auf die Bewunderung und das Wohlwollen ihres Vaters, dass sie gar nicht bemerkt hatte, wie es von etwas, das Eltern tun, um ihren Kindern den Start ins Leben zu erleichtern, zu etwas gekippt war, über das zu sprechen ihr zu peinlich war. Ihr Schmuckgeschäft brachte zwar Geld ein, war aber noch nicht profitabel. Sie konnte sich einmal im Monat vormachen, dass sie Gewinn machte – wenn ihr Taschengeld eintraf und ihre Konten von rot auf schwarz umstellte. Aber in Wirklichkeit war sie noch mindestens ein Jahr davon entfernt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und selbst dann würde es davon abhängen, ob alles gut lief und nichts schiefging. In sechs Monaten würde sie dreiunddreißig sein, längst vergangen das Alter, von dem sie glaubte, dass es mit der Unabhängigkeit von ihrem Vater einherginge.
Aber für den objektiven Betrachter machte Rachel Gold eine beeindruckende Figur: 1,70 m groß, sportlich, gepflegt, dezent unnahbar. Sie sah aus wie eine Selfmade-Frau. Eine Frau, die ihre Hypothek selbst abbezahlt, ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio selbst bezahlt und ein eigenes Uber-Konto hat.
An einem Freitagabend Ende Oktober, eine Woche nach der unerwarteten E-Mail des Amerikaners, auf die sie immer noch nicht geantwortet hatte, ging Rachel nach der Arbeit mit der Frau aus dem Studio nebenan in ihrem Wohnkomplex an der Grenze zwischen West Hampstead und Kilburn etwas trinken. Paige war dreiundzwanzig und wohnte noch bei ihrer Mutter, verdiente aber ihr eigenes Geld, genug, um ihrer Mutter etwas Miete zu zahlen, genug, um ihre eigenen Ferien und ihre eigenen Drinks und ihr eigenes Augenbrauenfärben zu bezahlen. Paige stellte Schmuck aus unedlen Metallen her, im Gegensatz zu Rachel, die Gold und Platin verwendete. Paige lebte unter ihren Möglichkeiten und sparte. Sie hatte die Kunstschule erst vor zwei Jahren verlassen, aber sie war schon erwachsener als Rachel.
In der Kneipe holte Rachel die erste Runde: eine Flasche Pinot Grigio. Auf der Terrasse gab es Heizstrahler, also tranken sie ihn draußen, mit Decken über den Knien. Rachel fragte Paige über ihr Liebesleben aus. Paige sagte: »Nil. Nada. Null. Nix. Und du?«
»Ein Mann«, begann Rachel zunächst zögernd und dann mit der unbestimmten Gewissheit, dass dies ein Gespräch war, das sie führen musste. »Ich habe ihn diesen Sommer in den Staaten kennengelernt, dann hat er mich im Internet verfolgt und mich über meine Website angeschrieben. Er sagte, er würde für ein paar Monate in London sein und wolle sich mit mir treffen. Ich habe irgendwie…« Sie stellte die Weinflasche in die Kühlbox.
»Ich kann irgendwie nicht aufhören, an ihn zu denken. Zuerst dachte ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen unheimlich. Er ist ja auch schon älter.«
»Gott. Wie viel älter?«
»Vielleicht zehn Jahre? Anfang vierzig, würde ich sagen. Hier.« Sie drehte ihr Handy zu Paige hin und zeigte ihr das Foto von Michael Rimmer, das sie in ihrer Fotogalerie gespeichert hatte.
»Heiß.«
»Glaubst du?«
»Ja, auf diese Weise. Verstehst du?«
»Auf welche Weise?« Sie kniff die Augen zusammen und wollte nicht, dass Paige ihre eigenen seltsamen Gedanken über diesen unerwarteten Mann wiederholte. »Sieht aus, als würde er dich hart ficken. Und dann liegt er da, splitternackt, mit den Armen hinter dem Kopf und bittet dich, ihm einen Drink zu holen.«
»Scheiße.« Sie riss Paige das Handy aus der Hand.
»Was, du weißt schon, eine gute Sache sein könnte? Ja?«
»Gott. Ich weiß nicht so recht. Ja, vielleicht. Aber nein. Im Guten wie im Schlechten, schätze ich. Ich werde nächstes Jahr dreiunddreißig. Ist es das, was ich will?«
»Ich weiß nicht – sag du es mir?« Paige schaute sie fragend an, eine Herausforderung in ihrem Blick.
»Nein. Nein. Ich meine, ja. Zum Spaß. Aber nicht für die Ehe, Babys und all das.«
»Ist es das, was du willst?«
»Nein, nicht wirklich, aber vielleicht will ich es und ich möchte nicht mit einem Mann zusammen sein, der sich nicht kümmert, oder? Man braucht einen Mann, der sich um die Kinder kümmert, wenn man Babys macht. Und dieser Typ«, sie warf wieder einen Blick auf Michael Rimmer, der in einem schäbigen Restaurant an der Côte d'Azur sein Champagnerglas umklammerte, »sieht nicht wie ein Versorger aus.«
»Nun«, sagte Paige. »Wenn du noch nicht bereit für Babys und die Ehe bist, warum nimmst du ihn nicht einfach als deinen letzten, der nicht der Richtige ist. Er ist nur für ein paar Monate in London. Nimm ihn einfach.«
Eine Welle nervöser Energie durchfuhr Rachel bei Paiges Vorschlag. Sie hatte gerade Rachels eigene Gedanken in Worte gefasst.
»Ja«, sagte sie. »Ja. Vielleicht werde ich das.«
Kapitel 6
Juni 2019
Lucy geht auf einen jungen Mann in einem engen grauen Anzug zu, der einen Ordner in der Hand hält. Sie streckt ihm die Hand entgegen und er schüttelt sie.
»Max Blackwood«, sagt er. »Sie müssen Lucy sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Haben Sie es gut gefunden?«
»Auf jeden Fall«, antwortet sie, »ich habe es einfach in Google Maps eingegeben. Heutzutage ist es leicht, sich zurechtzufinden, nicht wahr?«
»Sehr richtig«, antwortet er und erzählt ihr dann Geschichten von Google Maps, bei denen sich Leute verirrten und in Sackgassen, auf Schafsweiden und in die Gärten anderer Leute geführt wurden. Während er erzählt, gehen sie langsam auf das Haus zu. Lucy versucht, sich ihre Ehrfurcht und Aufregung nicht anmerken zu lassen. Sie trägt Kleider, die Henry, ihr Bruder, für sie ausgesucht hat. Er sagte: »Wenn man sich Millionenhäuser ansieht, muss man aussehen, als hätte man eine Million.«
Er hatte sie die Marylebone High Street rauf und runter geschleppt, war mit ihr in trendigen französischen Boutiquen ein- und ausgegangen und hatte sie dazu gebracht, sich eine Hausgarderobe aus weichen T-Shirts, maßgeschneiderten Hosen, ausladenden Maxikleidern, Blazern und strahlend weißen Turnschuhen mit Metallic-Muster zu kaufen. Dann steckte er sie für drei Stunden in einen Friseursalon zu einem Mann namens Jed, der ihr acht Zentimeter ihres sonnenverbrannten Haars abschnitt und den Rest mit vanilleblonden Strähnen versah.
Kurz nachdem sie bei ihm eingezogen war, hatte Henry sie dazu gebracht, sich die Zähne bleachen zu lassen. Sie hatte bemerkt, dass er jedes Mal zusammenzuckte, wenn sie lächelte, und schließlich gefragt: »Stimmt etwas mit meinen Zähnen nicht?«, woraufhin er nur erwidert hatte: »Ich nehme an, man verliert leicht den Blick für solche Dinge, wenn man so lange keinen regelmäßigen Zugang zu einem Spiegel hatte.«
So ein Scheißkerl, ihr großer Bruder. Er verbarg es mit einer schelmischen Fassade aus schwarzem Humor, aber sie vermutete manchmal, dass die Dunkelheit viel tiefer lag.
Sie klappt ihre Sonnenbrille von der Nase in die Haare hoch und schaut auf das Haus, das vor ihr steht. Es ist ein ehemaliges Pfarrhaus mit vier Schlafzimmern in der Nähe von St. Albans. Es hat einen Obstgarten, eine Holzschaukel, ein Trampolin und einen 60 Meter langen Garten mit Rasen, an dessen Ende ein baufälliger Pavillon steht. Fenster mit Steinpfosten, über denen Wasserspeier thronen. Eine doppelte Eingangstür mit Messingklopfern und Schuhabstreifern und eingebauten Bänken auf beiden Seiten. Es ist schmuddelig und ein bisschen zerfallen. Die Vorhänge, die sie durch die Fenster sehen kann, sind von der Sonne ausgebleicht und zerfetzt. Aber im Grunde ist es eines der schönsten Häuser, die sie je in ihrem Leben gesehen hat. Sie setzt ein Pokerface auf und sagt: »Es ist schön.«
»Das ist es wirklich«, sagt er und sortiert die Schlüssel in seiner Hand, um den zu finden, der die Haustür aufschließt. »Diese Art von Ort kommt nicht sehr oft vor. Kennen Sie sich in der Gegend aus?«
»Ja«, sagt sie. »Meine Tochter wohnt in St. Albans, in der Nähe des Zentrums.«
Die Worte bereiten ihr immer noch einen Schauer der Freude. Meine Tochter. Libby Jones. Serenity Lamb. Die Tochter, die sie als Baby zurücklassen musste und dann vor einem Jahr wiederfand, als sie gerade fünfundzwanzig geworden war. Sie hat weiches blondes Haar, Libby Jones, und blassblaue Augen, und sie hält deinen Blick, wenn du mit ihr sprichst, auf eine Art und Weise, die dir das Gefühl gibt, dass du ihr alles sagen kannst und sie es ohne Wertung aufnehmen wird. Sie hat einen Londoner Akzent: keinen glasklaren englischen Akzent wie Lucy, die auf eine Schule ging, auf der man sie zwang, einen Strohhut und eine Bluse mit Tortenkragen zu tragen, sondern einen Akzent, bei dem die Ränder abgeschnitten und abgeflacht sind, bei dem an den Enden bestimmter Wörter Stücke fehlen, einen Akzent, der sich in Gesamtschulen und in Vorstadt-Reihenhäusern gebildet hat. Sie hat Sommersprossen auf den Armen und trägt ihr Haar im Seitenscheitel. Alle paar Minuten streicht sie es hinter ihr Ohr, und manchmal berührt sie mit dem Finger die Spitzen ihrer Wimpern, als ob sie prüfen wollte, dass sie noch da sind. Sie riecht nach Vanille. Sie wäscht sich oft die Hände. Sie mag Obst. Ihre Handschrift ist sehr ordentlich. Sie ist großartig.
»Oh«, sagt Max und dreht sich zu ihr, um sie anzulächeln. »Das ist gut. Sie wird sich sicher freuen, wenn Mama die Straße hochkommt.«
Das Haus steht leer. Die Besitzer haben sich bereits in eine Neubauwohnung zurückgezogen. Sie haben die blanken Knochen einiger Einrichtungsgegenstände zurückgelassen, um den Eindruck eines geliebten Familienhauses zu erwecken. In Wirklichkeit dient die Sparsamkeit aber nur dazu, die Tatsache hervorzuheben, dass das absorbierende Universum, das einst in diesen vier Wänden existierte, nun ein Ende hat. Die Kinder sind ausgeflogen, der Lärm und das Chaos einer Familie haben sich auf zwei Menschen mittleren Alters reduziert, die irgendwo in einer Wohnung leben und in den Zwischenräumen von Besuchen und Telefonaten still vor sich hinleben.
»Es ist ein ziemlicher Schrotthaufen«, sagt Max und sucht dabei nach Lichtschaltern. »Die Besitzer haben eine Menge Geld in das Haus gesteckt, als sie es kauften, aber das ist schon über zwanzig Jahre her. Es ist also ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert, sagen wir mal.«
Lucy weiß bereits, dass sie es kaufen wird. Sie wusste in dem Moment, als sie die Details im Internet sah, dass sie es kaufen würde. Es hat einen unkonventionellen Grundriss. Lucy ist in einem Haus aufgewachsen, das im Kern symmetrisch war: ein zentraler Flur mit gleich großen Räumen, die sich auf beiden Seiten spiegelten. Sie will keine Symmetrie. Sie will Ecken und Winkel und lustige kleine Nischen und unerwartete Durchgänge, die zu Räumen führen, die keinen Sinn ergeben.
Oben tragen die Zimmertüren noch immer die Namen der Kinder, die einst dahinter schliefen. Oliver. Maddy. Milly.
Es sind zwar weiche Namen, aber die Schäden, die diese Kinder in ihrem Haus angerichtet zu haben scheinen, sprechen dagegen: zerrissene Tapeten, Filzstiftkritzeleien, etwas Neongrünes, das auf den billigen Teppichen unter den Füßen klebt – wahrscheinlich Knetschleim.
Nachdem sie ein Jahr lang in Henrys makelloser Wohnung gelebt hat, ihre Schuhe an der Haustür ausziehen musste, spezielle Sprays verwenden musste, um harmlose Flecken aufzuwischen, ein kodiertes System von Tüchern für verschiedene Oberflächen adaptieren musste, gezwungen war, ständig ihre Kinder zu überwachen, um sicherzugehen, dass sie nichts fallen lassen, nichts verschmutzen und nichts beschädigen, will sie das hier – ein Haus, in dem sie sich austoben kann, ein Haus, in dem sie Knetschleim fallen lassen kann, ein Haus, das sie und ihre Unvollkommenheiten aufnimmt.
Sie ignoriert die Rostflecken in den Waschbecken und den Toilettenschüsseln, die grünen Wasserflecken um die Wasserhähne in der Badewanne, die fehlende Buntglasscheibe, die mit braunen Spanplatten im Wäscheschrank überdeckt wurde. Sie ist bereit, eine Million Pfund für ein Haus zu bezahlen, das abgewetzt und zertreten ist, für schmutzige Teppiche und kaputte Fenster und ein Trampolin, auf dem Moos wächst. Sie würde alles bezahlen, um die kleine Familie, die sie auf der Straße, am Strand, auf Sofas, in Notunterkünften – und in den ersten Jahren von Marcos Leben im Haus eines Missbrauchers – großgezogen hat, mit Mauern zu umgeben.
Nach der Besichtigung geht sie zurück zu ihrem Auto und nimmt die Unterlagen von Max entgegen, schüttelt ihm noch einmal die Hand und verabschiedet sich. Sie legt die Papiere auf den Beifahrersitz und gibt dann die Adresse von Henry in Google Maps ein. Doch bevor sie losfährt, schreibt sie noch schnell eine SMS an Libby: Ich habe gerade das Haus in Burrow's End gesehen. Es ist perfekt. Ich werde ein Angebot machen. Hurra!
Dann steckt sie das Handy in die Halterung, fährt los und beobachtet ihr Haus im Rückspiegel, bis es komplett von Bäumen verdeckt wird.
Kapitel 7
Oktober 2016
Später in der Nacht verfasste Rachel ihre Antwort an Michael Rimmer. Sie war nicht ganz nüchtern, aber auch nicht zu betrunken, um ihre Tastatur zu bedienen.
Lieber Michael,
Es war SEHR überraschend, deine Nachricht in meinem E-Mail-Postfach zu finden. Äußerst überraschend IN DER TAT. Aber nicht unangenehm oder unerwünscht. Und ich danke dir für deine freundlichen Worte über meine Entwürfe. Zum Kontext und zur Farbe: Ich wohne in einem Apartment mit Blick auf den Kanal, auf dem Weg nach King's Cross. Ich lebe allein. Ich habe keine Haustiere. Ich trinke und manchmal rauche ich. Ja, ich bin Bridget Jones, vielen Dank, dass du danach gefragt hast.
Ich würde gerne mit dir in der Gegend feiern gehen. Hier ist meine Handynummer – schick mir eine SMS, wenn du Zeit hast, und wir hecken einen Plan aus.
Deine Rachel
Sie las sie nur ein einziges Mal durch, bevor sie auf Senden drückte und sie kraftvoll, mutwillig und gedankenlos in das Universum schickte, wo er ihr Leben in einer Weise verändern würde, die sie sich unmöglich hätte vorstellen können.
Als sie am nächsten Tag aufwachte, wartete eine Antwort von Michael auf sie. Es war fast Mittag. Sie hatte ihre Yogastunde verpasst. Sie verpasste immer ihre Yogastunde. Vor acht Wochen hatte sie zwölf Kurse gebucht und im Voraus bezahlt, und bisher war sie nur zu zwei gekommen. Sie griff nach ihrem Handy und zog das Ladekabel heraus, schaltete es ein, und da war er. Michael Rimmer, der Mann, den sie am Abend zuvor unbedacht mit einer Flasche Wein, einem Wodka-Shot und einer kleinen Schale gefüllter Oliven intus in ihr Leben eingeladen hatte.
Hallo Rachel!
Schön, von dir zu hören! Und ich nehme an, du kannst dir sicher denken, dass Bridget Jones so ziemlich meine Traumfrau ist, also ist da alles klar. Ich fliege am 8. ein, also wie wäre es, wenn wir uns an einem Abend in der Woche treffen? Ich schreibe dir, wenn ich hier bin. Und ich freue mich so darauf, etwas Zeit mit dir zu verbringen. Ganz ehrlich.
Dein Michael
Rachel seufzte. Hatte sie es sich anders überlegt? Nicht ganz. Die Frage war, ob sie es sich überhaupt überlegt hatte. Aber der 8. war noch zehn Tage entfernt. Michael Rimmer könnte bis dahin gestorben sein. Sie könnte bis dahin gestorben sein. Sein Flugzeug könnte über dem Atlantik abstürzen. Kein Grund, sich darüber aufzuregen. Es hatte keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Wenn es für Michael Rimmer bestimmt war, dann würde es so sein.
Zehn Tage später kam eine SMS:
Hallo! Rachel! Ich bin's, Michael Rimmer! Ich bin gerade in London angekommen. Wie sieht's für morgen Abend aus?
Rachel spürte, wie ihr Inneres bebte. Sie hatte kein Wort mehr von Michael Rimmer gehört, seit er auf ihre betrunkene E-Mail geantwortet hatte. Sie hatte mit einem Typen auf Tinder gechattet, der ein bisschen jünger war als sie, aber ziemlich erwachsen. Charlie. Ein Kurier für medizinische Produkte. Er lebte irgendwo im Südosten von London. Weiß Gott. Der Südosten Londons war für Rachel ein Mysterium. Aber sie hatten sich sehr intensiv unterhalten. Sie hatten über Familie, Träume, Ambitionen und Bedauern gesprochen, sogar ein wenig über Politik. Aber Charlie hatte immer noch nicht gefragt, ob sie ihn treffen wollte, und ehrlich gesagt war Rachel zu alt, um auf Jungs zu warten, die Charlie hießen und diese noch darum zu bitten, sich auf einen Drink zu treffen. Und dann war da noch Michael Rimmer, der sich mit seiner Vier-Satz-SMS dreist an die Spitze der Warteschlange drängte und gleich zur Sache kam, und zwar auf eine Art und Weise, die Rachel darauf hinwies, dass sie morgen um diese Zeit vielleicht schon Sex haben würde. Und sie wollte morgen um diese Zeit wirklich Sex haben.
Sie scrollte durch ihre Fotogallerie, um das Foto von Michael Rimmer zu finden, das sie gespeichert hatte, nachdem er ihr zum ersten Mal geschrieben hatte, das Foto, auf dem er Champagner in der Hand hielt, gut genährt und selbstbeherrscht aussah.
Sie zoomte es mit den Fingern auf und ließ das Bild eine Weile auf dem Bildschirm kreisen, um sich ihn vorzustellen.
Dann wechselte sie zu seiner Nachricht und tippte sie schnell ein:
Ja. Sicher. Komm zu mir, wir gehen von hier aus los.
Michael Rimmer erschien am nächsten Abend um 19 Uhr in ihrer Tür, braungebrannt aus einem Land, in dem es noch Sommer war. Er hatte Blumen dabei. Er hatte Champagner. Sie stellte die Blumen in Wasser und den Champagner in den Kühlschrank und lud ihn auf einen Cocktail ein, denn wenn sie den Champagner jetzt öffneten, würden sie innerhalb von zwanzig Minuten Sex haben, und sie wollte die einschneidende Erfahrung einer richtigen Verabredung genießen, den Aufbau einer unerträglichen sexuellen Spannung, bevor sie diese Grenze überschritten.
Er sah besser aus, als sie es in Erinnerung hatte. Weniger schlicht. Er trug ein blassblaues Hemd, Jeans und Turnschuhe. Er roch nach Kleidung, die gerade aus einem Koffer genommen worden war, und nach einem leichten Rasierwasser, das Rachel nicht identifizieren konnte. Er hielt ihr die Tür auf und zog ihr einen Stuhl heran, wie es Charlie, der Kurier für medizinisches Material, wohl kaum getan hätte.
Michael bestellte sich eine Margarita, Rachel einen Dark 'n' Stormy, und dann unterhielten sie sich.
»Hast du Kinder?«, fragte er sie.
Sie zuckte leicht zusammen. Die Frage, ob sie Kinder hatte, kam ihr so seltsam vor wie die Frage, ob sie noch alle ihre Zähne hatte. Rachel fühlte sich noch jung, viel zu jung, um als Mutter angesehen zu werden. Aber Michael war nicht der erste Mann, der sie das in den letzten ein, zwei Jahren gefragt hatte. Irgendwie hatte sie, ohne es zu merken, eine unsichtbare Grenze in die Mutter-Zone überschritten.
Sie versuchte, bei dieser Frage nicht zu erbleichen, und sagte: »Nein, nein. Noch nicht. Und du?«
Sie sah, wie sein Gesicht aufleuchtete. »Ja«, sagte er. »Ja. Nur eins. Ein Junge. Marco. Er ist … na ja, er wurde 2006 geboren, also muss er ungefähr zehn sein, schätze ich?«
»Du klingst nicht sehr sicher.«
»Es ist kompliziert. Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen.«
»Geschieden?«
»Ja. Geschieden. Und meine Ex…« Er stieß einen Lufthauch aus, der verdeutlichte, dass seine Ex problematisch war. »Nun, weißt du, es ist chaotisch, es ist kompliziert, meine Ex weiß, wo sie mich finden kann, aber sie will es nicht. Sie hat ein chaotisches Leben. Ich habe ihr angeboten, sie und den Jungen zu unterstützen. Aber sie hat mich abblitzen lassen. Also, ja. Es ist traurig. Marco, mein Gott, wenn du ihn gesehen hättest, einfach ein wunderbarer Junge. Aber er lebt ein Leben, das nicht gut enden wird.«
Rachel sah, wie Michaels Augen vor Tränen glasig wurden, und spürte, wie die Begegnung einen anderen Weg einlegte, einen Weg, der das unausgesprochene Versprechen auf unvermeidlichen Sex, das jeden Moment ihrer bisherigen Kommunikation durchzogen hatte, zu beeinträchtigen schien, der sie aber auch an einen anderen Ort führen konnte, an einen völlig unerwarteten Ort, an einen Ort, der erwachsen und echt war.
Sie streckte ihre Hand aus, um seine zu umfassen. Er drehte seine Hand um und wickelte seine Finger um ihre Handfläche.
»Schon gut«, sagte er und seine Augen wurden wieder trocken. »Es ist nur eine Schande, wie das Leben einen von den Dingen, die einem wichtig sind, wegbringen kann.«
»Hast du jemals versucht, das Sorgerecht zu bekommen?«
»Nein«, antwortete er und streichelte sanft ihre Hand. »Nein. Es war eine schnelle Scheidung, sie wollte nichts von mir. Ich dachte, wir würden die Dinge zu gegebener Zeit klären. Am Anfang habe ich Marco sehr oft gesehen. Aber dann bin ich für ein paar Wochen geschäftlich in die USA gegangen, und als ich nach Südfrankreich zurückkam…« Er zog seine Hand aus ihrer und beschrieb damit eine Rauchwolke.
»Du lebst also in Südfrankreich?«
»Ich lebe an vielen Orten. Aber ja, ich habe ein Haus in Antibes. Es ist rosa. Ich habe ein rosa Haus. Es würde dir gefallen.«
»Welchen Farbton hat es? Nicht etwa ein heißes Pink?«
»Nein. Nein. Ein sehr dezentes Rosa – meine Ex sagte immer, es hätte die Farbe von toten Rosen.«
»Tote Rosen? Wow! Das ist irgendwie bizarr poetisch.«
»Ja, nun, Lucy ist eine bizarr poetische Frau.«
Lucy, dachte Rachel. Lucy. Das ist der Name der Frau.
Die Frau, die vorher da war.
Kapitel 8
Juni 2019
Lucy dreht den Schlüssel im Schloss von Henrys Wohnungstür, der Atem stockt ihr, wie immer, wenn sie zurückkehrt. Nicht, weil sie glaubt, dass etwas Schlimmes passiert ist, sondern weil sie weiß, dass Henry lieber nie wieder das Geräusch ihres Schlüssels in seinem Schloss hören würde und dass allein die Tatsache, dass sie seine Wohnung betritt, ihre Tasche auf seinem Tisch abstellt, seinen Namen ruft, seinen Kühlschrank öffnet, ihren Atem in dem Raum zwischen den vier Wänden, die seinen eigenen, sehr privaten Raum abgrenzen, ein- und ausatmet, ihm Schmerzen bereitet, die sich in einen scharfen Kommentar, eine pedantische Beschwerde oder einfach in eine grüblerische Präsenz hinter der Tür seines Schlafzimmers verwandeln, einer Tür, die in letzter Zeit immer häufiger geschlossen bleibt.
Stella ist bei Freya G. zum Spielen verabredet (sie nennen sie Freya G., weil ihre andere beste Freundin auch Freya heißt) und Marco spielt mit seinem netten Freund Alf irgendein Videospiel auf dem großen Plasmabildschirm im Wohnzimmer. Lucy wirft einen nervösen Blick auf den Gang, der zu den Schlafzimmern führt, und hofft, dass die Geräusche nicht bis in Henrys Zimmer gelangen.
»Stell es ein bisschen leiser«, bittet sie sanft. Marco blickt nicht auf, sondern greift nach der Fernbedienung und reduziert die Lautstärke.
Alf dreht sich um und lächelt Lucy an. »Hallo Lucy«, sagt er, »wie geht es dir?«
»Mir geht es gut«, sagt sie. »Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut. Ich bin… Oh, Scheiße…« Und weg ist er. Seine Aufmerksamkeit gilt wieder dem Spiel auf dem Bildschirm, und Lucy geht in die Küche und schenkt sich ein Glas Wein ein.
Sie will Henry von dem tollen Haus in St. Albans erzählen, aber sie weiß, dass er einen Blick auf die Details werfen und ihr sagen wird, dass sie verrückt ist, dass sie sich irrt, dass sie dabei ist, einen großen Fehler zu machen. Er wird ihr sagen, dass es ein Geldvernichter ist, dass sie nichts von Immobilien versteht und dass sie es bereuen wird. Sie will diese Dinge nicht hören.
Bevor Henry sie dazu bringen kann, ihr Urteil in Frage zu stellen oder ihre Meinung zu ändern, schickt Lucy dem Makler eine E-Mail und macht ein Angebot.
Am nächsten Morgen stellt Lucy fest, dass Henrys Zimmertür noch geschlossen ist, als sie um acht Uhr fünfzig nach Hause kommt, nachdem sie Stella zur Schule gebracht hat. Normalerweise ist er um diese Zeit gerade auf dem Weg zur Arbeit, manchmal läuft sie ihm sogar auf dem Bürgersteig vor dem Wohnblock über den Weg. Auf Zehenspitzen schleicht sie den Flur entlang und drückt ganz leise die Klinke seiner Schlafzimmertür herunter, dann öffnet sie, als sie feststellt, dass sich niemand in seinem Zimmer befindet, sein Bett gemacht ist und die Jalousien geöffnet sind.
Sie ruft nach ihm, für den Fall, dass er in seinem Bad ist, aber er antwortet nicht.
Henry muss, so vermutet sie, ein frühes Treffen gehabt haben. Aber sie ist erst seit zwanzig Minuten aus dem Haus. Seine Dusche ist trocken. Auf dem Spiegel ist kein Kondenswasser zu sehen. Er war definitiv noch nicht auf, als sie das Haus verließ. Er kann unmöglich in der Zeit, in der sie aus dem Haus war, aufgewacht sein, sich fertig gemacht haben und gegangen sein. Henry würde nie das Haus verlassen, ohne zu duschen.
Sie will gerade eine Nachricht in ihr Handy tippen, als ihr etwas auffällt: Henrys Zahnbürste steht nicht in seinem Badezimmer. Er hat eine schicke elektrische Zahnbürste, die über ein USB-Kabel auf einem Sockel aufgeladen wird. Sie hat mehrere Einstellungen und eine blaue Leuchte und steht normalerweise auf der Marmoroberfläche seines Waschtischs und blinkt. Aber sie ist nicht da.
Dann packt Lucy etwas im Magen. Sie erinnert sich an etwas: an den Bruchteil eines Augenblicks, als sie aus dem Tiefschlaf erwachte, als es draußen noch dunkel war, Fitz am Fußende ihres Bettes, die Ohren gespitzt, ein leises Knurren in seiner Kehle. Sie lagen beide eine Weile ganz still, hörten das dumpfe Brummen des Fahrstuhls, der durch den Schacht im Korridor hinter der Wohnung fuhr, und schliefen dann wieder ein.
Sie hatte angenommen, dass jemand außerhalb der Wohnung sie geweckt hatte, aber vielleicht war es auch jemand innerhalb.
Sie schaltet ihr Handy ein und schreibt eine Nachricht an Henry: Wo bist du?
Sie starrt auf das Häkchen. Es bleibt einzeln und grau. Laut der App war Henry zuletzt um sieben Uhr fünfundvierzig online.
Sie zieht seine Schränke und Schubladen auf. Sie weiß nicht, wonach sie sucht, aber sie weiß, was sie denkt. Sie glaubt, dass Henry mitten in der Nacht die Wohnung verlassen hat, um einen Flug nach Botswana zu nehmen, um nach Phin zu suchen. Und aus irgendeinem tiefsitzenden und unangenehmen Grund erfüllt der Gedanke, dass Henry ihn finden könnte, sie mit Angst.
Kapitel 9
Reisen in der Business-Klasse. Wenn man es noch nicht getan hat, kann man es sich nur vorstellen. Und wenn man es einmal getan hat, kann man es sich nie wieder anders vorstellen – man ist für immer ruiniert. Es ist wahrscheinlich der beste Grund, wohlhabend zu sein, den es gibt.