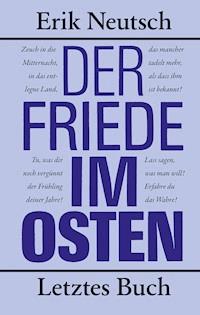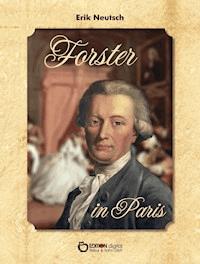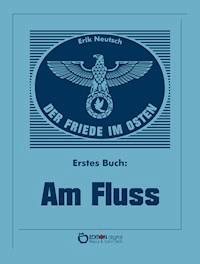
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Friede im Osten
- Sprache: Deutsch
Ein Apriltag des Jahres 1945. An einer Panzersperre erleben Achim Steinhauer und Frank Lutter als Hitlerjungen das Ende des Krieges. Aber war wirklich zu Ende, was sie mit Blut beschworen hatten? Achim Steinhauer wird es nicht leicht haben, seinen Weg aus den Verstrickungen der geschlagenen Welt des Faschismus in eine neue Zeit zu finden. Er begegnet schwierigen Situationen, er erkennt seine künftigen Freunde nur schwer, etwa Matthias Münz, den Kommunisten, der aus dem KZ kommt. Auch Franks Weg, der sich bald den antifaschistischen Kräften anschließt, versteht er zunächst nicht. Und schwierig wird für ihn die Zeit im Gefängnis, wo ihm schließlich der sowjetische Oberst Koschkin zu sich selbst und zur Freiheit verhilft. Bewähren und bestehen muss er die Station der Schule, wo man ihn, den Arbeiterjungen, anfeindet und vor allem wird ihn seine Liebe zu Ulrike Jaro in konfliktreiche Situationen führen. Wie wird er das alles meistern, und wie werden es seine Freunde schaffen? Davon erzählt Erik Neutsch in außerordentlich bewegenden und packenden Menschenschicksalen im ersten Buch seines Romans "Der Friede im Osten", der erstmals 1974 beim Mitteldeutschen Verlag Halle/Saale erschien und in mehr als 10 Auflagen verlegt wurde. INHALT: Vorspann Nachkrieg GEFANGENSCHAFT SCHULE LIEBE.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Der Friede im Osten. Erstes Buch
Am Fluß
ISBN 978-3-86394-397-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1974 bei Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Vorspann
Ich glaube, man muß in sozialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrundsatz ausgehen, die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volke suchen und die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen. Zu was soll ein Ding, wie diese, zwischen Himmel und Erde herumlaufen? Das ganze Leben derselben besteht nur in Versuchen, sich die entsetzlichste Langeweile zu vertreiben. Sie mag aussterben, das ist das einzig Neue, was sie noch erleben kann.
Georg Büchner (1835 in einem Brief an Karl Gutzkow)
Teil I: Nachkrieg
Zeuch in die Mitternacht, in das entlegne Land, das mancher tadelt mehr, als daß ihm ist bekannt! Tu, was dir noch vergünnt der Frühling deiner Jahre! Laß sagen, was man will! Erfahre du das Wahre!
Paul Fleming (1634 in einem Gedicht auf Nishni Nowgorod)
ERSTES KAPITEL
Die Stadt Graubrücken liegt in einem Bogen der mittleren Elbe. Im Norden und Osten wird sie von dem grau und träge dahingleitenden Fluß begrenzt, dessen tückische Hochwasser allerdings früher nicht selten die Deiche zerbrachen und die Wiesen und Wälder an den Ufern überschwemmten. Hier erreicht man die Stadt nur über eine Brücke. Auf ihrer Landseite hingegen, die sich bis zu den kahlen Hügeln am Ende des einstigen Urstromtales erstreckt, besitzt sie, auch für das Auge, ungehinderten Zugang von allen Seiten.
Wir nähern uns ihr von dort. Und schon bald, aus dem Südwesten kommend, nachdem wir die F 71 frühzeitig verlassen haben, die Landstraßen zweiter Ordnung benutzen und durch mehrere Dörfer fahren, befinden wir uns genau auf der Route, die am 11. April 1945 auch die nordamerikanischen Truppen einschlugen, der Südkeil ihrer Neunten Armee, als sie in wenigen Tagen, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, wie man heute weiß, von ihrem Brückenkopf Wesel am Rhein bis an die Elbe vordrangen.
Um uns dehnt sich die Börde. Kultursteppe. Im Sommer flimmert die Luft darüber, ein leichter Wind streicht durch reifende Kornfelder, deren endlos scheinende Fläche nur hin und wieder von Obstbaumzeilen an Chausseen und Masten von Starkstromleitungen unterbrochen ist. Schon von weitem erkennt man, neben Kirch- und Wehrtürmen aus dem Mittelalter, die wohl die Silhouette einer jeden deutschen Stadt noch immer wie von Merian gestochen aus dem Himmel treten lassen, das Gradierwerk, eins der wenigen, die in Deutschland erhalten blieben. Friedrich II. befahl seinen Bau, nachdem der westliche, damals noch eigenes Stadtrecht genießende Teil des heutigen Graubrücken an Preußen geschlagen war, und konkurrierte mit ihm und einer Saline die denkfaule, sich jeder technischen Neuerung widersetzende Pfännerschaft nieder, die bis dahin so ziemlich allein über Salz und Siedlung geherrscht hatte. Der König war es auch, der in dieser Zeit den Grundriß für das heutige Stadtbild formte, indem er drei Orte mit Kolonistenstraßen verbinden ließ. Später wurde ein Teil des Gradierwerks von einem Orkan gestürzt, ein anderer brannte ab. Doch auch der Torso ist noch imposant. Von seinen bizarren, verkrusteten Wänden aus Schlehdornreisig strömt stets ein erfrischender Solatem. Und diesem Umstand, der Heilsamkeit seiner Luft, von ein paar findigen Knappschaftsärzten entdeckt, verdankt denn auch der dortige Ortsteil seinen heute gebräuchlichen Namen: Bad Solau, dazu die Kurhäuser in meist klassizistischem Stil und die Villen inmitten grüner Parks. Hier bäderte und wohnte einmal im Sommersitz die Hautevolee.
Ansonsten fällt an der Stadt nichts Besonderes auf. Die Industrie ist hier zu Hause, ursprünglich im Gefolge der Salzgewinnung entstanden, seit dem vorigen Jahrhundert jedoch mehr und mehr von chemischen Betrieben und Maschinenfabriken geprägt. Die meisten Straßen sind niedrig und grau, streckenweise noch immer der Katenkolonie der Sieder und Böttcher Friedrichs II. ähnlich, und ein höher als dreistöckiges Gebäude wie die Renaissance-Nachahmung des Kreisgerichts in der ehemaligen König- und jetzigen Leninstraße war, zumindest bis zum erst jüngst erfolgten Aufbau der Wohnstadt auf dem Malzmühlenfeld, eine Rarität.
Andere Ortsteile Graubrückens sind das im Norden, nach Magdeburg zu gelegene Nöte, urkundlich bezeugt aus dem Jahre 936 als Glied eines Burgenwalls gegen die Slawen und Wenden, mittlerweile ein unscheinbares Viertel um den Binnenhafen, weiterhin Laubholtz, das Ausflugsziel der Städter seit eh und je auf dem Ostufer der Elbe, und Felgen, das den Südosten einnimmt, zweifache Wüstenei in der Vergangenheit, einmal nach einer verheerenden Pest, ein andermal nach der Einäscherung durch kursächsische Söldner während des Dreißigjährigen Krieges, doch stets wieder zu neuem Leben erweckt und noch um die Jahrhundertwende eins der üblichen schmucklosen Dörfer der Börde. Als zwischen ihm und der Stadt, infolge der anwachsenden Industrie, mehrere Arbeitersiedlungen mit idyllischen Namen wie Sonnenschein, Edelweiß und Lerchenschlag entstanden, wurde es kurzerhand eingemeindet. Zu ihm gelangt man, wenn man am Ende des Gradierwerks in Bad Solau der scharfen Rechtskurve folgt und dann unmittelbar hinter dem Bahnübergang in eine Asphaltstraße einbiegt, die bald durch einen Rest Feldmark führt. Am Ortseingang, gleich zu Beginn der sogenannten Bauernstraße mit ihren bis auf den heutigen Tag wie Festungen wirkenden Vierkantgehöften, steht eine Windmühle, auf einen Hügel gebockt, doch außer Betrieb inzwischen, lahm-flügelig, halb verfallen.
Noch im Frühjahr 1945 befand sich ihr gegenüber ein mehrstöckiges Wohnhaus. Jetzt ist dort eine Spielfläche angelegt, umgrenzt von quaderförmig gestutzten Ligusterhecken, Jasmin und Flieder. Unter die Büsche sind Bänke gestellt, auf den Rasen Turngeräte, und so erinnert nichts mehr daran, daß jenes Haus buchstäblich in der letzten Schrecksekunde Graubrückens in Schutt und Asche gelegt wurde.
Denn zwischen ihm und der Mühle war, wie auf allen Zufahrtsstraßen der Stadt, eine Panzersperre errichtet. Ein tiefer Graben zog sich quer über den Asphalt, bewehrt mit Geröll und Kies und einen Steinwurf entfernt von einem Gestrüpp pyramidal zusammengeschweißter und in den Boden gerammter Eisenbahnschienen. Hier kauerte in den frühen Morgenstunden des elften April, mit Panzerfäusten und Karabinern bewaffnet, ein Trupp von etwa zwei Dutzend Volkssturmmännern und Hitlerjungen, Krüppel, Greise, Kinder, die meisten wohl auch entschlossen, dem Führerbefehl bedingungslos zu gehorchen und dem Feind bis zum letzten Blutstropfen Widerstand zu leisten.
An der Grabenwand lehnte ein Junge von vierzehn Jahren. Mitternacht mußte vorbei sein. Doch genau wußte er es nicht, er besaß keine Uhr. Wiederum nahm er sich vor, sich als erstes, sobald er die Lehre antreten und selbst Geld verdienen würde, eine Armbanduhr zu kaufen, aus Edelstahl und mit Leuchtziffern, als zweites einen Packen Bücher, Werke von Schiller und Körner. Forsteleve wollte er sein, an Lagerfeuern Geschichten erzählen und den Tieren, dem Eisvogel besonders, den er noch nie gesehen hatte, bis in die Bruthöhlen folgen. Doch weiter kam er mit seinen Zukunftsträumen nicht.
Scheinwerferblitze durchzuckten von fernher die Dunkelheit und nahmen ihn wieder in Anspruch. Oder waren es Mündungsfeuer? Bis in den späten Abend hinein war das dumpfe Grollen einer Kanonade nach Felgen gedrungen. Es konnte nicht anders sein, als daß sich irgendwo die Entscheidungsschlacht anbahnte. Vielleicht sogar hier. In der Ebene zwischen der Elbe und dem Harz. Kimbern und Teutonen. Der Führer würde die Wunderwaffe einsetzen. Gott sei mein Richter, wenn die Feinde Großdeutschlands mich dazu zwingen, soll er gesagt haben, die Vergeltung wird furchtbar sein.
Der Junge spielte nervös am Schloß des Karabiners, den er am Abend zuvor empfangen hatte, spannte Feder und Bolzen. Irgend etwas mußte er tun. Das Warten war gräßlich. Worauf aber wartete er? Ein Volkssturmmann murrte. »Kein Spielzeug für Kinder.« Der Junge legte die Waffe zurück in die Scharte. Und obwohl die Kammer noch leer war, wagte er nach den Worten des Alten nicht, den Abzugshahn zu drücken.
Ein seltsames Gefühl beschlich ihn. Kälte, die von der frisch aufgeworfenen Erde durch seine Uniform kroch, und dieses Gefühl. Angst? Nein. Seine Sinne waren überreizt. Es sollte etwas geschehen. Die Dunkelheit weichen, die Sonne sich zeigen, ganz einfach der Himmel sich auftun ...
»Mensch, Achim, du zitterst ja«, hörte er Lutter sagen, der neben ihm lag. »Wie damals, als ich dein Blut zapfte.«
»Ich friere«, entgegnete Achim. Seine Stirn brannte heiß unter dem Stahlhelm.
Frank war sein Vorgesetzter, Fähnleinführer, und Kamerad. Ihre Freundschaft hatte im letzten Winter begonnen, in einer Schule am Fuße der Roßtrappe. Auf - nieder! Auf - nieder! Mit seinen Kommandos hatte ihn Frank über den schneebedeckten Sportplatz gejagt. Ich ziehe dir die Hammelbeine lang, wenn du nicht wiederholst: Hagen ist ein Held. Er antwortete keuchend: Hagen ist ein Meuchelmörder. Auf - nieder! Auf - nieder! Wiederholen: Katte ist ein Verräter. Antwort: Friedrich der Große ebenfalls. Wiederholen: Unsere Ehre heißt Treue. - Unsere Ehre heißt Treue.
Dieser Wahlspruch der Gebietsführerschule, an ihrem Giebel in Stein gemeißelt, versöhnte sie wieder, nachdem Achim seinem Ausbilder Frank Lutter wegen der Haltungen Hagens und des Thronfolgers Friedrich widersprochen hatte. Nein. Das werde ich niemals verstehen. Beides ist ungerecht. Siegfried wurde nicht Auge in Auge besiegt sondern hinterrücks. Und wenn Katte enthauptet wurde, so kann nicht der andere für dasselbe Vergehen, Fahnenflucht, nur weil er der Sohn des Königs ist, am Leben bleiben. Frank scheuchte ihn daraufhin, doch ohne Erfolg. Schließlich ließ er die Jungen antreten und befahl Achim, ausgepumpt und bleich, vor die Front. Wegen Gehorsamsverweigerung wirst du zum Pimpfen degradiert. Doch wegen deiner Standhaftigkeit, Pimpf Steinhauer, arischer Tugend, befördere ich dich mit sofortiger Wirkung zum Jungzugführer. Er legte ihm selber die grüne Schnur an.
Noch am selben Abend krochen sie in eine Felsschlucht am Ufer der Bode, ritzten sich mit Fahrtenmessern die Haut auf und tranken einander ihr Blut.
Seitdem wußte er, daß er sich stets auf seinen Blutsbruder würde verlassen können. Sie waren Soldaten des Führers. Sie trugen das Ehrenkleid seiner Jugend und seiner Hoffnung. Sollten die Panzer nur kommen. Ach, kämen sie doch. Das Gefühl, nur warten und untätig sein müssen, zermürbte.
Erst viel später wurde bekannt, was sich während des Bombardements in der folgenden Stunde auch anderenorts ereignet hatte. Im Osten war soeben ein erster fahler Glanz aufgedämmert, als aus der Höhe des Sternenhimmels ein Summen erklang. Motorengeräusch. Und obwohl es zunächst kaum vernehmbar war, vom Wind im Wechsel ferngerückt und nähergetragen, wirkt es doch, wie wohl seit langem jeder Laut am Himmel, bedrohlich. Die Gründe allerdings dafür, weshalb der Pilot da oben in dieser kritischen Nacht einen Alleinflug wagte, ob er die Flucht ergriffen oder sich nur verirrt hatte, werden wir nie erfahren.
Scheinwerferstrahlen sprangen auf und zerteilten mit einem Schlage die Dunkelheit. Sie schwenkten und kreisten, kreuzten und verknoteten sich, lösten sich wieder, trafen sich erneut im Bündel und hielten plötzlich in ihrer Lichtfaust den blinkenden Leib eines Flugzeugs. Deutlich war der Typ zu erkennen. Balkenkreuze an Tragflächen und Rumpf. Eine Ju 88. Sie flog in westliche Richtung, dorthin, wo bereits die amerikanischen Stellungen vermutet wurden.
Eine Salve krachte, abgefeuert von den Batterien, die verschanzt in den Wäldern am jenseitigen Elbufer lagen. Warnschüsse. Kleine, grellrote Fontänen zerspritzten vor der Maschine. Der Pilot aber änderte kaum ihren Kurs. Er stieß sie nur merklich tiefer, versuchte, mit solchem Manöver dem Strahlenbündel zu entkommen. Doch es gelang ihm nicht. Der Bomber klebte im Licht wie ein Insekt. Die Flak begann zu hämmern. Wütend, mörderisch. Der fahle Glanz im Osten war längst vor den Mündungsfeuern verblaßt.
Da wurde der Rumpf von einer Granate getroffen. Eine Rauchfahne quoll auf. Und nun drehte das Flugzeug ab, zog eine Schleife und raste mit heulenden, blackernden Motoren auf die Stadt zu.
Detonationen erdröhnten. Vielleicht hoffte der Pilot, sein Leben zu retten, indem er die tödliche Last abwarf. Vielleicht handelte er auch nur im letzten Aufbegehren seiner Angst.
Die Bomben fielen.
Sie krepierten in einem Zug von Häftlingen, der aus dem Konzentrationslager Dora kam, sich seit Tagen vom Harz herab durch die Börde schleppte, seinen Weg mit Leichen säumte, zu Tode gequälten Bündeln aus Haut und Knochen, und noch vor dem Morgengrauen über die Elbbrücke getrieben werden sollte. Die Gefangenen und ihre Peiniger wurden in Stücke gerissen, zerfleischt, Blutlachen beendeten ihren Marsch. Die Wachhunde winselten, klagten wie Menschen, die Menschen schrien wie Tiere, und die SS-Posten, selber sterbend, mähten mit ihren Maschinenpistolen noch diejenigen nieder, die, heil geblieben oder nur leicht verwundet, über die Äcker hetzten und sich befreien wollten.
Die Bomben durchschlugen das Dach einer Turnhalle, die zum Lyzeum in Bad Solau gehörte und in welcher Greise und Kinder schliefen, völlig erschöpft nach dem langen Treck aus Danzig und Pommern, so daß nicht einmal die scharfen Schüsse der Flak vermocht hatten, sie zu wecken. Tausend grausam verstümmelte Glieder wurden gegen die Wände geschleudert, ehe auch die zusammenbrachen. Sie schütteten ein Massengrab zu, über dem später ein hohes steinernes Kreuz errichtet wurde, eingraviert an die hundert Namen der Opfer, hinter den Namen die Geburtsjahre und unter allem der Tag des Todes, Mittwoch nach Quasimodogeniti, betet: Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ist genesen.
Sellier & Bellot wurde getroffen, eine der ältesten chemischen Fabriken der Stadt, in der auch in dieser Nacht noch Zündhütchen für Geschosse produziert wurden. Ein Munitionsdepot explodierte, und die furchtbare Druckwelle zertrümmerte alle Fenster im Umkreis, zerriß Frauen und Lehrlingen, die in der Nähe arbeiteten, die Lungen und wirbelte packenweise Flugblätter auf die Straßen, aus der Direktion des Werkes Durchhalteparolen, aus einem Versteck im Ersatzteillager der Dreherei Losungen des antifaschistischen Widerstands. Volksgenossen Graubrückens, versetzt den Plutokraten und Bolschewisten den Todesstoß! Bürger Graubrückens, hißt die weißen Fahnen!
Und schließlich stürzte das Flugzeug mit dem Rest seiner Bomben auf die Straße, die vor Felgen lag, und zerbarst keine hundert Schritte entfernt von der Panzersperre.
Wrackteile flogen durch die Luft. Das Mietshaus gegenüber der Mühle wurde halbiert. Die Erde brannte, der Asphalt zerschmolz. Und der Himmel darüber tat sich auf, wie Achim Steinhauer es vor kurzem noch herbeigesehnt hatte.
Vater und Mutter, Feuer und Untergang, alles ist aus. Frank Lutter lag im Sand, den Mund voll Sand. Denkfetzen schossen durch sein Gehirn. Er rang nach Atem, spuckte und schrie, aber er wußte nicht, ob er selber es war, der schrie. »Nieder! Deckung!« Achim, Kamerad, hörst du mich noch? Mit beiden Händen drückte er den Kopf des Freundes tief in die lehmige Erde. Er spürte den Helm, das kalte Metall, und wünschte, daß in diesem Augenblick der schützende Stahl wie die Hornhaut Siegfrieds über ihre Körper wüchse.
Ein ohrenbetäubender Lärm, die Glutwelle der Explosion zischte über den Grabenrand, warf Gesteinsbrocken auf die Brüstung. Dann war Stille, unheimliche Stille. Nicht einmal mehr das Raunen des Windes war zu hören.
Wie um Gewißheit zu haben, daß er noch lebte, wagte Frank eine Bewegung. Er zog die Beine an, sie gehorchten ihm, kniete sich hin. Sand rieselte von seiner Uniform. Neben sich erblickte er das blasse, verzerrte Gesicht Steinhauers, schwarze, feucht glänzende Flecke darin. Er erschrak. Blut. Wir bluten. Seit sechs Jahren, solange der Krieg dauerte, nein, länger, von Kindheit an war er daran gewöhnt worden, an Blut und Ehre, Tod und Ruhm. In der Gebietsführerschule im Harz hatte er auf blutgefüllte Schläuche schießen müssen, Abhärtung, der Dienst verlangte es, doch nun sah er zum ersten Mal sich selbst inmitten der Kinobilder und Lesebuchtexte, sah sich an allen Gliedern verstümmelt. Der Soldat stirbt. Mölders und Prien. Er fühlte sich naß. Schweiß, Blut. Der derbe Stoff seiner Überfallbluse klebte ihm auf der Haut, es roch süßlich, wie das Schweineblut, das aus den Schläuchen gequollen war. Er betastete sich. Eine warme, breiige Flüssigkeit blieb an seinen Fingern haften. Auch die Fähnleinführerschnur an seiner linken Schulter war durchtränkt.
Aber es war nicht sein eigenes Blut, das ihn besudelt hatte. Im Licht der Scheinwerfer, die noch immer die Nacht erhellten, sah er reglos einen Volkssturmmann liegen. Ein Wrackteil des Flugzeugs war ihm zwischen Hals und Brust gedrungen. Dort steckte es noch wie eine Axt. Der Mann war tot. Aus seinen Mundwinkeln sickerten dünne Fäden Blut. In seinen erstarrten Augen spiegelte sich das Licht.
Frank stand auf, wankte. Ein Würgen verschnürte ihm die Kehle. Er steckte den Finger in den Schlund. Das ist nun die Front, dachte er, die Stunde der Männer, einen Meter nur weiter, näher, und es hätte nicht den Alten erwischt, Großvater, Tattergreis, sondern uns, Achim und mich, kurz vor Toresschluß, und wir haben noch keine Frauen, keine gehabt haben wir, und wer weiß, ob das alles hier noch einen Sinn hat, nein, ich will nicht sterben ... Bei diesem Gedanken jedoch zuckte er zusammen. War er ein Feigling? Da bemerkte er, daß auch Achim sich erhob. Der bebte, schluchzte mit verbissenen Zähnen in sich hinein. Und die Verstörtheit des Freundes, der zwei Jahre jünger war als er, machte ihm wieder Mut. Jetzt brauchte er nur noch einen Befehl, mußte Überlegenheit spüren, um die eigene Angst zu vertreiben. Er straffte sich und befahl: »Reiß dich zusammen, Mensch, Achtung!« Zugleich versperrte er ihm die Sicht auf den Toten. Eine Führernatur zeichnet sich dadurch aus, daß sie stärker ist als andere. Er umarmte ihn, drückte ihn an sich und flüsterte: »Bleib tapfer, Hagen von Tronje, und halte die Wacht.«
Die Scheinwerfer erloschen. Hauptmann Kadig, im Zivilberuf Lehrer am Lyzeum, inspizierte die Sperre. Ein Alter erstattete Meldung. Zwei Tote. »Gefallen für Führer, Volk und Vaterland ...« Kadig unterbrach ihn. »Muß von einem Dichter sein, fällt mir jetzt erst auf. Hören Sie nicht? Gefallen für Führer, Volk und so weiter. Unverkennbarer Stabreim. Fa Fü Vo Va.« Er ließ die Leichen aus dem Graben und aus dem Mietshaus bergen, verteilte Zigaretten und Munition. Frank Lutter gab er einen Feldstecher und schickte ihn auf die Mühle. »Da, halten Sie Ausschau nach den Amis, Kamerad. Wenn sie kommen - was heißt überhaupt: wenn - dann über die Endmoränen, direkt aus der Eiszeit sozusagen. Erinnern Sie sich? Quartär, Diluvium ... Oder alles schon wieder verlernt?« Er lachte meckernd, wartete, daß auch Frank lachte. Doch als der keine Miene verzog, sich in ein Geradeausgesicht versteckte, wie er es nannte, winkte er ab und ging.
Frank bezog seinen Posten. Unter dem First der Mühle schichtete er Mehlsäcke übereinander, verbarrikadierte sich, lud den Karabiner und schob ihn durch eine Luke. Wenn er sich doch wenigstens von der Bluse befreien könnte! Das fremde, inzwischen zu Schorf verkrustete Blut auf seiner Kleidung stank. Wieder spürte er Übelkeit. Bald jedoch, allein in dieser Höhe und nach den Anstrengungen dem Schlaf oft näher als dem Wachen, tauchten Traumbilder vor ihm auf. Glücklicher Aufstand des germanischen Riesengeschlechts. Die Wunderwaffe, der Hammer Thors, wurde bis nach Amerika geschleudert, fiel über die Wolkenkratzer und übte furchtbare Rache für die Trümmer Magdeburgs und Berlins, aller deutschen Großstädte. Ein andermal setzte er seine Hoffnungen in die Japaner, die sich freiwillig, wie in den Zeitungen stand, in den Tod stürzten, Harakiri machten oder so ähnlich, selber zur Bombe wurden, um treffsicher, wie bei Pearl Harbour, die feindlichen Schiffe zu versenken. Ja, er wollte leben. Sein Kopf war voller Überlebenschancen. Doch wenn nichts dergleichen geschähe, was dann? Bei dem Gedanken, daß es keine Rettung mehr geben könnte, überlief ihn ein Zittern, reizte die Nerven, drängte in seine Lenden. Er dachte an das Leben, das er noch leben wollte, noch nicht gelebt hatte, ging in eine Ecke und entblößte sich.
Der erste Sonnenstrahl, orangegelb über der Elbe, beruhigte ihn dann. Im Licht fühlte er sich den dunklen Mächten weniger hilflos ausgeliefert. Wind kam wieder auf, klopfte in Böen an die hölzerne Mühlenkuppel und zerrte an den Flügeln, die abends zuvor fest verkettet und stillgelegt worden waren. Durch das Fernglas betrachtete er das Land. Schwarz, von den Flammen rußig, klaffte das Loch, das das abgestürzte Flugzeug in die Straße gerissen hatte. Verkohlte Wrackteile lagen verstreut umher, der ausgebrannte Rumpf steckte steil im Trichter. Den Platz im Graben, auf dem der Volksgrenadier verblutet war, bedeckte jetzt gelber Sand, dunkler gefärbt an den Stellen, in die sich das Blut gesaugt hatte. Daneben kauerte Achim Steinhauer. Frank richtete sein Glas auf ihn. Gab es denn keinen Ausweg? Nur den Untergang der Nibelungen? Bleib tapfer, Hagen von Tronje. Der Getreue des Königs war trotz der Warnungen der Meermädchen in Etzels Reich gegangen. Hagen hatte sogar das Fährschiff über die Donau zerstört. Der Schicksalsspruch war endgültig. Keine Rückkehr. So groze missewende. Der Zweifel, der verdammte Zweifel, daß hier alles keinen Sinn mehr hatte. Durch den Feldstecher sah er das Gesicht des Freundes dicht vor sich. Nur die Wimpern, die sich schwarz und lang wie bei einem Mädchen von den blassen Wangen abhoben, bewegten sich manchmal. Achims Augen, schien ihm, glänzten wie graue Seide.
Er entsann sich seines Auftrags und prüfte den Horizont. Jeden einzelnen Balken des Gradierwerks erkannte er, jeden Baum an den Chausseen. Sonne sah er und Weite. Und plötzlich, auf der schnurgeraden Linie einer Landstraße, erspähte er auch eine Reihe graugrüner Gebilde. Panzer. Er spürte sein Herz bis zum Hals hinauf schlagen. Er sprang an die Tür, riß sie auf, sprang auf die Mühlentreppe und schrie: »Panzer! Feind in Sicht! Paaanzer!«
Von weitem knallten Schüsse. Erste Kämpfe vielleicht an der Stadtgrenze in Solau.
Er wollte die Treppe hinuntersteigen, aber die schnarrende Stimme Kadigs hielt ihn zurück: »Oben geblieben, Sie Loki! Oder fürchten Sie sich vor Walhalla?« Erst jetzt entdeckte er den Kommandeur. Der saß vor einer ausgebrannten Fensterhöhle im ersten Stock des Mietshauses, unter sich einen Teppich, der zum Teil über den zertrümmerten Fußboden hing, über sich eine plüschrote Lampe mit Fransen. »Was sehen Sie noch?«
Eine Fontäne schoß im Norden der Stadt in den Himmel. Die mächtigen Bögen der Elbbrücke sackten zusammen, und schwarzgelber, schwefliger Rauch verhängte die Silhouette Magdeburgs im Hintergrund, die beiden Türme des Doms. »Die Brücke«, antwortete Frank, aber zu leise, da er sich in der Erregung verschluckte.
»Wie?«
»Sie haben die Brücke gesprengt.«
Ein Alter mit Silberbart und viel zu großem Stahlhelm kletterte aus dem Graben. »Verloren, verloren«, keifte er. »Die SS läuft davon, läßt uns krepieren hier.«
Kadig riß seine Pistole aus dem Futteral. »Halt! Zurück! Oder ich mache kurzen Prozeß!« Und in die Höhe, an Lutter gewandt, rief er: »Die Lage, Kamerad. Wo die Panzer sind, will ich wissen.«
Frank richtete sein Fernglas auf Bad Solau und erblaßte. Auf den beiden Kirchtürmen, auf dem Gradierwerk, hier und da an den Häusern erschienen weiße Tücher. Er wollte schreien, aber er schwieg, stumm vor Enttäuschung. Ja, die SS floh. Durchhalten bis zum letzten Blutstropfen. Warum hielt sie nicht durch? Sah sie denn nicht wie er, daß sich schon die Feiglinge und Verräter wie Ratten aus ihren Schlupfwinkeln wagten?
»Was Sie sehen, Fähnleinführer, hören Sie, was Sie sehen ...«
Am anderen Ende der Straße fuhren die grauen Kolosse auf. Weiße Sterne. Geschützrohre, die drohend auf Felgen zielten.
»Wie viele sind es?«
Frank zählte. »Drei, vier, sechs …« Dann gab er auf zu zählen.
Nachdem die Panzer die Feldmark erreicht hatten, schwärmten sie aus, schleuderten Erdklumpen unter sich auf und zermalmten die grüne Saat. Sie kamen zu fünft in einer Linie, und dahinter wieder in einer Linie zu fünft, und auch dahinter waren noch Panzer. Der böige Wind blies vom Westen herüber, trug die Geräusche heran, das dumpfe Grollen der Motoren und, schon im Gegensatz dazu, das hellere Rasseln und Klirren der Raupen. Frank eilte zurück in die Mühle, floh hinter die Balustrade aus Mehlsäcken, legte den Karabiner schußbereit neben sich, wußte, daß jeder Schuß damit sinnlos sein würde, und griff wieder zum Feldstecher. Dicht vor dem bläulichen Glas tauchte ein Stahlleib auf. Der Geschützturm schwenkte. Neben der Kanone war ein schweres MG montiert. Als Frank hinunter in den Graben blickte, sah er Achim und einen anderen Jungen seines Fähnleins an Panzerfäusten hantieren, die Sicherungsstifte aus den Visieren ziehen. Sie verständigten sich durch Zuruf. Schießt nicht, dachte er, es hat keinen Sinn mehr. Einen trefft ihr, und die anderen werfen sich über euch. Er legte das Fernglas aus der Hand. Mit bloßem Auge hatte er bessere Übersicht. So nah waren die Panzer.
Einer kroch auf den Trichter zu, der die Straße gespalten hatte. Der verkohlte Rumpf und eine von der Hitze verbogene Tragfläche versperrten ihm den Weg. Er blieb stehen, ruckte nach links, ruckte nach rechts. Es sah aus wie der Tanz eines Sauriers. Aus dem Jura, Herr Lehrer. Doch entschlossen stieß er plötzlich in den Abgrund. Die Motoren brüllten. Mit unheimlicher Kraft schob er sich durch die Trümmer und wälzte sich auf der anderen Seite des Trichters wieder heraus. Steil stand für Sekunden sein Bug.
In diesem Augenblick zischte ein Geschoß über die Straße. Es kam aus dem Mietshaus, vielleicht von Kadig. Frank sah hinüber. Aber der Lehrer war verschwunden. Auch die Lampe. Der Teppich mit Persermuster rutschte über den Fußboden und riß einen Polsterstuhl mit.
Sofort spien die Panzer Feuer. Eine Salve harter, knallender Schläge ertönte. In den Verhau aus Schienen und T-Trägern wurde eine Bresche gesprengt. Eine Granate zerplatzte im Graben. Geschrei, Gewimmer. Frank hielt sich die Ohren zu. Achim, wo bist du? Rette dich!
Bevor er sich aber vergewissern konnte, ob der Freund noch lebte, wurde er gegen die Holzwand geschleudert. Mühsam hob er den Kopf, und ihm war, als bewegten sich unter dem First die Sparren. Die Mühle schien sich zu drehen, um ihre Achse, lautlos, gespenstisch. War ihm schwindlig? Er hörte nur noch die Detonationen. Heulen und Rasseln. Gewimmer und Schreie.
Sehen, dem Tod ins Gesicht sehen, nur nicht lebendig begraben werden. Er rappelte sich auf, sprang an die Luke. Nein, er hatte sich nicht geirrt. Ein Karussell. Die Flügel kreisten, schneller und schneller. Ihr Schatten huschte über das Lichtquadrat. Die Verkettung der Mühle mußte von einer Granate gelöst worden sein. In der Ferne tauchte das Gradierwerk auf, dann der dunkle Wald am Fluß. Einmal der Osten, einmal der Westen. Und überall im Wind weiße Tücher.
Er suchte Halt. Für den Bruchteil einer Sekunde erblickte er Achim. Der lag noch im Graben, stemmte sich gegen die Brüstung. Auf der Schulter das Rohr einer Panzerfaust, zielte er durch das aufgeklappte Visierfenster.
Nicht schießen! Schieß doch nicht, Achim! Befehl! Das ist ein Befehl!
Die Mühle kreiste. Grüne Saat bis hinauf zu den Hügeln. Über die Straße, in Richtung der Gehöfte, liefen Männer und Jungen. Maschinengewehre knatterten. Ihre Garben schlugen Funken aus dem Gestein. Einer warf die Arme hoch und fiel kopfüber aufs Pflaster. Noch einer fiel. Schwarze Uniform des Jungvolks. Rainer, Führer des dritten Zuges. Richthofen, Schlageter … Bäume blühten, Forsythiensträucher.
Aber Frank konnte nichts mehr erkennen. Wie blind war er plötzlich, wie taub. Die Säcke waren aufgeplatzt. Der Raum füllte sich immer dichter mit staubigem Nebel. Mehl quoll ihm auf der Zunge. Er hatte das Gefühl, ersticken zu müssen. Flieh, wenn du davonkommen willst, flieh ... Er tastete sich zur Tür, verlor den Karabiner, ließ ihn zurück. Draußen auf der Treppe, im Kreisen der Mühle, prallte er gegen das Geländer. Holz splitterte. Er stürzte, fiel die Stufen hinunter.
Unsere Ehre heißt Treue. Nein. Auch die SS war geflohen. Auch Kadig, der Kommandeur. Er wollte am Leben bleiben wie sie. Mit betäubten Gliedern schleppte er sich in den Schutz der Gärten hinter den Bauernhäusern. Weiße Wolken segelten am Himmel. Und mit einem Male war auch kein Lärm mehr. Kein Schuß. Kein Gebrüll von Motoren. Nur die Mühle schwankte im Wind und knarrte.
Er fühlte sich leer, zerbrochen an seinem Glauben und an seiner Kraft, daß er nur noch weinen konnte. Er lag auf dem Bauch, preßte die Stirn ins Gras, und bei jedem Zucken seines Körpers spürte er Schmerzen entlang der Wirbelsäule, die von dem Sturz herrührten.
Erst der Gestank des fremden Blutes brachte ihn wieder zur Besinnung. Der Krieg war zu Ende, die letzte Schlacht geschlagen, das Reich der Nibelungen untergegangen. Es gibt keine Rückkehr mehr. Endgültig der Spruch der Nornen. Er hockte sich hin, riß sich Bluse und Braunhemd vom Leib. Als er aber beides in Händen hielt, reute ihn sein Entschluß. Noch einmal kam er sich vor, als habe er tausend Eide gebrochen, als verriete er alles, woran er bisher geglaubt hatte, als desertiere er vor sich selbst, und er überlegte, ob er nicht wenigstens die Rangabzeichen, Schnur und Sterne, vom Stoff trennen und für später aufheben sollte. Doch wozu? Was war später!? Die Leere, das Nichts, König Etzels Land. Er warf die Uniform und das Fahrtenmesser in eine Furche und scharrte Erde darüber. Dann ging er an eine Tonne mit Regenwasser, die er im Garten entdeckte, und wusch sich.
Das eigentliche Dorf, neben protzigen Gehöften meist mit windschiefen Katen bebaut, und die Arbeitersiedlungen trennt der von Norden nach Süden führende, langgestreckte Damm der Eisenbahnlinie Magdeburg-Leipzig. Zwischen ihm und dem anderen, der Panzersperre gegenüberliegenden Ende der Bauernstraße befindet sich nur noch ein Platz, bestanden von hohen und dichtverzweigten Linden vor zwei sich damals neidisch belauernden Gaststätten. Die eine ist heute Büro einer landwirtschaftlichen Kooperationsgemeinschaft, die andere, wo im März 1933, am Abend nach den letzten Reichstagswahlen, wie eine dort angebrachte Gedenktafel bekundet, der Funktionär des Metallarbeiterverbandes und Stadtrat der SPD Otto Höllsfahrt von SA-Schlägern ermordet wurde, das Kulturhaus von Felgen. Hinter dem Damm beginnen die ausgerichteten Reihen der Zwillingshäuser, mit Satteldächern gedeckt und von Obst- und Gemüsegärten umgeben. Zur Straße hin von Blumenrabatten, Flieder und anderen Zierpflanzen eingefaßt, schließt sich an die Rückfront der Häuser stets ein Hof an, den auf des Nachbarn Seite Ställe für Hühner, Ziegen und, jedenfalls bis in die Nachkriegszeit üblich, auch für Schweine begrenzen, auf der Gartenseite eine Waschküche und eine mannshohe Mauer unter Spaliergehölzen und sonstigem Buschwerk.
Hier, in der Siedlung Lerchenschlag, wohnte Achim Steinhauer. Sein Vater, gelernter Glasbläser, später Former, war mitten im Kriege, wenige Monate nach der Schlacht bei Stalingrad, die er, schon auf dem Krankenbett, als den endgültigen Beweis für seine Behauptung genommen hatte, daß Hitlers Niederlage unausbleiblich sei, an Silikose gestorben. Seitdem lebte Achim mit der Mutter allein im Erdgeschoß, das aus dem nunmehr gemeinsamen Schlafzimmer, der guten Stube, so genannt, weil sie nur an Festtagen benutzt wurde, und der Wohnküche bestand. Eine der beiden Dachkammern, die bis dahin ihm gehört und zu der eine schmale und steile Treppe führte, war auf Geheiß der Behörden an ein dienstverpflichtetes Mädchen aus dem Ruhrgebiet vermietet worden. In der anderen Kammer hatte sein Bruder Lothar gewohnt, und obwohl er bereits kurz nach Kriegsausbruch, kaum zwanzigjährig, in Frankreich gefallen war, wohnte er eigentlich noch immer dort, ging sein Schatte darin um. Denn die Mutter bewahrte darin all seine Sachen auf, behandelte sie, als käme ihr Sohn noch einmal auf Urlaub und wünschte sie zu gebrauchen, getraute sich nicht, sie von ihrem Platz zu rücken, und konnte sich demzufolge auch nicht entschließen, das Zimmer für Achim zu räumen.
Er nahm ihr Gehabe hin, fand für sich bald eine neue Unterkunft, die er, je mehr er sie nach seinem Geschmack einrichtete, für weit romantischer hielt als die Kammern im Dachgeschoß. Er hatte sich auf dem Heuboden über den Ställen einen Verschlag gebaut. An die Wand roher Bretter, hinter der das ganze Jahr über Wiesenheu duftete, waren der Buntdruck einer Szene, die Major Schill mit seinen Offizieren im Biwak zeigte, und colorierte Postkartenfotos seiner Helden gepinnt, Rommel, der Wüstenfuchs, Prien, der U-Boot-Kommandant, und Mölders vor seiner Messerschmitt. Unter der mittleren Pfette, vor einer tarnfarbigen Zeltbahn, die, da das Ziegeldach an manchen Stellen darüber durchlässig war, vor Regen und Wind schützte, hingen mehrere Waffen, ein Kleinkalibergewehr, ein blitzender Finnendolch, ein Dragonerdegen, dessen Klinge schon arg zerschartet war, und ein Krummsäbel unbestimmter Herkunft, mit vergoldetem Griff, getauscht einmal gegen ein Paar alter Schlittschuhe. Auch die Wimpel der von ihm befehligten Jungschaften, bestickt mit den Namen von Gotenkönigen, Teja, Alarich und Dietrich von Bern, hatte er in den letzten Tagen dort aufgereiht. Zugleich diente ihm der Balken als Bord für die wenigen Bücher, die er besaß, Karl May und Löns (natürlich, er wollte ja Förster werden), eine Sammlung von Gedichten, Zöberleins »Glaube an Deutschland«, Hitlers »Mein Kampf«, in schwarzem Leinen mit Goldschrift. Diesen Band hatte er erst vor wenigen Tagen, anläßlich seiner Jugendverpflichtung im flaggengeschmückten Lichtspieltheater »Astoria« geschenkt bekommen. Gelesen aber war er noch nicht, im Gegensatz zu einem dünnen, rötlichbraunen Reclamheft, das nur noch aus losen Blättern bestand. In einem unbemerkten Augenblick hatte er es Mathilde, der Stenotypistin aus Dortmund, aus dem Zimmer gestohlen, sich an den flammenden Reden des Räubers Karl Moor darin, die er inzwischen auswendig kannte, berauscht, und es daraufhin zu seiner Kriegstrophäe erklärt, was soviel hieß, daß er sich fortan nicht mehr als Dieb fühlte. Ein Feldbett, eine selbstgezimmerte Bank und ein Gartentisch, über den statt einer Decke eine Hakenkreuzfahne gespannt war, vervollständigten das Inventar. Genau im Schnittpunkt des Kreuzes, vom Licht aus der Dachluke beschienen, lag, wie eine Reliquie, ein Messingmedaillon mit dem Bildnis des Bruders.
In diesen Raum zog es ihn jetzt, nachdem die Panzer ihn überrollt hatten. Er wollte allein sein, sich nur seinen Gefühlen hingeben, denken, träumen und ... und ... Doch er wußte keine Antwort auf dieses Und, wußte nicht, wie es nun weitergehen sollte. Schießen, jetzt schießen, das war sein letzter klarer Gedanke gewesen. Er lag im toten Winkel und hielt den Panzer im aufgeklappten Visierfenster. Wie nach Vorschrift. Aber er zögerte. Ihm zitterte die Hand. Auf allen vieren, sah er, kroch Hauptmann Kadig über den Teppich und floh. Widerstand bis zur letzten Patrone. Hatte nicht so noch gestern der Führerbefehl gelautet? Die Volkssturmmänner sprangen aus dem Graben, gefolgt von den Jungen, auch von Rainer, der wie er die grüne Schnur trug. Die Stellungen verteidigen bis zum letzten Blutstropfen. »Feiglinge!« schrie er, »Feiglinge!«, immerzu »Feiglinge!«. Im Getöse der Explosionen gingen seine Schreie unter. Die Mühle kreiste. Auf ihrer Treppe erschien Lutter, prallte gegen das Geländer, stürzte in die Tiefe. War er getroffen, verwundet, tot? Wilder Haß ergriff Achim. Doch er wußte nicht, wen er am meisten haßte. Den Feind oder die Deserteure. »Feiglinge!«. Er verschaffte sich Luft. »Verräter!« Der stählerne Leib des Panzers bäumte sich vor ihm auf, wälzte sich über ihn. Er drückte sich in den Graben. Geröll und Kies prasselten auf ihn nieder. Er hörte das Mahlen und Malmen der Ketten. Auch ihm versagten die Hände. Er mußte doch aber schießen, schießen ... Er hatte nicht geschossen.
Nachdem es still geworden war, wühlte er sich aus der Erde wie aus einem Grab. Das Dröhnen der Panzermotoren erklang nur noch von weitem. Auf der Straße lagen Leichen. Er wagte nicht, in ihre erstarrten Augen zu blicken, zu sehen, ob auch Frank Lutter darunter war. Nicht einmal seinem Vater, der im offenen Sarg in der guten Stube gelegen hatte, von weißen Chrysanthemen bedeckt, hatte er damals in das tote Antlitz schauen können. Sogar Chrysanthemen waren ihm seitdem zuwider. Ihr Geruch erinnerte ihn an den Tod, und ihn schauderte, wenn er nur an sie dachte.
Unter den fortgeworfenen Waffen fand er eine Walther, prüfte das Magazin und sah, daß es gefüllt war. Er steckte die Pistole in die Tasche und schlich sich durch die Gassen des Dorfes. Hin und wieder hörte er einen Hund jaulen. Sonst rührte sich nichts.
An den Bahndamm gelangt, nahm er den Weg über die Äcker, die sich hinter den Siedlungsgärten, hier noch unbestellt, braun und kahl bis an den Horizont erstreckten, bis zu den fernen Türmen einer Stadt und den dunklen Wäldern am Fluß. Er mied die Straßen, wollte niemandem begegnen. Niemand sollte seine Verzweiflung sehen, seine unendliche Traurigkeit, niemand, auch nicht die Mutter. Deutschland, sein Glaube und seine Liebe, war es vernichtet? Die Leute aus Lerchenschlag würden entweder frohlocken oder ihn nur bedauern. Ach, Achim, du bist ja ein Kind noch. Nein, spätestens heute nacht war er zum Manne gereift. Gestern abend, eine Ewigkeit her, hatte er sich aus den Armen der Mutter gerissen. Ihr rotes, vom vielen Weinen aufgedunsenes Gesicht schreckte ihn ab. Du bist doch mein Letzter, Einziger, und wenn ich auch dich verliere, greif ich zum Strick … Ihr Gejammer vertrug er nicht.
Der Garten war weithin kenntlich an einer Kastanie, die seinen Zaun überwucherte. Sie war einem Samen entwachsen, den hier sein Bruder einmal im Sand verspielt hatte, und er war oft in ihre Krone gestiegen und hatte im Spätwinter den Grünlingen und im Herbst den Rotschwänzen nachgerufen: Bleibt oder nehmt mich mit. Bleibt oder nehmt mich mit. Vogelzug stimmte ihn traurig. Doch noch nie hatte er sich so verlassen und traurig gefühlt wie jetzt.
Die Mutter schien nicht zu Hause zu sein. Vielleicht hatte die Angst um ihn sie hinausgetrieben, nach Felgen, an die Sperre. Wenn sie die Spuren des Kampfes entdeckte, wie würde ihr dann zumute sein? Er spürte Mitleid, doch bevor es ihn tiefer ergriff, fiel sein Blick auf den Giebel. Aus dem Fenster über der Treppe wehte ein weißes Bettlaken. Von allen Nachbarhäusern leuchteten weiße Tücher. Kapitulation. Deutschland vernichtet. Der Gedanke schmerzte ihn mehr als alles andere. Er vergaß die Mutter. Sein Herz krampfte sich wie von einer eiskalten Faust umklammert zusammen. Wann endlich konnte er sich von diesem Gefühl, diesem Nichtweiterwissen, diesem UND, für das er keine Fortsetzung wußte, befreien? Die Antwort! Vielleicht fand er sie in seinem Verschlag.
Unbemerkt kam er in den Heuboden, verriegelte die Tür hinter sich und warf sich auf das Feldbett. Die Dinge an den Wänden, Waffen und Wimpel, Bilder und Bücher waren ihm vertraut und beruhigten ihn vorerst. Sein Verhältnis zu ihnen war wie zu lebendigen Wesen. Manchmal hatte er die Verse von Schiller und Theodor Körner laut deklamiert, manchmal hatte er Zwiesprache mit seinen Helden gehalten. Er wollte nach dem Reclamheft greifen. Eine Zeile Moors kam ihm plötzlich in den Sinn: ... dieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muß für sie des Todes sterben … Doch hatten sie ihn nicht schon alle verlassen? Rommel und Mölders, Prien und Lothar. Vielleicht auch Frank Lutter? Er entsann sich, daß er noch nie in dem schwarzen Band gelesen hatte, nahm ihn vom Bord und blätterte darin. Eine Kapitelüberschrift erregte seine Aufmerksamkeit: Der Starke ist am mächtigsten allein. Ein anderer Satz fiel ihm in die Augen: Wer leben will, der kämpfe also, und wer nicht streiten will in dieser Welt des ewigen Ringens, verdient das Leben nicht ... War das die Antwort? So sehr er auch suchte, weiter fand er nichts, was seinen Gefühlen entsprochen hätte. Juden, Sozialdemokratie, Marxismus. Nichts.
Ratlos lag er auf dem Bett, fühlte die Pistole in seiner Tasche, legte sie auf den Tisch. Das Medaillon blitzte ihn an. Sein Bruder, zweifelte er nicht, war als Held gestorben. Warum aber hatte er nicht geschossen?
Der Starke ist am mächtigsten allein. An der Front kann man sterben. Als Deserteur muß man sterben. Sätze des schwarzen Buches. War nicht auch er desertiert? Allein sein, sich nur seinen Gefühlen hingeben und ... Wie weiter? Was kommt nach diesem UND? Bleibt oder nehmt mich mit. Kalt, unheimlich kalt glänzte der schwarze Lauf der Pistole. Feigling. So schieß doch, schieß endlich, schieß ...
Hanna Steinhauer kam zurück. Ihre Holzpantinen klapperten über den Hof. »Wo is mien Junge, mien armer Junge?« rief sie.
Frank Lutter entgegnete: »Wissen denn Sie nicht, wo er ist?«
»Du häst'n vorführt, du. Wie de Deiwel löppst de hinner ihn her.«
Wenn die Mutter erregt war, verfiel sie besonders stark in ihr Bördeplatt.
Deutlich vernahm Achim die Stimmen. Schon hörte er, wie die Holme der Leiter gegen das Teerpappendach krachten. Er sprang vom Bett, schob den Riegel auf. Frank lebte. Sein Blutsbruder lebte. Die Freude darüber brachte sein Blut zum Wallen. Höher schlug ihm wieder das Herz.
Das war die Antwort. Kameraden wollen wir sein, nicht länger allein. Noch hatte er einen Freund, ein Frontschwein inzwischen wie er. Und sie würden weiterkämpfen.
Er stieß die Tür auf. Auf dem Dach stand Frank. Als die Mutter ihren Sohn erblickte, bei heilen Gliedern, entrang sich ihrer Brust ein heiserer, gurgelnder Schrei. Alle durchlittene Qual der letzten Stunden preßte sie aus sich heraus. Kopflos vor Glück rannte sie in das Haus. »Ick mak juch wat tau eten. Hungrich mutt ju sin. Ach, ihr Lusbengels, ihr jieprigen Wölfe.«
Achim jedoch erstarrte. Frank stand in Zivil vor ihm. Die blonden Haare sauber gescheitelt. Sauber das Hemd, die Hose, der blaue Sweater. Nichts mehr an ihm, was an den Kampf erinnerte, nicht einmal an den heiligen Schwur der Blutsbrüderschaft in der Höhle am Bodeufer, an Mölders und Prien und Hagen von Tronje. Ein anderer Mensch ohne Uniform. Er entsann sich nicht, ihn jemals in Zivil gesehen zu haben. Und er zweifelte nicht, daß auch Frank desertiert war.
Mehr noch als seine Trauer schmerzte ihn der Verrat. Er fühlte sich verraten wie nie zuvor.
Frank ahnte, was seinem Freund durch den Kopf schoß. Er sah es ihm an. Weit aufgerissen die Mädchenaugen. Ein unsägliches, fassungsloses, unbegreifliches Staunen darin. Er ging auf ihn zu und sagte: »So hör mich doch erst mal an …«
Aber Achim, als fürchtete er, sich anzustecken, wich sofort zurück. »Feigling!« zischte er. Dann spie er ihm ins Gesicht.
Mit den Fäusten schlugen sie aufeinander ein, wütend und grob, jeder nur darauf bedacht, dem anderen Schmerz zuzufügen, um den eigenen Schmerz, die eigene Enttäuschung nach diesem schmählichen Ende zu vergessen. Wie Tiere verbissen sie sich, wälzten sich über das ächzende Dach, drohten abzustürzen, schienen sich nicht mehr zu kennen, kannten sich selbst nicht mehr, schlugen bis sie bluteten, aus Nase und Mund, bis sie erschöpft abließen, nebeneinanderlagen und kein Wort mehr über ihre wunden Lippen brachten.
ZWEITES KAPITEL
Nach der Trauerfeier, eilends vom Pfarrer in Solau für die Hinterbliebenen veranstaltet, und nach dem Begräbnis, einer mehr symbolischen denn zweckdienlichen Handlung, da man auf Grund, daß nur wenige Opfer des Luftminenüberfalls auf die Turnhalle identifiziert worden waren, meist hinter leeren, teils sogar imitierten Särgen aus Pappe hatte einherschreiten müssen, führte Gudrun Jaro ihre beiden Töchter fast täglich in das gotische Gewölbe von Sankt Johannis, um für das Seelenheil ihres toten, nicht mehr auffindbaren Sohnes Klaas zu beten. Ingeborg, sechzehnjährig und, wie man ihr in Danzig stets nachgesagt, von »gesegneter Schönheit«, nach der Katastrophe jedoch mit grämlichen, das schöne Antlitz häßlich verdüsternden Zügen, begleitete ihre Mutter nicht nur widerspruchslos, sondern mit einer nahezu masochistischen Inbrunst. Sie wollte gedemütigt sein, stand schon in aller Frühe, während sich ihre jüngere Schwester Ulrike noch faul auf dem Strohsack rekelte, angekleidet im Zimmer und drängte eifernd zum Kirchgang. In jener Nacht hatte sie bei dem kleinen Klaas in der Turnhalle gelegen, war aber, aufgeschreckt durch die Kanonade, vor die Tür getreten. Sofort hatte der Luftdruck sie beiseite geschleudert; sie war gerettet, hielt sich jedoch seitdem für mitschuldig am Tod ihres Bruders, machte sich Selbstvorwürfe und wäre ihm wohl am liebsten nachgefolgt.
Ulrike hingegen wollte an nichts mehr erinnert sein. Sie freute sich, daß die Flucht nun ein Ende hatte, es keine Gefahr mehr gab, von Tieffliegern beschossen zu werden, empfand sogar eine solche Kleinigkeit, sich täglich wieder waschen zu können, mit Wasser und Seife zu hantieren, als eine große Wohltat, genoß sie und war voller Lebensmut. So verwundert es nicht, daß sie bald einen heftigen Widerwillen verspürte, wenn sie das spitzbögige Portal der Bad Solauer Kirche betrat. Jeder neue Tag, wußte sie, würde sein wie der gestrige, wie in dem düsteren Zimmer so auch hier: Heulen und Zähneklappern und immer wieder die Totenbeschwörung. Im Gestühl, vor Augen den mit Schnitzfiguren und Gemälden in üppigem Rahmenwerk reichlich versehenen Altar, der trotz seiner Pracht kalt und abstoßend auf sie wirkte, bestürmten sie wieder die grausigen Einzelheiten, und es half ihr auch nicht, daß sie sich dagegen wehrte. Der Mutter fehlten seit jener Nacht zwei Finger, auch ihr linker Daumen war nur noch ein Stummel, bedeckt von einer unförmigen schwarzen Lederhülle, so daß sie nun nicht einmal mehr ihre Hände ordentlich zum Gebet falten konnte. Ulrike fragte sich, wie Gottes Sohn, der vom Kreuz aus einer Figurengruppe des Altaraufsatzes herniederschaute, zumute sein mochte, wurde ihm ein solch häßlicher Anblick geboten. Ob er bereue, ob es ihm leid tut, und ob er der Mutter wieder neue Finger wachsen läßt? Hatte er nicht ähnliches schon am galiläischen Meer mit den Blinden und Lahmen getan? Unentwegt starrte sie auf die verkrüppelte Hand, erwartete das Heilwunder Christi, doch Gottes Sohn ließ sich nicht herab. Sie war enttäuscht, vergaß sogar die Gebetstexte und dachte wieder zurück an das furchtbare Geschehen. Ohne zu wissen, was sie tat, war sie in eine schützende Nische der Schulhofmauer gesprungen, die zur alten Stadtbefestigung gehörte. Sie drückte sich gegen die eisigen Quader, hatte nur Angst, und da erdröhnten auch schon die Donner der Explosionen, gellten die Schreie, die lange kein Ende nahmen. Sie sah das Feuer, das himmelhoch aufschoß, spürte die sengende Glut in ihrem Gesicht und fand sich erst wieder, als sie, umringt von irrsinnig sich gebärdenden Menschen, nach der Mutter und den Geschwistern rief. Frauen und Mädchen krochen über den Boden, rauften sich die Haare; einige stürzten sich in die Flammen, wurden selber zu Flammen, brannten wie Fackeln. Als die Feuerwehr kam, war nichts mehr zu retten, die Halle bereits eine Ruine. Später dann gruben die Überlebenden mit bloßen Händen in der heißen Asche, wühlten darin und brachten doch nur verkohlte, zerfetzte Glieder hervor, hier einen Arm, dort einen Fuß, schwarzes Fleisch. Auch Ingeborg scharrte, tat es mit ausdruckslosem, zur Maske erstarrtem Gesicht. Sie wagte nicht mehr, Ulrike, die, vor Schmerz wie gelähmt, fortwährend den Namen ihres Bruders wimmerte, in die Augen zu sehen. Und auch die Hand der Mutter war schwarz und blutete. Ein Splitter mußte ihr die Wunde bereits auf dem Hofe gerissen haben, unter der Deichsel des Pferdewagens, wo sie und Ulrike geschlafen hatten.
Abends darauf, nachdem gegen Mittag einmal ein Jeep mit amerikanischen Offizieren an der Brandstätte aufgetaucht, sofort aber wieder abgefahren war, führte der Pfarrer von Solau die Flüchtlingsfamilien, eine nach der anderen, in die Stadt, um sie, wie er sagte, christlicher Nächstenliebe anzuvertrauen. Die beiden Jarotöchter forderte er auf, sich vor einen Handwagen zu spannen, der nun mit den allerletzten Habseligkeiten, einigem Silbergeschirr, schmutzigen Decken und ein paar Beuteln und Koffern voller Wäsche, beladen war, und er selber schob am hinteren Ende nach Leibeskräften. Ein rundlicher Mann in bauschigem Mantel, schwitzend, mit roter Nase und blanker Glatze, erinnerte er Ulrike an den Gauner Adam, den sie noch kurz vor Weihnachten im Danziger Stadttheater, dort im Gezwänge der Gassen, gesehen hatte. Die Mutter, deren Linke inzwischen in einem dicken Verband steckte, ging schweigend nebenher. An einem Schulterriemen trug sie wiederum die Tasche, von der sie sich während des Trecks nie getrennt, die sie wie ihren Augapfel gehütet hatte, besser als ihn, besser als ihre Hände und den kleinen Klaas. Welche Sünde ... Ja, Ulrike konnte den Tod ihres Bruders noch immer nicht fassen, sehnte sich nach seinem Gestammel, wollte ihn in den Armen wiegen, sie hatte ihn sehr geliebt. Aber der plötzliche Vergleich erschreckte sie. Wie ungerecht und grausam war sie geworden! Liebte sie denn nicht auch die Mutter und die Schwester, und sollte sie nicht Gott danken, daß sie wenigstens sie noch hatte? Der Splitter … Wenn der Splitter das Herz der Mutter durchbohrt hätte? Am liebsten wäre sie ihr jetzt um den Hals gefallen, hätte sie geküßt, um Verzeihung gebeten und sich in ihren Armen ausgeweint. Die Tasche aber erregte nach wie vor ihre Neugier. Auf allen Lagern, in den Eisenbahnwaggons auf der Fahrt nach Küstrin, im Stroh märkischer Scheunen, hatte die Mutter stets mit dem Kopf darauf geschlafen. Wurde sie nach dem Inhalt der Tasche befragt, gab sie wortkarg und ausweichend zur Antwort: »Der Schmuck und die Papiere.« Ulrike mißtraute ihr.
Die Straßen waren verdunkelt und still, kein Lichtschein glimmte. Vor einer Villa hieß der Pfarrer sie warten. Er klopfte an eine Tür, und als ihm geöffnet wurde, bat er mit seinem gutmütig kollernden Baß, Licht zu machen. »Der Herr erleuchte uns«, sagte er, »das Morden hat nun ein Ende, die Furcht und die Sünde, und auch der Luftschutz ist ein vergangener Schnee.« Wie zur Antwort flammte eine Lampe auf und erhellte einen gepflasterten Gartenweg. In den Strahlen stand eine alte, hagere Frau, schlohweiß das Haar, wie eine Heilige unter der Aureole. Sie reckte den Kopf, neigte ihn, um besser hören zu können, und starrte in die Finsternis. Im Nähertreten, auf der Steintreppe, fand Ulrike, daß die großen, geweiteten Augen der Greisin seltsam stumpf und leer blickten. »Reichsdeutsche?« fragte die Fremde. Und die Mutter entgegnete eilfertig: »Ja, ja, gewiß. Aus Danzig. Wir haben in der Frauengasse gewohnt, Nummer zwanzig, auf dem Giebel einen Greifen, ganz in der Nähe der Marienkirche. Wenn Sie sich bitte erinnern, liebe Frau, auf allen Ansichtskarten war sie abgebildet. Und mein Gatte ist Offizier, Gymnasiallehrer eigentlich, doch jetzt Major. Seinen letzten Brief erhielt ich aus Kroatien. Gott geb's, daß er noch lebt. Ach, er ahnt ja nicht, was seinen Lieben widerfahren ist. Sein Sohn, sein Liebling, der kleine Klaas ... Ja, ja. Seit er mich dort kennengelernt und heimgeführt hat, mich, die Tochter eines Senators, wohnten wir in der Frauengasse.« Sie wischte sich über die Stirn, schluchzte. Ulrike aber hätte ihr jetzt am liebsten den Mund verboten, ihr gefiel nicht, wie die Mutter in einem fort redete. Warum mußte sie hier, vor fremden Leuten, als erstes ihre Herkunft herauskehren? Die Frauengasse, o ja, ihre bunten Giebel mit Adlern, Schwänen und einmal auch, beim Süßwarenhändler Fittich, einer plumpen Schildkröte, der Geruch, der vom Fischmarkt auf der Langen Brücke herüberwehte, die Putten und steinernen Tierbilder an den Hauseingängen, das uralte Krantor und das dröhnende Glockengeläut der Marienkirche zum Heiligabend, das alles hatte sie von den Fenstern im oberen Stockwerk aus, wo ihre Zimmer gelegen, sehen und hören, fühlen können. Wie ein Märchenland war nun die Heimat, verschollen, unendlich fern. Doch was verstanden die Fremden in dieser kalten und grauen Stadt davon? Pfarrer Adam und die Greisin? Die verzog ihren rissigen Mund, seufzte und setzte, nicht ohne Geringschätzung, hinzu: »Das behaupten sie alle jetzt. Schöne Häuser und ehrbare Ämter. Wer aber will wissen, ob sie nicht lügen? Wenn man wenigstens ihre Augen betrachten könnte … Die Augen, nicht wahr, Herr Pastor, die Augen sind das Licht Gottes.« Erst jetzt schien es Ulrike, als sei die Frau erblindet, und sie spürte Mitleid.
Fortan bewohnten sie ein kahles Zimmer in der Ahornstraße. Am Fenster hingen keine Gardinen, auf der Tapete hatten ausgeräumte Möbel und abgehängte Bilder helle Flecke hinterlassen. Ulrike war entmutigt in all den Wochen, die sie hier verbrachte. Das volle, das fröhliche Leben, nach dem sie sich wieder zu sehnen begann, konnte sich nur, glaubte sie, weit weg von diesem Zimmer, weit draußen, in keiner Villa, keiner Kirche, nur unter freiem Himmel abspielen. Mit anderen Menschen aber als mit dem Pfarrer und der Greisin kamen sie kaum in Berührung. Mißtrauisch verschloß sich ihnen die Stadt, und wenn sie einkauften, schien es, zählten die Händler, Bäcker und Fleischer doppelt und dreifach das Geld nach. Viele Familien aus Pommern und Danzig zogen weiter, dorthin, wo sie Verwandte wußten. Doch die Mutter war des langen Marsches müde. Graubrücken am nächsten wohnte eine Cousine von ihr in einem erzgebirgischen Dorf namens Hundshübel, und das war weit. So blieb sie, ging täglich in die Kirche, betete, beklagte ihren Sohn und hoffte, daß irgendwann ihr Mann sie und die Kinder holen käme. Deutschland, hieß es bald, habe kapituliert. Ulrike erfuhr es, als sie eines Morgens in einer Schlange nach Trinkwasser anstand, das wegen der Seuchengefahr nach Maß verteilt wurde, einen Eimer voll pro Kopf und Tag. Die Amerikaner schrien es aus. »Hitler tot, Germany kaputt!« Dazu schossen sie die Magazine ihrer Schnellfeuergewehre leer, umarmten sich und tanzten. Ulrike erschrak. Zwar hatte sie sich längst mit der Niederlage abgefunden, aber die endgültige Gewißheit, daß nun keine Aussicht mehr auf den Sieg bestand, ihr tapferer Vater umsonst gekämpft hatte, stimmte sie dennoch traurig. Plötzlich sah sie ihn in Gefangenschaft, sah, wie rohe und rachsüchtige Menschen ihn bespien und beleidigten. In Neufahrwasser war es einmal einem englischen Piloten, der sich aus seinem brennenden Flugzeug mit einem Fallschirm gerettet hatte, ähnlich ergangen. Die Menschen hatten mit Fäusten und Knüppeln auf ihn eingeschlagen, und sie hatte daneben gestanden und um sein Leben gebangt. Sofort eilte sie zurück, um der Mutter die Nachricht zu bringen. Die aber legte schlaff ihre Hände in den Schoß, erwähnte mit keinem Wort den Vater und sprach wohl nur laut ihre stillen Gedanken aus: »Wozu das alles. Sechs Jahre Angst und Tod, wozu. Ob unser Haus noch steht, wenn wir zurückkehren? Wegen Danzig hat alles angefangen, und jetzt werden bestimmt die Polen darin hausen.« Nachts schliefen sie auf Strohsäcken, denn außer ein paar Gartenstühlen und einem wurmstichigen Tisch, hatte ihnen die Wirtin nichts in den Raum gestellt. Tagsüber legten sie die Säcke übereinander, um Platz zu schaffen; immerzu lagen auf den blanken, mit rostroter Ölfarbe gestrichenen Dielen Staub und Häcksel.
Einmal, am Abend ihres vierzehnten Geburtstages und zugleich in sehnsüchtiger Erinnerung an ihre Mädchenstube mit dem Blick auf das dunkle Krantor, begann Ulrike das Zimmer zu schmücken. Niemand hatte ihr gratuliert, und nun wollte sie sich selbst ein Fest bereiten. Aus den Koffern holte sie eine kostbare, mit bunten Masurenmustern durchwirkte Decke und breitete sie über den Tisch. Aus dem Garten der Frau von Pfuel, wie die halb erblindete Wirtin hieß, stahl sie Tulpen und Maiglöckchen, die bald einen betäubenden Duft ausströmten. Ingeborg aber zerstörte ihr Werk, zerpflückte die Blumen und verbarg auch wieder die Decke. »Das Zimmer«, sagte sie, »ist unser Sarg, und so soll es auch bleiben, solange wir hier noch aushalten müssen. Ewig wird es nicht sein.« Ulrike weinte und rannte hinaus auf die Straße, erst nach langem Suchen wurde sie dort von der Mutter gefunden, die sich nun anklagte, bereute, daß sie nicht einmal mehr auf den Kalender geachtet, und sie umarmte und küßte.
»Rike, mein Kind, ach Rikchen, ich bin eine schlechte Mutter. Nie wieder will ich deinen Geburtstag vergessen.«
»Aber ... Ihr denkt ja doch immer an den Tod, nicht ein einziges Mal an das Leben.«
»Verstehst du denn nicht? Der kleine Klaas ... Es nimmt mir noch den Verstand.«
»Ich hasse die Kirche.«
»Ulrike! Liebst du deinen Bruder nicht mehr?«
»Nichts macht ihn wieder lebendig.«
Das war so schroff gesagt, daß es die Mutter wie einen Schlag empfand und sich krümmte. Ulrike jedoch, wieder daran erinnert, daß sie Klaas niemals mehr bei sich haben, ihn niemals mehr würde in den Armen halten können, weinte um so heftiger.
»Schon gut, schon gut«, tröstete die Mutter sie. »Wir holen die Feier nach. Wünsch dir was Schönes.«
Im Innersten aber verzieh Ulrike ihr nicht. Immer öfter hegte sie Fluchtgedanken, und immer öfter trieb es sie auf die Straße, in den Park um das Gradierwerk, unter die Säulengänge der Bäder, die wie in Zopot waren, in die Stadt. Vor jedem Häuserblock wollte sie wissen, was hinter ihm war. Bis in die himmelblaue Ferne wollte sie gehen, vielleicht erwartete sie irgendwo ein Mensch, der noch lachen konnte, ihr zuhörte und, wie früher daheim ihr Vater, all ihren Fragen Verständnis entgegenbrachte. Schlank müßte er sein und blond, und am weitesten springen und am schnellsten laufen, und vor allem durfte er sie, wenn sie ihn liebte, niemals enttäuschen … Sie spähte in fremde Gesichter, forschte darin, suchte den winzigen Schimmer der Freude, ein kleines Augenzwinkern und Sichverstehen, und wurde trotzdem nur gewahr, daß niemand ihre Blicke erwiderte. Betrübt senkte sie da den Kopf, wagte nicht einmal mehr, sich in den Schaufenstern zu bespiegeln und ihre Gestalt, dieses staksige, unscheinbare Etwas, zu betrachten, der sie nun allein die Schuld an ihren Mißerfolgen gab. Sie wirkte ja noch wie ein Kind, hatte übermäßig hohe Beine und einen viel zu schmalen Oberkörper. Die blonden Zöpfe standen hinter den Ohren wie Drahtgeflechte ab, nur mit Mühe konnte sie täglich ihr Haar, das dicht und störrisch war, bändigen. In der Brust spürte sie zwar ein Ziehen, wußte von Ingeborg, daß sie wuchs, aber unter dem Stoff ihrer Bluse verbarg sich nur ein Paar flacher, harter Knötchen. Sie ärgerte sich darüber und dachte: Ach, wäre ich doch so schön wie meine Schwester, ich bin das häßlichste Entlein der Welt.
Eines Tages wurde sie jäh ernüchtert. Wiederum hatte sie ihren Spaziergang bis zum Marktplatz ausgedehnt. Zwischen dem alten Rathaus und jetzigen Heimatmuseum und dem inzwischen abgerissenen Wepnerschen Fachwerkhaus Ecke Schadeburgstraße stand eine Gruppe amerikanischer Panzer. Die Soldaten tummelten sich bei einem eigenartigen Fangspiel mit Bällen, einige warfen Zigaretten und Schokolade unter allerlei Gaffvolk, das sie umringte, zertraten aber grinsend, sobald sich jemand danach bückte, mit ihren dick besohlten Schuhen die Packungen. Empört, wobei sie nicht wußte, wem sie mehr zürnen sollte, den Amerikanern oder den Deutschen, die sich in ihren Augen entwürdigten, schaute Ulrike von weitem zu. Doch plötzlich kam ihr einer der Soldaten entgegen, winkte mit einem gepolsterten, schaufelgroßen Lederhandschuh und rief: »Hallo, Darling! Hallo, kleine Naziweib!« Er gab ihr sonderbare Zeichen, lachte und steckte den Daumen der freien Hand zwischen Mittelfinger und Zeigefinger. Sie floh. Das rohe Gelächter der Männer, das Gekreisch umherstehender Frauen verwirrte sie. Als sie sich umblickte, sah sie, daß der Soldat ihr folgte, aus verzerrtem Munde immerfort ein grauenvoll gemeines Wort stieß, torkelte und schließlich über eine Bordsteinkante stolperte und niederschlug. Sie aber lief und lief, bis sie völlig außer Atem war, sich irgendwo in einer ihr unbekannten Straße wiederfand und sich, schwindlig geworden, gegen eine Hauswand lehnte. Es ekelte sie, und sie war immer noch blaß von Schwindel und Ekel, als sie die Villa der Frau von Pfuel betrat.
Die Mutter jedoch ahnte nichts von ihrer Verwirrung. Sie empfing sie mit ausgebreiteten Armen und führte sie sofort in ein Zimmer nebenan. Stolz wies sie auf drei mit weißem Damast überzogene Betten. »Ich habe sie eingetauscht«, sagte sie, und in ihrer Stimme klang eine seit langem nicht mehr gehörte Geschäftigkeit, »gegen die Perlen, du weißt doch, die ich zu deiner Konfirmation trug. Und unsere Wirtin hat uns ein zweites Zimmer abgetreten. Sei brav, bedanke dich bei ihr. Sie ist nun überzeugt davon, daß wir keine Kaschuben sind.« Ulrike schwieg. Noch betäubt von der Furcht vor den Soldaten, ließ sie die hektische Freude der Mutter und der Schwester über sich ergehen und nahm nur wie im Traume wahr, daß Ingeborg sogar übermütig in die Betten stieg und sich in den Kissen wälzte.
Der einen Anschaffung folgten andere, bald ein Schrank, ein neuer Tisch und Stühle, auch ein Rundfunkgerät, aus dem nun Abend für Abend amerikanische Tanzmusik und Nachrichten in deutscher, von englischem Akzent gefärbter Sprache schollen. Die Mutter saß davor, erfuhr zwar, daß die Rückkehr nach Danzig und Ostpreußen noch eine Weile dauern würde, schien aber dennoch wie umgewandelt. Offensichtlich machten ihr die Nachrichtensprecher Mut. Immer öfter griff sie nach der Tasche, die sie jetzt unter dem Kopfende ihres Bettes verbarg und auch hier eifersüchtig bewachte. Ulrike entdeckte, daß sie, sobald sie sich allein wähnte, einen zierlichen Messingschlüssel aus dem Rocksaum holte, die beiden Schlösser damit öffnete, die Klappe aber niemals höher hob als für einen kurzen Einblick erforderlich. Doch so oft auch die Mutter mit ihrer gesunden Rechten darin kramte, die Tasche nahm nie ab, stets blieb der blanke, nur an seinen Kanten ein wenig abgewetzte Lederbauch prall und rund. Wenn dann Ulrike die Tasche heimlich untersuchte, sie mit beiden Händen schüttelte und in sie hineinhorchte, vernahm sie lediglich ein Rascheln, das sie nicht zu deuten wußte. Die Mutter vergaß auch Ingeborgs Geburtstag nicht, der nur wenig später lag als der Ulrikes. Frisch vom Friseur gekommen, deckte sie den Tisch und schmückte das Wohnzimmer, den früheren »Sarg«, mit Blumen. Sie aßen mit silbernen Kuchengabeln eine Torte aus Kartoffeln und eingemengter Marmelade. Und eines Tages sagte sie: »Wir müssen nach Hamburg schreiben, an Onkel Neidhart. Wenn Vater sich durchschlägt, dann nach dort. Hamburg, das ist am sichersten. Neidhart sein Lieblingsbruder.« Und schließlich ermahnte sie sie und Ingeborg: »Ihr müßt auch wieder zur Schule gehen. Morgen bringe ich euch hin.«
Doch nirgends wurde unterrichtet. Ein Lehrer mit unangenehm knarrender Stimme, der das Lyzeum nur besetzt hielt, um Auskünfte zu erteilen, riet der Mutter, ihre Töchter zu den Bauern auf die Felder zu schicken. Das sei nützlicher jetzt als das Lernen, was denn auch und wozu, wenn man Geschichte nähme zum Beispiel, da doch nun Deutschland vielleicht eine Kolonie Amerikas wird wie Honolulu. Als Ingeborg das hörte, sah sie sich nach einer Arbeit um, die ihr erträglicher schien als die Plackerei auf der Erde und auch standesgemäßer. »Ich bin keine Kuhmagd«, antwortete sie. In der Küche eines Krankenhauses fand sie Anstellung, von dort brachte sie jeden Abend Suppenreste mit. Ulrike hingegen ließ sich an die Mittelschule verweisen, da das Lyzeum wegen Einsturzgefahr gesperrt war und es den Rüben - sagte der Lehrer - ohnehin gleich sein könne, ob sie von höheren oder mittleren Töchtern gerupft würden.
Täglich fuhr sie auf rumpelnden Pferdewagen, im Kreise anderer Mädchen und Jungen, in die Börde, auf die Gutsäcker eines Herrn Dr. Wanckel von Carlowitz, wie auf den Namensschildern der Gespanne zu lesen war. Jetzt endlich sah sie den Horizont, das Ziel ihrer Wünsche, frei von jeder Begrenzung vor sich, anders zwar als auf der Westernplatte, der Mole von Sopot oder auf Hel, aber ebenso weit und lockend wie über dem Meer.
Lieder wurden gesungen, die auch Ulrike kannte, selbst gesungen die einen, im Chor der Danziger Gudrun-Schule und während des Sportlehrgangs am Lagerfeuer auf der Marienburg, oftmals gehört die anderen bei den Aufmärschen des Jungvolks, Hoch auf dem gelben Wagen und Wir lagen vor Madagaskar. Zaghaft stimmte sie ein, fühlte sich anfangs zwar noch an die Seite gedrängt, rückte scheu an den äußersten Rand der Bänke, doch dann neckte sie ein Junge im Dialekt der Ostpreußen, Marjellchen und det Jellbe vont Eei, die anderen lachten, sie errötete, war aber hinfort in die Runde aufgenommen. Die Kleene is nich übel, wenn se ooch Beene hat wie'n Storch. Das war nun im Magdeburger Mischmasch. Sonderbar, die Bemerkung kränkte sie nicht, obwohl sie doch stets gefürchtet hatte, man könnte sich, was ja nun auch geschehen war, über die kleinen Häßlichkeiten ihres Körpers lustig machen.
Eines Morgens füllte sie ihren Frühstücksbeutel mit Kirschen, die ihre Schwester aus der Küche mit nach Haus gebracht hatte, rote Kirschen aus dem Süden, ein Wunder in dieser Zeit, reif und süß. Auf dem Wagen reichte sie sie reihum, war sofort umringt und gefeiert. Daher schöpfte sie Mut, nahm eine Kirsche in den Mund, spitzte die Lippen und schoß den Kern auf einen Jungen ab. Achim Steinhauer.
Gleich am ersten Tag war er ihr aufgefallen. Seine Blicke verwirrten sie. Obwohl kräftiger als seine Altersgefährten, beteiligte er sich nur selten an deren Balgereien, saß statt dessen still und ernst in einer Ecke des Fuhrwerks, beobachtete seine Umgebung, maß die Mädchen, maß auch sie, Ulrike, und zwar mit einer solchen Eindringlichkeit, daß es sie heiß überströmte und sie unwillkürlich den Rock fester um ihre kantigen Knie zog. Abends, vor dem Einschlafen, dachte sie an ihn, seltsam unruhig, versuchte, sich sein Gesicht vorzustellen. Weiche, von langen Wimpern umschattete Augen. Die dunkelblonden Haare fielen ihm strähnig in die Stirn, verliehen ihm etwas Wildes, Verwegenes, was weder zu seinen Augen noch zu seiner sonstigen Zurückhaltung passen wollte. Er trug eine Windjacke aus grauem, grobem Leinen und eine kurze, von einem breiten Uniformkoppel gehaltene Kordhose, die noch vom Jungvolk stammte. Adler und Hakenkreuz auf dem Koppelschloß waren abgefeilt.
Ulrike hatte ein Liebesspiel angestiftet. Lärmend taten die Jungen und Mädchen ihr nach, beschossen sich mit Kernen, neckten sich, spuckten, prusteten, spuckten.
Achim spürte die Feuchtigkeit auf seiner Wange, wischte sie ab. Er überlegte, warum die Kleine aus Danzig es ausgerechnet auf ihn abgesehen hatte. Sie gefiel ihm, ja. Dunkelblau ihre Augen, längst bemerkt, die Lippen vom saftigen Fleisch der Kirschen so rot und ein schneeweißes Lachen, das zudem an Hühnergegacker erinnerte und ansteckte. Er sah in die Runde. Der Trubel nahm zu, und außer Ulrike beachtete ihn niemand. Schnell klappte er das Revers seiner Jacke um und zeigte ihr das Abzeichen, das er daran befestigt hatte.
Zunächst entging ihr die flüchtige Bewegung. Sie zielte über den Daumen und schoß. Der Kirschkern prallte gegen etwas Blinkendes, Metallisches, nicht größer als ein Knopf, nur anders geformt. Doch ehe sie es genauer betrachten konnte, hatte Achim das Revers zurückgeschlagen. Ein Zeichen also allein für sie? Was hatte es zu bedeuten?
Auf dem Feld nahm sie die Reihen neben ihm. Doch da ihm die Arbeit vertrauter war als ihr, wuchs der Abstand zu ihm mehr und mehr an. Sie wollte ihm nach, unbedingt bei ihm bleiben, schuftete. Ihre Knie schmerzten, ihr Rückgrat wurde zum Durchbrechen schwach, so sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte ihn nicht erreichen.
Plötzlich stieß sie in ihren Reihen auf Pflanzen, die schon verzogen waren. Grüne Blättchen trockneten in der Sonne. Er hatte ihr ausgeholfen. Sie holte ihn ein. Und nun, den anderen weit voraus, kamen sie hinter einen Hügel und waren allein. »Ho!« und »He!« hörten sie die Jungen und Mädchen rufen. »Wenn ihr euch küßt, macht's nicht so heimlich. Sonst wird 'ne Hochzeit draus.«
»Was die sich denken«, sagte Ulrike, senkte aber den Kopf und blinzelte durch ihr störrisches Haar auf Achim. Als er nichts erwiderte, bat sie: »Laß mich noch einmal sehen ...«
»Was?« fragte er.
»Das da unter dem Aufschlag.«
Er setzte sich mit dem Rücken zum Hügel und klappte den Stoff um. Jetzt erkannte sie deutlich, daß daran ein HJ-Abzeichen steckte, der rotweiße Rhombus mit dem schwarzen Hakenkreuz in der Mitte.
Verblüfft schaute sie ihm in die Augen. »Hast du denn keine Angst, Achim?«
»Wovor?«
»Die Amis, hab ich gehört, die machen Jagd darauf, seit der Krieg verloren ist und der Führer tot.«
Der Führer tot. Das durchzuckte ihn. »Hör mal ...«