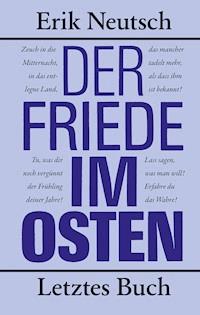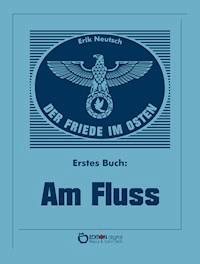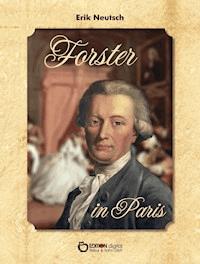10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geld, Frauen und das Gefühl, ein Herrscher zu sein auf dem Bau: Das vor allem gehört zum Bild vom angenehmen Leben für den unruhig von Baustelle zu Baustelle streunenden Glückssucher Hannes Balla. Er rebelliert, trumpft auf, wehrt sich: gegen die Anweisungen der Bauleitung, die Forderungen der Partei, gegen sein Gefühl für Katrin Klee, die junge Diplomingenieurin, gegen Horrath, den neuen Parteisekretär von Schkona. Und doch beginnt er zugleich an der Gültigkeit der lange gehegten Glücksideale zu zweifeln. Mehr und mehr ist er vor allem von Horrath und der Konsequenz seiner Haltung beeindruckt, von Horrath, der für ihn dem Bezirkssekretär gegenüber eintritt und sich nicht scheut, für das einmal als richtig Erkannte sogar eine Parteistrafe auf sich zu nehmen. So sind Ballas Rebellionen, ja sogar sein Schkonaer Streik nur Stationen der konsequent und mit all ihren Widersprüchen gezeichneten Entwicklung eines Menschen, der zur Erkenntnis seiner selbst und seiner Position in der Republik kommt. Und doch ist das keimende Freundschaftsverhältnis zwischen Horrath und Balla bedroht: Horrath scheint ein Doppelleben zu führen. Er weiß in seine persönlichen Beziehungen keine Ordnung zu bringen. Er vermag sich weder für Katrin Klee, die von ihm ein Kind erwartet, noch für seine Frau Marianne zu entscheiden. Wie wird sich Balla verhalten, wie Horrath? Wie entscheidet die Partei, nachdem bekannt wird, dass Horrath sie bewusst irregeführt, dass er geheuchelt, kein Vertrauen zu den eigenen Genossen gehabt hat? Erik Neutschs Buch führt mitten hinein in die Diskussionen um die Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der DDR, um Moral, Ökonomie, Kultur. Es stellt Fragen und zwingt den Leser zur ständigen Auseinandersetzung. Mit seinem großen Komplex von Konflikten und überzeugend gestalteten Charakteren wird es zugleich zur erregenden Widerspiegelung der Entwicklungsetappe in den 1960er Jahren. Erik Neutsch erhielt für dieses 1964 erschienene Buch den Nationalpreis für Kunst und Literatur der DDR. Frank Beyer verfilmte das Buch bei der DEFA. Der Film mit Manfred Krug und Eberhard Esche wurde zu den Arbeiterfestspielen im Juni 1966 in Potsdam uraufgeführt und begeistert aufgenommen. Auf Betreiben des Zentralkomitees der SED lief der Film nur wenige Tage, danach verschwand er bis Ende 1989 im Archiv.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1305
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Spur der Steine
Roman
ISBN 978-3-86394-392-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1964 bei Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Erster Teil
1. Kapitel
Sechzehn Schornsteine stützen den Himmel über der Stadt, höher aufragend als die höchsten Türme ringsum, sechzehn Fabrikschlote, in einer Reihe, staubgrau und steil, wie sie nirgends noch einmal in Deutschland zu finden sind. Tag und Nacht wälzt sich der Qualm aus den sechzehn Essenschlünden, Tag und Nacht. Er schwärzt im Winter den Neuschnee auf den Äckern, rußt im Frühling über die weißen Blüten der Kirschbaumzeilen an den Chausseen, trübt sogar im Herbst noch die novemberdunklen Flüsse und umflort im Sommer die heiße gelbe Sonne.
Wenn der Wind von Westen herüberweht, was nicht selten geschieht, dann drückt er den Rauch der Fabriken in die Straßen der Stadt, dann bringt er oft Regen mit, einen schmutzigen, klebrigen Regen, der den Ruß aufgesaugt hat und ihn auf das Pflaster, die Dächer, auf die Felder und die Baumkronen legt. Die Sonne brennt danach die Pfützen aus, die der Regen wie Blei in die Dellen schmolz, auf der Erde verdampft die Nässe; und der Ruß, der Schmutz bleiben. Alle Häuser tragen einen dunkelgrauen Putz, die Farben sind abgeätzt, die einstmals roten Dachziegel sind schwarz, die Fensterscheiben immer undurchsichtig wie Milchglas. Auch die Flüsse sind modrig, mit den Abwässern der Werke vollgepumpt, und die Weiße Elster ist nicht mehr weiß, sie ist von sumpfigen Teichen umufert, Überresten der Schneeschmelze, in denen sich die Zweige abgestorbener Bäume sperren.
Vom schornsteinzerspießten Himmel prallt die Sonne im Juli unerbittlich auf das Städtchen Schkona hernieder. Sie wird von einem braunen gleitenden Schleier verdeckt, aus dem sie nur milchig-matt hervorblinkt, aber ihre Strahlen wirken ungemindert. Die Blätter der Bäume sind stumpf, die Kirschen röten sich hektisch, die graugrünen Äpfel und Birnen sind unreif und holzhart. Die Steine glühen, an den Häuserwänden kleben die Fliegen, schwirren nur träge auf, wenn ein Schatten in ihre Facettenaugen dringt und sie scheucht. Der schwarze, zu Pulver gebrannte Staub auf den Straßen flattert in langen Fahnen hinter den Autos her, sickert in die Schuhe der Fußgänger, in jede Ritze der Kleidung, knirscht zwischen den Zähnen. Über allem zieht der Qualm, und die Luft ist geschwängert vom fauligen Geruch der Schwefelgase.
An einem solchen Tage heulten die Sirenen. Sie heulten zu einer ungewöhnlichen Stunde, kurz nach dem Mittag schon. Das Werk dröhnte, die Scheiben aller Hallenfenster zitterten, an den Mauern zerplatzte der vielstimmige Schall. Nirgends gab es einen Winkel, der im Lärmschatten blieb, dem Echo verborgen, dem langgezogenen Schrei, der auf und nieder wellte. Denn von allen Dächern heulten die Sirenen gleichzeitig, gellten auf mit einem plötzlichen Mal, sekundengenau: dreizehn Uhr und vierundzwanzig Minuten. Sonst immer, wenn die Sirenen zum Schichtwechsel riefen, setzten sie nacheinander ein. Von irgendwoher, von einer der fernen Fabriken, erklang dann ein dünnes Zirpen, die Sirenen in der Nähe kündigten sich mit einem Surren an, ehe sie losbrüllten. Immer ähnelte es einem Orchester, das sich allmählich erst einstimmte. Diesmal jedoch war es ein heftiger Schlag, ausgelöst von einem einzigen Befehl, von einem einzigen Druck auf den Knopf: Um dreizehn Uhr und vierundzwanzig Minuten erreichte der Ministerpräsident das Werk, schob sich der Troß der schwarzlackierten, staubüberpuderten Wagen durchs Tor.
Unter den Tausenden, die sich auf den unübersichtlichen, von den Hallen eingezwängten und mit Rohrleitungen überspannten Straßen der Schkonawerke entlangschoben und von den Sirenen zur Eile getrieben wurden, befanden sich auch die Ballas, acht Zimmerleute von den Baustellen, benannt nach ihrem Brigadier. Sie waren in den Strudel der Männer und der Frauen mit den Filzjacken, den öligen Schlosserkombinationen und den Laborkitteln geraten; ihre schwarzen breitkrempigen Hüte, die äußeren Zeichen ihrer Zunft, schwammen über der Menge wie die Blätter von Seerosen auf einem Teich. Von dem buntbeflaggten Gebäude der Kreisleitung herab stieß, nachdem die Stille urplötzlich wie der Lärm hereingebrochen war, eine Bläsergruppe in Blauhemden Fanfarensignale. Trommeln wirbelten, ihr Klang vermischte sich mit dem Getrappel der Füße auf dem Pflaster. Aus allen Hallentoren krochen die Menschen, schwitzten und schluckten hustend den Staub, der bis hoch zu den Fabrikgiebeln aufwallte, winkten und riefen sich Grüße zu, wenn sie einander entdeckten. Manchmal formierten sich Kolonnen, versuchten im Gleichschritt zu marschieren. Die Drei-Mann-Glieder ruckten jedoch unablässig zusammen und zogen sich, Harmonikabälgen ähnlich, wieder auseinander, weil die vorderen Reihen oft genug gezwungen waren, auf der Stelle zu treten, da kein Durchkommen war, je mehr sich die Menschen dem Platz der Kundgebung näherten. Rote, blaue und schwarz-rot-gelbe Fahnentücher ragten über den Köpfen auf, hingen schlaff an den Stangen herunter, die Luft bewegte sich kaum, sie flirrte nur vor Hitze. Immer wieder wandelten breite, farbige Spruchbänder oder Pappschilder die eine Losung ab: Wir fordern von Genf einen Friedensvertrag für Deutschland... Die Gedanken, die in diesen Tagen die Welt bewegten, waren zum Transparent geworden. Über sie würde auch der Ministerpräsident sprechen.
Wer sich dem Strom der vielleicht zwanzigtausend Menschen entgegenstemmte, hatte es schwer. Die Ballas hatten sich fest an den Händen gepackt und eine Schlange gebildet, die nun, je mehr sich das Gewühl verdichtete, immer heftiger bedrängt wurde. Voran ging der Brigadier, breitschultrig, einen Meter und achtzig groß; er ruderte mit dem freien Arm in jede Lücke hinein, die sich ihm bot, verteilte Püffe, wenn ihm jemand den Weg versperrte, erntete Flüche und Schmähreden. Er arbeitete verbissen, schob das Knie vor, drückte sich mit der Schulter gegen die Wand der Menschen, als gelte es, einen Balken zu heben, und zerkeilte sie. Doch die Anstrengung war umsonst, die Schlange zerriß, ein Brigademitglied nach dem anderen wurde abgetrieben. Jochmann klammerte sich verzweifelt an Ballas Jacke; der Brigadier spürte, wie sich der Zimmermann gegen den Druck wehrte, der auch ihn abzusprengen drohte; die Nähte des Manchesters krachten. Hinter Jochmann waren noch Kleimert und der kleine Nick. Seitab im Gedränge zappelte der Hut Franz Büchners, der Alte schwang sich von Zeit zu Zeit auf die Schuhspitzen, reckte den runzligen Hals, wedelte mit den Armen, damit ihn Balla nicht aus den Augen verlöre, und rief: "Wir treffen uns am Tor, Hannes, wenn alles schiefgeht..."
Sechs Stunden hatten die Zimmerer in der sengenden Hitze geschuftet, hatten vom blanken Morgen an Beton gestampft. Nach der Mittagspause waren dann auch die Bauarbeiter von den Gerüsten geklettert und hatten sich der Menschenflut angeschlossen, die aus den Chemiehallen quoll. Einer aus der Brigade hatte gesagt: "Kundgebung in dieser Glut, Balla, da kriegst du 'nen Knall. Ich wüßte ein schattiges Fleckchen und ein Mittel, das hilft." Unmißverständlich hatte er mit Daumen und Zeigefinger an den Hals geschnippt. Nur Jochmann – der noch immer an der Jacke seines Brigadiers hing und sich fast von ihm fortschleifen ließ – hatte die Lippen geöffnet und widersprechen wollen. Balla hatte ihm mit einem gewalttätigen Blick die Zunge gelähmt, hatte genickt und gedacht: Was soll's... Gegen die Bomben kommt keiner mehr an. Wenn sie diesmal fallen, dann von allen Seiten. Verschont bleiben nur die da oben vielleicht, wenn ihre Bunker tief genug sind. Ob nun auf die Straße gegangen oder nicht, gestorben wird doch. Genieße das Leben bis zum letzten Blutstropfen... Jochmann hatte geschwiegen, hatte keine Antwort gewagt. Balla beherrschte die Brigade, und wer sich ihm nicht auslieferte, der konnte gewiß sein, daß er von ihm den Laufpaß erhielt. Jochmann hatte sich gefügt, das Kommando galt, wie in der Armee, so auch hier. Aber die Baustelle der Zimmerer lag im Südwesten, und sie wollten nach dem Osten, nach Schkona. Sie mußten das Werk durchqueren und sich durch den Strom der Menschen wühlen, Schritt für Schritt, Fußbreit um Fußbreit, und diese Anstrengung brannte ihre Kehlen noch mehr aus.
Die Menge raunte, stampfte, sang und stank. Der Schweißdunst der Leiber mischte sich mit dem durchdringenden Geruch der Gase, die dem Werk entströmten. Balla war jeder Atemzug lästig. Der Staub, den die vielen Füße aufwirbelten, verklebte ihm Augen und Nasenlöcher. Das alles ekelte ihn an, ungestüm warf er sich gegen die Brandung, so daß Jochmann sich mit einem Zerren in Erinnerung brachte. Er hat Angst, dachte Balla, Angst, daß ihn seine Genossen entdecken, und darum läßt er sich nicht von mir abschütteln... Dicht neben sich hörte er jemanden sprechen: "Gespannt bin ich, was wohl Otto dazu sagen wird... Unser Außenminister, zum ersten Mal nimmt er an einer Konferenz der Großen teil..." Balla sah sich nach der heiseren, ihm vertrauten Stimme um. Im Taumel der vorübereilenden Gesichter erkannte er den Maurer Prokoff. Der hatte seine Drillichjacke ausgezogen, sein schmuddliges Hemd straffte sich über den gebräunten, feuchtglänzenden Muskeln. Als Prokoff den Brigadier der Zimmerer gewahrte, maulte er: "Und du? Machst wieder den Drückeberger, was?" Balla reckte drohend die Faust, wollte mit ein paar saftigen Worten entgegnen, grinste aber nur verächtlich und behielt seine Gedanken für sich: Prahlhans, nimmt den Mund nur so voll, weil er hingehen muß und seine Partei ihn am Gängelband hat, armer Kerl... Ihre Körper rieben sich aneinander, das Gewog der Menge klemmte sie ein. Balla stand nur noch auf einem Bein und schwankte. Jochmann preßte ihm die harten Knöchel seiner Hände in den Rücken und schob ihn mit aller Kraft weiter. Er senkte den Kopf, versteckte sich vor dem Maurer, verschanzte sich hinter den breiten Schultern seines Brigadiers vor dem Beschuß der Blicke. Balla bedeutete ihm mehr als der Ministerpräsident, Balla war jeder Tag, war das tägliche Brot, denn ohne ihn und seinen Bleistift wäre mehr Luft in den Lohntüten als Geld. Der Brigadier mochte ahnen, was Jochmann dachte, er drehte sich um, blinzelte und lachte übermütig. Büchners tanzender Hut war verschwunden. Balla entsann sich, daß er auf den Alten am Tor warten sollte.
Eine Reihe singender Mädchen, die sich fest untergehakt hatten, stellte sich den Zimmerern quer in den Weg. Balla bemerkte sie zu spät; die Mädchen juchzten, als er ihnen in die Arme lief, wankten hin und her und ließen sich nicht trennen. Dicht vor sich sah Balla den Stoff dünner Blusen, der unter den Achselhöhlen durchfeuchtet war, das leichte Zittern zweier fester Brüste. Er hatte Lust, sie mit seinen Händen zu umschließen, er hätte sich nicht einmal in diesem Getümmel davor gescheut. Aber unnachgiebig stieß ihm Jochmann die Faust ins Kreuz, drängte ihn vorwärts, bis die Kette der Mädchen zerriß. Wiederum wandte Balla den Kopf, schaute der gesprengten Gruppe nach und rannte erneut gegen ein Hindernis. Seine Füße verfingen sich, er stolperte, aber es war unmöglich, in diesem Gedränge zu stürzen, die Leiber hielten ihn auf. Er erhaschte mit seinen Blicken nur noch ein paar geschwungene Nackenbögen, blonde und braune Haare, die bald von grauen Filzjacken und ölverschmierten Schlosseranzügen verdeckt wurden.
Endlich schwächte der Anprall ab, das Gewühl lichtete sich. Die Ballas erreichten das Tor, der Brigadier klopfte den Staub von der Hose und zählte die Knöpfe nach, ob sie ihm nicht abgerissen worden waren. Er wartete auf Büchner und die übrigen Mitglieder der Brigade. Die Kundgebung hatte begonnen, aus den Tonsäulen, die die Werkstraßen säumten, erklang eine dunkle und ruhige Stimme: "... Solange verhandelt wird, wird nicht geschossen, und darum ist jede Verhandlung ein Sieg der Friedenskräfte über die Kräfte des Krieges. Unsere Aufgabe besteht darin, den Willen der Verständigung weiter zu stärken. Denn Verständigung ist Friede, und Friede ist die Grundlage für unsere Arbeit, ist die Grundlage zum Aufbau eines neuen Wohlstands, eines neuen glücklichen Lebens. In Genf müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß mit dem deutschen Volk endlich ein Friedensvertrag abgeschlossen werden kann..." Jochmann schien zu lauschen. Balla wunderte sich, für ihn waren die Worte hohles Getön. Franz Büchner kam mit Elbers und Bolbig, er hatte Galonski verloren, er sagte: "Ich habe gesehen, wie er sich mit jemandem geprügelt hat..."
Als Galonski schließlich erschien, fehlte ihm ein Ärmel an der Jacke. Im selben Augenblick scholl es aus dem Lautsprecher: "Ich sage euch, es wird der Tag kommen, an dem auch mit der Bonner Kriegspolitik endlich Schluß sein wird, wenn die Arbeiter sich zu einheitlichen Aktionen zusammenschließen und den ganzen Spuk, der das Leben der Nation gefährdet, hinwegfegen..." Beifall rauschte auf, Hochrufe ertönten. Balla dachte: Es ist immer dasselbe. Wenn, wenn... Sie vertrösten einen auf die Zukunft wie die Schwarzkittel aufs Jenseits. Niemand kann's nachprüfen, man erlebt weder das eine noch das andere...
Sie gingen. Aus den Tonsäulen verfolgte sie die Stimme: "Von unserer Republik geht der Friede für Deutschland aus. Wir bauen bereits die Straße, die in eine lichte Zukunft führt und die früher oder später die gesamte Nation beschreiten wird. Jeder muß Aufbauhelfer sein, mit seiner Arbeit, an seinem Platz. Die Verantwortung, die wir tragen, ist von wahrhaft geschichtlicher Größe. Sie zu erkennen und in ihrem Sinne zu wirken, daran beweist sich eine starke Persönlichkeit, beweist sich, ob der Mensch seine Freiheit errungen hat..."
Balla sagte: "Gibt es denn keinen, der uns davon befreit?" Er nickte in die Richtung des Werkes, wo die Lautsprecher dröhnten.
Seine Frage blieb unbeantwortet, sie tauchte ein in das träge Geschlurf der Schritte.
Die Müdigkeit verflog erst wieder, als das kalte Bier die Trockenheit der Kehlen aufschnürte. Die Zimmerer hockten in einer Kneipe in der Stadt um einen zerkratzten runden Tisch, an dem sie allesamt kaum Platz gefunden hatten. Ihr Lärm verscheuchte bald die wenigen Gäste, die vor ihnen eingetroffen waren, sich erfrischen und ausruhen wollten. Die Sonne stach durch die Schmutzkruste der Scheiben, warf die Schatten des Fensterkreuzes auf die schweißigen Gesichter, in ihren Lichtbalken walzte blauer Zigarettenrauch.
Hannes Balla hatte seinen schwarzen Hut schräg über das rechte Ohr gestülpt und so sein Gesicht gegen die aufdringlichen Strahlen abgeschirmt. Sein schmallippiger, harter Mund, die leicht gebogene, scharfgratige Nase und vor allem die glänzenden Augen unter den buschigen braunen Brauen lagen verdunkelt. Der Brigadier hob das Bierglas, trank in mäßigen Schlucken, setzte das Gefäß ab und zupfte selbstvergessen an der erbsengroßen goldgefaßten Perle, die durch sein linkes Ohrläppchen gestochen war. Wenn Balla trank, erst recht, wenn er lachte, was er nicht selten tat, wurden zwei Reihen gelbgeräucherter Zähne sichtbar, die oben ein wenig schief standen. Sein Lächeln wirkte stets durchtrieben und belustigt zugleich, so daß man eigentlich nie wußte, woran man bei ihm war. Es zerriß ihm jedesmal die von Wetter und Wind gegerbten Wangen, um seine Augen und Mundwinkel legten sich tausend Fältchen.
Balla schob seine sehnige Faust quer über die Tischplatte, berührte beinahe die schorfigen Knöchel Kleimerts. Sie beide waren die letzten im Spiel und knobelten die nächste Lage aus. Balla war an der Reihe, die Zahl der Streichhölzchen zu raten, die die Hände umschlossen. Er beobachtete jede Regung im Gesicht des Zimmermanns, er spürte, daß Kleimert auch ihn abforschte, und dachte: Hier sind wir gleichberechtigt, mein Junge, hier kannst du sogar versuchen, mich zu täuschen und zu hintergehen... Er ließ seine Faust leer und bluffte. Kleimert ging in die Falle, er verlor auch bei der Wiederholung und grinste säuerlich. "Du bist gerissen wie keiner, Balla", knirschte er, rief den Wirt und verlangte acht doppelte Wodka.
Das Spiel begann von vorn, und diesmal schieden Balla und Kleimert früher aus. Beide sahen sie, wie Bolbig den kleinen Nick am Hemdkragen packte, den Stoff zusammendrehte und den Jungen zu sich hinüberzog. Nick zappelte und schnappte nach Luft. Aber Gerhard Bolbig lockerte seinen Griff nicht, er hob die geballte Faust, fuchtelte wild vor Nicks Nase umher und drohte: "Sag das noch einmal, du Krabbe..." Nick japste, röchelte: "Und du... Du hast dich doch gedrückt... Vor der Arbeit... Heute früh..." Bolbig preßte Nick mit dem Nacken auf die Stuhllehne. Nick lief blau an, gab jedoch nicht nach, krächzte etwas, was nicht mehr zu verstehen war. Er tappte mit seinen Fingern nach dem Bierglas, erfaßte es zitternd und goß die Flüssigkeit in Bolbigs empörtes Gesicht. Sofort ließ Bolbig los, rieb sich erschrocken mit dem Handrücken über die Augen und wollte sich wutentbrannt auf den Burschen stürzen.
Kleimert blinzelte über sein Glas hinweg, er beobachtete den Brigadier noch immer. Er wußte, daß Balla jetzt toben würde, denn er duldete nie Streitigkeiten in der Brigade. Er wachte über die Verschworenheit der Zimmerer wie über sein Leben. Er würde jeden davonjagen, der daran zu rütteln wagte, seine Redensart war: "Wenn bei 'ner Mauer nicht jeder Stein fest am anderen bindet, wirft der erste Wind sie um."
Balla verständigte Kleimert mit einem einzigen Wink, und das hieß: Wir wissen, was wir voneinander zu halten haben. Dieser Bolbig ist erst seit Schkona bei uns, wir werden ihm unsere Sitten beibringen...
Balla irrte sich nicht, Kleimert würde ihm bedingungslos gehorchen. Vor sechs Jahren, am Abend eines ebensolchen hitzeprallen Sommertages, waren beide einander begegnet. Kleimert hatte noch das Zeugnis bei sich getragen, das ihm von der Oberschule ausgestellt worden war. Er hatte im Fach Deutsch eine Vier und in Geschichte gar eine Fünf erhalten. In Physik und Mathematik bekam er zwar Einsen, aber sie konnten seine schlechten Noten nicht ausgleichen. Kleimert wurde nicht versetzt und schob alle Schuld dafür seinem Deutschlehrer zu, mit dem er sich während des Unterrichts stets bekriegt hatte. In der Dunkelheit lauerte er ihm auf und verprügelte ihn jämmerlich. Danach aber getraute er sich nicht mehr nach Haus, nicht zu seiner kränkelnden Mutter und schon gar nicht wieder in die Schule. Tage und Nächte stromerte er umher, schlief in Scheunen und nährte sich von Obst und Gemüse, das er aus Gärten und von Feldern stahl. Als ihn der Durst peinigte, schlich er sich in eine Kneipe, traf Balla und bettelte ihn um eine Limonade an. Balla, der gerade seine Brigade gebildet hatte, fragte den Burschen, warum er kein Geld besitze, lachte schallend, als Kleimert schließlich drucksend von seinem Schicksal erzählte. "Bleib bei mir. Ich mach aus dir einen Zimmermann, daß deine Pauker vor dir den Hut ziehen sollen." Wohl aus Furcht vor der Blamage hatte der Lehrer nie gewagt, Kleimert zu verraten. Nur die Mutter hatte die Polizei benachrichtigt, daß ihr Sohn verschwunden war. Als man ihn fand, glaubte man, er habe sich lediglich verkrochen, weil er den Spott der Mitschüler fürchtete, und ließ ihn bei Balla. Dankbar war Kleimert seitdem seinem Brigadier von Baustelle zu Baustelle gefolgt. Er hatte von ihm das Handwerk erlernt und sich angewöhnt, in ihm sein Vorbild zu sehen.
Jetzt sprang Balla auf, klopfte die Bierlachen von seiner Manchesterhose. Er lachte nicht mehr, die Fältchen um Augen und Mund waren verschwunden. Er umklammerte Bolbigs Arm und bellte: "Besoffen, was? Die Staubecken laufen schon über, wie? Prügelt euch sonstwo... Aber nicht in meiner Brigade." Nick massierte seinen schmerzenden Hals und jammerte: "Sieh mich mal an, Brigadier. Mich gegen diesen Bullen da." Er deutete wütend auf Bolbig. "Fünf Japaner weniger hat er gekarrt, in der Knallsonne, heute früh... Die Wahrheit will er nicht hören."
Balla dachte wieder: Arbeiten muß jeder... Die Butter schmiert sich nicht von allein aufs Brot. Um das zu begreifen, dazu genügt auch das halbe Jahr, das Bolbig jetzt bei mir ist.
Der alte Franz Büchner nutzte die Pause. Er nahm zwei doppelte Wodka vom Tablett, das der Wirt watschelnd brachte. Wenn Balla der Wolf war, war Büchner der Fuchs. Kleimert kannte ihn ebensolange wie Balla und wußte, daß auch Büchner den Brigadier unterstützen würde. Wegen seiner Gewitztheit und seiner Erfahrung genoß der Alte den anderen gegenüber Vorrechte; nicht seines Alters wegen, nein, Balla wäre auch davor nicht zurückgeschreckt. Büchner mochte es ahnen, und so gebrauchte er seine Sondervollmachten stets nur mit unaufdringlicher Schläue, auch jetzt. Er drückte jedem der beiden Kampfhähne ein Glas in die Hand, um sie zu besänftigen, und zwinkerte belustigt. "Versöhnt euch, ihr Bäckerburschen. Ich hab mal einen gekannt in meinem langen Wanderleben, der hat auch immer, bei jeder Gelegenheit, sage ich euch, eine Schlägerei gesucht. Damit kam er eines Tages auch mal zu mir. Ich weiß nicht, warum, aber er wollte mit mir anbändeln. Da hatte ich zufällig eine Flasche Korn bei mir, in der Hosentasche. Ich greife hinein und sag ihm: Komm, sage ich, ehe du zuschlägst, trinke erst einen mit mir, dann rauft es sich besser. Schnaps ist für uns, was dem Samson seine Locken waren. Man braucht nur dran zu riechen, und schon wachsen einem neue Kräfte. Was soll ich euch sagen, er hat Gefallen daran gefunden, und wir haben die Flasche ausgekümmelt, wir beide. Dann hab ich ihm eins auf die Nase gesetzt, daß er sich nie mehr mit mir prügeln wollte..." Franz Büchner erzählte oft solche Geschichten; man wußte nie, ob man über sie lächeln oder gar nachdenken sollte, und auch nie, ob er sie wirklich erlebt hatte oder nur erfand. Nun legte er den Rand des Glases an seine runzligen Lippen und kippte das scharfe Getränk mit einem Ruck in sich hinein.
"Na, los schon", befahl Balla, als er gewahrte, daß sich Bolbig und Nick noch immer mißtrauisch bemusterten. "Oder ihr bestellt die nächsten."
Bolbig trank schnell, verschluckte sich und hustete: "Beuge mich nur dem ökonomischen Druck. Habe keinen Pfennig mehr in der Tasche."
"Nicht einmal saufen kann der." Nick behielt wie meist das letzte Wort.
Eberhard Galonski indessen ging an das Fenster, spuckte auf den Zipfel seines rotseidenen Halstuches und rieb über die Scheiben. Er wollte ein Loch in den Schmutz wischen, mühte sich aber vergebens, da das Glas von außen verklebt war. Galonski schrieb sich Briefe mit Bolbigs Schwester, er lief seinem älteren Freunde wie ein Hund nach. Auch er war erst vor wenigen Monaten zu den Ballas gestoßen. Er wäre Bolbig im Streit mit Nick beigesprungen, wenn der Brigadier ihn nicht schon allein mit seinen Flüchen daran gehindert hätte. Nun zog er sich zurück, sein Schädel summte. Er knebelte das Fenster auf, wedelte sich frische Luft zu und schaute auf den Marktplatz. Sein Blick fiel auf den unbeweglichen, staubtrüben und von Algen grün schillernden Teich. Die Hoffnung auf Wasser erregte in ihm das Gefühl, als spüle plötzlich eine kalte Dusche den heißen Schweiß von seinem Körper. Der stinkige Teich erschien ihm von verlockender Sauberkeit, und ohne Übergang sagte er: "Ich gehe baden. Wer kommt mit?"
Überrascht schwiegen die anderen. Nur Elbers zischelte aus dem Hintergrund: "Verrückt. Der Schnaps. Es ist der Schnaps. Wo willst du denn baden?"
Galonski nestelte schon an den silberweißen Perlmuttknöpfen seiner Jacke und schlüpfte aus dem einen Ärmel, der ihm noch geblieben war. "In dem Teich da. Ich halt's nicht mehr aus vor Hitze."
Gerhard Bolbig putzte gelassen seine Fingernägel. Jeder in der Brigade wußte, daß er sie sich an manchen Sonntagen wie ein Weib lackierte. Er sagte: "Wenn wir gehn, dann alle."
Franz Büchner ahnte sofort, was werden würde. Er ließ seinen Kopf auf die Tischplatte fallen, markierte Trunkenheit und lallte: "Ich hab mal – hick – einen gekannt in meinem – hick – langen Wanderleben..." Durch die Fingerritzen prüfte er, ob sich die anderen von ihm täuschen ließen.
Wiederum richtete Horst Kleimert seine Blicke auf Balla. Einige schrien schon wild durcheinander, so daß der dicke Wirt hinter der Theke nervös von einem Bein auf das andere zu tänzeln begann und um die Einrichtung seiner Gaststube bangte. In Ballas Augen sprangen Fünkchen auf, Kleimert waren sie vertraut. Sie hatten ihn damals bereits angeglüht, als ihn Balla in die Brigade gelockt hatte. Der Vorschlag versöhnte den Brigadier; was der eine von den beiden Neuen beinahe verdorben hätte, glich der andere wieder aus. Zwanzigtausend Menschen brieten jetzt zwischen den Chemiebuden wie in Pfannen, keuchten und schwitzten, aber die Ballas waren ausgerissen und nahmen ein Bad. Allein der Gedanke daran erheiterte. Kleimert erhob sich heftig, krachend schlug sein Stuhl um, Ballas Entschlossenheit steckte an.
Als Nick bemerkte, daß Elbers zurückblieb, sich nicht vom Fleck rührte, fragte er: "Und der Hauptmann? Der will sich drücken, was?"
An der Tür drehte sich Bolbig um und knurrte: "Los, Elbers. Wo wir ersaufen, ist schnuppe. In dem Teich da oder im Alkohol."
Martin Elbers blinzte den Burschen an und entgegnete: "Mätzchen sind das. Laßt mich in Ruhe damit."
Jochmann, ebenfalls berauscht und benommen, rief: "Kümmert euch nicht um den. Das hat er noch von den Nazis. Allüren aus dem Offizierskasino."
Balla dachte noch: Elbers wird sein Leben lang nicht wissen, wohin er gehört...
Die Tür klappte ins Schloß. Der Wirt atmete erleichtert auf. Er hatte Schlimmeres befürchtet. Zufrieden widmete er sich jetzt den Gläsern, wusch sie aus. Als Büchner gewiß war, daß die anderen den Raum verlassen hatten, richtete er sich auf und kicherte: "Von mir haben sie geglaubt, ich bin hinüber. In dem Schleimloch da draußen baden..." Er zirpte mit der Zunge an den Zähnen, schüttelte den Kopf. "Dir werden sie's übelnehmen, Hauptmann. Mir mit meinen fünfundfünfzig Lenzen nicht mehr."
Elbers drückte eine Kippe im Aschenbecher aus und griff sofort wieder nach der nächsten Zigarette. "Laß doch endlich den Hauptmann sein", murmelte er. Völlig ernüchtert grübelte er den Worten Jochmanns nach. Er litt darunter, daß niemand vergaß, woher er seinen Titel hatte. Vierzehn Jahre waren inzwischen vergangen, nicht vergangen war seine Vergangenheit. Sie hing ihm überall an, in den Akten, sogar in den Blicken, mit denen ihn dieser oder jener betrachtete. Ein einziges Mal hatte er in der Brigade erzählt, damals an der Talsperre noch, daß er Hauptmann in der faschistischen Wehrmacht gewesen war. Er bereute es tief, denn es verging seitdem kaum ein Tag, an dem er nicht mit dem Spitznamen, den die Zimmerer ihm zugelegt hatten, an die Zeit erinnert wurde, die er aus seinem Gedächtnis löschen wollte. Es lag immer etwas Geringschätziges in diesem Wort: Hauptmann. Vielleicht empfand er es selbst auch nur jedesmal als geringschätzig, weil er es nicht mehr hören wollte.
Franz Büchner blickte verdutzt auf Elbers, als der ihm nur unwillig antwortete: "Laß doch endlich den Hauptmann sein..." Er begann zu schwatzen: "Ich hab mal einen gekannt, sag ich dir, einen Kerl wie ein Baum. Eines Tages, es war schwül, und der Schweiß rann uns in Strömen aus der Haut, da packte den auch die Wut nach was Nassem. Wir arbeiteten damals an einer Badeanstalt, betonierten die Bassins. Und wir hatten wohl alle schon einen über den Durst getrunken, auch mein Kerl, der wie ein Baum war. Jedenfalls war das eine Becken schon fertig, und die Startblöcke standen auch schon. Aber es war noch kein Wasser eingelassen, wie das so ist, wenn an der Badeanstalt noch gebaut wird. Mein Kerl hat das gar nicht bemerkt in seinem Suff. Er ist auf den Startblock gestiegen und ins Wasser gesprungen, das noch gar nicht da war, kopfüber ist er gesprungen. Was soll ich dir sagen, wir haben ihn herausgeholt, er hatte aber nur eine Gehirnerschütterung. Weil er ein Kerl wie ein Baum war, wie unser Balla... Hörst du überhaupt zu?"
Martin Elbers sagte: "Du hast recht. Balla will mit dem Kopf durch die Wand. Wie eh und je..." Seine Gedanken waren über Büchners Erzählung hinweggelaufen.
Büchner merkte, daß Elbers ihm nicht gefolgt war, und seufzte: "Ach, dir ist auch nicht mehr zu helfen. Ich spendiere noch einen. Herr Wirt...!"
Elbers stand auf und ging an das geöffnete Fenster.
Der Marktplatz von Schkona war ein verträumter Winkel in dieser rauchigen Industriestadt. Er lag etwas abgeschieden vom Getümmel des Hauptverkehrs, das den Stadtkern mied. Nur von fernher vernahm man hier halbstündlich die Überlandbahn, die in den Kurven quietschte. Überragt wurde der Platz von den Türmen der Kirche, die aber schon hinter den zackigen Giebeln stand, und von der Pickelhaube auf dem Dach des Rathauses. Die breite, einstmals gelbgetünchte Front der Stadtverwaltung, an der schmiedeeiserne Gitter die Fenster absperrten und rote Geranien und violette Petunien in Blumenkästen wuchsen, begrenzte das Quadrat an der einen Seite. Rechtwinklig zu ihr verlief die Geschäftsstraße, von der nur ein winziger Ausschnitt zu sehen war, bepflanzt mit hochstämmigen, zwiebelförmigen Linden, die den Duft verwelkter Blüten ausströmten. An den beiden anderen Seiten des Quadrats kauerten altersschiefe, meist zweistöckige Wohnhäuser mit ausgetretenen, bemoosten Steinstiegen vor den Türen und verwaschenen Fassaden; sie hatten früher einmal den Honoratioren der Stadt gehört.
Eben noch hatte der Platz still in der Sonne gedöst. Jetzt wurde er von einem mächtigen Hallo aufgescheucht. Die Leute lüpften die Gardinen und horchten dem Lärm nach. Eine Postbotin riß erschreckt ihr gelbes Fahrrad von einer Hauswand, wollte es in Sicherheit bringen und stolperte dabei über die Bordkante. An den Schaufensterscheiben der Konditorei, des HO-Textilgeschäfts und des Friseursalons drückten neugierige Frauen und Mädchen ihre Nasen platt. Auch hinter den Geraniendolden des Rathauses tauchten die weißen Gesichter der Angestellten auf. Von irgendwoher erklang eine Radiostimme, dumpf und seltsam ruhig, sie mischte sich in das Geschrei der Zimmerer.
Dunkle Gestalten mit schwarzen Hüten und knallbunten Halstüchern schwankten über die Straße. Bolbig und Galonski sprangen als erste an den Teich, legten ihre Jacken auf den schmutzigen vergilbt-grünen Rasen, der das Wasser umgab, und lockerten ihre Hosengurte. Dicht vor dem Fenster der Eckkneipe tauchte Balla auf, auf seinem Nacken und in den Fältchen um Augen und Mundwinkel glitzerten kleine Schweißtröpfchen. Martin Elbers beobachtete den Brigadier, versuchte, ihm die Gedanken vom Gesicht abzulesen: Wir sind noch immer die alten, auch die beiden Neuen machen sich immer besser, als wenn sie mit uns schon über alle Baustellen gewandert wären...
Balla dachte es schwerfällig leichtmütig. Die Gedanken überstürzten sich, flogen wieder auf, Bier und Branntwein hatten auch ihn verwirrt, die Hitze schlug ihn wie mit einer Faust. Er lächelte in sich hinein, es war ein verzerrtes, beinahe blödes Grinsen auf seinen Lippen. Er gewahrte die Häuser und die Menschen um sich herum wie durch einen nebligen Schleier. Die Konturen der Gebäude verwischten vor seinen Augen, der ganze Marktplatz schien zu tanzen; es war belustigend. Balla fühlte, wie ihm die pralle Sonne ins Gesicht stach und mit ihrem grellen Licht seinen Kopf beschwerte. Er versuchte, nach ihr zu greifen, sie störte ihn. Er dachte: Wir werden noch lange nicht zur Ruhe kommen, selbst hier in der Heimat nicht, nirgends sind wir zu Haus. Das ist das Abenteuer, das große Abenteuer... Die Sonne, man müßte ihr alle Gerüste auf Erden entgegenbauen und sie mit einer Plane behängen, damit sie nicht mehr brennt. Wehe, es wagt jemand, die Ballas morgen zur Rechenschaft zu ziehen, weil sie baden gehen und nicht auf dem Firlefanz sind...
Das unsichtbare Radio dröhnte plötzlich in voller Lautstärke. "Wir bauen bereits die Straße, die in eine lichte Zukunft führt und die früher oder später die gesamte Nation beschreiten wird. Jeder muß Aufbauhelfer sein, mit seiner Arbeit..." Die Kundgebung in den Schkonawerken wurde übertragen.
"Musik!" schrie Balla. "Warum wird denn keine Musik gemacht?"
Galonski und Bolbig wateten ängstlich in den Teich. Bolbig betrachtete seine Fingernägel und rief: "Eklig, dieses schmierige Grünzeug in der Pfütze." Martin Elbers dachte: Immer hat er es mit seinen Fingernägeln, schon deshalb ist er unausstehlich...
Plötzlich kreischte der kleine Nick: "Meine Badehose! Ich hab keine Badehose an!" Unterhalb seiner Gürtellinie setzte sich die Haut weiß und blendend ab. Schnell zog er mit beiden Händen die staubfleckige Arbeitshose wieder hoch. Ein schriller Juchzer gellte über den Platz.
Die Stimme im Radio sprach von Genf und von einem Friedensvertrag für Deutschland.
Balla stockte, besann sich, er war nicht besser versorgt als Nick. Er lachte, daß alle Fältchen in seinem Gesicht sprangen, und brüllte: "Los, Männer, nackig!"
Martin Elbers versteckte sich hinter dem Fensterflügel. Diese Verwegenheit Ballas hatte er von Anfang an geahnt und gefürchtet. Jochmann schob sich an die Seite des Brigadiers und keuchte ernüchtert: "Mach ich nicht mit, Hannes. Wir sind keine Säuglinge mehr. Bei uns..." Er suchte nach einem Ausdruck, der überzeugen könnte, fand nur diesen: "Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses." Martin Elbers dachte wütend: Volksarmeeallüren, aber er gab dem Zimmermann recht. Jochmann stülpte den Hut wieder auf, den auch er bereits abgesetzt hatte, und wollte fliehen. Balla packte ihn an der Weste. "Bis nach Halle hab ich dich mitgenommen, he. Aber du hast noch immer nicht begriffen, daß wir Ballas ständig ein öffentliches Ärgernis sind."
Dieter Jochmann stöhnte unter Ballas hartem Griff. Elbers beobachtete, wie Nick aus den Hosenbeinen hüpfte und sich bäuchlings in das schlierige Wasser stürzte. Für diesen zwanzigjährigen Burschen, der elternlos aufgewachsen war, nicht einmal richtig schreiben und lesen konnte, galten die Worte des Brigadiers bis zuletzt. Galonski planschte wollüstig im Wasser, es reichte ihm bis knapp an die Hüfte, als er sich aufrichtete. Er streifte seine Badehose ab und warf sie mit einem Grunzen ans Ufer! An seinem Kinn hatte sich ein grüner Bart aus Algen gesammelt. Bolbig schwenkte mit dem Arm den nassen Tuchfetzen hin und her, stelzte mit langen Storchschritten an den Rand des Teiches und stellte sich schamlos zur Schau. Jochmann sträubte sich nicht länger, er fügte sich in das Unvermeidliche. "Ich mach's nur wegen der Solidarität, damit das klar ist." Wenn er sich jetzt noch gewehrt hätte, wußte Martin Elbers, wären die anderen über ihn hergefallen, Balla als erster.
Inzwischen waren im weiten Rund des Marktplatzes Türen und Fenster geöffnet worden. Die Verkäuferinnen und die Friseusen hatten die Geschäfte und den Salon verlassen und gafften. Manche drehten sich mit hochroten Köpfen ab und versteckten sich wieder hinter den Ladentischen und in den Kabinen. Selbst an den schmiedeeisernen Gittern des Rathauses drängten sich jetzt dicht bei dicht die Gesichter. Von der Stadtverwaltung herab scholl die unverkennbare Stimme des Ministerpräsidenten: "Die Verantwortung, die wir tragen, ist von wahrhaft geschichtlicher Größe. Sie zu erkennen und in ihrem Sinne zu wirken, daran beweist sich eine starke Persönlichkeit, beweist sich, ob der Mensch seine Freiheit errungen hat..."
Martin Elbers durchschauerte es kalt, als ihm bewußt wurde, wie unflätig sich Balla benahm. Er schaute sich nach Büchner um. Der trank noch immer Wodka. Der Wirt sagte: "Halten Sie sich raus, kann ich nur raten. Das ist politisch..."
Plötzlich schwieg das Radio. Über einen Fenstersims des Rathauses beugte sich eine Gestalt und schrie: "Soll man sich das bieten lassen... Direkt unter den Augen der Staatsmacht? Einsperren muß man das Gesindel."
Bald darauf wurde das schwere Portal des Rathauses aufgestoßen. Ein Wachtmeister schritt in gemessener, beinahe würdevoller Haltung die wenigen Stufen der Treppe hinunter und auf den Teich zu. Die Gaffer waren verstummt, sie warteten. Über den Platz hallten nur noch die trunkenen Rufe der Zimmerer, die sich unbekümmert in dem trüben Wasser wälzten. Der Polizist setzte die Trillerpfeife an die Lippen und stieß einen gellenden Pfiff aus. Die Badenden hoben verdutzt die Köpfe, gewahrten erst jetzt, wer ihnen gegenüberstand.
Der Wachtmeister nutzte die Stille. Er fühlte aller Augen auf sich gerichtet, zupfte an der Uniform und befahl: "Im Namen des Gesetzes, meine Herren, verlassen Sie sofort den Teich."
Jochmann erhob sich, vergaß, daß er unbekleidet war, und jammerte: "Ich hab's nur aus Solidarität getan, Genosse." Er tauchte sofort wieder unter.
Die Zimmerer brachen in schallendes Gelächter aus. Der Polizist zerstampfte wütend mit seinen Stiefeln den Rasen. Er wußte sich nicht zu helfen und fingerte nervös an seinem Gummiknüppel.
Aber Balla und Kleimert waren bei ihm, noch ehe er die Waffe in der Hand hielt. Jochmann wollte nichts mehr sehen und kniff die Augenlider zusammen. Die beiden stämmigen Zimmerer packten den zappelnden Polizisten und stießen ihn in das trübe Wasser des Teiches.
2. Kapitel
Um dreizehn Uhr und vierundzwanzig Minuten, als die Sirenen zur Kundgebung mit dem Ministerpräsidenten riefen, erwartete Oberbauleiter Richard Trutmann doppelten Besuch. Vor ihm lag das Fernschreiben aus Rostock, das ihm sofort nach seiner Rückkehr aus der Bezirkshauptstadt in die Hand gedrückt worden war und dessen Text lautete: "eintreffe spaeten nachmittag stop gruesse stop horrath." Soeben auch war ihm vom Betriebsschutz der Chemischen Werke telefonisch mitgeteilt worden, daß ihn Diplomingenieur Katrin Klee zu sprechen wünsche. Trutmann war froh, denn nunmehr galt er als abkömmlich, brauchte nicht an der Kundgebung teilzunehmen und durfte in seinem Zimmer bleiben. Ärztliche Vorschrift riet ihm, seinen anfälligen Kreislauf nicht übermäßiger Hitze auszusetzen. Er tupfte sich mit dem Taschentuch die Schweißperlen von der flachen, fliehenden Stirn, die durch eine Glatze über der vorderen Schädelhälfte verlängert wurde. In der Verwaltungsbaracke war die Luft ebenfalls bedrückend warm und stickig. Außerdem litt er noch immer unter der seelischen Belastung der letzten Tage, die er heute früh hatte abschütteln wollen. Es war ihm nicht gelungen. Das Gespräch in Halle hatte ihn erschöpft.
Es hatte nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. Er durchmaß es noch einmal Minute für Minute, sann, ob er nicht doch irgendeinen Fehler begangen haben könnte. Er mußte verneinen.
Richard Trutmann war oft aus dem Schlaf gerissen worden. Gedanken und Träume hatten einander gejagt. Entschlossen war er am Morgen in seinen Wagen gestiegen und zur Bezirksleitung gefahren. Er hatte sich der Partei anvertrauen und offenmütig bekennen wollen.
In Halle hatte seine Entmutigung damit begonnen, daß er nicht Herman Jansen antraf, den Ersten Sekretär, von dem er sich vor allem Verständnis erhofft hatte. Statt dessen empfing ihn ein Mann aus dem Apparat; "aus dem Apparat", wie das klang.
"Genosse Trutmann, was treibt denn dich schon in aller Frühe hierher?" Leutselig, freundlich, oberflächlich.
Richard Trutmann erzählte von den Schwierigkeiten auf der Baustelle, nein, auf den zwanzig Baustellen in Schkona, die ihm unterstellt waren. Vielleicht hatte er sogar ein wenig weitschweifig berichtet, wie ihm jetzt schien, als er das kurze Gespräch noch einmal überdachte.
"Ist das alles? Bist du deshalb gekommen? Wolltest du damit Herman Jansen überfallen?" Die Fragen überstürzten sich, Freundlichkeit wurde gegen bissigen Spott ausgewechselt. Der Mann begriff ihn nicht. Vielleicht war er ebensosehr mit Sorgen überhäuft wie er selbst, Richard Trutmann. Vielleicht kam täglich ein Betriebsleiter zu ihm, mit dem gleichen Anliegen, so daß er schon unempfindlich geworden war.
"Nein."
"Also, was ist?"
Richard Trutmann druckste, ehe er sich aufraffte und bekannte: "Ich spüre, ich bin meiner Aufgabe nicht länger gewachsen."
Der Mann schwieg, stand auf, atmete hörbar.
"Gebt mir eine andere Funktion." In der Stille klang es wie ein Hilferuf.
Der Mann lehnte sich breit über den Schreibtisch, sagte: "Gut, es ist immer besser, sich in wichtigen Angelegenheiten zu beraten. Aber..." Er ließ eine drohende Pause. "Aber wenn ich mich nicht irre, willst du uns die Arbeit vor die Füße werfen, willst du kapitulieren. Du bist für den Sozialismus, aber aufgebaut werden soll er ohne dich..."
Richard Trutmann zuckte zusammen. "Nein, nein..." Er mußte sich wehren, er fühlte sich völlig mißverstanden. Zu seinem Trost wurde ihm lediglich noch einmal versichert, daß vielleicht schon heute der neue Parteisekretär eintreffen werde. Gestern sei er mit Nachdruck vom Zentralkomitee angefordert worden.
Richard Trutmann war zurückgekehrt, ohne überzeugt zu sein. Er hoffte nur noch für später, daß nichts von diesem Gespräch an die große Glocke gehängt würde. Ein Rest Bitterkeit und Enttäuschung jedoch war ihm geblieben. Er spürte ihn auch jetzt.
Er mußte sich zwingen. Er griff noch einmal zu den Personalakten von Katrin Klee, um sich vor ihrem Erscheinen ein Bild von ihr zu machen. Der Fragebogen war sorgsam ausgefüllt, doch er verriet nicht mehr als üblich. Name, Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Geburtstag, zweiundzwanzig Jahre alt. Wohnsitz der Eltern Dresden, Vater Parteimitglied, bereits vor dreiunddreißig organisiert gewesen, jetzt Redakteur bei der sozialistischen Presse, Mutter Hausfrau. Katrin Klee studierte an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar, spricht Englisch und Russisch, ist selbst Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Jugendverbandes natürlich und anderer gesellschaftlicher Organisationen, ledig. Ihre Beurteilungen und Zeugnisse sind ausgezeichnet, das Diplom erwarb sie mit der Gesamtnote Gut. Von dem Paßbild, das mit einer Drahtklammer an den Fragebogen geheftet war, sah den Oberbauleiter ein hübsches, ovalgeschnittenes Mädchenantlitz an, umrahmt von dunklen, schweren Zöpfen. Trutmann ersparte sich, noch einmal den Lebenslauf zu lesen, der mit steilen Buchstaben und verschnörkelten Initialen geschrieben war. Was hätte ein Mädchen in diesem Alter, das offensichtlich während seines kurzen Lebens vom Elternhaus und vom Staate verwöhnt worden war, schon Bemerkenswertes in ihm niederlegen können! Man kennt das doch, Schule, Oberschule, Abitur, Hochschule, Diplom – das ist alles, zwischendurch vielleicht einmal die Masern oder die Gelbsucht.
Den Oberbauleiter beschlichen wieder die Bedenken, die ihm bereits gekommen waren, als er die Kaderunterlagen Katrin Klees zum ersten Mal gesichtet hatte. Die Chemiebaustelle der Schkonawerke schrie nach Ingenieuren, ja, aber nach solchen, die Erfahrung mitbrachten. Sie waren rar wie die Monate, in denen der Plan erfüllt wurde. Was aber sollte er mit Hochschulabsolventen anfangen? Nie zuvor hatten sie einen Bagger aus der Nähe gesehen. Ihre Hilflosigkeit, wenn ihnen erst die Erkenntnis dämmerte, daß hier nichts in die Schablone ihrer Schulweisheiten paßte, stiftete nichts als Verwirrung. Wie sollte sie sich auch zurechtfinden! War in den Weimarer Vorlesungen jemals ein Wort darüber gefallen, welche Kunstkniffe ein Bauleiter anwenden mußte, um mit zwei Dritteln der Arbeitskräfte den Plan zu schaffen? Hatte jemals ein Weimarer Professor berücksichtigt, daß an jedem Objekt hier mehr ehemalige Bäcker, Friseure, Landarbeiter und Gleisleger aus der Braunkohle bauten als echte Zimmerer und Maurer? Trutmann hatte dies alles doch schon an Hesselbart erlebt, auch einem Diplomingenieur aus Weimar, der noch immer auf dem Baugelände umherirrte, als sei er mit einer Rakete versehentlich auf den Mond geschossen worden. Und nun schickte ihm die Phantastenkommission vom Ministerium gar ein Mädchen, eins, das sicherlich hinter Reißbrettern stehen und sich die Fingernägel nicht beschmutzen wollte. Er erinnerte sich nicht, in seiner zwanzigjährigen Praxis jemals mit einem Ingenieur in Röcken zusammen gearbeitet zu haben. Wenn das Fräulein auf die Gerüste steigt, liegt eine ganze Baustelle still und dreht ihm ihre Augen unters Kleid... Die Ballas zum Beispiel, die nicht einmal vor ihm Respekt hatten.
Heute früh erst wieder war sogar er, Richard Trutmann, kleinmütig geworden, obwohl er mit Erfahrungen vollgesaugt war wie ein altes Haus mit Schwämmen. Vor zwei Jahren, als er die Leitung der Chemiebaustelle in Schkona übernommen hatte, war im das Vertrauen, das man in ihn setzte, höchst ehrenvoll erschienen, und er hatte sich geschworen, sich mit all seiner großen Beharrlichkeit, die man ihm oftmals nachrühmte, der neuen Aufgabe zu widmen. Er hatte ja stets verstanden, sich durchzubeißen, auf seiner Lebensleiter war er nach und nach, Stufe um Stufe hinaufgeklettert, nie ohne jenes Quentchen verbissener Rücksichtslosigkeit allerdings, das allen Leuten eigen ist, die in ihrem Streben weder auf Protektion noch auf irgendeine andere Begünstigung hoffen durften, und das man auch, hatten es bestimmte Umstände geläutert, Beharrlichkeit nennen konnte. Er hatte Maurer gelernt. Als der Krieg ausbrach, hatte er es bereits bis zum Polier gebracht. Man steckte ihn zu den Pionieren; während der Vormärsche ließ man ihn Brücken bauen, während der Rückzüge Brücken sprengen. In der faschistischen Wehrmacht trug er zuletzt den Feldwebelstern, soldatischen Eifer hatte er aber nur gezeigt, um mit ihm seine Lage zu lindern. Nach kurzer Gefangenschaft in die Heimat zurückgekehrt, bot sich ihm die Gelegenheit zu erneutem Aufstieg. Er gehörte zu den ersten Aktivisten in der Bauindustrie, sein Name wurde damals oft gepriesen, sein Bild hängten alle Zeitungen aus. Einmal erschien seine Photographie sogar auf dem Titelblatt einer Illustrierten, bunt und fremd lachte ihm sein Gesicht aus einem Kiosk entgegen. Trutmann schlich sich an die Auslagen heran, erstand ein Exemplar, bezahlte schnell, fürchtete, von allen Seiten beobachtet zu werden. Doch niemand nahm von ihm Notiz, er selbst erkannte sich kaum wieder, der Photograph hatte ihn arg verschönert, hatte sogar seine Glatze über der vorderen Schädelhälfte mit Haaren zugezogen. Auch in den Artikeln fand er seine bescheidenen Talente in einem Licht geschildert, das ihn erstaunte, dem er anfangs nicht zu trauen wagte, denn es glich einer Gloriole aus Heldentum und Edelmut. Als ihm jedoch immer öfter gratuliert wurde, keiner seine Zweifel zu teilen schien, verlor auch er den Unglauben an sich und sah sich immer öfter aus der Sicht der Journalisten. Es war nun nur noch eine Frage der Konsequenz, daß er in die Partei eintrat, als man es ihm vorschlug. Einen Sonderlehrgang beschloß er als Ingenieur, danach wurde er zum Leiter eines Kreisbaubetriebes berufen und ging als solcher nach Schkona.
Richard Trutmann wäre zufrieden gewesen, hätte sich am Ziel seiner Wünsche geglaubt, wenn die Baustelle nicht rasend gewachsen wäre, zu den drei Objekten, die er einst vorgefunden hatte, nicht innerhalb zweier Jahre zwanzig hinzugekommen wären. Das Chemieprogramm der Regierung, vor kurzem erst beschlossen, nahm Gestalt an, und zwar in hundert und mehr Fabriken, die plötzlich überall in der Republik aus dem Erdboden gestampft wurden, an der Oder, in Mitteldeutschland und in den Bergen. Er wurde Oberbauleiter in dem neugegründeten Riesenkombinat, und als er nun von der obersten Sprosse seiner Leiter hinunter in die Tiefe blickte, begann ihm zu schwindeln. Ehrlich vor sich selbst, fühlte er seine Grenzen, schon öfter hatte es ihn gedrängt, vor die Partei zu treten und zu sagen: "Nein, das schaffe ich nicht, es übersteigt meine Kräfte." Heute früh hatte er sich aufgerafft, war seiner Unruhe gefolgt und nach Halle gefahren. Er war abgewiesen worden, unverstanden und nunmehr verdächtig, kapitulieren zu wollen. Jetzt setzte er all seine Hoffnungen in den neuen Parteisekretär; der alte hatte ihn nicht zu stützen vermocht, war ebenfalls an der Verantwortung gescheitert, hatte sie stets abzuwälzen versucht. Vielleicht, vielleicht, dachte Trutmann, wird mir mit diesem Horrath wieder leichter. Er wollte sich endlich beraten können, denn er litt unter seiner Unsicherheit.
Zunächst aber trat Katrin Klee ins Zimmer. Trutmann, dick und behäbig, hob sich aus dem Schreibtischsessel, streckte ihr seine fleischige, rötlich behaarte Hand entgegen, während er sich vorstellte. Er war überrascht, das Mädchen glich kaum noch dem Gesicht auf dem Paßbild, das er soeben erst betrachtet hatte. Die Ingenieurin trug keine Zöpfe mehr. Das dunkle, fast schwarze wellige Haar reichte ihr nur noch bis in den Nacken, auf dem es einen blauschattigen, flaumigen Glanz hinterließ; ein paar widerspenstige Strähnen fielen ihr in die glatte Stirn. Die Augen ähnelten denen auf der Photographie vielleicht am meisten, sie lagen hinter langen, seidigen Wimpern verborgen, so daß die Farbe ihrer Regenbogenhaut nicht zu erkennen war. Sie verliehen dem Gesicht etwas Träumerisch-Zartes, was freilich mit der Fröhlichkeit, die aus den Zügen der Ingenieurin sprach, als sie ins Zimmer drang, nicht zu harmonieren schien. Sie ließ sich in einen der Sessel fallen, schlug die Beine übereinander, zupfte ungeniert den Saum ihres Rockes über die Knie, zündete sich eine Zigarette an und erklärte: "Da bin ich also, lieber Kollege. Einen Monat früher als angekündigt. Ich bin total erschöpft nach der langen Fahrt. Und dann dieses Gedränge im Werk. Ich habe ja nichts geahnt davon..."
Trutmann schockierte die Anrede: Kollege! Sie ließ keinen Abstand zwischen ihm und diesem jungen, unerfahrenen Ding. Sein Urteil stand fest, es hatte bereits vorher festgestanden, jetzt aber war es unumstößlich: eine Ballerina, die durchs Leben tanzen wollte. Man konnte ihr deswegen nicht einmal böse sein, sie war hübsch, und sicherlich hatte ihr das Leben keine anderen Vorstellungen von sich anerzogen. Solche Mädchen werden überall verwöhnt, überall drückt man für sie ein Auge zu. Aber die Baustelle ist nun einmal kein Parkett, damit basta. Ein wenig ärgerlich wurde Trutmann nur, als die Ingenieurin nun auch noch mit den Fußspitzen zu wippen begann.
Katrin Klee gewahrte den strafenden Blick und unterbrach erschrocken das Gewipp. Sie fragte jedoch dreist: "Sie scheinen nicht sehr erbaut zu sein über meine Ankunft."
Trutmann beherrschte sich, setzte zu einer langen Erklärung an. Taktvoll wollte er jeden Gedanken, den er während der Prüfung von Katrin Klees Personalien empfunden hatte, vermeiden. Er wollte das Mädchen nicht kränken, es aber dennoch dazu bewegen, die Baustelle wieder zu verlassen. Er war davon überzeugt, daß jeder weibliche Ingenieur, noch dazu, wenn er über keine Praxis verfügte, nur eine Belastung für ihn sein würde. Außerdem, wie das Fräulein aussah, würde es sich vielleicht sogar freuen, schickte er es zurück zu Mutti und Vati. Richard Trutmann sprach in einem Ton, der nicht verletzend klingen sollte, den er nur noch gewählt hätte, wenn das Mädchen seine Tochter gewesen wäre, dann allerdings nicht ohne einen gewissen Schuß Zorn über ein derartiges Getue: mit den Füßen zu wippen und Zigaretten zu rauchen. Jetzt blieb nur väterliche Besorgtheit: "Wenn ich Ihnen gütigst raten darf, liebes Fräulein Klee, dann kehren Sie schleunig wieder um. Holen Sie erst gar nicht Ihr Gepäck vom Bahnhof."
"Ich habe ein Taxi genommen. Meine Koffer stehen beim Pförtner."
Trutmann schluckte. "Dennoch. Steigen Sie in den nächsten Zug, fahren Sie zurück nach Dresden. Glauben Sie mir, ich meine es gut mit Ihnen. Hätte ich eine Tochter in Ihrem Alter, nie würde ich es erlauben, daß sie die rohen Sitten einer Baustelle auch nur einen Tag an sich erführe. Als Oberbauleiter weiß ich nicht einmal – aus Gründen, die Ihnen zu erklären ich mich scheue –, wo ich Sie einsetzen könnte. Ich habe darüber schon vergeblich nachgedacht, als mir Ihr Besuch angekündigt wurde. Stenotypistinnen, Reinemachefrauen, ja, auch daran leiden wir Mangel, was sich denken läßt, weil kein Mädchen, das – entschuldigen Sie – etwas auf sich hält, auf den Bau geht. Und Sie wollen sogar als Ingenieur anfangen..." Er lächelte ungläubig und ein wenig ironisch, was sich mit dem bisherigen Tonfall nicht recht vertrug. "Nein, nein. Ich bitte Sie inständig. Kehren Sie um." Er dachte auch: Wer einmal in diese Mühle gerät, der muß sich mahlen lassen, wie ich heute früh, in Halle, und um dich wäre es schade, mein Kind...
Katrin Klee lehnte sich in den Sessel zurück und zerdrückte ein Seufzen. Sie schloß für Sekunden die Augen. Trutmann musterte sie, ahnte wohl ihre Enttäuschung, und beinahe tat sie ihm leid. Er tadelte: "Und dann – wenn ich mir noch eine Bemerkung gestatten darf – ich verstehe Ihren Vater nicht. Er ist doch ein erfahrener, hartgeprüfter Mann." Trutmann nahm auch diese Kenntnis aus den Akten. "Wie konnte er Sie nur hierher reisen lassen?"
Katrin Klee stand plötzlich auf. Trutmann befürchtete schon, er habe sie nun doch beleidigt. Aber er konnte nicht wissen, daß er nur einen alten Trotz in ihr geweckt hatte, indem er sie an ihren Vater erinnerte. Sie glättete ihren Rock, rückte an der knallbunten Bluse und fragte hart: "Also, wo kann ich schlafen?"
"Wenn Sie meinen Rat unbedingt in den Wind schlagen wollen, liebes Fräulein..." Trutmann stemmte sich hoch, schüttelte mißbilligend den Kopf und war ehrlich bekümmert. Gleichermaßen verwunderte ihn aber auch die Energie, die das Mädchen plötzlich wie einen Bogen spannte. "Melden Sie sich im Wohnlager, doch erschrecken Sie nicht, es ist kein Hotel. Vielleicht treiben wir bald mit Gottes Hilfe ein Zimmerchen für Sie auf." Er lächelte, wieder nicht ohne Ironie, denn er gab sein Urteil nicht auf: Ballerina, launisch dazu. "Das heißt, wenn Sie dann noch immer danach verlangen."
Katrin Klee entnahm ihrem Handtäschchen einen Spiegel und prüfte sich in ihm. Sie führte ihre Lippen dicht an das Glas, um zu sehen, ob die blaßlila Schminke einer Korrektur bedurfte. Mit den Fingerspitzen ordnete sie flüchtig das Haar. Trutmann hüstelte, halb verlegen, halb gemahnend, daß sich die Ingenieurin in Gesellschaft befände. Katrin Klee lachte belustigt, meinte damit wohl aber die ironische Anspielung in den Worten des Oberbauleiters und sagte: "Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden. Bis morgen dann, und auf gute Zusammenarbeit bis in alle Ewigkeit." Trutmann bemerkte, daß ihr noch dieses bissige Amen auf der Zunge lag, was ihn wiederum entrüstete, obwohl es unausgesprochen blieb. Er drückte ihre schmale Hand, durch deren Haut bläuliche Äderchen schimmerten, öffnete die Tür und sagte: "Ja, ich erwarte noch Besuch."
Katrin Klee fragte spöttisch: "Auch einen Ingenieur, dem Sie das Bleiben vergällen wollen?"
Richard Trutmann entgegnete, heftiger, als ihm lieb war: "Nein. Horrath. Den neuen Parteisekretär."
Katrin verließ den Oberbauleiter mit weit weniger spöttischer Heiterkeit, als ihr Verhalten vorgab. Sie hatte gehofft, mit offenen Armen empfangen zu werden. Ihr Wunsch war es gewesen, damals in Weimar, als Architektin irgendwo in einem Projektierungsbüro für den Wohnungsbau zu arbeiten, insofern hatte sich Trutmann in ihr nicht einmal getäuscht. Doch dann war die Kommission des Ministeriums an der Hochschule aufgetaucht und hatte unter den Angehörigen der Absolventenklasse für die Chemiebaustellen geworben: Das Chemieprogramm sei jetzt wichtiger als alles andere. Seitdem hatte sie sich eingebildet, in Schkona dringend gebraucht zu werden. Doch nun fühlte sie sich durch die Ratschläge Trutmanns, so väterlich-besorgt sie auch geklungen hatten, abgewiesen und verraten, und ihr Mut war gesunken. Ihr Seufzer hatte davon gezeugt, wenn sie ihn auch mit einem Biß auf die Lippen zerquetscht hatte. Als sie aber die Frage vernommen hatte, die sie an ihren Vater erinnerte, war ihr alter Trotz erwacht: Nun erst recht.
Die erste Gefühlsregung, die Kati, wie man sie meist nannte, ihrem Vater gegenüber jemals empfunden hatte, war Entsetzen gewesen, ein lähmender Schreck, der ihre Kindheit lange beschattet hatte. Sie und ihre Mutter waren in ein dumpfes Kellerloch gepfercht worden, an dessen Wänden das Wasser silbrige Tropfen bildete, die die Mutter stets mit einem Tuch aufsaugte, indem sie sagte: "Selbst die Steine haben Tränen..." Die Stadt war ausgebrannt, in einer Nacht, die Trümmerreste, geborstene Mauern und verkohlte Balken, trugen noch immer einen rauchigen Geruch durch die zerstörten Straßen, obwohl in ihren Spalten bereits Unkraut emporschoß, grün und mit weißlich-gelben Blüten. In die Stadt waren Soldaten gekommen, auf den Schneisen zwischen den Ruinen standen Panjewagen und struppige Pferdchen, die Kati jedesmal, wenn sie an ihnen vorüberschlich, am liebsten gekämmt hätte, wie sie es mit einer versengten Puppe tat, die sie vor dem Feuer gerettet hatte. In den Fabriken wurde nicht mehr gearbeitet, die Mutter hockte nun den ganzen Tag über in der Kellerhöhle, Schneewittchens Sarg, wie Kati sie noch immer insgeheim nannte, obwohl ihr die Mutter erschrocken den Mund zugehalten hatte, als sie hier eingewiesen worden waren und sie gefragt hatte: "Ist das der Sarg von Schneewittchen, Mama?"
Kati liebte alle traurigen Märchen, die traurigsten Stellen darin las sie unzählige Male, stets begann sie in dem verschlissenen Buche dort, wo Rotkäppchen von dem Wolf verschlungen wurde, Dornröschen in einen hundertjährigen Schlaf fiel und Schneewittchen von den sieben Zwergen zu Grabe getragen wurde, stets brach sie dort ab, wo noch keine Aussicht auf Rettung bestand. Immer dann mußte sie weinen, in ihrer reichen Phantasie empfand sie jedesmal das Schicksal der armen Mädchen nach, aber sie ersann auch selber stets aufs neue die wunderbarsten Varianten für ihre Erlösung, was schließlich eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen wurde. Besonders fühlte sie mit Schneewittchen; alles, was sie tat, wenn sie nur Kartoffeln schälte oder das Geschirr spülte, tat sie wie Schneewittchen, denn sie hatte öfter als einmal die Nachbarinnen aus der alten Wohnung sagen hören: "Das Kind ist wie Schneewittchen, aber es ist eine Schande, daß sich ihre Mutter so gehen läßt... Soll sie doch endlich ihren Sträfling vergessen..." Zwei Worte hatten sich seitdem in Katis Gedächtnis eingeprägt: Schneewittchen und Sträfling; und seitdem zweifelte sie nicht mehr daran, daß sie verwunschen war, irgendwann würde ein strahlender Prinz zu ihr kommen und sie wachküssen. Dann würde die Mutter sie mit Gold und Silber und mit schönen Kleidern beschenken, damit sie nicht mehr auf den bösen Geist zu warten brauchte, auf den Sträfling, dem die Leute soviel Schlechtigkeiten nachsagten und von dem die Mutter nur in großer Angst sprach – denn nicht anders deutete Kati die Vorsicht der Mutter.
Eines Tages jedoch hatte die Mutter Kati an die Hand genommen und war mit ihr in den Trümmerberg geklettert, der von dem Mietshaus übriggeblieben war, in dem sie einst zwei enge Zimmerchen besessen hatten. Mit einem Stück Kalk, das die Mutter mit ihren Fingernägeln aus einer Fuge gekratzt hatte, schrieb sie auf eine Fläche heiler Ziegel: "Paul, wir leben! Richthofenstr. 11." Kati buchstabierte den Namen, eine tiefe Ahnung, daß nun der Geist erscheinen müßte, befiel sie, und sie fragte: "Paul? Mama, wer ist das?" Die Mutter preßte sie an sich und antwortete: "Der Vater, ach, Kind. Nun wird er kommen, und alles ist wieder gut." Für Kati hatte das Wort Vater nur den Klang von etwas sehr Heimlichem, Verbotenem; wenn sie manchmal in der Schule danach gefragt worden war, war sie jedesmal zusammengezuckt. Jetzt nun spürte sie das freudige Zittern in der Stimme der Mutter, doch sie begriff es nicht. In ihrer kleinen phantasiegeschüttelten Vorstellung überstürzten sich all die Namen, die sie in der letzten Zeit gehört hatte und die sie nur halb begriff: Sträfling, Paul, Vater, böser Geist... Ihre Träume wurden damit belastet. Völlig grundlos, wie es jedenfalls der Mutter schien, fing sie manchmal bitterlich zu schluchzen an. Kati aber wagte nicht, sich mit einer zweiten Frage zu vergewissern, sie fürchtete, die Zauberformel nicht finden zu können, die sie aus ihrer Verwunschenheit befreite. Sie zermarterte sich ihr kleines Hirn, und sie beschloß am Ende für sich, der Mutter mehr als den Nachbarinnen und den Lehrern zu trauen und die Namen Paul und Vater demjenigen zu geben, der sie erlösen würde. In ihrer Einbildung nahm er die Gestalt eines lachenden Jünglings an, der in dunkelrote, glitzernde Gewänder gekleidet war und ein Schwert und eine Krone trug wie der Prinz, der auf einem der Bilder in ihrem Märchenbuch dem Sarge Schneewittchens folgte.
Doch das Mädchen wurde bitter enttäuscht. Auf der obersten Stufe der finsteren Kellertreppe stand plötzlich ein Mann, der in nichts ihrem Phantasiegebilde glich, eher einem Gespenst ähnelte. Seine Füße steckten in unförmigen, groben Schuhen, um die Schultern hing ihm ein Mantel wie eine zerlumpte Decke. Der Mann stützte sich mit beiden Fäusten auf das Geländer, daß es knackte, und suchte mit einem zaghaften, zärtlichen Ruf den Raum ab: "Bettina? Betti?"
Die Mutter saß unter einer Petroleumlampe, deren Docht flackerte, und stopfte. Die Dämmerung von der Straße warf durch ein niedriges Fenster schummriges Zwielicht in die Notwohnung. Die Mutter schien zu erstarren, als sie die Stimme vernahm. Dann ließ sie die Schere fallen, sprang auf und schrie: "Paul, Paul..." An der Decke geisterte ihr Schatten. Sie redete wirr. "Liebster... Paul! Wo bist du..."
Kati drückte sich scheu in die Nische unter der Treppe. Sie wagte kaum zu atmen. Die Mutter und der Fremde lagen sich in den Armen. Sie küßten sich und weinten. Auch der Mann weinte, seine Augen waren stark gerötet, waren wie Blutflecken. Alles an dem Fremden, der Paul hieß, sah häßlich aus. Durch das Gitter der Stiegen hindurch beobachtete Kati genau sein Gesicht. Seine Haut war runzlig und gelb. Der Mund, ein Loch ohne Zähne, gähnte schwarz, wenn er sich von dem der Mutter löste. Die Wangen waren eingefallen, mit kurzen, schmutzigen Stoppeln besät. Unter dem Mantel trug er einen Anzug aus lauter Streifen.
Als Kati mit der fremden, brüchigen Stimme ihren Namen nennen hörte, duckte sie sich noch tiefer in die Nische, umklammerte ihre Puppe und ängstigte sich sehr. Die Mutter sagte verstört: "Um Gottes willen. Wir haben sie ganz vergessen. Sie kennt dich doch gar nicht, Paul... Und sie war in den letzten Tagen schon so sonderbar. Wo mag sie nur sein?" Paul sagte: "Vergiß nicht, Betti, ich habe sie zum letzten Mal gesehen, als sie sechs Wochen alt war..." Kati verstand von alledem nichts, sie rührte sich nicht, riß nur ihre großen, dunklen Augen auf und verfolgte, wie die Erwachsenen sie suchten, ihre Mutter und der Fremde.
Als sie gefunden wurde, bebte sie am ganzen Leib. Der Mann hob sie in wilder Freude an seine Brust. Er stürzte mit ihr ans Licht, grub seine harten Bartstoppeln in ihr Gesicht, drückte sie, küßte sie und betrachtete sie mit dem Ausdruck rasender Sehnsucht. Kati schluchzte krampfhaft. Die Mutter versuchte, sie zu trösten, sie lachte unter Tränen. Kati hatte die Mutter noch nie so gesehen. Der Mann stammelte: "Was zitterst du, mein Vögelchen... Erkennst deinen Vater nicht... Diese Lumpen, sie wollten dich vaterlos machen... Diese Lumpen... Liebling, Töchterchen, sag doch was..." Und Kati sagte das Wort, das noch niemand von ihr gehört, doch das sie immer gequält hatte: "Du bist ja ein Sträfling."
Die Mutter erschrak. Der Mann sank auf die Stahlrohrpritsche und vergrub das Gesicht in den Händen. Kati verkroch sich wieder in eine Ecke. Der Mann stöhnte: "Hast du's ihr nicht gesagt?" Die Mutter jammerte: "Wie konnte ich... Ich durfte doch nicht. Sie hätte es nicht verstanden." Kati war von Entsetzen gepackt...
Und dennoch war der Mann ein Erlöser. Je länger er blieb, desto mehr schien sich Katis kleine Welt zu vergolden. Kati merkte es zuerst an der Mutter, die nun sehr oft fröhlich war und lachte und gar nicht mehr, wie früher, stumm und traurig vor sich hin blickte. Sie wurde schön, wie sie vordem nie gewesen war, der ewige Rauchgeruch an ihr verschwand, sie duftete wie eine Blume. Kati hätte sie jetzt gern den Nachbarinnen gezeigt, die einmal so schlecht von ihr gesprochen hatten. Aber auch die waren verschwunden, mit ihnen die Männer in den braunen und schwarzen Uniformen, den Stiefeln und Helmen. Kati war überzeugt, daß es böse Feen und Gnomen gewesen waren, die nun wie Rumpelstilzchen in den Erdboden versunken waren, zur Strafe für ihre Unfreundlichkeit. Statt ihrer kamen jetzt viele andere Männer und Frauen zu Mutter und Vater, manchmal auch solche, deren Sprache Kati nicht verstand. Sie setzten sie auf ihre Knie, schaukelten sie und übten mit ihr wunderliche Wörter: Spassibo, doswidanja, adjin, dwa, tri, kukla – was ist das? – die Puppe. Oftmals blieb der Vater mehrere Tage fort, aber jedesmal, wenn er jetzt wieder nach Haus kam, brachte er Geschenke mit, zu Katis achtem Geburtstag eine Puppe und einen Puppenwagen. Wie die Mutter erhielt auch Kati neue Kleider, die keine Sengflecken mehr hatten, einen wolligen Mantel und Schuhe aus weichem, schmiegsamem Leder, ohne die steifen Holzsohlen, die die Füße wund gescheuert hatten. Der Vater räumte die knarrende Pritsche fort, auf der Kati bisher mit der Mutter gemeinsam geschlafen hatte, sie durfte fortan allein in einem Bett mit weißen Bezügen liegen, in denen sie viel schöner träumen konnte. Und schließlich verließen sie auch Schneewittchens Sarg, die feuchte Kellerhöhle, und zogen in ein Haus mit vier Räumen, das Kati ein Schloß dünkte. Dort erhielt sie sogar ein Zimmer für sich, vor dessen Fenster ein Apfelbaum seine Zweige reckte; man brauchte nur in sie hineinzugreifen, um sich tüchtig satt essen zu können. Kati freundete sich mit dem Vater an, sie schwor sich, nie wieder jenes häßliche Wort zu ihm zu sagen: Sträfling, und sie vergaß es auch bald, denn nichts erinnerte sie mehr an den Mann, der plötzlich, kahlköpfig, in gestreiften Lumpen und mit blutroten Augen, auf der Treppe gestanden hatte. In ihrer stark ausgeprägten Empfindsamkeit erfühlte sie aber auch, daß sich der Vater vor diesem Wort fürchtete, daß er vor allem deshalb um ihre Zuneigung rang, damit er es nie mehr zu hören brauchte. Kati geizte nicht mit ihren Liebkosungen, um so mehr, als sie bald herausgefunden hatte, wie sehr sie der Vater dafür jedesmal belohnte; er schlug ihr kaum einen Wunsch ab. Nur manchmal noch in den Nächten wurde Kati von der Erscheinung des ersten Tages gepeinigt, am Morgen danach war sie dann immer in Schweiß gebadet, und nur dann verübelte sie es dem Vater, daß er zu ihr nicht als Prinz in dunkelrotem Samt und mit glitzernder Krone gekommen war.
Viel später erst begriff Kati, was sie ihrem Vater wirklich zu verdanken hatte, dem Menschen Paul Klee, und nachträglich litt sie heftig unter der Beschimpfung, die sie ihm, obgleich unwissend, zugefügt. Ihre tobende Phantasie hatte sich zwar gelegt, war aber nur in eine empfindsame Gefühlstiefe übergewechselt, die das Mädchen nun fast wider Willen zwang, sich in die Lage aller Geschöpfe hineinzuversetzen, die es leiden sah. Im Unterricht vernahm Kati von den Taten und Opfern der deutschen Antifaschisten, mit ihrer Klasse besuchte sie das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald, in dem auch ihr Vater gefoltert worden war. Mehrmals wurde ihr schwarz vor Augen und speiübel, als sie die Stätten des Grauens besichtigte, den Steinbruch, den Pferdestall mit den Meßlatten für Genickschüsse, die Prügelböcke, die Todeszellen, den Keller des Krematoriums, die Keulen, an denen noch das Blut und die Hautfetzen der Erschlagenen klebten, die Hakenreihe der Galgen, den Verbrennungsofen, die Berge von Kinderschuhen, das geschorene Haar der Frauen... Aber sie wich der Wahrheit nicht aus, sie befahl sich, auf die Stimme des Mannes zu hören, von dem die Schüler geführt wurden; sie wollte alles über den Sträfling Paul Klee wissen, die Worte dröhnten in ihren Ohren, die Nerven peitschten sie. Sechs Wochen war sie alt, als die Gestapo ihren Vater verhaftete, einen Metallarbeiter, der Flugzeuge bauen mußte und Flugblätter verteilte, die den Krieg der Legion Condor gegen das spanische Volk anprangerten. Keine Qual des Lagers blieb ihm erspart, sieben Jahre lang; Briefe von seiner Frau erhielt er kaum noch, über ein verstecktes Radio empfing er die letzte Nachricht von der Zerstörung Dresdens, danach war alles tot. Er war unter denen, die das Tor stürmten, er schlug sich zu Fuß bis in die Heimat durch, rastete kaum, schlief kaum, hetzte nur immer dem Augenblick entgegen, in dem er Frau und Kind wiederzusehen hoffte. Er durchwühlte die eingeäscherten Häuser, stieß auf die verwaschene Inschrift: Wir leben, und dann rief er nach Bettina, und dann suchte er nach dem verschüchterten Mädchen, bettelte um einen Laut von seinen Lippen und hörte: Sträfling...