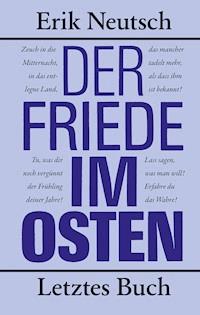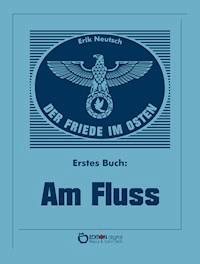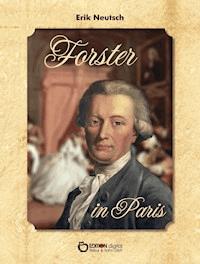5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Stühle bleiben leer bei einem Absolvententreffen: Uwe Tolls und Wolfgang Lichterfeld sind nicht erschienen. Der Ich-Erzähler, Direktor der Schule, geht den Lebensläufen seiner ehemaligen Schüler nach, fragt sich und andere, was mit ihnen geschehen ist, dem hochbegabten Lichterfeld, dem Klassenbesten, der Medizin studierte, und dem schwarzen Schaf der Klasse, Uwe Tolls, der überraschenderweise Offizier der NVA wurde. Aber die Fragen des Erzählers zielen über die Schicksale seiner Helden hinaus. Sie bewegen sich um das Problem der Erziehung als gesellschaftliche Aufgabe. Wie erziehen wir junge Menschen in der Schule? Lassen wir sie nach Zensuren jagen, wie beantworten wir ihre manchmal unbequemen Fragen? Erik Neutsch provoziert wie oft in seinen literarischen Arbeiten das schöpferisch-kritische Mitdenken, die Diskussion um erregende Fragen des Lebens in der DDR. Das in vielen Auflagen beim Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig erschienene Buch von 1979 wurde 1983/84 von der DEFA verfilmt, verboten, dann doch 1987 das erste Mal aufgeführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Zwei leere Stühle
Novelle
ISBN 978-3-86394-405-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1979 bei Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Wenn ich nur wüßte, was wir versäumt oder falsch gemacht haben, ich, der Direktor, Kommunist gar keine Frage, meine Lehrer, damals nicht mehr als dreißig, da unsere Schule erst später Zuwachs aus den Neubauvierteln erhielt, jeder vierte jedoch Parteimitglied, SED jedenfalls, und zwei Liberaldemokraten und ein Christ, nicht nur einer mit Taufschein, meine ich... Wenn ich nur wüßte, was uns so selbstgerecht und zufrieden, so saturiert werden ließ.
Ich bin nach Katzow gefahren, habe mich dort im Krankenhaus und in der Kreisleitung umgehört, war auch in Hartenstein bei den Genossen, denn als ich die Nachricht bekam, kurz vor dem Klassentreffen, die beiden Nachrichten innerhalb einer Woche, war mir speiübel, ich stellte mich tagelang selber in Frage. Das ist das Schlimmste, was einem geschehen kann, das Schlimmste in unserem Beruf. Ein wenig zur Ruhe gekommen, suchte ich dann nach Gründen. Lagen die Fehler nicht schon bei uns? Einen Teil der Schuld gebe ich heute dem verdammten Formalismus, der mir nie geschmeckt hat, dem Zensurenhaschen zum Beispiel, der Jagd nach Einsen, sogar differenzierten Einsen, solchen mit Kreuzen oder waagerechten Strichen dahinter im Klassenbuch, was bedeuten soll: eins plus oder eins minus. Mathematik-Müller hatte sie eingeführt, diese Plus- und Minuszeichen hinter den Prädikaten; wahrscheinlich hofft er, daß bei dieser Art von Benotung endlich einmal einer sein Abitur mit dem Durchschnitt von 0,9 besteht - das wäre doch ein wirkliches Novum, Weltniveau in der Volksbildung. Er hatte damit, zumindest in seinem Fach, ein Strebertum ausgelöst, das mich stets an die Szenen aus meiner Kindheit erinnerte, als wir Bengel nach Bockwürsten und allerlei anderem Firlefanz an den Erntedankfestkronen in unserem Dorfe hangelten. Damals durfte, nein, mußte wohl jeder hinaufklettern. Einer in Uniform machte uns von unten her scharf wie abgerichtete Hunde. Und wem die Muskelpakete reichten, der durfte mal abbeißen von der Wurst oder sich einen Lutscher aus Zuckerguß herab auf die Erde holen. Den anderen blieb nur der Spott, man stieß sie sogar mit Stangen und Stielen in den Hintern, sobald sie keine Kraft mehr hatten und auf halber Strecke am Mast hängenblieben. Was aber ist denn mit uns? Besteht unser Ehrgeiz darin, Intelligenzpakete zu erziehen, Menschen, die zwar jeden beliebigen Sinus- und Kosinuswert ohne Logarithmentafeln berechnen können, sich aber sonst im Leben nicht zu bewähren wissen?
Eine solche Frage - ich weiß - ist rhetorisch, in der holden und hehren Dichtkunst nur im äußersten Falle gestattet, nur dann nämlich, wenn die Helden sie akzeptieren und selber stellen. Des Sängers Höflichkeit jedenfalls hat zu schweigen. Ich aber bin kein Sänger, und ein Held, wie er in Büchern steht, bin ich schon gar nicht. Sollte mich daher Deutsch-Müller eines Tages wegen meiner Rhetorik oder besser: wegen meiner Kommentare hier kritisieren, werde ich ihm entgegnen, daß ich keine Novelle schreibe, nicht einmal etwas Ähnliches, nicht einmal einen Aufsatz, sondern einen Tatsachenbericht, den allerdings im Klartext und versehen mit meinen Bemerkungen, so gut ich's vermag und sobald es mir paßt.
Sie waren auch seine Schüler.
Um Wolfgang Lichtenfeld geht es und Uwe Tolls.
Und zugleich geht es um uns, die Lehrer und mich, den Direktor, der sie in Geschichte und zuletzt in Staatsbürgerkunde unterrichtete.
Sag einer nicht, wir hätten es nicht verhindern können! Wir haben uns gründlich geirrt. Das ist das Mindeste. Und die beiden haben uns nur auf die konsequenteste Art, die es im Leben gibt, darauf aufmerksam gemacht.
Das ist es, was ich mit meinen Idealen, ja: Idealen, nicht vereinbaren kann und will, womit ich mich niemals abfinden werde, worauf das eine wie das andere, jedes auf seine Weise, eine Stellungnahme von mir verlangt und weshalb ich, je mehr ich darüber nachdenke, zu dem Schluß komme, daß auch wir etwas falsch gemacht haben müssen, ich, Erzieher der beiden und Genosse.
Ich wurde Lehrer aus Überzeugung, ging im ersten Jahr der Republik zum Studium, sofort nach dem Abitur, FDJ-Sekretär bis dahin, und ich dachte: Das könnte vielleicht die höchste Aufgabe sein, der du dich stellen und die du in unserem Staat übernehmen kannst. Die nach uns kommen, meine eigenen Kinder, sollen es nicht noch einmal so schwer haben wie wir. Ich werde ihnen die Straße ins Leben pflastern. Asphaltieren werde ich sie. Sie sollen es glatt haben. Ich hatte schon damals Makarenko gelesen und Kalinin, ihnen recht gegeben und ihre Sätze mir eingeprägt: Die Arbeit des Lehrers ist sehr schwierig und seine Verantwortung groß... Ohne Übertreibung kann man sagen, daß ein Lehrer, wenn er große Autorität besitzt, bei manchen Leuten für das ganze Leben die Spuren seines Einflusses hinterläßt. Deshalb ist so wichtig, daß der Lehrer auf sich achtet, daß er sich der Kontrolle bewußt ist, der sein Benehmen und seine Handlungen dauernd durch die Augen seiner Schüler ausgesetzt sind. Die Hauptsache ist, daß man zu den Kindern ehrlich ist... Und schließlich, Genossen, müssen die Kinder auf lange Jahre hinaus helle Eindrücke, die allerbesten Eindrücke und Erinnerungen von der Schule behalten... Das scheint das Wichtigste zu sein, was man von einem Lehrer verlangen muß...
Und im Gegensatz dazu habe ich auch noch selber die Pauker kennengelernt und mitgeholfen, sie aus unseren Schulen zu vertreiben. Seitdem, dachte ich, hat die Paukerei ein für allemal ein Ende und ist nur noch ein Ereignis in den Erzählungen der Mütter und Väter.
Trotzdem nun dies: Da machen wir jährlich Bestandsaufnahme, tüfteln uns Bilder von Menschen zusammen, klamüsern Beurteilungen über sie aus, schreiben sie in die Reifezeugnisse, doch wenn sie das Leben dann hat, scheren sie sich einen Dreck um unsere Formulierungen.
In Katzow und Hartenstein erfuhr ich's genau. Aber wohl auch schon im letzten Herbst, als mich beide besuchten. Tolls hatte sich vorher mit einem Brief angemeldet. Seine Eltern wohnen noch bei uns in Dörnrode, und er befand sich im Urlaub. Wolfgang Lichtenfeld kam an diesem Tag überraschend hinzu, läutete im Vorübergehen an der Gartentür und wollte sich nur mal, wie er sagte, erkundigen, was sein »oller Schulmeester« noch so macht... Doch davon, von dem Gespräch, wird wohl erst später die Rede sein müssen.
In diesem Jahr wollte die Klasse 12a von damals ihr Jubiläum feiern. Man traf sich zum zehnten Male, seit man sich 1969 durch die Prüfungen geschwitzt und das Abitur abgelegt hatte, und so war mit der Teilnahme aller gerechnet worden. Auch der Wirt der »Silbernen Forelle«, eines hübschen Lokals am Ufer des steinübersäten Flüßchens, das unsere Stadt durchquert, hatte sich dementsprechend darauf eingerichtet, Fünfundzwanzig Stühle ließ er um einen länglich-ovalen Tisch in seinem Saal für Konferenzen und Festlichkeiten stellen, einundzwanzig für die ehemaligen Schüler, die restlichen für Rudi Berster, die beiden Müllers, ihre Klassenleiter von der Neunten bis zur Zwölften, und mich.
Doch dann blieben zwei Plätze frei.
Eine bedrückende Stille zog ein, dauerte, bis auch der letzte begriffen hatte, worum es sich handelte, und noch lange danach wollte erst recht keine Heiterkeit aufkommen. Das Bedrückendste aber, fast schon Makabre an allem war: Wir wagten es bis zum Schluß nicht, die beiden leeren Stühle aus der Reihe zu nehmen. Denn hätten wir es mit dem einen getan, so wohl auch mit dem anderen. Und obwohl es zwischen beiden Fällen gewaltige Unterschiede gab, wollten sie uns noch nicht in den Kopf.
Ich versuche mich zu erinnern und habe in diesem Moment wieder die Klasse vor Augen wie damals. Jeder hatte inzwischen seinen festen Platz, Tolls saß, vom Lehrertisch aus gesehen, rechts, in der vorletzten Bank auf der Fensterseite, Lichtenfeld links, unmittelbar neben der Tür, und so verlief zwischen ihnen fast eine Diagonale, in deren Mitte, sozusagen auch geometrisch den Mittelpunkt des Raumes bildend, sich das Goldköpfchen Ingrid befand, was für beide noch von Interesse sein wird. Ich könnte nun aus dem Gedächtnis, zumal nach dem letzten Klassentreffen, all die Namen ihrer Mitschüler nennen und auch aufzählen, was aus ihnen geworden ist, vorläufig jedenfalls in den zehn Jahren, die seither vergingen. Aber das würde zu weit führen. Achtung, soll es nur heißen, seien wir nicht schon wieder voreilig, weder eine Bewährung noch ein Versagen reichen fürs ganze Leben. Bei den meisten ist noch gar nichts entschieden, im Gegensatz allerdings zu Uwe und Wolfgang, bei dem einen sogar - und mich schaudert nun vor diesem Wort - totsicher und bei dem anderen wohl ebenfalls unwiderruflich.
Deutsch-Müller war seit der Elften ihr Klassenlehrer, und bei seiner Pedanterie in der Behandlung klassischer Formen der Erzählkunst haben sie gewiß auch gelernt, wie man beginnen muß, wenn man etwas erzählen will. Neulich erst hörte ich über ihn, er verlange von seinen Schülern »preußisch präzise« Antworten. Die Jüngsten in der jetzigen Neunten gar soll er bereits in der ersten Unterrichtsstunde das Fürchten gelehrt haben, indem er sie darauf verwies, daß erst in der EOS »ein wissenschaftliches Denken« anhebe, und wer sich dazu nicht »befähigt fühle«, solle am besten gleich wieder umkehren. Unter diesen Aspekten stelle ich mir die Themen seiner Aufsätze vor, und ich müßte daraufhin wohl wirklich einmal, was ich schon lange nicht tat, bei ihm hospitieren. Romeo und Julia auf dem Dorfe, der Tod in Venedig und Mario und der Zauberer - denn vornehmlich ist er ein Anhänger Thomas Manns -, charakterisieren Sie bitte die Hauptpersonen, preußisch präzise, und wenn Sie es nicht vermögen, so haben Sie doch ein Einsehen, daß Sie und die Wissenschaft nicht füreinander geschaffen sind.
Ich fange mit mir an.
Helmut Hausknecht, Häuschen nannten sie mich, oder Hausi nennen mich heute noch meine Schüler, Spitznamen, die ich erträglich finde. Manches ist schon gesagt, was ich von Kalinin, der kommunistischen Erziehung und der Verantwortung des Lehrers halte. Ich habe vier Kinder, bin demzufolge verheiratet, glücklich, besitze tatsächlich ein solches Ding, ein Häuschen, auf einem der Berghänge rings um Dornrode, das ursprünglich Grafensitz war und Bergarbeitersiedlung, besitze auch ein Auto und, trotz aller Diätvorschriften, die ich streng zu beachten versuche, einen dicken Bauch. Meine Frau ist - Lehrerin. Kreistagsabgeordnete. Wir heirateten während des Studiums. Ich indessen, wenn nicht gerade die Partei mit mir etwas anderes vorhat, stehe dem Klub der Intelligenz in unserer Stadt vor und kümmere mich um ein paar gute Veranstaltungen. Meist lade ich dazu einige meiner ehemaligen Schüler ein, den Schauspieler vom Deutschen Theater zum Beispiel, dessen Name inzwischen so berühmt ist, daß ich ihn hier nicht nennen möchte, auch den Dichter, den Lyriker, der allerdings von der Kritik mehr getadelt als gelobt wird, was dann nicht selten auch mir Ärger einbringt. Genug.
Wolf gang Lichtenfeld.
Doch da beginnt schon die Schwierigkeit. Ich kann ihn nur charakterisieren, indem ich seine ganze Geschichte aufschreibe, und so bitte ich um Verständnis, wenn ich vorerst nur bei Äußerlichkeiten verweile. Er war mittelblond, hielt seine Haare in Grenzen und ließ sich erst während des Studiums einen Bart wachsen. Damals wäre es für ihn wohl auch noch zu früh gewesen, denn er brauchte sich nicht zu rasieren, obwohl er sonst schon sehr kräftig wirkte, sogar etwas pummelig, wie man in unserer Gegend sagt, gut genährt, aber nicht mehr, als daß es die Mädchen nicht angezogen hätte. Er stammte - und indem ich das Imperfekt fortsetze, fällt mir auf, klingt es schon wie von einem Verstorbenen - aus einer Ingenieursfamilie, das heißt, nur der Vater war Ingenieur, hatte sich nach fünfundvierzig vom Arbeiter zum Meister und weiter qualifiziert. Was er selber nun nicht mehr vermochte, traute er seinem Sohn zu. Jedenfalls vernahm ich dergleichen einmal von Wolfgangs Mutter: Wir wollen, daß er all seine Chancen nutzt, und wenn er in seinen Leistungen nachläßt, geben Sie uns bitte sofort Bescheid, mein Mann wird ihm dann schon den Marsch blasen... Das aber brauchte er nie. Was Wolfgang Lichtenfeld über die Maßen auszeichnete, war sein Intelligenzquotient. Zunächst, bei der ersten Begegnung mit diesem Begriff, wußte ich nichts mit ihm anzufangen. Aber die Absolventen der Universitäten und Pädagogischen Hochschulen brachten ihn mit, und also, dachte ich, müsse auch ich mich ihm beugen; ich wollte nicht altmodisch oder gar rückständig gegenüber neuen Lehrmeinungen erscheinen. Es war ja auch erwiesen, daß Wolfgang eine überdurchschnittliche Begabung besaß. Zweifellos war er der Primus der Klasse, holte in sämtlichen Fächern Bestnoten, außer im Sport, wobei wir dann später ein Auge zudrückten und ihm eine Zwei verschafften, und vielleicht lag das wirklich alles an diesem verdammten Quotienten, der, ich kann mir nicht helfen, ein bißchen zu stark nach Vorbestimmung und daher auch Voreingenommenheit gegenüber dem Menschen riecht. Wer hatte denn meinen Eltern, einer Waschfrau und einem Fördermann, an meiner Wiege gesungen, daß aus mir ein Studienrat wird, noch dazu an einer dieser Schulen, dem früheren Gymnasium für feine Pinkels in Dornrode? Unsere Generation jedenfalls besorgte sich ihren Intelligenzquotienten selber. Ähnliches, unter anderen Bedingungen zwar und gewiß auch auf andere Art, nahm ich von Wolfgang Lichtenfeld an, um so mehr, als ich dann später erfuhr, daß er sich seine Zensuren hart erarbeitete, oft bis tief in die Nacht hinein über den Büchern hockte und büffelte und ihm das Lernen also gar nicht so leichtgefallen war, wie wir alle geglaubt hatten.
Wir konnten nicht anders, als ihn das Abitur mit Auszeichnung bestehen zu lassen. Das spricht für ihn. Doch heute frage ich mich, ob wir es denn auch anders jemals gewollt hätten. Seine um zwei Ziffern aufpolierte Note im Sport sagt etwas anderes aus. Längst ist es Usus geworden, die Erfolge einer Schule am Zensurendurchschnitt zu messen, und so jagen sich denn nicht selten die Lehrer und Direktoren gegenseitig mit frisierten Berichten den Rang ab, mogeln ein bißchen hier und mogeln ein bißchen dort, einige lassen gelegentlich auch schon, Beziehungen nutzend, vor den Klausurarbeiten die Prüfungsthemen aus dem Sack, gehen auch gern einmal auf die Toilette, wenn es die Klasse fordert und spicken will, und tun noch mehr. Freilich, das war nicht unsere Art, aber so ganz unbeeindruckt davon blieben auch wir nicht. Wolfgang Lichtenfeld erhielt die Lessing-Medaille. Die Nachbar-EOS in Klutzerbeck hatte ja ebenfalls eine beantragt.
Uwe Tolls.
Natürlich kann ich mich auch bei ihm nicht mit dem Motto von Deutsch-Müller begnügen: Charakterisieren Sie mal die Hauptpersonen. Er war ein Krauskopf, in doppelter Hinsicht, dem Worte gemäß, das ich bereits von meiner Mutter kannte: krauses Haar - krauser Sinn. Dunkelbraun, und die Locken bis auf die Schultern, nachdem uns diese Tracht aus dem Westen ins Haus getragen war. Die Schule, glaube ich, nahm er spätestens ab der Elften, seit ich ihn unterrichtete und ständig beobachten konnte, nicht mehr ernst und handelte manchmal nach uns völlig unerforschlichen Grundsätzen. Zu mir sagte er, es habe mit seiner Verehrung für Che Guevara zu tun, daß er sich einen Bart stehenlasse. In Kuba und Lateinamerika sei wenigstens noch etwas los. Das leuchtete mir sogar ein, ich dachte an unsere Zeit, und sollte ich ihm da mit dem Unfug kommen, das Revolutionärste im Sozialismus sei, in jedem Fach eine Eins plus zu ergattern, wo ich doch wußte, daß er höchstens im Sport und in Geschichte noch Chancen darauf hatte? Das ermuntert doch keinen jungen Burschen dazu, ein wirklicher Revolutionär zu werden! Und trotzdem: So recht traute ich seiner Begründung nicht. Wir hatten stets unsere Mühe mit ihm. Mitten im Unterricht, ich hab es erlebt, Staatsbürgerkunde, erhob er sich plötzlich und protestierte gegen irgendeine Behauptung, die sich allerdings, muß ich zugeben, bei näherer Betrachtung meist auch als ungenau, vielleicht sogar als routinehaft erwies. Da hatte man mal nicht aufgepaßt, für zwei Sekunden, und schon hakte er ein, mit solcher Bravour jedoch, daß jedenfalls mir manchmal nichts anderes blieb, als mich, wollte ich weiterhin glaubwürdig sein, zu korrigieren. Ein erhebendes Gefühl ist das gerade nicht, besonders wenn einen dann die gesamte Klasse anstarrt und auf die nächste Phrase wartet. Oft genug aber stellte er auch etwas in Zweifel, was längst zum Allgemeingut wissenschaftlicher Weltanschauung gehörte, und ich dachte dann, daß er nur die Absicht hatte zu provozieren. Sagen Sie, Herr Studienrat, Herr Hausknecht - die Betonung lege ich heute hinein, weil sie mir damals so vorkam -, Sie sind ein glühender Verfechter der sowjetischen Außenpolitik. Gibt Ihnen denn aber nicht zu denken, daß sowjetische Panzer auf dem Wenzelsplatz stehen, in einem sozialistischen Land also, wohin sie doch wohl am allerwenigsten gehören? Ich will hier nicht wiederkäuen, was ich entgegnete, zumal ich auf diesen Disput vor versammelter Mannschaft noch zurückkommen muß. Mich irritierte damals vor allem seine Herkunft. Wieso stellte ausgerechnet er solche Fragen? Sein Vater war Mitarbeiter der hiesigen Kreisleitung der SED, beschäftigt in der Abteilung Wirtschaft, politischer Funktionär, was er, nach entsprechenden Lehrgängen der Gewerkschaft und der Partei, als Arbeiter, Elektromotorenbauer, geworden war. Seine Mutter verkaufte Textilien in einem HO-Geschäft.
Uwe Tolls bestand sein Abitur mit Ausgleich. Trotz des allgemeinen Unverständnisses, auf das ich im Kollegium stieß, gab ich ihm in Geschichte eine Eins und in Staatsbürgerkunde eine Zwei. In Mathematik und in Chemie allerdings erhielt er Vieren, was aber auch daran lag, daß Mathematik-Müller und er sich nichts schenkten und gegenseitig befehdeten. Welcher Schüler würde dabei wohl nicht den kürzeren ziehen?
So also war es damals, neunzehnhundertneunundsechzig, um beide bestellt. Vor meiner Fahrt nach Katzow und Hartenstein sah ich mir auch noch einmal die Beurteilungen an, die wir ihnen in die Reifezeugnisse geschrieben hatten. Ich würde etwas Wichtiges verschweigen, wollte ich sie nicht ebenfalls wiedergeben:
»Uwe Tolls ist ein gelehriger Schüler, doch könnte er es zu weitaus höheren Leistungen bringen, wenn er mehr Fleiß entwickelte und stets bemüht wäre, seinen Klassenstandpunkt zu festigen. Im Kollektiv spielte er eine unterschiedliche Rolle. Seine kritische Art zu denken beflügelte oft, verhinderte aber auch andererseits eine größere Geschlossenheit der Klasse. Wir sind der Meinung, daß bei ständiger Aufmerksamkeit seitens seiner Erzieher und Vorgesetzten aus Uwe ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft werden kann. Die Vorbedingungen hierfür sind durch seine soziale Herkunft zweifellos gegeben.«
»Wolfgang Lichtenfeld ist ein ernsthafter und sehr gewissenhafter Arbeiter, der sich nicht nur im Unterricht, wovon seine hervorragenden Leistungen zeugen, sondern auch in der gesellschaftlichen Tätigkeit als Mitglied der ZSGL der FDJ große Verdienste erwarb. Alle ihm übertragenen Aufgaben erfüllte er stets zur vollsten Zufriedenheit. Sein Verhalten insgesamt spricht von hoher Reife, und an seinem Klassenstandpunkt gab es nie etwas auszusetzen. Er war eine der vorwärtstreibenden Kräfte innerhalb des Kollektivs und wirkte stets als Vorbild. Wir sind überzeugt, daß er schon heute ein nützliches Mitglied unserer Gesellschaft ist und können ihn nur wärmstens für das Studium der Medizin empfehlen, wozu er sich im vollen Bewußtsein der hierfür nötigen Verantwortung entschlossen hat.«