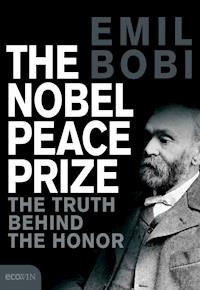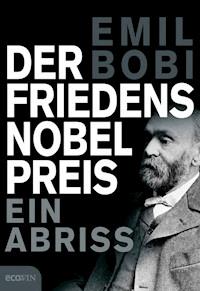
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem Testament bestimmte Alfred Nobel, dass der Friedenspreis an jene Personen gehen sollte, die "die meiste oder beste Arbeit für die Verbrüderung von Nationen, für die Abschaffung oder Reduzierung stehender Armeen und für das Durchführen und Fördern von Friedenskongressen geleistet hat". Hat Barack Obama eine Armee abgeschafft? Hat Malala Yousafzai Friedenskongresse veranstaltet? Haben die Preisträger jemals den Kriterien Alfred Nobels entsprochen? Emil Bobi ist diesen Fragen nachgegangen. "Emil Bobi ist zweifellos einer der renommiertesten investigativen Journalisten im deutschsprachigen Raum, ein Vorbild für viele Kolleginnen und Kollegen." JÜRGEN ROTH
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emil Bobi
DER FRIEDENSNOBELPREIS
Ein Abriss
© 2015 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Gesetzt aus der Sabon
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Gesamtherstellung: Buch.Bücher Theiss, www.theiss.at
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN 978-3-7110-5142-4
Für Johanna
Das Testament
27. November 1895, Paris
Was immer einen Menschen dazu treiben mag, sich sein Leben lang Situationen zu schaffen, in denen er bei jedem kleinsten Fehler in Stücke gerissen wird, ist jetzt einmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Alfred Nobel genau das gemacht hat. Und, vielleicht noch wichtiger, dass er nie in Stücke gerissen wurde.
Nobel hat in seinem Leben zahllose Entscheidungen getroffen, die er nur deshalb überlebt hat, weil sie richtig waren. Voraussetzung war, dass er jedes Mal, bevor er einen Handgriff tat, wusste, warum genau dieser Handgriff in genau jenem Augenblick zu erfolgen hatte, und zwar exakt so und nicht so ähnlich. Wenn er leben wollte, durfte er keinen Fehler machen. Er hat jahrzehntelang Tag und Nacht mit Sprengstoffen hantiert und das nicht etwa, um aus sicherer Entfernung ein Loch in einen Felsen zu sprengen. Er hat mit diesen Substanzen experimentierend immer das Unbekannte gesucht, nicht wissend, was der nächste Augenblick brachte, aber wissend, dass es das Richtige sein musste. Jeder Arbeitsschritt hatte ein Produkt glasklarer Überlegungen zu sein, dirigiert von einem Geruchssinn, der unter vielen unbekannten Noten die richtige unbekannte Note erkennt. Seine endlosen Experimente mit diesen aggressiven Stoffen haben zwei Beweise erbracht, die seine eigene Person betreffen: Alfred Nobel wusste, was er wollte. Und: Er wusste, was er tat. Er hat so lange gelebt, weil er gelernt hatte, geistesgegenwärtig zu handeln.
An diesem Mittwoch wollte Alfred Nobel abrechnen. Er war mit der Kutsche in der Rue de la Chaussée-d’Antin vorgefahren, um im dort niedergelassenen Schwedisch-Norwegischen Club ein Dokument zu erzeugen, das die Nachwelt noch beschäftigen sollte. Die westliche Zivilisation stand im Bann täglich neuer Erfindungen und Entdeckungen, die das Leben für immer veränderten. Die menschliche Zivilisation, so schien es, befand sich vor dem Durchbruch in eine neue Kulturdimension und man glaubte fest daran, dass die heile Welt etwas war, das erfunden werden konnte. Man vermutete, dass die Lösungen aller Probleme vorgefertigt in der Natur bereitlagen und nur erkannt und isoliert werden mussten. Ein Herr Wilhelm Conrad Röntgen hatte in diesem Jahr »eine neue Art von Strahlung« entdeckt. In Deutschland nahm die erste Buslinie der Welt mit einem benzinbetriebenen Omnibus ihren Dienst auf, erstmals tauchte der Begriff »Elektron« auf, in »The New World« erschien die erste Comic-Zeichnung. In einem Theater in Paris wurde erstmalig eine öffentliche Filmvorführung veranstaltet und Sigmund Freud betrat in Wien das von ihm entdeckte Reich der Träume. Aber in ganz Europa roch es auch nach Krieg. Und nicht nur in Europa: Italien annektierte Abessinien, Frankreich Madagaskar, Belgien den Kongo und Teile Ostafrikas.
Alfred Nobel, der spürte, dass er im Endbereich seines Lebens angekommen war, betrat den Schwedisch-Norwegischen Club, wo er manchmal vorbeigeschaut hatte, um die Kulturaktivitäten seiner Landsleute zu beobachten und ein Glas Wasser zu trinken. Wie immer im schwarzen Anzug und weißen Hemd, seit seinen Vierzigern schon am Stock, lenkte er seine kurzen Schritte vorsichtig wie auf dünnem Eis auf einen Schreibtisch zu, um Platz zu nehmen. Auch Sigurd Ehrenborg war da, der Leutnant in Ruhe, der Zivilingenieur Strehlenert, Thos Nordenfelt, der Mann aus dem Baugeschäft, und der Zivilingenieur Leonard Hwass. Nobel bat die Herren um einen kleinen Gefallen: Sie sollten vor dem Gesetz bezeugen, dass er, Nobel, nicht verrückt geworden war.
Nun, das ließe sich gerade noch machen, scherzte die Runde und die vier Herren bezeugten mit ihrer Unterschrift, dass »Herr Nobel klaren Geistes und aus freiem Willen das oben Angeführte zu seinem letzten Willen und Testament« erklärt und dass er dasselbe unterschrieben habe wie sie, die vier Zeugen, in Nobels Gegenwart »und jeder in Gegenwart der anderen«.
Das war nicht nur aus formaljuristischen Gründen angezeigt, sondern auch deshalb, weil die Lektüre seines Testaments durchaus die Frage aufwerfen konnte, ob der Verfasser nicht verrückt geworden war: Denn der Multimillionär Alfred Nobel, einer der ersten internationalen Industriemagnaten überhaupt, hatte beschlossen, sein gesamtes Kapital zu verschenken. Nobel ließ sich auf den Sessel am Club-Schreibtisch sinken, tauschte seinen Stock mit einer Schreibfeder und fasste seine Gedanken.
Ein seltsames Wesen, dieser Schwede: heimatlos, ruhelos, immer auf der Suche, immer auf der Flucht. Immer abreisend, fast nie ankommend. Dinge sehend, die es nicht gab, aber geben würde. Schüchtern bis kommunikationsgestört, kalt in der Analyse und im Urteil, aber ein kindlich eingeschüchtertes Betteln in den Augen, manchmal durchzuckt von Blitzen aus Ironie und Schalk. Ein merkwürdig hintergründiger, komplexer Sonderling. Ein draufgängerischer Eigenbrötler, ein rücksichtsloser Querdenker, ein sarkastischer Klarkopf. Die Tage und Nächte seines Lebens in seinen Labors brütend oder in Eisenbahnzügen zwischen Paris, Sankt Petersburg, London, Stockholm und überall anders in Europa unterwegs; weder in einem Land noch in irgendeiner Gesellschaft zu Hause; ein seelisch Obdachloser voller Ideen, voll unter dem Druck seiner komplizierten Existenz, gehetzt, geschlaucht, genervt, krank. Am liebsten hätte er Ruhe gehabt, doch dafür war keine Zeit. Victor Hugo, einer der wenigen Menschen, die einen persönlichen Draht zu ihm hatten, nannte ihn den »reichsten Vagabunden Europas«.
Kranker Geist in einem kranken Körper
Ein Vagabund, doch kein Lebenskünstler: Nie auf seiner Flucht durch das Leben schien er je stehen geblieben zu sein, um sich einmal umzudrehen und seinen Verfolger zu fixieren. Mit nie hinterfragter Verbissenheit hat er sein tägliches 18- oder 20-Stunden-Programm durchgezogen und jeden abgewichenen Millimeter beklagt. Er hat nicht bloß eine Fabrik gegründet, oder drei oder fünf. Er hat 80 Fabriken in 20 Ländern gegründet. Dass es nicht noch mehr wurden, lag nicht daran, dass es nun genug gewesen wäre, sondern daran, dass sein Leben zu Ende war. Es ging nicht um Firmen oder um das Genug oder Nicht-Genug. Es ging darum, niemals aufzuhören. Was man heute gemeinhin Burn-out nennt, ist im Vergleich zu Nobels arbeitsbedingter Auszehrung meist lächerliches Wellness-Gejammer einer ihrer selbst müde gewordenen Freizeitgesellschaft. Nobel hatte wie nebenbei 355 Patente angemeldet: mit Fotokameras ausgerüstete Heißluftballons zum Ausspionieren von Kriegsgegnern, Kunstseide, künstlichen Kautschuk, ein System nicht explodierbarer Dampfkessel, eine automatische Bremse und, und, und. Alles war längst zu viel und noch lange nicht genug – und das unter widrigsten Umständen: Sein ungeheurer Zwang zum Schaffen wurde von Depressionen gebremst, von Angstzuständen und Zwangsvorstellungen bedroht, von Misstrauen gegenüber allem und jedem eingeengt. Und zum kranken Geist kam der kranke Körper: lebenslange Kopfschmerzen, chronische Muskelinflammation, Skorbut, Herzschwäche, Rheuma, schlechter Magen. Niemals saß er ruhig, sein Körper war ununterbrochen auf der Suche nach einer weniger schmerzhaften Haltung, sein wie von Übelkeit entgeisterter Blick stach aus dunklen Höhlen. So mancher konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Mann jemals jung gewesen war. Und dennoch war mehr Kindliches an ihm, als unauffällig gewesen wäre: Sein Trippeln wirkte, als hätte er eben Laufen gelernt, seine Augen ängstlich, liebend, fragend, sagend. Die wenigen, die ihn näher kannten, berichteten, dass sie, seine Augen, manchmal schelmisch glitzerten, wenn er seine sarkastischen Seitenhiebe auf die Welt formulierte. Frech, mit der Sprache spielend, glomm in ihm bis zum Schluss etwas wie Glücksbereitschaft, die freilich einer zukünftigen Welt galt, die erst durch kulturelle Verfeinerung der Menschheit zu erreichen war, wie er meinte.
Im Herzen war er ein Schreiber, ein Philosoph. Jemand, den das Leben und die Vorgänge in der Welt so beschäftigten, dass er etwas zu sagen hatte. Aber einer, der das, was zu sagen war, vor der Welt verbarg und nur heimlich schrieb. In »Nemsia« etwa, einer Tragödie, einer hinter einem Theaterstück versteckten, autobiografischen Reflexion, lässt er Figuren Dinge über seine Familie und seine Kindheit sagen, die er selbst nicht über die Lippen brachte. In zahlreichen Briefen berichtet er von der Qual, ein »halbes Leben« führen zu müssen, in einem »Tal der Tränen« unterwegs, seiner Kindheit und Jugend beraubt zu sein. Er beklagte, seine Zeit für nervtötende Gespräche mit Managern und Behörden vergeuden und immer und immer wieder diese verhassten Nachtzüge nach irgendwo besteigen zu müssen.
Explosionsgefahr und Geborgenheit
Am frühzeitigen Zusammenbruch gehindert und weitergetrieben nur von einer Kraft, die noch stärker war als seine Müdigkeit: der Sucht. Der Sucht nach dem Forschen und Erfinden, dem Entdecken und Entwickeln war er erlegen wie dem Glücksspiel und dessen Verlockungen des Möglichen. Im unsichtbaren Raum des noch nicht Erfundenen lag für ihn der Schlüssel für das mentale und materielle Überleben. Und es war seine Konfrontation mit sich selbst. Beim Forschen konnte er sich stellen und gleichzeitig flüchten. Die geballte Konzentration auf die Arbeit bot Schutz vor dem Rest des Lebens. In der akuten Todesgefahr seiner Experimente suchte er nichts anderes als Sicherheit. Die heutige Psychiatrie hätte eine lange Liste mit Fachbegriffen für seine Symptombilder parat.
Während Nobel vornüber geneigt dasaß und seine Feder über den gelblichen Papierbogen kratzte, durfte niemand in der Nähe sein. Auch die vier Zeugen seiner Zurechnungsfähigkeit nicht, denn der Inhalt seines Testaments sollte bis nach seinem Tod geheim bleiben. Während er schrieb, schien er nicht viel nachzudenken und brachte einen Satz nach dem anderen flüssig zu Papier, als hätte er vorher alles auswendig gelernt.
Dieser Mann war seltsam genug gestrickt, um seine Erleuchtung bei einer Explosion zu erleben: Vor Faszination erstarrt wie ein Wahnsinniger war er, als er in jungen Jahren in Sankt Petersburg von einer Flüssigkeit erfahren hatte, die der Chemiker Ascanio Sobrero 1847 in Turin entdeckt hatte. Sie sollte das Leben Alfred Nobels für immer und vollkommen einnehmen: Salpetersäure-Triglyzerid oder auch Nitroglyzerin genannt, nachdem der Entdecker selbst es zunächst Pyroglyzerin getauft hatte. Schlug man mit dem Hammer auf ein Tröpfchen der Substanz, gab es eine Explosion von schockierender Aggressivität, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte und selbst Militärs, wie sich später bei Vorführungen zeigen sollte, bis ins Knochenmark verschreckte. Diese Flüssigkeit, die mit ihrer ungeheuren Kraft eine neue Dimension des Sprengens eröffnete, beendete das Jahrhunderte dauernde Zeitalter des Schwarzpulvers, das sich plötzlich wie Feuerwerkszeug ausnahm. Aber erst, nachdem Alfred Nobel Hand angelegt hatte.
Denn Nitroglyzerin war nutzlos. Es war völlig unkontrollierbar. Die Substanz explodierte lediglich da, wo die Fläche des Hammers auch wirklich auf der Flüssigkeit aufschlug. Und das nur, wenn der Untergrund aus Eisen bestand. Auf Holz zum Beispiel geschah nichts. Erhitzte man es langsam, krachte es bei 180 Grad Celsius. Wurde es schnell erhitzt, erst bei 230. Das war alles, was man zu wissen glaubte. Zu wenig, um es nutzbar zu machen. Zu wenig, um an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt aus sicherer Entfernung etwas wie eine kontrollierte Explosion auszulösen. Man konnte das Zeug ja nicht irgendwo hinschütten und mit dem Hammer draufhauen. Ebenso wenig war die Flüssigkeit als Waffe zu denken: Es war kaum möglich, Nitroglyzerin in Behältern vorsichtig dem Feind zu übergeben und anzuregen, er solle den Inhalt einer harten Erschütterung aussetzen. Entdecker Sobrero hatte alles Mögliche probiert und überlegt, aber schließlich empfohlen, die Finger davon zu lassen. Wohl auch, weil das nicht lenkbare Teufelszeug ihm das Gesicht verunstaltet hatte.
Doch genau diese Substanz versetzte Alfred Nobel in Trance. Mit ihr und für sie verbrachte er sein ganzes Dasein. Um sie zu zähmen, riskierte er unzählige Male sein Leben. Um sie kontrollierbar, mit kalkulierbarem Risiko handhabbar und für die Industrie verwendbar zu machen, dafür war er da. Doch zunächst fiel diesem Menschen nichts anderes ein, als den ohnehin über alle bekannten Maße hinaus aggressiven Sprengstoff noch aggressiver zu machen. Also mischte er dem Neuen einfach das Alte bei. Diese Mischung aus Nitroglyzerin und Schwarzpulver nannte er Sprengöl und war tatsächlich von noch größerer Sprengkraft als pures Nitroglyzerin.
Doch wie sollte er diese Explosionen sicher und gezielt auslösen, sodass sich die frei werdende Sprengkraft in gewünschte Bahnen ausbreitete und so zu etwas wie einem konstruktiven Ergebnis führte, wie etwa ein beabsichtigtes Loch im Felsen zum Bau eines Tunnels? Wie aus sicherer Ferne die harte Erschütterung herbeiführen, unter der Nitroglyzerin detonierte? Und wie sollte man Nitroglyzerin chemisch stabiler machen, damit man sich in seiner Nähe nicht automatisch in Lebensgefahr befand und der Umgang sowie der Transport weniger gefährlich wurden?
Die Bombe in der Bombe
Also erfand Alfred Nobel zwei Dinge: die Zündkapsel und dann das Dynamit. Die Frage der herbeizuführenden Erschütterung des Nitroglyzerins, um es zur Explosion zu bringen, löste er mit der wahrhaft genialen Einfachheit seines Denkens. Er fragte sich: Warum machst du damit nicht einfach das, was du ohnehin mit allem machst – es in die Luft jagen? Die nötige Erschütterung des Nitroglyzerins erreichst du, indem du es mit Schwarzpulver sprengst. Eine Sprengung soll die Explosion auslösen, was sonst? Genial: eine Bombe in der Bombe. Eine kleine Bombe explodiert in der großen Bombe und zündet sie damit. Nobel bastelte ein hölzernes Hütchen, befüllte es mit Schwarzpulver und versah es mit einer Zündschnur. Dieses Ding versenkte er im eigentlichen Sprengstoff und fertig war die epochale Sensation. Der »Nobelsche Zündhut«, die wichtigste sprengtechnische Entwicklung seit der Erfindung des Schwarzpulvers, wird bis heute unverändert in der »Initialzündung« angewendet.
Dann das Dynamit. Dynamit ist nichts anderes als das flüssige Nitroglyzerin an eine feste Substanz gebunden. Dynamit ist Nitroglyzerin in festem, daher stabilerem Zustand. Nach Hunderten Versuchen hatte er das passende Material gefunden, das große Mengen Nitroglyzerin binden konnte, ohne die Sprengkraft wesentlich zu reduzieren: Kieselgur. Ein wertloses, weißliches Pulver aus Ablagerungen von Einzellern. Vermischt mit Nitroglyzerin entstand eine Paste, die man zu handlichen Stangen portionieren und bequem in Sprengöffnungen platzieren konnte. In Holzkisten ließen sie sich relativ risikoarm transportieren, weil zwischen Holzplatten die nötige Erschütterung normalerweise nicht zustande kam. Das chemische Ungeheuer Nitroglyzerin war gezähmt. Man konnte die in Paraffinpapier gewickelten Stangen gefahrlos durch die Luft werfen und nichts geschah. Zündete man die Paste an, verbrannte sie ruhig wie Öl. Nur wenn man die Zündschnur ansteckte und so das Schwarzpulver innerhalb der Paste Feuer fing, wurde auch Niet- und Nagelfestes zerfetzt.
Vernichten statt besiegen
Ob beabsichtigt, nur in Kauf genommen oder gar nicht bedacht, war damit auch eine Waffe erfunden, deren Bedeutung als Tötungsmittel nicht weniger epochal war. Mit ihr war auch der bequeme Massenmord erfunden, der ohne großen Aufwand von Einzelpersonen durchgeführt werden konnte. Plötzlich ging es nicht mehr um das Besiegen, sondern um das Vernichten. Und mit dieser neuen Möglichkeit von Sprengstoffanschlägen wurde wohl auch ein Vorläufer dessen geboren, was man heute Terrorismus nennt.
Der Sankt-Gotthard-Eisenbahntunnel und viele andere Verkehrsbauprojekte wären ohne Nobels Sprengpaste undenkbar gewesen. Im Amerikanischen Bürgerkrieg flogen seine Dynamitstangen durch die Luft, eine Welle von Anschlägen ging über Europa hinweg und so manche seiner Fabriken explodierte. Es zerriss Schiffe und andere Transportmittel, die mit seiner Erfindung beladen waren – und Alfred Nobel machte viele Millionen.
Nun war sein Herz immer schwächer und das Ende absehbar geworden. Jahre zuvor hatte er ein erstes Testament geschrieben und wieder weggeworfen. Auch sein zweites Testament hielt weiteren Überlegungen nicht stand und so verwarf er auch dieses. Aber nun hatte er sich endgültig entschieden. Eines der Opfer seines neuen Entschlusses war der Schwedisch-Norwegische Club selbst, wo er nun am Schreibtisch saß und schrieb. In seinem zweiten Testament hatte er dem Club eine stattliche Summe zugedacht, jetzt aber sollte er leer ausgehen. Im Club, der sich in der Rue de Rivoli befindet und wo der Testamentsschreibtisch noch immer liebevoll verwahrt ist, pflegt man das Bedauern jenes Umstands augenzwinkernd bis heute. Dieses zweite Testament soll später im Buch noch einmal zur Sprache kommen, wenn es darum geht, zu begreifen, was Alfred Nobel unter dem Frieden verstand, der hinter einem seiner Preise steckt.
Friedensunfähige Barbaren
Nobel war zu der Auffassung gelangt, dass das Vererben großer Vermögen über Generationen innerhalb der Familie nur Nachteile habe. Familienmitglieder sollten nur so viel erben, wie zur Absicherung der Existenz und einer guten Ausbildung nötig sei, um die Leistungsbereitschaft nicht zu schädigen. Außerdem war er überzeugt, dass der Fortschritt der Menschheit hin zu einer friedfertigen Gemeinschaft den allgemeinen Wohlstand als Basis benötige und nicht den Reichtum Einzelner. Er war weder Kommunist noch Pazifist, noch wirklich Demokrat. Er war ein kalter Techniker, der sich in der Seele nach Ruhe und Frieden sehnte. Eine seiner ganz großen Lebensfragen lautete: Wie war ein Zustand erreichbar, den man Weltfrieden nennen konnte? Für ihn lag es schlicht auf der Hand, dass die Menschheit, durch alle Gesellschaftsschichten hindurch, den Kern der Barbarei in sich trug, geistig, intellektuell und kulturell zu unterentwickelt war, um eine soziale Umgangskultur an den Tag zu legen, die es ermöglichte, einen friedlichen Zustand zu etablieren und diesen durch intelligente Konfliktlösungsstrategien wie neuartige internationale Schiedsgerichte zu sichern. Nobel war nicht unbedingt für das allgemeine Wahlrecht. Zu gefährlich schienen ihm die drohenden Auswirkungen einer ungebildeten Masse an der Wahlurne. Er zeigte offene Abscheu nicht nur gegen die Arroganz der Oberen, sondern auch gegen den Pöbel auf der Straße.
Um weltweit Ruhe zu schaffen, war ihm jedes Mittel recht. Jahrelang hatte er sich den Kopf darüber zerbrochen, wie das funktionieren könnte: Konnte man die Menschheit durch die Bedrohung einer alles vernichtenden Superbombe dazu zwingen, still zu halten? War das schon Frieden, wenn die Waffen nur deshalb schwiegen, weil man Angst hatte abzudrücken? Nobel träumte nicht nur ernsthaft von dieser Superbombe, er arbeitete auch konkret an ihrer Erfindung und damit an etwas, was einige Jahrzehnte später als Atombombe und als »Gleichgewicht des Schreckens« in die Welt kommen sollte. Oder war es, so seine zweite Überlegung, möglich, eine neuartige internationale Gemeinschaft des Denkens zu etablieren, die es erlaubte, das uralte Prinzip des »gesunden« Misstrauens und des Selbstschutzes durch bewaffnete Gewaltbereitschaft abzulösen und durch etwas wie eine internationale Diplomatie des Vertrauens zu ersetzen? Waren präventiv-politische Maßnahmen wie zwischenstaatliche Verträge denkbar, die das Vorgehen im Konfliktfall regeln und einen potenziellen Aggressor mit Sanktionen der Gemeinschaft bedrohen konnten?
Auf beiden Seiten
Alfred Nobel war lange Jahre seines Lebens auf beiden Seiten der Linie gestanden. »Frieden durch Krieg« oder »Frieden durch Frieden« war ihm egal, nur funktionieren musste es. Er, der soziophobe Sonderling, der nie einen intimen Freund und auch nie wirklich eine Frau hatte und seine erdrückende Einsamkeit in vielen Briefen beschrieb, dürfte die Entscheidungshilfe für seine große Frage schließlich doch von einer Frau erhalten haben: der österreichischen Baronin Bertha von Suttner. Ihr hat Nobel wie ein kleiner Junge sogar seine vor aller Welt versteckten Gedichte gezeigt. Da war eine Seelenpartnerschaft, über der all die Jahre ein gespanntes Knistern lag, in der sich der intellektuelle Austausch der beiden wie eine schüchterne Ersatzhandlung ausmachte. Bertha von Suttner war ein für die Zeit vollkommen neuartiger Frauentyp. Vielsprachig, hoch gebildet, eine intellektuelle Großkapazität, die als Literatin und Friedensaktivistin in den Häusern von Königen und Staatsmännern in ganz Europa aus- und einging. Der Friede, den Alfred Nobel letztlich meinte, hatte so auch etwas mit Liebe zu tun. Einer Liebe, die bis zum Schluss ein Traum blieb. Ganz ähnlich wie der Weltfriede selbst, der immer geträumt, aber nie erreicht wird.
Nobel hatte also beschlossen, seinen angehäuften Reichtum in die Allgemeinheit zurückzuführen, gleichsam als Dünger für den allgemeinen Fortschritt. Er wollte keine Suppenküchen finanzieren, Krankenhäuser bauen oder andere Symptome der gesellschaftlich-kulturellen Unterentwicklung lindern, sondern die Entwicklung fördern. Sein Geld sollte nicht als Einmalzahlung »für Gutes« beim Fenster hinausgeworfen werden. Es sollte weiter arbeiten und Jahr für Jahr neue Impulse geben. Alfred Nobel hat sehr weit nach vorne gedacht. Und als Kind des Zeitgeistes der Erfindungen dachte er wohl, dass es nur die Erfindungen sein würden, die die Voraussetzungen für allgemeinen Wohlstand schufen, worauf erst echter Friede aufbauen konnte. Die Behauptung, Nobel hätte seine Millionen der Allgemeinheit geschenkt, weil er selbst keine Kinder hatte, ist ebenso falsch wie die Darstellung, er hätte das Geld aus schlechtem Gewissen wegen der zerstörerischen Auswirkungen seiner Erfindungen guten Zwecken gespendet.
Alfred Nobel hat nichts gespendet. Er hat investiert. Und zwar in ein entwicklungspolitisches Maßnahmenpaket, das seiner Zeit so weit voraus war, dass es nur von wenigen überhaupt verstanden wurde: Nobel wählte fünf Kategorien, in denen jährlich Preise für die jeweils größte Leistung bei der Entdeckung oder Entwicklung von Erleichterungen ausgeschrieben werden sollten, die die Menschheit in geistiger, kultureller und sozialer Hinsicht weiterbringen und so langfristig erst fit machen sollten für etwas wie Friedensfähigkeit – drei naturwissenschaftliche Bereiche, Physik, Chemie und Physiologie oder Medizin, die geisteswissenschaftliche Kategorie der Literatur und eine Art Workshoppreis für die direkte, technische Umsetzung friedlicherer Zustände.
Das dritte Testament
Nobel saß da und verteilte schreibend seine Millionen. Eingangs listete er eine Reihe von Verwandten und andere ihm nahestehende Personen und Mitarbeiter auf, die kleinere Summen erhalten sollten. Das Testament im Wortlaut:
»Für meine Neffen Hjalmar und Ludvig Nobel, die Söhne meines Bruders Robert Nobel, hinterlasse ich die Summe von 200.000 Kronen für jeden der beiden.
An meinen Neffen Emanuel die Summe von 300.000 und an meine Nichte Mina Nobel 100.000 Kronen.
An die Töchter meines Bruders Robert Nobel, Ingeborg und Tyra, die Summe von je 100.000 Kronen.
Fräulein Olga Boettger, derzeit wohnhaft bei Frau Brand, 10 Rue St. Florentin, Paris, soll 100.000 Franc bekommen.
Frau Sofie Kapy von Kapivar, deren Adresse bei der Anglo-Österreichischen Bank in Wien bekannt ist, ist hiermit zu einer Rente von 6000 Forint österreichischer Währung berechtigt, die von der genannten Bank ausbezahlt wird, wo ich den Wert von 150.000 Gulden in ungarischen Staatsanleihen deponiert habe.
Herr Alarik Liedbeck, derzeitige Adresse 26 Sturegatan, Stockholm, soll 100.000 Kronen erhalten.
Fräulein Elise Antun, derzeit in 32 Rue de Lubeck, Paris, ist berechtigt, eine Rente von 2500 Franc zu beziehen. Zusätzlich sollen 48.000 Franc aus ihrem Besitz, die derzeit bei mir in Verwahrung sind, rückerstattet werden.
Herr Alfred Hammond, Waterford, Texas, USA, soll 10.000 Dollar erhalten.
Die Damen Emy und Marie Winkelmann, Potsdamerstraße 51, Berlin, erhalten 50.000 Mark.
Frau Gaucher, 2 Boulevard du Viaduc, Nîmes, Frankreich, 100.000 Franc.
Meine Diener Auguste Oswald und seine Frau Alphonse Tournand, angestellt in meinem Labor in San Remo, werden eine Rente von 1000 Franc beziehen.
Mein früherer Diener, Joseph Girardot, 5 Place St. Laurent, Châlons sur Saône (sic!), ist berechtigt, eine Rente von 500 Franc zu beziehen und mein früherer Gärtner, Jean Lecof, derzeit bei Frau Desoutter … eine Rente von 300 Franc.
Herr Georges Fehrenbach, 2, Rue Compiègne, Paris, bekommt eine jährliche Pension von 5000 Franc vom 1. Jänner 1896 bis 1. Jänner 1899, dann endet die besagte Pension.
Eine Summe von je 20.000 Kronen, die in meinem Gewahrsam sind, sind das Eigentum der Kinder meines Bruders, Hjalmar, Ludvig, Ingeborg und Tyra, und sollen rückerstattet werden.«
Und jetzt:
»Mit meinem verbleibenden realisierbaren Vermögen soll auf folgende Weise verfahren werden: Das Kapital, von Nachlassverwaltern in sichere Wertpapiere angelegt, soll einen Fonds bilden, dessen Zinsen jährlich in Form eines Preises an diejenigen verteilt werden sollen, die im abgelaufenen Jahr den größten Nutzen für die Menschheit erbracht haben. Die besagten Zinsen sollen in fünf gleiche Teile aufgeteilt werden: ein Teil an die Person, die auf dem Gebiet der Physik die bedeutendste Entdeckung oder Erfindung gemacht hat; ein Teil an die Person, die die wichtigste chemische Entdeckung oder Weiterentwicklung gemacht hat; ein Teil an die Person, die die wichtigste Entdeckung auf dem Gebiet der Physiologie oder Medizin gemacht hat; ein Teil an die Person, die in der Literatur das Herausragendste in idealistischer Hinsicht produziert hat; und ein Teil an die Person, die die meiste oder beste Arbeit für die Verbrüderung von Nationen, für die Abschaffung oder Reduzierung stehender Armeen und für das Durchführen und Fördern von Friedenskongressen geleistet hat. Die Preise für Physik und Chemie sollen von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften vergeben werden; der für die physiologische oder medizinische Arbeit vom Karolinska Institutet in Stockholm; für Literatur von der Schwedischen Akademie in Stockholm; und der für die Meister des Friedens von einem Komitee von fünf Personen, die vom norwegischen Storting (Parlament, Anm. d. A.) gewählt werden sollen. Es ist mein ausdrücklicher Wille, dass bei der Preisverteilung der Nationalität der Kandidaten keinerlei Bedeutung beigemessen wird und der Würdigste den Preis erhält, egal ob er Skandinavier ist oder nicht.«
Dann folgt die Nennung der Exekutoren des Testaments, Ragnar Sohlman und Rudolf Lilljequist, sowie eine lange Liste von Geldinstituten in verschiedenen Ländern, bei denen die Millionen Nobels lagen. Gezeichnet: Alfred Bernhard Nobel, Paris, 27. November 1895.
Dieses Rechtsdokument übermittelte Nobel der Stockholmer Enskilda-Bank zur Verwahrung bis zu seinem Tod.
Für den Preis für die »Meister des Friedens« hatte er drei Teilbereiche ersonnen, die miteinander korrespondierten: Punkt eins, die »Verbrüderung der Nationen«, also die Etablierung einer internationalen Politik des Vertrauens, war eine Voraussetzung für Punkt zwei, die Reduzierung oder Abschaffung stehender Armeen als Folge überwundenen Misstrauens. Und dieses Programm sollte durch Punkt drei, einen medialen Aspekt, in »Friedenskongressen«, diskutiert, weiterentwickelt und der breiten Öffentlichkeit bekannt und verständlich gemacht werden. Der erst später so benannte »Friedenspreis« ist genau betrachtet kein Preis für Frieden, sondern einer für die Abschaffung von Kriegen, was viel weniger ist. Dieser Preis sollte jährlich die erfolgreichste praktische Umsetzungsarbeit zur Abschaffung von militärischen Auseinandersetzungen prämieren.
Alfred Nobel hatte von all dem Reichtum sehr wenig für sich selbst entnommen und alles zurückgegeben. Von Urlaub war in seinem Leben nie die Rede gewesen. Alles, was er sich an Freizeit je gegönnt hatte, waren einige Kuraufenthalte, bei denen er seine multiplen Beschwerden zu lindern suchte. Er besaß einige Pferde, ein Haus am See in Zürich und eines in Paris, das er später gegen jenes in San Remo tauschte. Am liebsten nahm er einfache Mahlzeiten zu sich und trank dazu ein Glas Wasser, selbst wenn er Gäste bewirtete. Er galt nicht nur als bescheiden, sondern auch als ausgeprägt, ja übertrieben sparsam und vermied Ausgaben, wo immer er konnte, sodass er sich die meiste Zeit nicht einmal eine Sekretärin leistete und alles selber machte, obwohl er sich damit sinnlos blockierte. Aber für ihn, der von seiner Kindheit her wusste, wie es war, gar nichts zu haben, der »die alte Zeit« in Stockholm und Sankt Petersburg mit den Bettlermassen in den Straßen noch gesehen hatte, war der zurückgenommene Umgang mit Geld wohl weniger nackter Geiz als Demut vor den Werten.
Heute, nach hundert Jahren
5. Dezember 2014, Stockholm
»Creme von der Blumenkohlsuppe, Mosaik aus roten Königskrabben, in Erbsen und Zitrone eingelegte Röschen vom Blumenkohl. Würzige Lende vom roten Hirsch, Karottenterrine, in Salz gebackene goldene Rüben, geräucherte Perlzwiebel, Kartoffelpüree und Jus vom Wild. Dazu Villa Cafaggio 2011 und Chianti Classico. Dann Mousse und Sorbet von wilden Beeren aus Gotland, Safran-Panna-Cotta und Biskuit mit brauner Butter. Tee, Kaffee, Spirituosen.«
Klas lächelt. Er ist Kochweltmeister, Koch-Olympiasieger, einer der wichtigsten Köpfe der kulinarischen Nationalmannschaft Schwedens, doch was zählt das alles. Erst jetzt ist er wirklich ganz oben. Die letzten acht Monate hat der unrasierte Aufsteiger mit der schicken Glatze und dem hellen Lächeln beim Brainstorming mit der versammelten gastronomischen Intelligenz des Landes verbracht, ist mit den 60 besten Küchenchefs Schwedens, mit gastronomischen Beratern aus allen Richtungen, mit Kulinarik-Professoren der Umeå-Universität und den künstlerischen Leitern der »Restaurangakademien« in endlosen Konferenzen gesessen, um die Köpfe rauchen zu lassen. Um zu testen und zu kosten, um Ideen aufzugreifen, sie zu drehen und zu wenden, zu verwerfen und ganz neu zu denken. Alles, um bloß bereit zu sein für die höhere Eingebung. Das Projektergebnis des fast hundertköpfigen Expertenstabs ist das genannte Abendessen aus drei Gängen. Es ist das Abendessen für die Nobelpreisträger 2014: Das Nobel-Banquet-Dinner. Das Abendessen der Nation.
Der schwedische König wird da sein, seine Familie, die Nobelstiftung und die Preiskomitees, der Regierungschef, sechs Minister, alle Chefs der Parlamentsparteien und 1500 Ehrengäste, Gönner, Bewunderer, Bewunderte. Am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, findet dieses Essen statt, also in fünf Tagen, aber schon morgen geht es los, weil die Zubereitung selbst vier Tage dauert und am Ende alles im selben Augenblick fertig werden muss. Und zwar in einem ganz bestimmten Augenblick: Um 19.03 Uhr erklingen im mit Blumen übersäten Blauen Saal der Stockholmer Stadthalle Fanfaren. Die vom König angeführte Prozession ergießt sich, begleitet von Orgel und Trompeten, über die Haupttreppe nach unten und nimmt um 19.11 Uhr an der Tafel Platz, um ein erstes Gläschen Champagner zu nehmen. Um 19.14 Uhr wieder Fanfaren, der Vorstandschef der »Nobelstiftelsen« begrüßt den König. Um 19.16 Uhr sagt der König etwas Nettes über Alfred Nobel. Um 19.18 Uhr die erste Fotosession an der Ehrentafel, exakt zwei Mal zwei Minuten. Dann sechs Minuten für die Zerstreuung, bevor Klas Lindberg zur Ablieferung seines Meisterstücks schreiten lässt: Ruhig und getragen wie ein großer Strom fließt dann sein Ballett aus 260 Kellnern über die Hauptstiege, ein in das spritzende weiße Licht von Wunderkerzen getauchtes Tablett über ihren rechten Schultern schwebend, ästelt zu einem Delta aus und serviert den ersten Gang um 19.33 Uhr sämtlichen Gästen im gleichen Augenblick.
Das geht so eineinhalb Stunden. Und dann, wenn schon fast alles vorbei ist, die Musik- und Balletteinlagen zwischen den Gängen, die weiteren Fotosessions, die launigen Reden der Preisträger – wenn die Gesellschaft zum Tanz im Goldenen Saal einen Stock höher bereit ist, muss Klas um 22.08 Uhr noch Kaffee, Tee und Spirituosen reichen, bevor er selbst als Koch in die Unsterblichkeit entschweben und in der Küche mit seinen 46 operativen Küchenchefs und den Hunderten Gehilfen einen heben kann.