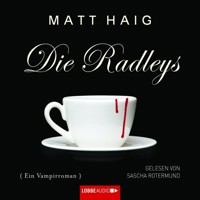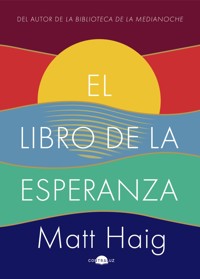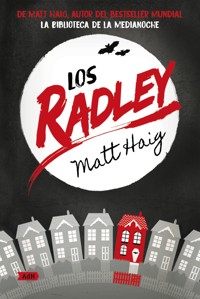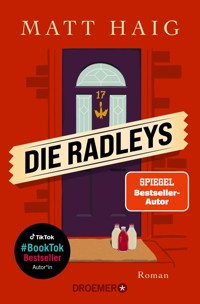9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie weit geht ein Vater, um seine Tochter vor der Welt zu schützen? Beklemmend, bewegend und zutiefst zu Herzen gehend: der psychologische Roman über die zerstörerische Kraft von Liebe und Angst vom Autor des großen SPIEGEL-Bestsellers »Die Mitternachtsbibliothek«. Wann wird Liebe zu Besessenheit? Drei Mal schon musste Antiquitätenhändler Terence Cave den Verlust eines geliebten Menschen verkraften: erst den Selbstmord seiner Mutter, dann den Mord an seiner Frau, und schließlich den tragischen Tod seines Sohnes Reuben. Geblieben ist ihm nur noch seine Tochter Byrony, Reubens Zwillingsschwester – und das Gefühl, dass ihm alle genommen werden, die er liebt. Umso verzweifelter versucht Terence nun, seine wunderschöne Tochter vor jeder Gefahr zu schützen, koste es, was es wolle! Doch die 15-jährige Byrony riskiert immer mehr, um aus dem goldenen Käfig ihres Vaters auszubrechen, und Terence muss sich fragen, ob er sie wirklich nur beschützen will? Mit »Der fürsorgliche Mr Cave« hat der britische Bestsellerautor Matt Haig hat einen ebenso anrührenden wie erschütternden psychologischen Roman über einen Vater geschrieben, dessen Fürsorge in Besessenheit zu kippen droht. Die Sorgen und Nöte, die Angst-Störungen und Depressionen verursachen, kennt Matt Haig aus eigener Erfahrung. "Sehr geschickt, beinahe unmerklich greifen Realität und Fantasie ineinander. Brillant beschreibt der Auto einen Vater, der der Dämonen in seinem Kopt nicht mehr Herr wird." Stern Entdecken Sie auch die anderen Romane von Matt Haig bei Droemer: Die Mitternachsbibliothek, Die Radleys, Nachricht von Dad, Für immer, euer Prince
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Matt Haig
Der fürsorgliche Mr. Cave
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Hübner
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach dem tragischen Tod seines Sohnes Reuben scheint es dem Antiquitätenhändler Terence Cave endgültig, als sei seine Liebe verflucht: Seine Mutter hat den Freitod gewählt, seine Frau starb bei einem Raubüberfall. Einzig Reubens Zwillingsschwester Bryony ist noch übrig – und Terence schwört sich, seine wunderschöne Tochter mit all seiner Kraft vor den Gefahren dieser Welt zu beschützen, koste es, was es wolle. Doch die Fünfzehnjährige fühlt sich von ihrem überfürsorglichen Vater mehr und mehr in einen Käfig gesperrt, der ihr die Luft zum Atmen nimmt. Als Terence’ Regeln immer strenger werden, bahnt sich eine Katastrophe an.
Inhaltsübersicht
Motto
Natürlich weißt du, wo [...]
Wie du weißt, habe [...]
Seit der Beerdigung hatte [...]
Wie jede Geschichte hat [...]
Eine Woche nach Rom [...]
Einige Tage später kam [...]
Du hast meinen Regeln [...]
Ein Lovesong. Auf einer [...]
Ach ja, die Balkonszene.
Du hattest schon immer [...]
Du warst in der [...]
Ich kochte uns Porridge [...]
Dann der nächste Morgen, [...]
Jetzt frage ich mich, [...]
Die georgianischen Häuser glitten [...]
Und ich war in [...]
Durch das Knacksen und [...]
Wie dies ein Vater [...]
Und dann – die Kakofonie:
Genau in diesem Moment [...]
Alles, was wir an den Kindern ändern wollen, sollten wir zunächst wohl aufmerksam prüfen, ob es nicht etwas sei, was besser an uns zu ändern wäre […].
Carl Gustav Jung
Über die Entwicklung der Persönlichkeit
Aber wenn sich die Hand des Kindes für immer vom Hals der Mutter löst, wenn es die schwesterlichen Küsse nicht mehr auf seinen Lippen fühlt – diese tiefen, tiefen Tragödien dauern unter allen Überlagerungen an und bleiben lebendig bis zuletzt.
Thomas de Quincey
Bekenntnisse eines englischen Opiumessers
Natürlich weißt du, wo es beginnt.
Es beginnt so, wie das Leben beginnt, mit einem Schrei.
Ich saß oben am Schreibtisch und erledigte die Buchhaltung. Ich weiß noch, ich war in recht beschwingter Stimmung, denn ich hatte am Nachmittag einen viktorianischen Klapptisch verkauft, zu einem hocherfreulichen Preis. Es muss gegen halb acht gewesen sein. Ich entsinne mich noch, dass ich den Abendhimmel besonders schön fand. Es war einer dieser herrlichen Sonnenuntergänge im Mai, wenn sich die Schönheit des Tages in seinen letzten Augenblicken noch einmal zusammenballt.
Und wo warst du? Ach ja: in deinem Zimmer. Du hattest Cello geübt, schon seit Reuben gegangen war, um sich mit seinen Freunden bei den Tennisplätzen zu treffen.
Als ich ihn hörte, den Schrei, ruhte mein Blick bereits auf dem Park. Vermutlich blickte ich nicht auf das leere Klettergerüst, sondern zu den Kastanienbäumen hinüber, denn ich hatte niemanden auf der East Mount Road bemerkt. Es gab irgendeine Unstimmigkeit in der Abrechnung, und ich versuchte den Fehler zu finden, kann mich aber nicht mehr genau erinnern.
Ach, hier könnte ich diese Szene jetzt anhalten. Ich könnte zehntausend Wörter über diesen Sonnenuntergang schreiben, über den Park, die belanglosen Fragen zu meiner Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Während ich dies schreibe, fühle ich mich wieder ganz in diesen Augenblick zurückversetzt, in jenes Zimmer, warm eingehüllt in ahnungslose Zufriedenheit. Es fühlt sich fast wie ein Verbrechen an, diesen Abend weiter zu schildern, bis zu dem Moment, wo der Schrei eine konkrete Bedeutung gewann. Und doch muss ich dir erzählen, wie das damals war, genau so, wie ich es gesehen habe, denn hier endete und begann alles, nicht wahr? Also, Terence, schreib weiter, du hast nicht den ganzen Tag Zeit.
Zuerst empfand ich den Schrei als Störung, denn aus deinem Zimmer schwebten die betörenden Klänge einer Brahmssonate zu mir herüber. Aber dann, noch bevor ich wusste, warum, spürte ich eine Art Schmerz, mein Magen krampfte sich zusammen, als ob mein Körper noch vor dem Verstand begriffen hätte.
Zeitgleich mit diesem Schrei hörte ich andere Laute aus derselben Richtung. Stimmen, die ein zweisilbiges Wort oder einen Namen skandierten, den ich nicht ganz verstand. Ich blickte hinüber, und in diesem Moment ging flackernd die erste Straßenlampe an. Irgendetwas hing von der Querstrebe des Laternenpfahls. Ein dunkelblaues Objekt, das ich nicht gleich erkannte, hoch über dem Boden.
Unten standen Leute – eine Gruppe von Jungs –, und jetzt erkannte ich, was da hing, und verstand im selben Moment, was der Chor skandierte.
»Reuben! Reuben! Reuben!«
Ich erstarrte. Vielleicht war ich in Gedanken immer noch zu sehr bei meinen Geschäftsbüchern, denn ich starrte einfach nur auf diese Szene.
Mein Sohn hing an der Querstrebe eines Laternenpfahls und riskierte unter Aufbietung aller Kräfte sein Leben, um diesen Jungs, die er für seine Freunde hielt, etwas zu bieten.
Plötzlich gewann alles an Schärfe, und ich sprang auf und rannte in den Flur.
Dein Cellospiel verstummte.
»Dad?«, hörte ich dich fragen.
Ich eilte die Treppen hinunter, hetzte durch den Laden. Ich stieß mit der Hüfte gegen eine Kommode, sodass eine der Figuren herunterfiel und zerbrach.
Ich rannte über die Straße und durch das Tor. Ich flog durch den Park wie in jüngeren Jahren, über Laub und Gras und den verlassenen Spielplatz. Die ganze Zeit behielt ich Reuben im Blick, als würde sich sein Griff lockern, wenn ich ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen ließ. Ich rannte, und die wahnsinnige Angst hämmerte in meiner Brust, hinter meinen Augen, in meinen Ohren.
Er schob die Hände näher zum senkrechten Teil des Laternenpfahls.
Jetzt sah ich sein Gesicht, im Licht der Lampe fahlgelb. Er bleckte vor Anstrengung die Zähne, die Augen quollen ihm aus den Höhlen, und sein Blick verriet, dass er schon wusste, welch fatalen Fehler er begangen hatte.
Bitte, Bryony, versteh doch: Der Schmerz eines Kindes ist der Schmerz der Eltern. Als ich auf deinen Bruder zurannte, war mir klar, dass ich auf mich selbst zurannte.
Ich stieg auf die Parkmauer und sprang hinab, landete hart auf dem Beton. Trotz des verstauchten Knöchels rannte ich weiter, rief seinen Namen.
Dein Bruder konnte sich nicht bewegen. Sein Gesicht war qualvoll verzerrt. Im grellen Licht wirkte es fahl, von dem Muttermal befreit, das er so gehasst hatte.
Ich kam näher.
»Reuben!«, schrie ich. »Reuben!«
Er erblickte mich, als ich mich zwischen seinen Freunden hindurchdrängte. Ich sehe immer noch sein Gesicht vor mir, und die Verwirrung, Angst und Ohnmacht darin. In jenem Moment des Erkennens, der Ablenkung, ließ die Konzentration, die es ihn kostete, genau dort auszuharren, wo er war, auf einmal nach. Ich spürte es im Voraus, wie ein hämisches Verhängnis, das ringsum aus den Reihenhäusern sickerte. Ein unsichtbares, aber allumfassendes Unheil, das noch die letzte Hoffnung raubte.
»Reuben! Nein!«
Er fiel wie ein Stein herab.
Binnen einer Sekunde verstummte sein Schreien, und er lag vor mir auf dem Betonpflaster.
Alles an ihm wirkte grauenhaft unnatürlich, er lag da wie eine weggeworfene Puppe. Die verrenkten Beine. Der Brustkorb, der sich rasch hob und senkte. Das leuchtend rote Blut, das aus seinem Mund quoll.
»Ruft einen Krankenwagen!«, schrie ich die Jungs an, die schweigend dastanden, wie betäubt. »Schnell!«
In der Ferne rasten auf der Blossom Street Autos vorbei, nach York oder hinaus, Richtung Supermarkt, gleichgültig, ahnungslos.
Ich kauerte mich neben ihn, berührte sein Gesicht und flehte ihn an, bei mir zu bleiben.
Ich bettelte.
Sein Sterben kam mir wie eine ganz bewusste Bestrafung vor. Ich sah die Entschlossenheit in seinem Blick, während das Leben immer mehr aus seinem Körper wich.
Einer der Jungs, der kleinste, erbrach sich auf das Pflaster.
Ein anderer – kahl rasierter Kopf, stechender Blick – wich zurück, taumelte auf die leere Straße.
Der größte und muskulöseste Bursche in der Gruppe stand einfach nur da und sah mich an, das Gesicht von einer Kapuze verschattet. Ich hasste diesen Jungen und seine unmenschlich gleichgültige Miene. Ich verfluchte den Gott, der dafür verantwortlich war, dass dieser Junge hier vor mir stand und atmete, während Reuben sterbend auf dem Pflaster lag. In der Verzweiflung jenes Moments spürte ich, dass mit diesem Jungen irgendetwas nicht stimmte, als sei er aus einer anderen Realität an diesen Schauplatz versetzt worden.
Ich nahm Reubens schwere Hand, die linke, und sah, dass die Handfläche vom Umklammern der Querstrebe immer noch gerötet und eingekerbt war. Ich rieb seine Hand und redete ihm unablässig zu, spürte aber, dass er sich immer mehr zurückzog, seinen Körper verließ. Und dann sagte er noch etwas.
»Geh nicht weg.« Als sei ich es, der ging, und nicht er. Das waren seine letzten Worte.
Die Hand wurde kalt, die Nacht umfing mich dichter, und die eintreffenden Sanitäter konnten nur noch feststellen, dass es nichts mehr zu tun gab.
Ich erinnere mich, dass ich dich durch den Park kommen sah.
Ich erinnere mich, dass ich mich von Reubens Leichnam, der auf dem Pflaster lag, entfernte.
Ich erinnere mich, dass du fragtest: »Dad, was ist los?«
Ich erinnere mich, dass ich sagte: »Kehr um, Herzblatt, geh nach Hause. Bitte!«
Ich erinnere mich, dass du mich nach dem Krankenwagen fragtest.
Ich erinnere mich, dass ich deine Frage ignorierte und meine Bitte wiederholte.
Ich erinnere mich, dass der Junge mit der Kapuze dich direkt anstarrte.
Ich erinnere mich, dass ich insistierte, ich erinnere mich, dass ich dich am Arm packte und anschrie, ich erinnere mich, dass ich strenger zu dir war als je zuvor.
Ich erinnere mich an deine Miene, und ich erinnere mich daran, dass du zurückranntest, nach Hause, auf den Ladeneingang zu, und die Tür hinter dir zuzogst. Und dass ich in all diesem Wahnsinn wusste, ich hatte euch beide verraten.
Wie du weißt, habe ich den größten Teil meines Lebens damit zugebracht, defekte Dinge instand zu setzen. Uhren zu reparieren, alte Stühle zu restaurieren, Porzellan zu kitten. Im Lauf der Jahre habe ich gelernt, wie man Flecken mit Ammoniak oder einem Tupfer Lackbenzin beseitigt. Ich kann Kratzer aus Glas entfernen, verschiedene Holzmaserungen imitieren. Und ich weiß, wie man einen korrodierten Tudor-Leuchter mit Essig, einem Viertelliter heißem Wasser und einem Stück feiner Stahlwolle restauriert.
Eine Mahagoni-Frisierkommode aus der Zeit Georges III. zu kaufen, mit all den Schrammen und Kratzern aus zweihundert Jahren, und ihr wieder zu ihrer ursprünglichen Pracht zu verhelfen, war früher das Höchste für mich. Oder der Moment, wenn Mrs. Weeks in den Laden kam und mit kundigen Fingern über eine Worcester-Vase strich, ohne die Sprünge zu ertasten – vor noch nicht allzu langer Zeit versetzte mich das in einen wahren Glückszustand.
Vermutlich schenkte es mir ein Gefühl von Macht. Es half mir, die Zeit zu besiegen. Es gab mir die Möglichkeit, mich gegen diese ekelhafte Epoche des Zerfalls abzuschotten. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie fürchterlich es mich schmerzt, dass ich die Vergangenheit unserer Familie nicht auf die gleiche Weise restaurieren kann.
Es gibt da etwas, das du verstehen musst.
In meinem Leben gab es vier Menschen, die ich aufrichtig geliebt habe, und von diesen vier Menschen bist du mir als Einzige geblieben. Die anderen starben eines unnatürlichen Todes. Mein Sohn, meine Ehefrau, meine Mutter. Alle drei viel zu früh.
Man liebt drei Menschen, und sie sterben. Das rechtfertigt ja wohl kaum eine öffentliche Untersuchung, oder? Nein. Wie viele Menschen, die man liebt, müssten sterben, bevor diese Liebe Argwohn erwecken würde? Fünf Menschen? Zehn? Hundert? Drei ist nichts. Kann man vergessen. Drei Menschen bedeuten einfach nur ganz normales Pech, selbst wenn es drei Viertel all dessen bedeutet, was einem auf Erden jemals wichtig war.
Oh, natürlich habe ich versucht, dies rational zu betrachten. Na komm, Terence, habe ich zu mir gesagt. Du trägst an keinem dieser Todesfälle Schuld. Und natürlich hätte meine Verteidigung vor einem Gericht für Strafsachen Bestand.
Aber wo gibt es Gerichte für Liebessachen? Und welche Strafe könnten sie verhängen, die schlimmer wäre als die Trauer? Nach Reubens Tod gelangte ich zu der Überzeugung, dass irgendetwas mit mir und mit der Liebe, die ich zu geben hatte, nicht stimmte. Ich hatte Reuben enttäuscht. Ich hatte ihn in der Gegenwart von Freunden sterben lassen, die ich gar nicht kannte.
Ich hatte ihn zwar geliebt, aber immer gedacht, es käme einmal die Zeit, wo ich alles wieder an ihm gutmachen würde. Und ich konnte mich nicht damit abfinden, dass diese Zeit nun nie mehr kommen würde.
Natürlich ist der Tod eines Kindes für Eltern immer unerträglich. Man hört die ersten Takte einer vertrauten Sonate, und die Musik bricht ab, aber man fühlt noch die stummen Töne, ihre Schönheit und Macht sind nicht weniger real, nicht weniger vollkommen. Bei Reuben hatte ich nie auf die Melodie geachtet. Sie war die ganze Zeit erklungen, seine ganzen vierzehn Lebensjahre lang, aber ich hatte einfach nicht mehr hingehört. Ich konzentrierte mich auf den Laden oder auf dich und überließ Reuben sich selbst.
Und so bemühte ich mich jetzt, das zu finden, was ich einst missachtet hatte, und wenn ich mir genug Mühe gab, leuchtete es manchmal auf, dieses Leben, das verwandelt war, aber nicht wirklich beendet. Töne, die nicht harmonisch aufeinanderfolgten, sondern als Kakofonie erklangen und mit dem Gewicht der Schuld über mich hereinbrachen.
Am Morgen der Beerdigung weckte mich ein Summen. Ein wütendes Sirren, das sich durch die Dunkelheit fräste. Ich öffnete die Augen und hob den Kopf vom Kissen, um zu sehen, woher es kam. Im gedämpften Licht der Morgensonne, die durch die Vorhänge drang, lag der Raum da wie immer. Die gerahmte Fotografie deiner Mutter, der Schrank, der William-Turner-Druck, die französische Kaminuhr. Bis auf das Geräusch war alles ganz normal. Erst als ich mich weiter aufrichtete, auf die Ellbogen gestützt, erkannte ich den Ursprung des Geräuschs. Dicht über der Bettdecke, Richtung Fußende, sah ich kleine Fliegen schweben, fünfhundert vielleicht, einfach nur schweben, als läge ich in der Wüste, ein in der Sonne verwesender Leichnam.
Einen Moment lang spürte ich keine Angst. Der Anblick dieser Tierchen, die sich in kleinen ovalen Wirbeln bewegten, wirkte hypnotisch auf mich. Dann änderte sich etwas. Die Fliegen setzten sich in Bewegung, als hätten sie gemerkt, dass ich wach war, und flogen wie eine Wolke auf mein Gesicht zu. Bald hüllten sie mich ein, ein dunkler Blizzard, mit ihrem wütenden Gesumm, das immer lauter wurde. Ich kroch rasch unter die Decke, und mit dieser abrupten Bewegung verstummte der Lärm komplett. Ich wartete eine Sekunde im warmen, weichen Dunkel und tauchte wieder auf.
Die Fliegen waren verschwunden, spurlos. Ich blickte mich um, und obwohl ich die Insekten nicht mehr sah, beschlich mich das Gefühl, dass der Raum sich verändert hatte, als wären alle Gegenstände darin der gleichen Einbildung erlegen wie ich.
Ich erinnere mich, dass Cynthia und ich uns im Auto unterhielten, unseren Schmerz hinter banalen Worten versteckten, während der Trauerzug durch die alten angelsächsischen Straßen rollte. Einmal wandte sich Cynthia zu dir um und sagte: »Du hältst dich so tapfer!« Ich sah dich traurig lächeln und pflichtete deiner Großmutter murmelnd bei. Tatsächlich warst du die ganze Woche über bemerkenswert gefasst. Zu gefasst, fand ich und befürchtete, du würdest vielleicht alles in dir aufstauen.
Ich versuchte, meine Gedanken auf deinen Bruder zu konzentrieren, merkte aber, dass sie ständig abschweiften, nämlich zu dir und deinem veränderten Verhalten seit dem Tod deines Bruders.
Du hattest die ganze Woche lang nicht Cello gespielt. Das verstand ich natürlich. Du warst jeden Abend zu den Stallungen gegangen und hattest dich um Turpin gekümmert, ihn aber am Tag vor Reubens Tod zum letzten Mal geritten. Auch dies war eigentlich zu erwarten gewesen. Immerhin hattest du deinen Zwillingsbruder verloren und warst jetzt allein, das einzige Kind eines alleinstehenden Vaters. Trotzdem machte ich mir Sorgen. Du warst nicht zur Schule gegangen, und ich hatte den Laden zugesperrt, und doch hatten wir, glaube ich, die ganze Woche kein einziges Mal richtig miteinander geredet. Stets hattest du eine Ausrede parat, um den Raum zu verlassen (nach dem Bügeleisen schauen, Higgins füttern, auf die Toilette gehen). Selbst damals im Wagen, auf der langsamen Fahrt zum Friedhof, war mir, als ob du unter meinem Blick zusammenzucktest, als würde dir ein Hitzestrahl die Wange versengen.
Cynthia drückte meine Hand, als wir uns der Kirche näherten. Wie üblich hatte sie sich die Fingernägel schwarz lackiert und ihr gruseliges Make-up aufgelegt, und ich musste an den Scherz denken, den sie morgens unter Tränen gemacht hatte – das Praktische an ihrem Kleidungsstil sei, dass sie bei Beerdigungen nie groß überlegen müsse.
Wir hielten vor der Kirche und stiegen aus. Unsere Gesichter spiegelten die Trauer, die wir empfanden, die aber auch, das war uns durchaus bewusst, von uns erwartet wurde. Als wir an den dicht gedrängten alten Gräbern der Pestopfer vorbeikamen, dachte ich an all die toten Eltern, die von ihren Kindern getrennt worden waren. Erinnerst du dich an die Gespenstergeschichte, die Cynthia früher immer erzählt hat? Ein Junge starb an der Pest und wurde gemäß den neuen Gesetzen außerhalb der Yorker Stadtmauern bestattet, und der Geist seiner Mutter entstieg ihrem Grab und suchte vergeblich nach dem Sohn. Das hat sie euch beiden erzählt, als ihr noch klein wart und mit euren Orangen und Kerzen vom Adventsgottesdienst nach Hause gingt, und Reuben hat dich damals ausgelacht, weil du Angst hattest.
Es ist ein seltsames Gefühl. Als würde ich versinken. Man erinnert sich an etwas, aber darunter lauert immer noch etwas anderes, das einen hinabzieht. Ich muss den Kopf oben halten. Weiter frische Luft schnappen.
Du fragst dich vielleicht, warum ich das alles wiederaufleben lasse und dir erzähle, wo du doch selbst dabei warst, aber ich muss es dir so schildern, wie ich es erlebt habe, denn du kennst nur deine Seite, und ich kenne nur meine. Wenn du diese Schilderung gelesen hast, kannst du mein Handeln vielleicht besser verstehen, und ich hoffe, dass irgendwo in jenem Raum, jenem gestaltlosen Raum zwischen deinem Lesen und meinem Schreiben, eine Art Wahrheit zum Vorschein kommt. Eine vergebliche Hoffnung, aber die letzte, die mir bleibt, und so klammere ich mich daran, wie ich mich damals an dich geklammert habe, als wir den Pfad entlang auf die Kirche zugingen.
Am Ende des Pfads erwartete uns Peter, der Pfarrer, der uns seine Anteilnahme bekundete und den Ablauf erklärte. Er wandte sich an dich, und Cynthia antwortete schnell an deiner Stelle, um dich zu schonen. In diesem Moment drehte ich mich um und sah den Jungen, der am Abend von Reubens Tod dabei gewesen war. Den Jungen, der mir gleich verhasst gewesen war, wegen seines leeren, teilnahmslosen Gesichtsausdrucks. Diesmal fehlte die Kapuze. Er trug einen billigen Anzug mit schwarzer Krawatte, war aber zugegebenermaßen eine eindrucksvolle Erscheinung. Die bleiche Haut, das schwarze Haar und diese Augen, in denen eine dunkle, grüblerische Macht zu liegen schien. Etwas Gewalttätiges und Gefährliches.
Ich weiß nicht, ob du ihn damals auf dem Friedhof gesehen hast. Ich flüsterte Cynthia etwas ins Ohr und ging an den uralten Gräbern vorbei auf ihn zu.
»Darf ich fragen, was du hier tust?«
Er sagte erst einmal gar nichts. Er kämpfte mit der Wut, die sich plötzlich in seiner Miene spiegelte.
»Ich bin Denny«, sagte er, als sei dies von Bedeutung.
»Denny?«
»Ich war einer von Reubens Kumpels.« Aus der Stimme sprach grobe Arroganz, eine Streitlust, die dem Anlass vollkommen unangemessen schien.
»Er hat dich nie erwähnt.«
»Ich war da, als er … Sie haben uns ja gesehen.«
»Ja, ich habe euch gesehen.« Ich verkniff mir Beleidigungen und Vorwürfe. Es war hier weder die Zeit noch der Ort dafür. »Und warum bist du hier?«
»Die Beerdigung.«
»Nein. Du warst nicht eingeladen.«
»Ich wollte kommen.« Sein Blick wirkte eindringlicher als seine Worte.
»Na gut, du bist gekommen. Und jetzt kannst du wieder gehen.«
Er blickte an mir vorbei, über meine Schulter. Ich drehte mich um und sah, dass du dich immer noch mit dem Pfarrer abmühtest.
»Geh jetzt«, sagte ich. »Du bist hier nicht willkommen. Lass uns in Ruhe.«
Er nickte. Als habe sich seine Vermutung bestätigt.
»Gut«, sagte er mit zusammengepressten Lippen. Als er sich umdrehte und davonging, hatte ich eine ganz seltsame, unangenehme Empfindung. Ich kann sie dir nur als Verlassenwerden beschreiben, als würde ein wichtiger Teil meiner Seele von mir abgezogen, als wisse ich einen Moment lang nicht mehr genau, wo ich mich befand. Mir wurde schwarz vor Augen, eine seltsame Energie benebelte mein Gehirn, und ich musste mich an den steinernen Torpfosten klammern.
Meine nächste Erinnerung ist die Kirche. Ich erinnere mich, dass wir schleppend hinter dem Sarg hergingen. Ich erinnere mich vage an die Details der Traueransprache des Pfarrers. Ich sehe Cynthia vor mir, wie sie am Lesepult steht und ein paar Verse aus den Korintherbriefen liest, ganz ohne ihre sonstige Theatralik. »Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten.«
Noch genauer erinnere ich mich daran, wie ich auf die Trauergemeinde blickte, während ich vergeblich ansetzte, das von mir ausgewählte Gedicht vorzutragen. Ich sah so viele Gesichter, alle mit der obligatorischen Trauermiene. Lehrer, Kunden, Leute vom Beerdigungsinstitut. Und du unter ihnen, auf der vordersten Kirchenbank, den Blick starr auf den Sarg deines Bruders gerichtet. Ich blickte auf das Blatt Papier, das Cynthia ordentlich für mich ausgedruckt hatte.
Eine ganze Weile konnte ich nicht sprechen, nicht weinen, gar nichts. Ich stand einfach nur da.
Diese Minute muss den armen Leuten wie eine Ewigkeit erschienen sein. Ich konnte kaum atmen. Erst als Peter mit hochgezogenen Augenbrauen auf mich zukam, raffte ich mich endlich auf.
»An den Schlaf«, sagte ich, und meine Worte hallten von den kalten Steinmauern wieder.
»An den Schlaf.«
Ich sagte es immer wieder – »An den Schlaf« –, als seien diese Worte ein Zündschlüssel, mit dem ich etwas in Gang setzen wollte. »John Keats.«
O sanfter Duft der stillen Mitternacht,
Der zart und sorgsam unsre Augen schließt
Und schattend vor dem Lichte sie bewacht,
In Seelen göttliches Vergessen gießt.
O sanfter Schlaf! Schließ mir die willigen Lider,
Eh dieses Hymnus’ letztes Wort verklingt,
Nein, hör das Amen erst, eh schläfernd nieder
Dein Mohn die süßen Gnadengaben bringt.
Dann hüte mich, sonst gießt der Tag sein Licht,
Vielfachen Jammer brütend, auf mein Kissen,
Behüte mich, denn ach, es schlummert nicht
Das wie ein Maulwurf wühlende Gewissen;
Dreh flink den Schlüssel in geölten Riegeln,
Die meiner Seele Springbrunn sanft versiegeln.
Ich setzte mich wieder, und Peter führte den Gottesdienst zu Ende. Ich blickte auf die Füße der Sargträger, die durch den Gang zurück zur Eingangstür schritten. Vier Paar Füße bewegten sich perfekt im Takt, wie zu Beginn einer makabren Tanzeinlage.
Ich blickte auf, ins Gesicht eines Mannes, der die Anstrengung zu verbergen suchte, die es ihn kostete, den schweren Sarg zu schultern; den Kummer, den sein Gesicht zeigte, empfand er nicht.
Ich sah dich an und sagte zu dir: »Alles ist gut.«
Du schwiegst.
Fünf Minuten später plätscherte draußen sanfter Regen auf den großen schwarzen Regenschirm, den ich über dich und deine Großmutter hielt. Nach einer Woche des Schweigens brachst du in Tränen aus, und auch Cynthia konnte nicht mehr an sich halten. Nur meine Augen blieben trocken, auch wenn mein Herz sicherlich geweint hat. Doch, ganz gewiss.
Ich höre immer noch Peters Stimme.
»Wir haben unseren Bruder Reuben Gottes Barmherzigkeit anvertraut und übergeben nun seinen Leib der Erde.« Die Sargträger ließen den Sarg an schwarzen Gurten hinab. »Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.« Die tröstliche Wirkung der Wiederholung, des Rituals, vermochte dein Schluchzen nicht zu beruhigen. »In der unerschütterlichen Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus.« Der Sarg erreichte den Boden des Grabs. »Welcher starb und begraben wurde und für uns wiederauferstand. Ehre sei ihm in alle Ewigkeit.« Und dann ertönte das gemeinschaftliche »Amen«, so leise und gedämpft, als komme es aus der Erde, die ihn begraben würde. Die Erde, die uns glauben ließ, er sei gestorben.
Die Polizei hatte nicht die Absicht, irgendetwas gegen seine Freunde zu unternehmen.
»Man hat ihn ja nicht gezwungen, da raufzuklettern.«
Was für eine primitive Auffassung von Zwang, Unglück und Verantwortung.
Ich habe dir das nie erzählt, aber ich habe sie aufgesucht. Die Jungs. Sie trieben sich an den stillgelegten Tennisplätzen herum, und nachdem ich dich beim Reitstall abgesetzt hatte, fuhr ich hin, um meinen Emotionen Luft zu machen.
Sie waren da. Alle, außer ihm, Denny.
Ich hielt am Bordstein an und kurbelte die Scheibe herunter.
»Na, seid ihr jetzt zufrieden?«, rief ich, aus dem Fenster gelehnt. »Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht, ihm beim Sterben zuzuschauen! Hoffentlich schlaft ihr gut in dem Wissen, dass sein Blut an euren Händen klebt!«
Sie standen da, hinter dem Gitterdraht, wie Schurken in einem Bernstein-Musical. Der kahl rasierte Junge mit dem stechenden Blick machte eine obszöne Geste, sagte aber nichts.
»Mörder!«, schrie ich, bevor ich mit quietschenden Reifen losfuhr.
Und dabei beließ ich es nicht. Am nächsten Abend brüllte ich ihnen aus dem Wagenfenster den gleichen Vorwurf zu. Und am nächsten und übernächsten wieder, Tag für Tag. Aber ihn sah ich dort nie. Denny. Und beim vierten Mal war keiner mehr da. Ich schrie ins Nichts, klagte die Luft an. Die sind abgehauen, weil sie solche Schuldgefühle haben, sagte ich mir. Meine Worte haben sie vertrieben. Seltsamerweise empfand ich aber keinerlei Genugtuung. Es deprimierte mich, dass sie verschwunden waren, und mein Zorn wich rasch wieder der Verzweiflung.
Schon seit seinen ersten Schulzeugnissen war klar, dass die Stärken deines Bruders nicht im akademischen Bereich liegen würden. Er erntete nie die Art von Kommentaren, mit denen du überschüttet wurdest – »überdurchschnittlich« oder »bemerkenswert«, nie ein Lob wie »So macht das Unterrichten Freude!« oder »Eine wahre Bereicherung für die Klasse!«.
Reuben hatte nicht das gleiche Interesse an Büchern wie du. Für ihn blieb das Lesen immer ein notwendiges Übel. Genau wie du liebte zwar auch er meine Gutenachtgeschichten von Dick Turpin und den anderen legendären Schurken, aber er wollte dieselben Geschichten immer wieder hören, wogegen es bei dir stets eine neue Geschichte sein musste.
Ich sehe ihn jetzt vor mir am Fenster, wie er mit dem Finger Muster auf die beschlagene Scheibe malt. »Ein stiller Junge.« »Leicht beeinflussbar.«
Geld ist in diesem verblendeten Jahrhundert ja der Maßstab für Liebe geworden. Einmal warf mir ein Außenstehender ziemlich grob vor, ich hätte für dich besser gesorgt als für ihn, weil ich seit deinem elften Lebensjahr Schulgeld für dich bezahlt habe.
Aber was blieb mir anderes übrig? Ich konnte mir das nur für einen von euch leisten – hätte ich euch beide benachteiligen sollen, nur damit ihr gleichberechtigt seid? War es meine Schuld, dass es sich bei der Mount School zufällig um eine Mädchenschule handelte? Wäre es besser gewesen, Reuben, der nie gerne gelernt hat, wäre auf eine weiterführende Schule gegangen? Nein, es lag wirklich nahe, ihn auf die St John’s School zu schicken.
Gut, ich gebe zu, dies war nicht der einzige Luxus, den ich dir gönnte. Du wolltest reiten, also kaufte ich dir ein Pferd und finanzierte die Stallmiete. Du wolltest ein Instrument spielen, also zahlte ich für deinen Geigen- und Cellounterricht an der Musikschule. Du wünschtest dir eine Katze, eine kaffeebraune Birma-Katze, also kaufte ich dir Higgins.
Du hattest an alldem so lebhaftes Interesse! Es war ja kein übertriebener Luxus, oder falls doch, hätte ich deinem Bruder nur allzu gern denselben Luxus ermöglicht, wenn er derlei Wünsche geäußert hätte. Aber wo lagen denn Reubens Interessen? Keine Ahnung. Er wünschte sich ein Fahrrad, doch als ich ihm eines kaufte, war es ihm nicht gut genug. Er wünschte sich diesen ganzen Technikquatsch, wo er von vornherein wusste, dass ich Nein sagen würde. Wir dürfen nie vergessen, dass dein Bruder nicht leicht zu haben war. Selbst in meinem Kummer durfte ich dies nicht außer Acht lassen. Tatsächlich mahnte mich gerade mein Kummer, es nicht zu vergessen, denn ich wusste ja, Sentimentalität kann die Erinnerung so überfluten, dass man sich an den eigentlichen Menschen gar nicht mehr entsinnt.
Ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Ich wollte mich an sein endloses nächtliches Gebrüll als Baby erinnern, an seine späteren Wutanfälle, seinen unersättlichen Appetit auf Fruchtgummi. Ich wollte mich daran erinnern, wie böse er immer wurde, wenn ihr zusammen im gleichen Bilderbuch lesen solltet. Ich wollte mich an eure Auseinandersetzungen erinnern, selbst an jenen Streit, als er deine Musiknoten zerriss.
Ich wollte mich daran erinnern, wie er dasaß und fernsah und dabei mit der Hand das Muttermal im Gesicht verdeckte. Ich wollte mich an den Vorfall mit der Zigarette, den Vorfall mit dem Ladendiebstahl, den Vorfall mit der zertrümmerten Vase erinnern. Ich wollte mich daran erinnern, wie ich euch manchmal früh am Sonntagmorgen zu Antiquitätenmärkten mitnahm und er die ganze Fahrt über herummeckerte.
Und doch fiel es mir immer schwer, die Erinnerung an ihn wachzurufen und ihn vor mir zu sehen. Dachte ich an ihn, schob sich sofort der Gedanke an dich dazwischen. Versuchte ich mir euch als Babys vorzustellen, so wie eure Mutter euch zuletzt gesehen hat, hatte ich nicht sein brüllendes Gesicht vor Augen. Ich sah immer nur dich, wie du friedlich neben ihm lagst, in unschuldig-stille Träume verloren. Du selbst ein Traum.
Und dann kam der Tag, an dem ich nach dem Begräbnis zum ersten Mal wieder den Laden aufmachte. Dein erster Tag zurück in der Schule. Ich war nur damit beschäftigt, silberne Wasserkrüge, Suppenterrinen und sonstige Silberwaren auf Hochglanz zu polieren. Den ganzen Tag trug ich meine weißen Baumwollhandschuhe, der Laden roch nach Politur, und von den silbernen Gegenständen starrte mir verzerrt, mit irrem Blick, mein Spiegelbild entgegen.
Kunden kamen herein und verschwanden, ohne etwas zu kaufen, weil ich sie gleich wieder verscheuchte. Ich machte Fehler. Ich gab zu wenig Wechselgeld heraus. Ich ließ eine Davenport-Kanne fallen. Ich war in einem fürchterlichen Zustand.
»Jetzt reiß dich mal am Riemen, Terence«, mahnte Cynthia, die mir an der Ladentheke aushalf. »Du musst meine Enkelin ernähren!«
Ich weiß, dass ich mich damals bei dir beschwerte, Cynthia würde mir mit ihren Hexenkrallen, ihren Klamotten und ihrer allzu direkten Art die Kunden vergraulen, aber in Wirklichkeit war sie mir eine große Hilfe.
Und dann war da dieses tolle Essen, das sie einfach so plante, ohne besonderen Anlass. »Ich lade meine alten Freunde aus der Laientheatergruppe ein«, meinte sie. »Wir gehen ins Box Tree. Offenbar hat es einen Michelin-Stern und wurde frisch renoviert. Man muss Monate im Voraus reservieren – wenn ich also im August hinwill, muss ich jetzt schon alles organisieren. Wollt ihr kommen, ihr zwei?«
Du hast auf dem Sofa gesessen, in Reithosen, weil du gleich in den Stall wolltest. »Klar, ich bin dabei«, meintest du zu meiner großen Erleichterung.
»Ja, Cynthia, natürlich«, sagte auch ich, weil ich merkte, wie wichtig es ihr war. »Das wäre schön.«
»Sehr gut«, meinte sie. »Dann trage ich das im Kalender ein.«
Auf der Fahrt zu den Stallungen warst du recht schweigsam. Ich weiß noch, wie ich dich absetzte und plötzlich das gleiche Gefühl hatte wie damals beim Begräbnis. Diese komische Empfindung, von mir selbst verlassen zu werden, als hätte meine Seele ein Leck. Mir wurde wieder schwarz vor Augen. Und bei der Rückkehr sah ich ihn. Denny. Da es schon dunkel wurde, als ich zur Pferdekoppel einbog, glaubte ich erst an eine Sinnestäuschung, als ich ihn im fahlen Scheinwerferlicht in Joggingkleidung vorbeikeuchen sah. Ich zwinkerte, aber er war immer noch da und starrte jetzt direkt zu mir herüber.
Ich stieg aus und befahl ihm, zu verschwinden. Er blickte mich mit eiskalter Entschlossenheit an, bevor er sich ein paar Schritte entfernte und einfach weiterjoggte. Ich rief nach dir, erinnerst du dich? Wir stritten, als wir Turpin in den Stall zurückführten. Offenbar hattest du keine Ahnung, was der Junge dort wollte. Offenbar war er dir ebenso verhasst wie mir. Offenbar hatte er sich hier noch nie zuvor herumgetrieben.
Du warst absolut überzeugend, und ich war absolut überzeugt, auch wenn mir plötzlich etwas klar geworden war. In meinem Leben gab es so vieles, das mir kostbar war und das ich trotzdem überhaupt nicht schützte. »Tut mir leid, Herzblatt«, sagte ich, »dass ich dich angeschrien habe.« Und du hast genickt und auf die vorbeigleitenden Häuser geblickt und dich vielleicht hinter diese golden erleuchteten Fenster geträumt, glücklich im Dienstagabend eines anderen Mädchens.
Ich erinnere mich, dass ich versuchte, die Sachen deines Bruders zu sichten. Auf seinem Bett sitzend spürte ich, wie fremd mir sein Zimmer war. Filmplakate, die mir überhaupt nichts sagten. Rätselhaftes technologisches Equipment, von dem ich nichts gewusst hatte. Zeitschriften mit Titelfotos von Frauen, die nicht wie Frauen aussahen, sondern so, als hätte sie ein italienischer Sportwagenhersteller designt.
Ich durchstöberte seine Schultasche und fand einen Brief, den er mir nie ausgehändigt hatte. Er stammte von seinem Klassenlehrer, Mr. Weeks, und informierte mich darüber, dass Reuben zwei Geschichtsstunden versäumt hatte. Der Brief war vom März, noch bevor Mr. Weeks seinen Job verloren hatte. Ich erinnerte mich an ihn – er war einmal mit seiner Frau und seinem Sohn George zu mir in den Laden gekommen, um die Bastardtruhe aus Kiefernholz zu kaufen, ein Hüne von einem Mann, der als Lehrer wohl ziemlich fies sein konnte.
Es war seltsam, sich in Reubens Zimmer aufzuhalten. Seine Gegenwart war so real, eingefangen in all diesen Gegenständen, seinen Habseligkeiten, die mich daran erinnerten, wie wenig ich ihn verstanden hatte. Mit Cynthias Hilfe schaffte ich vieles davon auf den Dachboden. Du hast auch mitgeholfen, nicht wahr?
Etwas ganz Wichtiges muss ich dir aber im Zusammenhang mit seinem Fahrrad erzählen. Wie du weißt, hängte ich einen Zettel ins Schaufenster und bot das Rad für fünfundzwanzig Pfund an. Gleich am selben Tag meldete sich eine Frau bei mir, die es für ihren Sohn kaufen wollte. Eine Schottin, deren längliches Gesicht mich stark an die Steinstatuen auf der Osterinsel erinnerte.
Ich holte gerade das Rad aus dem Schuppen, als sich erneut das Dunkel um mich zusammenzog und ich wieder dieses komische Gefühl im Hinterkopf spürte. Nur war es diesmal stärker. Als würde jemand versuchen, in meinem Bewusstsein eine andere Sendefrequenz einzustellen. Das Gefühl steigerte sich noch, als ich auf den Radsattel klopfte und die Schottin den Lenker packte und das Rad wegschob. Ich stand eine Weile da, wie in Trance, und sah ihr nach, wie sie es die Straße entlangschob. Ich blieb stehen, bis sie und das Rad meinem Blick entschwunden waren, das seltsame Gefühl sich legte und ich wieder in meinen tröstlichen Trauermodus versank.
Musiker zu sein bedeutet, um deinen einstigen Helden Pablo Casals zu zitieren, dass man die Seele erkennt, die den Dingen innewohnt. Eine Seele, die am stärksten in einem Steinway oder einer Stradivari spürbar wird und ihren höchsten Ausdruck bei Bach oder Mozart findet, die aber auch sonst in allem Stofflichen präsent ist.
Natürlich bin ich kein Musiker. Ich verkaufe Antiquitäten, doch hier gilt das Gleiche. Man sitzt den ganzen Tag in einem Laden, umgeben von alten Uhren, Tischen, Stühlen, Tellern und Kommoden und fühlt sich genauso wie sie. Man ist auch nur ein Objekt, das Ereignisse durchlebt hat, die sich nicht ändern ließen, ein Objekt, das erschaffen und transformiert wurde und gezwungen ist, angesichts eines unbekannten Schicksals in einer Art Limbus auszuharren.
Eines Nachmittags kam ein Kunde in den Laden – ein bulliger Mann vom Yorkshire-Schlag. So ein Typ, bei dem man nicht weiß, was dominiert, Arroganz oder Ignoranz. Er meckerte sich von Preisschild zu Preisschild und erklärte Cynthia und mir, er wäre mehr als überrascht, wenn wir so viel für eine Art-nouveau-Figur oder ein Lesetischchen bekommen würden.
»Oh«, meinte Cynthia, »es ist immerhin Rosenholz.«
»Egal«, erwiderte der Mann.
»Und frühgeorgianisch.«
»Nicht mal, wenn es mesopotamisch wäre, fände ich diesen Preis gerechtfertigt.«
Jetzt hatte ich genug. »In einem Antiquitätengeschäft gibt es zweierlei Kunden«, erklärte ich ihm. »Die einen erkennen die Seele eines Objekts und begreifen, dass man selbst die kleinsten Dinge – Saucenlöffel, Fingerhüte, silberne Muskatreiben – gar nicht hoch genug schätzen kann. Solche Kunden würde ich als echte Liebhaber bezeichnen; sie wissen unsere Vorfahren zu würdigen, die die betreffenden Gegenstände benutzt, getragen oder Getränke aus ihnen eingeschenkt haben, die sich im gleichen Raum wie die Objekte befanden, im selben Raum weinten oder träumten oder sich verliebten. Solche Menschen suchen einen Laden wie Cave Antiques auf.«
Nicht nur Cynthia, sondern auch der Kunde starrte mich mit großen Augen und offenem Mund an, stumm wie die Figur in seiner Hand, das Mädchen mit Tamburin, grün und rosa emailliert. Es waren ursprünglich zwei Figuren gewesen. Die andere Figur war zerbrochen, als ich auf dem Weg zu Reuben gegen die Kommode stieß, am Abend, als er starb.
Ich fuhr fort: »Wogegen der andere Kundentyp, der Typ, mit dem ich es möglicherweise hier zu tun habe, einen Gegenstand nur als Summe der Materialien betrachtet, aus denen er zusammengesetzt ist. Solche Kunden haben kein Gefühl dafür, dass ein Objekt von Menschenhand geschaffen und jahrhundertelang von all seinen längst verstorbenen Besitzern in Ehren gehalten wurde. Nein, um so etwas scheren sich diese Leute nicht. Es ist ihnen egal – sie sehen nur Zahlen, wo sie Schönheit sehen sollten. Sie blicken auf das Zifferblatt einer Messinguhr und sehen nur die Zeit.«
Der Mann stand da, fast ebenso verblüfft von meinem Ausbruch wie ich selbst. »Die wollte ich eigentlich meiner Frau zum Geburtstag kaufen«, sagte er schließlich und stellte die Art-nouveau-Figur zurück. »Aber wenn man hier so behandelt wird, gehe ich dann doch lieber woandershin.«
Nachdem er den Laden verlassen hatte, machte Cynthia mir Vorwürfe. »Terence, was um alles in der Welt ist in dich gefahren?«
»Nichts«, erwiderte ich. »Mir hat es einfach nicht gefallen, wie er mit dir gesprochen hat.«
»Mein Gott, Terence. Ich bin alt und hässlich genug, um auf mich selber aufzupassen. Jetzt hast du einen Käufer verprellt.«
»Ich weiß, tut mir leid. Es ging nicht um ihn. Tut mir leid.«
Sie seufzte. »Du weißt schon, was du nötig hättest, nicht wahr?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Du musst hier raus. Mit Bryony. Macht Urlaub. Ich könnte mich eine Woche lang um den Laden kümmern.«
Urlaub. Schon das Wort klang absurd. Ein tanzender Narr, der bei einem Leichenschmaus bunte Ansichtskarten verteilt. Eine Erinnerung blitzte in mir auf. Wie wir auf einer französischen Autobahn Richtung Süden fuhren, du und Reuben schlafend auf der Rückbank zusammengerollt, einträchtig einander zugewandt.
»Nein, Cynthia, das glaube ich nicht«, erwiderte ich, aber die Idee ging mir den ganzen Nachmittag nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht war sie ja gar nicht so absurd. Vielleicht war dies unsere Chance, zur Normalität zurückzukehren. Die vielen Bruchstücke aufzuheben und wieder zusammenzusetzen. Ja, dies war die Chance, unsere gebrochenen Herzen zu heilen.
Seit der Beerdigung hatte ich leichte Änderungen an deinem Verhalten bemerkt.
Statt Pablo Casals’ melancholischem Bogenstrich oder deines eigenen Cellospiels hörte ich aus deinem Zimmer jetzt andere Musik. Einen so brutalen und hässlichen Lärm, dass ich dich fast jeden Abend bat, ihn leiser zu stellen.
Du übtest kaum noch. Zwar gingst du immer noch allwöchentlich zur Cellostunde in die Musikschule, fragte ich dich aber, wie es lief, war die Antwort nur ein leichtes Achselzucken oder ein leises Summen. Plötzlich war da eine Freundin, von der ich noch nie gehört hatte – Imogen –, die du offenbar jeden Abend anrufen musstest. Deine Zimmertür war immer zu, und manchmal stand ich davor und überlegte, ob du wohl gerade auf dem Bett liegen oder am Computer sitzen mochtest. Einmal, als du herauskamst, bemerkte ich, dass du dein Pablo-Casals-Plakat abgehängt hattest. Der alte Meistercellist, der dich immer so sehr inspiriert hatte!
Ich fand das unglaublich. Dieser Mann war doch immer dein Idol gewesen!
Du hattest seine Interpretation der Cellosuiten von Bach geliebt. Du hattest dir sogar eine alte Filmaufnahme aus der Bibliothek bestellt. Pablo, der mit vierundneunzig Jahren in der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine seiner Kompositionen uraufführte. Der winzige alte Mann, in dessen altersrunzligem Gesicht sich die bewegten Emotionen des Orchesters spiegelten, bis Mensch und Musik eins wurden und jeder Takt, der in diesem riesigen Saal erklang, direkt aus seiner Seele zu strömen schien.
Früher einmal hattest du seine Memoiren verschlungen und sie mir wärmstens empfohlen. Ich erinnere mich an die Geschichte, wie er und einige Gefährten den Mount Tamalpais in der Nähe von San Francisco erklommen. Pablo hatte sich an jenem Morgen sehr schwach und müde gefühlt, dann aber zur Verblüffung seiner Freunde trotzdem darauf bestanden, den Berg zu besteigen. Sie begleiteten ihn, doch dann, während des Abstiegs, die Katastrophe. Erinnerst du dich an diese Geschichte?
Weiter oben am Berghang hatte sich ein riesiger Felsbrocken gelöst und raste auf die Gruppe zu. Pablos Gefährten gelang es, dem Felsbrocken auszuweichen, er selbst jedoch starrte ihm wie gelähmt entgegen. Und so traf der vorbeirasende Brocken Pablos linke Hand, seine Greifhand, und verletzte sie schwer. Entsetzt blickten seine Freunde auf die blutüberströmten, zerfleischten Finger, doch Pablo selbst zeigte keinerlei Anzeichen von Schmerz oder Angst. Im Gegenteil, er wirkte unendlich erleichtert und dankte Gott dafür, dass er nie mehr Cello spielen musste.
»Eine Gabe kann auch ein Fluch sein«, schrieb der Mann, der sich seit seiner Kindheit als Sklave seiner Kunst empfunden hatte. Der Mann, der vor jedem Auftritt an Panikattacken litt.