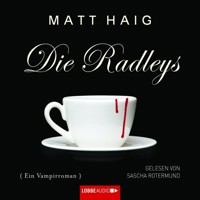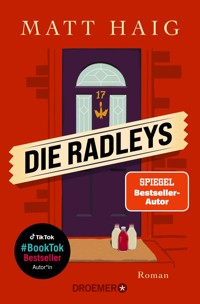Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was aussieht wie Magie, ist einfach ein Teil des Lebens, den wir noch nicht verstehen … Als Grace, eine pensionierte Mathematiklehrerin, von einer fast vergessenen Freundin ein heruntergekommenes Häuschen auf einer Mittelmeerinsel erbt, siegt ihre Neugier. Ohne Rückflugticket, Reiseführer oder einen Plan fliegt sie nach Ibiza. Zwischen den rauen Hügellandschaften und goldenen Stränden der Insel macht Grace sich auf die Suche nach Antworten über das Leben ihrer Freundin – und das Rätsel ihres Todes. Was sie dabei entdeckt, ist merkwürdiger, als sie es sich je hätte träumen lassen. Eine Wahrheit, die unmöglicher kaum sein könnte. Doch um sich auf sie einlassen zu können, muss Grace sich erst ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Eine Geschichte voller Wunder und wilder Abenteuer. Ein Roman über Hoffnung und die lebensverändernde Kraft eines Neuanfangs. »Grandios. Ein wunderschöner Roman voll lebensbejahender Wunder und Vorstellungskraft.« Benedict Cumberbatch "Die Unmöglichkeit des Lebens" – der neue Roman vom Autor des internationalen Millionen-Bestsellers und der TikTok-Sensation "Die Mitternachtsbibliothek"
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matt Haig
Die Unmöglichkeit des Lebens
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Hübner, Bernhard Kleinschmidt und Thomas Mohr
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Als Grace, eine pensionierte Mathematiklehrerin, von einer fast vergessenen Freundin ein heruntergekommenes Häuschen auf einer Mittelmeerinsel erbt, siegt ihre Neugier. Ohne Rückflugticket, Reiseführer oder einen Plan fliegt sie nach Ibiza. Zwischen den rauen Hügellandschaften und goldenen Stränden der Insel macht Grace sich auf die Suche nach Antworten über das Leben ihrer Freundin – und das Rätsel ihres Todes. Was sie dabei entdeckt, ist merkwürdiger, als sie es sich je hätte träumen lassen. Eine Wahrheit, die unmöglicher kaum sein könnte. Doch um sich auf sie einlassen zu können, muss Grace sich erst ihrer eigenen Vergangenheit stellen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Verlagsstimmen
Widmung
Motto
Eine Geschichte zum Heulen
Bitte um Entschuldigung
Die Unfähigkeit, Freude zu empfinden
Ananas
In der Schwebe
14159. Kapitel
Gespräche mit den Toten
Der hohe Felsen
Irgendwas mit A
Salz
Trostlosigkeit
Die Bilder an der Wand
Das Olivenglas
Zufriedenheit
Notwendigkeit
Ein Drittel voll
Mathematik
Eine neue Theorie der Unendlichkeit
Santa Gertrudis
Die Frau, die die Zukunft verkaufte
Die gelbe Blume
Das Klopfen an der Tür
La vida imposible
Halten Sie sich bitte von Mr Ribas fern
Anhedonia
Hippie-Markt
Die Schlange und die Ziege
Alberto
Morgen um Mitternacht
Die unentrinnbare Einsamkeit der Grace Winters
Kaputte Radios
Leuchten
Ein Boot namens NO
Nolletia chrysocomoides
Das jähe Dunkel
Licht
Wolke und Kugel
Frei
Alles war fort
Kreiselnd, wirbelnd, trudelnd
Jemandes Namen kennen ohne zu wissen, woher
Zacken
La Presencia
Zufallstreffer
Instruktionen
Das unendliche Hotel
Seltsame Phänomene
Orangensaft – ein unendlicher Genuss
Das Buch
Fleetwood Mac
Wassermelone in der Sonne
Ich war das Leben
Katze
LKW
Lieke
Größer als Gedanken
Die Unmöglichkeit des Lebens
Zwischenfall mit Ziege
Die Hummer
Alberto Ribas’ Geruch
Lichtteilchen
Kirche
Der Glaube an mehr
Paläste
Die dritte Person
Der stürzende Mond
1855. Kapitel
Erlösung
Aus der Bodenperspektive
Eine Gleichung ohne Lösung
Wurmloch
Was Christina auf dem Boot sagte, während der Wind ihr sanft durchs Haar strich
Grace Taugenichts
Pferd
Flughafen
Schutz
Die verschlossene Tür
Verschmähter Orangensaft
Der 52-Hertz-Wal
Marta und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
Eine Feige
Elvis Presley und das zerbrochene Glas
Gedankenfischen
Gebrochene Herzen und verkaterte Hirne
Es gibt keine Inseln
El Pescador
Art Butler
Unscharfe Größen
Alle schlauen Ideen, die momentan in Albertos Kopf waren
Flyer
Eine Aufgabe
Das Signal
Mein Disco-Schläfchen
Eine Frau, die ich kenne
Der beste Mensch, der mir je begegnet ist
Vollkommene Unvollkommenheit
Das erwachende Kind
Die Helligkeit
Grace Winters plus zwei
Die Werkstatt der Vergesslichen
Die Freude zu zählen, ohne zu zählen
Hermana
Lorbeer
Roulette
Der Turn und der River
Widersprüche
Viel zu verarbeiten
Das Fläschchen
Die Demonstration
Auf Sand gebaut
Salacia
Der Strand der Wahrheit
Jetzt kann das Signal gesendet werden
Lebendig
Das Schicksal, das wir erschaffen
So ist das Leben
Vive por mí
Asche
Ich geschehe
Der blaue Vogel
Lodern
Danksagung
»Diesem Buch wohnt ein besonderer Zauber inne. Mit seiner Erzählung um Grace Winters und seinem brillanten Schreibstil gelingt es Matt Haig auf einzigartige Weise, eine bewegende Geschichte mit weitreichenden Botschaften zu den großen Lebensfragen zu verbinden. Ein wundervoller, berührender Roman voller kluger Gedanken und mit einer bleibenden Wirkung.«
Nina Vogel, Leitung Marketing
»Ich bewundere Matt Haig dafür, dass er in seinem neuen Roman die Magie des Lebens feiert, ohne die oft schmerzlichen Erfahrungen in dieser Welt zu verleugnen. Wie auch in Die Mitternachtsbibliothek gelingt es ihm, die hellen und die dunklen Seiten unserer Existenz einfühlsam zu vereinen.«
Steffen Haselbach, Gesamtverlagsleitung
»Und wieder hat mich Matt Haig mit seiner Magie eingefangen und mit dieser wundervollen Geschichte Mut gemacht, die eigenen ›Kisten im Keller‹ auszupacken. Es lohnt sich.«
Antje Buhl, Verlagsleitung Vertrieb
»›Die Welt wird heller, wenn man Matt Haig liest‹ – ein Zitat von Johanna Adorján an das ich immer denken muss, wenn ich Matt Haig lese und über Matt Haigs Bücher spreche. Weil es einfach so richtig doll stimmt! Bevor die Welt heller werden kann, ist sie manchmal dunkel, so wie bei Grace, eine pensionierte Mathelehrerin. Und wie sich dieses Dunkel Zeile für Zeile lichtet, wie Grace wieder in das Leben, die Freude und die Leichtigkeit zurückfindet, das ist, wie immer in Matt Haigs Büchern, einzigartig und intensiv, berührend und, auch wie immer, sehr überraschend.«
Katharina Scholz, stellvertretende Vertriebsleitung
Der Insel Ibiza und ihren Menschen
Die Wirklichkeit ist nicht immer glaubhaft oder wahrscheinlich.
Jorge Luis Borges
Die Gewalt und der Schrecken, vor denen die Psychologie uns warnt, sind in den tiefsten Tiefen verborgen. Aber wer diesen Monstren noch weiter in die Tiefe folgt, bis hinaus über den Rand der Welt, findet das, was unsere Wissenschaften weder zu verorten noch zu benennen vermögen, das Substrat – das Meer, die Matrix, den Äther –, die Basis, auf der alles weitere fußt, wo aus dem Guten die Macht zum Guten und aus dem Bösen die Macht zum Bösen erwächst: das einheitliche Feld, unsere komplexe, unerklärliche Sorge umeinander und um unser hiesiges Zusammen leben. Sie ist gegeben. Sie ist nicht erlernt.
Annie Dillard
When the angels from above,
Fall down and spread their wings like doves;
As we walk, hand in hand,
Sisters, brothers, we’ll make it to the promised land.
Joe Smooth, ›Promised Land‹
Liebe Mrs Winters,
ich hoffe, es ist ok, dass ich mich an Sie wende.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Sie waren in Hollybrook meine Mathematiklehrerin. Ich bin jetzt zweiundzwanzig und in meinem letzten Studienjahr. Ich studiere Mathematik, was Sie sicher freuen wird!
In den Osterferien habe ich in der Stadt zufällig Mr Gupta getroffen und mich nach Ihnen erkundigt, und er hat mir alle Neuigkeiten erzählt. Es tut mir leid, dass Sie Ihren Mann verloren haben. Mr Gupta sagte, Sie seien nach Spanien gezogen. Eine meiner Großmütter ist wieder nach Grenada zurück, obwohl sie seit ihrem siebten Lebensjahr nicht mehr dort gewesen war, und hat ihr Glück gefunden. Ich hoffe, das wird Ihnen genauso gehen.
Auch ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen traurigen Verlust erfahren. Meine Mama ist vor zwei Jahren gestorben, und ich war verzweifelt. Ich komme mit meinem Vater nicht gut aus und habe Probleme, mich aufs Studium zu konzentrieren. Meine Schwester (vielleicht erinnern Sie sich noch an Esther) braucht jetzt noch mehr Unterstützung als früher. Meine Freundin hat sich von mir getrennt, weil ich sie im Stich gelassen habe. Und das war noch nicht alles. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben schon in jungen Jahren genau festgelegt ist. Zuweilen kann ich kaum noch atmen unter diesem Druck.
Ich bin in einem Muster gefangen, wie in einem Zahlenmuster, einer Fibonacci-Folge – 0,1,1,2,3,5,8,13,21 usw. – und genau wie diese Folge birgt das Leben immer weniger Überraschungen. Doch statt zu erkennen, dass die nächste Zahl durch Addition der beiden vorausgehenden Zahlen entsteht, wird einem klar, dass alles, was vor einem liegt, bereits entschieden ist. Und je älter ich werde, je mehr Zahlen ich hinter mir lasse, desto vorhersehbarer wird dieses Muster. Und nichts kann es durchbrechen. Früher habe ich mal an Gott geglaubt, jetzt glaube ich an gar nichts mehr. Ich war verliebt und habe es vermasselt. Manchmal hasse ich mich selbst. Ich vermassle alles. Ich fühle mich nur noch schuldig. Dass ich zu viel trinke, verpfuscht mir mein Studium. Und auch dafür fühle ich mich schuldig, weil Mama wollte, dass ich mir richtig Mühe gebe.
Wenn ich mir so anschaue, was in der Welt passiert, wird mir klar, dass unsere ganze Spezies auf die Zerstörung zusteuert. Wie programmiert, auch dies ein Muster. Und ich habe es einfach satt, ein Mensch zu sein, so ein Winzling, der die Welt nicht retten kann. Nichts scheint mehr möglich.
Keine Ahnung, warum ich Ihnen das alles erzähle. Ich wollte es einfach mal jemandem sagen. Und Sie waren immer nett zu mir. Ich stehe in der Finsternis und brauche Licht. Sorry. Das klingt ziemlich melodramatisch. Ich muss meiner Schwester unbedingt ein Vorbild sein.
Bitte fühlen Sie sich nicht zu einer Antwort verpflichtet. Aber alles, was Sie sagen, ist hochwillkommen. Bitte entschuldigen Sie diese lange E-Mail.
Danke,
Maurice (Augustíne)
Lieber Maurice,
herzlichen Dank!
Eigentlich beantworte ich keine E-Mails, was aber nicht heißen soll, dass ich sehr viele bekomme. Ich »nutze« das Internet überhaupt nicht. Ich tummle mich nicht in den sozialen Netzwerken. Ich habe nur WhatsApp, mache aber so gut wie nie davon Gebrauch. Doch bei Ihrer Nachricht hatte ich das Gefühl, antworten zu müssen, und zwar richtig.
Es tut mir sehr leid, dass Sie so viel durchmachen mussten. Ich entsinne mich von einem Elternabend her an Ihre Mutter. Sie war mir sympathisch. Obwohl ich sie als recht ernst in Erinnerung habe, spielte ein kleines Lächeln um ihre Mundwinkel, wenn sie von Ihnen sprach. Sie haben ihr Freude bereitet. Einfach durch sich selbst. Und das war eine echte Leistung, besonders für einen Teenager.
Ich hatte eine Antwort an Sie begonnen, und sie wurde immer länger und länger, alles andere als eine kurze E-Mail.
Um ehrlich zu sein, wollte ich all dies schon länger einmal niederschreiben, und Ihre Nachricht war der perfekte Anstoß dafür.
Ich werde Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen, die selbst ich noch immer kaum fassen kann. Bitte fühlen Sie sich nicht genötigt, mir zu glauben. Aber Sie sollen wissen, dass nichts davon erfunden ist. Ich habe nie an Magie geglaubt, und daran hat sich nichts geändert. Aber manchmal ist das, was wie Magie aussieht einfach ein Teil des Lebens, den wir noch nicht verstehen.
Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass meine Geschichte Ihnen helfen wird, an das Unmögliche zu glauben. Aber diese Geschichte ist so wahr wie jede andere und handelt von einer Frau, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sah und dann die größte Erfüllung überhaupt gefunden hat. Ich denke, es ist meine Pflicht, Ihnen davon zu erzählen. Ich bin definitiv kein Vorbild, wie Sie gleich selber sehen werden. Auch ich hatte in meinem Leben jede Menge Schuldgefühle. Und in gewisser Weise handelt diese Geschichte davon. Ich hoffe, sie wird Ihnen weiterhelfen.
Siehe Anhang.
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen,
Grace Winters
Eine Geschichte zum Heulen
Es war einmal eine alte Frau, die führte das langweiligste Leben im ganzen Universum. Diese Frau verließ nur noch selten ihren Bungalow, außer für Arztbesuche, um im Charity-Shop zu helfen oder auf den Friedhof zu gehen. Auch das Gärtnern hatte sie aufgegeben. Der Rasen war verwildert, und die Blumenbeete standen voller Unkraut. Ihre Wocheneinkäufe ließ sie sich liefern. Sie lebte in den Midlands. Lincoln. Lincolnshire. In einer Marktstadt mit hellroten Backsteinhäusern, in der sie – abgesehen von der Zeit an der Universität Hull, die ewig lang zurücklag – ihr ganzes Erwachsenenleben verbracht hatte.
Sie kennen diesen Ort ja auch.
Und das Leben dort im Alter war nicht einmal so schlimm, nur die Straßen wirkten weniger einladend als früher. Es bedrückte die Frau, dass die Hälfte ihrer liebgewonnenen Erinnerungen hinter Bauzäunen und zerfetzten Plakaten verborgen lag.
Tagsüber saß sie vor dem Fernseher, las hin und wieder ein Buch und hielt ihr Hirn mit Kreuzworträtseln und Buchstabenspielen fit. Sie beobachtete die Vögel im Garten oder starrte auf das kleine leere Treibhaus, während die Uhr auf dem Kaminsims unaufhörlich vor sich hin tickte. Einst hatte die Frau leidenschaftlich gern im Garten gewerkelt, aber das hatte sie aufgegeben. Sie war erst zweiundsiebzig, doch seitdem vier Jahre zuvor ihr Mann gestorben war und kurz darauf ihr Zwergspitz, Bernard, fühlte sie sich sehr einsam. Das war aber eigentlich schon seit über dreißig Jahren so. Genauer gesagt, seit dem 2. April 1992. Dem Datum, an dem ihr jeder Lebenssinn abhandenkam. In den letzten Jahren allerdings war die Einsamkeit der Frau sehr konkret und real geworden, und sie kam sich eher wie hundertzweiunddreißig vor. Sie kannte kaum noch jemanden. Ihre Freunde waren verstorben, hatten den Wohnort gewechselt oder sich zurückgezogen. Es gab nur noch zwei Kontakte über WhatsApp – Angela von der Britischen Herzstiftung, und Sophie, ihre Schwägerin, die seit dreiunddreißig Jahren in Perth in Australien lebte.
Doch von allen traurigen Momenten ihrer Vergangenheit hallte jener lang zurückliegende Apriltag am stärksten in ihr nach. Der Tod ihres Sohnes Daniel war der schwerste, verheerendste Verlust für sie gewesen, eine Tragödie, aus der immer weitere Kümmernisse und Misserfolge wuchsen, wie Äste aus einem Baumstamm. Aber das Leben ging weiter. Sie und ihr Mann Karl zogen irgendwann in einen Bungalow und versuchten das Beste aus der Situation zu machen. Da das aber nicht so richtig funktionierte, hatten sie beide den ganzen Tag schweigend nebeneinandergesessen, ferngesehen oder Radio gehört. Sie und ihr Mann waren schon immer sehr verschieden gewesen. Obwohl Karl eigentlich ein stiller, in sich gekehrter Mensch war, hatte er Hardrock und Real Ale geliebt. Das Problem mit Tragödien ist, dass sie alles, was danach geschieht, mit einer Teerschicht bedecken. Hin und wieder hatte sich das Paar noch mit gemeinsamen Erinnerungen getröstet, doch als Karl starb, wurde es für die alte Frau immer schwerer, weil ihre Erinnerungen nirgends mehr hin konnten. Sie blieben in ihrem Kopf gefangen. Und deshalb sah sie beim Blick in den Spiegel immer nur ein halbes Leben. Einen langsam fallenden Baum in einem unsichtbaren Wald.
Auch finanziell steckte sie ziemlich in der Klemme.
Ihre Ersparnisse existierten nicht mehr. Ein Betrüger mit vertrauenserweckendem schottischem Akzent hatte sich als Finanzberater der National Westminster Bank ausgegeben und ihr, mit ihrer törichten Hilfe, 23,390.27 Pfund gestohlen, ihre und Karls gemeinsame Rücklagen. Es war eine lange Geschichte – in den Hauptrollen abgefeimte Gauner und eine dumme alte Närrin (hallo!) – aber zum Glück geht es hier ja um etwas anderes.
Jedenfalls saß sie, die besagte Dame, einfach nur den ganzen Tag herum, mit ihren schmerzenden Beinen, und gab sich Mühe, Mails mit unbekanntem Absender zu ignorieren, während ihr zerknülltes Leben wie eine leere Chipspackung den Fluss hinuntertrieb. Nur der Anblick der Buchfinken und Stare im Vogelhäuschen in dem kleinen Garten belebte sie ein wenig und rief alte Erinnerungen und verblasste Träume wach.
Bitte um Entschuldigung
Sorry. Das war jetzt doch etwas trübsinnig und geschraubt. Von mir selbst in der dritten Person zu sprechen. Ich beschreibe einfach nur die Ausgangslage.Keine Bange, es wird trotz dieser Einleitung unterhaltsam, Und wie so viele unterhaltsame Geschichten beginnt auch diese mit einer minimalinvasiven Radiofrequenzablation von Krampfadern.
Die Unfähigkeit, Freude zu empfinden
Ich stand Kopf, als ich beschloss, nach Ibiza zu ziehen.
Die OP-Liege, auf der ich lag, war so weit nach hinten gekippt, dass ich jeden Moment herunterzurutschen drohte. An der Wand hing ein Spiegel. Ich sah mein ungekämmtes graues Haar, mein müdes Gesicht und erkannte mich kaum. Ich sah aus wie ein Hutzelweib. Wo irgend möglich, ging ich Spiegeln aus dem Weg.
Man versuchte den Blutfluss in meinen Beinen umzukehren. Ich hatte mehr blaue Adern als ein Gorgonzolakäse und musste sie entfernen lassen. Nicht wegen der Optik, sondern weil mir ständig die Waden juckten und wunde Stellen entstanden. Meine Tante war daran gestorben, dass sich in den Beinvenen ein Blutgerinnsel gelöst und zu einer veritablen Lungenembolie geführt hatte. Und so wollte ich die Krampfadern entfernen lassen, bevor bei mir ein Blutpfropf ähnliche Ambitionen entwickelte. Vielleicht wollen Sie es gar nicht so genau wissen, tut mir leid. Aber ich bin entschlossen, so ehrlich wie möglich zu sein, und deshalb fange ich so an, wie ich auch fortfahren möchte.
Wahrheitsgetreu.
Während ich dem Summen des Geräts lauschte, injizierte mir die Chirurgin mehrfach über die ganze Länge meines linken Beins hinweg ein Lokalanästhetikum – die letzte Injektion nannte sie so liebevoll wie treffend den »Bienenstich«. Dann kamen wir zum Hauptteil, bei dem, wie sie mir erklärte, ein Katheter in meine Wade eingeführt wurde, um die Vena saphena magna von innen mit 120 Grad Celsius »Zwiebelbrathitze« zu beschießen.
»Sie sollten etwas spüren …«
Und tatsächlich. Es war nicht angenehm, aber zumindest spürte ich etwas. Offengestanden hatte ich seit Jahren kaum noch etwas gespürt. Nur noch eine vage, anhaltende Traurigkeit. Anhedonie. Kennen Sie dieses Wort? Die Unfähigkeit, Freude zu empfinden. Ein Nichtgefühl. Nun, daraus bestand ich eine Zeitlang. Ich weiß, wie sich Depressionen anfühlen, aber es war nicht so intensiv wie eine Depression. Es war nur ein Mangel. Ich vegetierte vor mich hin. Essen war nur noch dazu da, mir den Magen zu füllen. Musik war nur noch strukturierter Lärm. Ich war einfach nur noch da.
Sie sollten etwas spüren.
Das ist die elementarste Form der Existenz, nicht wahr? Etwas zu spüren. Zu leben, ohne dass man etwas spürt, was ist das schon? Was war das? Ich saß nur noch herum. So wie ein Tisch in einem geschlossenen Restaurant steht und vergeblich darauf wartet, dass jemand an ihm Platz nimmt.
»Denken Sie an etwas Schönes …«
Und ausnahmsweise fiel mir das nicht schwer. Ich konzentrierte mich auf einen Brief, den ich knapp zwei Stunden zuvor von einer Anwaltskanzlei erhalten hatte.
Ananas
Ein ungewöhnlicher Brief.
Der mich darüber informierte, dass mir eine gewisse Christina van der Berg eine Immobilie auf Ibiza, Spanien, vermacht habe. Diese Christina van der Berg war verstorben und hatte mir ihren irdischen Besitz hinterlassen. Zumindest einen Teil davon. Bestimmt wieder ein Betrugsversuch, dachte ich. Denn wer einmal bestohlen wurde, sieht überall nur noch Räuber und Ganoven. Aber auch ohne die Erfahrung damals mit dem Betrüger hätte ich die Vorstellung absurd gefunden, eine mir völlig unbekannte Frau könnte mir ihr Haus auf einer Mittelmeerinsel vermachen.
Erst nach einer Weile dämmerte mir die Wahrheit. Oder mit anderen Worten: Ich brauchte eine Weile, bis mir klar wurde, dass Christina van der Berg gar keine Fremde war. Jedenfalls nicht direkt. Das Problem bestand darin, dass mir ihr Name überhaupt nichts sagte. Das niederländische »van« verlieh ihm eine gewisse Grandezza, die künstlich und fremd wirkte und mich in die Irre geführt hatte.
Zum Glück enthielt das Schreiben von Nelson and Kemp Solicitors noch weitere Informationen, einschließlich der kurzen Erwähnung von Christinas Mädchennamen: Papadakis.
Der allerdings sagte mir etwas.
Christina Papadakis war kurze Zeit Musiklehrerin gewesen. Wir hatten an derselben Schule gearbeitet, nicht lange bevor ich wieder mit Karl zusammenkam. (Wir hatten gemeinsam studiert, aber ihm war es mit dem Heiraten so eilig gewesen, dass ich erst mal eine Auszeit brauchte.)
Ich muss zugeben, dass ich Christina kaum gekannt habe. Ich erinnere mich an sie als eine schöne und scheue junge Frau mit einer glamourösen Aura, etwas, das 1979 noch seltener war als heute. Sie trug Perlen und erinnerte mich mit ihren dichten Ponyfransen und dem langen dunklen Haar an die Sängerin Nana Mouskouri, nur ohne Brille. Ihr Vater war als junger Mann kurz nach dem Krieg aus Griechenland emigriert. Obwohl sie nie in Griechenland gewesen war, erschien sie mir, der Provinzlerin, als Inbegriff mediterraner Kultiviertheit. Und tatsächlich vermisste sie das Essen, das sie aus ihrer Londoner Kindheit in der griechischen Community kannte – das Wort »Halloumi« hörte ich das erste Mal von ihr. Sie aß viel Obst. Zum Beispiel hatte sie in ihrer Lunchbox fein geschnittene Ananasscheiben dabei – keine Stücke – und das beeindruckte mich jedes Mal von neuem. Einmal ging ich am Klassenzimmer vorbei, während sie »Rainy Days and Mondays« sang und die ganze Klasse ehrfürchtig lauschte. Ihre Stimme konnte sich durchaus mit der von Karen Carpenter messen (noch eine Sängerin aus grauer Vorzeit). Eine Stimme, bei deren Klang Luft und Zeit gleichermaßen stillzustehen schienen.
Jedenfalls war ich kurz vor den Weihnachtsferien einmal länger in der Schule geblieben, um eine Trigonometrie-Tafel mit Lametta zu behängen und hatte – auf der Suche nach Heftklammern – Christina an ihrem Tisch angetroffen. Sie saß einfach nur da und pulte an ihren Nägeln herum.
»Nicht!«, rügte ich übergriffig, als sei sie eine Schülerin und keine Kollegin. »Die brechen doch!« Mir gefielen nämlich ihre Nägel mit ihrem warmen Terrakotta-Ton. Aber ich bereute meine Worte sofort, als ich sah, dass sie ins Leere starrte. Ich war schon immer etwas taktlos gewesen.
»Äh, tut mir leid«, entschuldigte ich mich.
»Macht nichts«, erwiderte sie mit angestrengtem Lächeln.
»Alles in Ordnung?«
Und da schüttete sie mir ihr Herz aus. Sie war eine Woche lang nicht in der Schule gewesen, was ich kaum bemerkt hatte. Sie steckte in einer Krise. Sie hasste Weihnachten. Ihr inzwischen verschwundener Verlobter hatte ihr im Vorjahr ausgerechnet an Weihnachten einen Heiratsantrag gemacht. Da sie erst relativ kurz hier wohnte, kannte sie niemanden, und auch ihre Familie lebte weit entfernt. Also lud ich sie spontan zu Weihnachten ein.
Und sie kam. Wir schauten uns gemeinsam die Weihnachtsansprache der Queen und Goldfinger an. Später, bei Blondies Song Sunday Girl in Top of the Pops, meinte Christina, sie würde auch mal gerne vor großem Publikum singen. Wir leerten ein paar Flaschen Blue Nun, noch nie der ideale Stimmungsstabilisator, und ich entschuldigte mich, dass ich keine Ananas im Haus hatte. Wir quatschten bis tief in die Nacht.
Christina fühlte sich von allem restlos überfordert. Ein Gefühl, das auch mir inzwischen vertrauter ist als damals. Sie quälte sich mit ihrem Lehrerinnenjob und fragte sich, ob sie den falschen Beruf ergriffen hatte. Ich sagte ihr, so gehe es in Hollybrook eigentlich allen. Einmal erwähnte sie Ibiza. Wir standen kurz vor dem Beginn eines neuen Jahrzehnts. Pauschalreisen nach Spanien boomten, und sie hatte von einem neuen Hotel auf Ibiza gehört, das Sängerinnen und Musiker suchte.
Christina faszinierte mich. Ich fand sie irgendwie geheimnisvoll und stellte ihr bestimmt zu viele Fragen. Wohl typisch für eine Mathematiklehrerin. Der Wert der unbekannten Variablen muss gefunden werden.
»Ich habe das Gefühl, in mir steckt ein Leben, das nach Ausdruck verlangt, aber nicht gelebt wird.«,
Wahrscheinlich war das nicht genau ihre Worte, aber so ungefähr. Und sie fuhr fort: »Ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt. Ich bin ja Griechin, keine Spanierin. Es gibt genügend griechische Inseln. Da sollte ich hin. Weil ich die Sprache kann. Einigermaßen. Spanisch hingegen kann ich überhaupt nicht und ich bin der Meinung, man sollte die Landessprache beherrschen, wenn man irgendwo lebt.«
»Du könntest Spanisch lernen. Wirklich. Falls du Lust dazu hast.«
»Es ergibt keinen Sinn.«
Und dann sagte ich etwas, das gar nicht zu mir passte, nämlich: »Es muss ja nicht alles einen Sinn ergeben.«
Ihre Augen leuchteten bei der Aussicht, dort einen Job zu finden, deshalb riet ich ihr, unbedingt zuzugreifen und sich nicht um das Gerede der Leute zu kümmern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das sagte, weil ich ihr eine Halskette schenkte, die ich seit meiner Kindheit besaß – und auf dem Anhänger war der Heilige Christophorus abgebildet, der Schutzpatron der Reisenden. Mir als nichtpraktizierender Katholikin war diese Kette zu sehr mit meiner Kindheit verknüpft, aber ich hatte es nicht übers Herz gebracht, sie wegzuwerfen. Es fühlte sich gut an, sie Christina zu schenken.
»Er wird dich beschützen«, meinte ich.
»Danke, Grace. Danke, dass du mir geholfen hast! Bei dieser Entscheidung.«
Irgendwann im Laufe dieses Abends sang sie Blackbird. Zuerst solo. Zwar nicht besonders weihnachtlich, aber sehr schön. Ihr bittersüßer Gesang brachte mich zum Weinen. Sie versuchte mir etwas zu vermitteln. »Man muss mit dem Song eins werden. Vergessen, dass man existiert. Von den Beatles-Songs ist das der leichteste zum Nachsingen«, ermutigte sie mich. »Na ja, nach Yesterday und Yellow Submarine.«
Wie sich herausstellte, war der Song keineswegs leicht nachzusingen. Aber wir hatten so viel Wein intus, dass es uns nicht störte.
Sie erklärte mir ihre Liebe zur Musik.
»Sie macht die Welt größer«, sagte sie, und ihre Augen schimmerten vor Rührseligkeit. »Manchmal fühle ich mich, als sei ich in einer Kiste eingesperrt, und wenn ich Klavier spiele oder singe, breche ich eine Weile aus dieser Kiste aus. Musik ist für mich wie eine Freundin, die genau im richtigen Moment ins Zimmer tritt. Ein bisschen wie du, Grace.«
Später machten wir einen Spaziergang. Einen dieser kalten Weihnachtsspaziergänge, wo man jeden Fremden anlächelt, dem man begegnet. Zumindest machte man das damals so.
Und das war’s. Es kam nicht mehr viel. Sie blieb noch ein paar Monate an der Schule, dann war sie weg. Sie besuchte mich nie mehr. Wir plauderten zwar manchmal im Lehrerzimmer, aber sie wirkte immer etwas verlegen. Ich verstand das nicht. Mir war schleierhaft, warum es dieser reizenden, talentierten Frau, die gern vor großem Publikum singen wollte, peinlich war, dass sie sich an Weihnachten Gesellschaft gewünscht hatte. Und eines Tages kam sie auf dem Parkplatz zu mir her – vermutlich unsere letzte Begegnung – und sagte leise, mit Tränen in den Augen: »Danke. Du weißt schon, für Weihnachten …«
Ich kann nicht genug betonen, für wie absolut selbstverständlich ich das gehalten hatte. Ich hatte damals nichts weiter getan, als einen Menschen an Weihnachten bei mir aufzunehmen.
Und dann, Jahrzehnte später, aus heiterem Himmel, dieser Brief. Und darin stand, dass Christina gestorben war und mir ihr Haus in Spanien vermacht hatte, für »eine liebe Geste vor langer Zeit«. Ich hatte auch das Recht, das Haus zu verkaufen oder zu vermieten, falls es für mich »nicht machbar« war, selber dorthin zu ziehen.
Ich war, gelinde gesagt, überrascht. Und hatte das Gefühl, mehr verloren als gewonnen zu haben. Eine Freundin, die ich eigentlich nie gehabt hatte, aus einer Zeit, die mir wie ein ferner Traum erschien. Ich hatte nicht vor, nach Ibiza zu ziehen. Mit zunehmendem Alter wird es immer schwerer, Muster zu durchbrechen. Und man will es auch gar nicht mehr. Meine Muster waren in der Vergangenheit mehrfach durchbrochen worden. Als ich pensioniert wurde. Als mein Mann in seinem Gewächshaus tot umfiel. Sogar als unser Hund starb, geriet ich aus dem Gleichgewicht. Und natürlich, als Daniel beim Radfahren von einem Lastwagen der Royal Post erfasst wurde.
Und jetzt, während ich mich innig nach dem alten Ehemuster sehnte, das mir damals zuviel geworden war, hatte sich ein neues Muster entwickelt. Morgens die Vögel füttern, montags Lebensmittellieferung, Freitagvormittag Ehrenamt im Charity-Shop der britischen Herzstiftung. Sonntags Friedhof. Und ewige Schuldgefühle, Trauer und Leere. Es gab nur winzige Schwankungen. Ich hatte mich an das Muster des Immer-Älter-Werdens gewöhnt, ohne groß darüber nachzudenken.
Doch das sollte sich jetzt alles ändern.
In der Schwebe
»Bitte entschuldigen Sie, falls das zu direkt sein sollte«, sagte ich zu der Anwältin. »Aber wie ist sie denn gestorben?«
»Ich dachte, das wüssten Sie«, erwiderte sie. Mrs Unna Kemp, eine Stimme wie aus dem Eisfach.
»Nein«, sagte ich. »Im Brief stand nur, dass sie gestorben sei, aber nicht wie. Deshalb würde ich gern erfahren, wie sie gestorben ist, wenn das ginge.«
»Sie starb im Meer …«
Ich merkte natürlich, dass sie mit dieser Antwort auswich.
»Entschuldigung. Wie ist sie gestorben?«
Ein leises Ächzen in der Leitung.»Äh, das ist noch in der Schwebe.«
In der Schwebe.
»Entschuldigung. Wie ist das gemeint?«
»Das ist so gemeint, dass die spanischen Behörden immer noch die genauen Todesumstände untersuchen. Die sind da sehr gründlich. Bisher wissen wir nur, dass sie auf See gestorben ist. Mehr hat man uns nicht gesagt.«
Erst gute fünf Minuten nach diesem Gespräch wurde mir klar, wie seltsam diese vage Auskunft klang. Warum waren denn die Todesumstände so mysteriös? Laut der Anwältin hatte Christina ihr Testament erst kürzlich geändert, um mich als Begünstigte einzusetzen. Dies und der ohnehin bizarre Umstand, dass sie mir ihr Haus hinterließ, warfen viele Fragen auf; und ich habe immer schon zu den Menschen gehört, die auf jede Frage eine Antwort suchen. Egal, wo mich das hinführt.
14159
»Es kommt nie vor, dass zwei Beine völlig identisch sind.«, sagte die Chirurgin. »Nicht einmal bei ein und demselben Menschen. Nicht einmal dann, wenn die Beine gleich aussehen. Die Venen haben immer ihr eigenes Muster. Wie Fingerabdrücke.« Irgendwie erinnerte mich das an die Mathematik. All diese Beispiele von Unvorhersehbarkeit im Gleichen. Wenn man den Durchmesser mit Pi multipliziert, erhält man immer den Umfang eines Kreises, und doch folgen die Ziffern der Nachkommastellen keinem Muster.
3.14159 und endlos so weiter, mit totaler, verwirrender Beliebigkeit.
Selbst die vorhersehbarsten Dinge enthalten immer ein Element des Unvorhersehbaren. Und wenn man diesen Umstand ignoriert, zieht einem das Leben den Teppich unter den Füßen weg. Warum die Stellen hinterm Komma, 14159, dann nicht einfach akzeptieren.
Ich starrte auf die kahle Wand und die aus meiner Perspektive kopfüber hängende Uhr. Ich wusste fast nichts über Ibiza. Außer, dass ich nie im Leben daran gedacht hätte, dort einmal hinzufliegen. Oder auch nur den Wunsch dazu verspürt hätte.
Im Radio kam Blondie. Nicht Sunday Girl, aber Heart of Glass. Unvorhersehbar innerhalb eines Musters. Wie das Leben.
»Bei Ihnen steht in nächster Zeit aber kein Flug an?« erkundigte sich die Chirurgin ein paar Minuten später. »Das wäre ein bisschen riskant, mit Ihren Beinen.«
»Sie meinen, ich sollte sie lieber hierlassen?«
Sie ignorierte meinen Scherz.
»Nein«, sagte ich, während ich zusah, wie mir die Krankenschwester langsam einen Kompressionsstrumpf überstreifte. »Nein, in nächster Zeit plane ich keinen Flug.« Es war lange her, dass ich bewusst gelogen hatte. Und ich fühlte mich so ungezogen, wie das einer pensionierten, verwitweten Mathematiklehrerin nur möglich ist. Denn in dieser Sekunde, immer noch kopfüber auf der Behandlungsliege, fasste ich einen Plan. Einen simplen, unverbindlichen Plan: mit einem offenen Rückflugticket nach Ibiza zu fliegen, mir dieses Haus anzuschauen, das jetzt absurderweise mir gehörte, und dortzubleiben, bis mir alles so über war, dass sogar der leere Bungalow in Lincoln mit all seinen Erinnerungen als bessere Option erschien.
Doch vorher musste ich noch etwas erledigen. Ich musste den einzigen Ort besuchen, der mir wirklich am Herzen lag. Den Friedhof.
Gespräche mit den Toten
Auf dem Weg zum Friedhof begegnete mir mein früherer Chef – Ihr ehemaliger Schulleiter, Mr Gupta – der gerade aus einem Café kam. Nach ein bisschen Smalltalk erkundigte er sich, wie es mir gehe. Ich war traurig, und da ich das nicht sagen wollte, erzählte ich ihm etwas anderes.
»Ibiza?«, fragte er. Hochgezogene Augenbrauen, verstohlenes Lächeln. »Ich hätte nie gedacht, dass Sie der Ibiza-Typ sind.«
»Nein«, erwiderte ich. »Ich auch nicht.«
Und kurz darauf setzte ich meinen Weg fort.
Später, als ich meinem Daniel frische Blumen aufs Grab gestellt hatte, saß ich auf der Bank unter der Eibe. Ich starrte auf den schlichten grauen Grabstein, sein spartanisches Design und die eingravierten Buchstaben, die man hier im Schatten lesen konnte.
DANIEL WINTERS
Er wurde sehr geliebt
15. März 1981–2. April 1992
An jenem Tag blieb ich dort eine Stunde lang.
Wie immer schweigend. Ich wusste nie, was ich zu ihm sagen sollte. Zu seiner imaginierten Gegenwart. Wobei ich mich keineswegs scheute, öffentlich mit den Toten zu sprechen. Mit Karl unterhielt ich mich ständig. Mit Daniel war es aus vielerlei Gründen schwierig. Mehr als drei Jahrzehnte der Trauer lagen hinter mir – wir waren schon weit im nächsten Jahrhundert, Jahrtausend angelangt – aber ich war immer noch sprachlos. Ich hatte nichts zu sagen, außer verzeih mir! Wie immer beruhigte ich mich auch jetzt, indem ich Grabsteine zählte und Quersummen bildete.
Auch wenn ich diese Geschichte nicht mit traurigen Themen überfrachten will, möchte ich Ihnen sagen, dass Daniel ein ganz besonderer Junge war. Er war immer etwas groß und schmal für sein Alter und las oft beim Gehen in einem Buch. Er war stets fröhlich und hatte selbst an schlechten Tagen ein kleines Lächeln im Gesicht, als betrachte er das ganze Leben als Komödie. Er liebte Choose Your Own Adventure-Romane, Popmusik und Fernsehserien, für die er noch zu jung war (Hill Street Blues, eine Serie, deren Wiederholungen er sich, zu meinem Missfallen, als Neunjähriger mit seinem Vater angeschaut hat). Er machte sich Sandwiches, dreifach mit Erdnussbutter und Marmite bestrichen. Er zeichnete Comicstrips über einen zeitreisenden Hund. Er ging nicht besonders gern zur Schule – jedenfalls nicht in seine neue Schule, weil er sich nichts aus Sport machte und das auch nicht verhehlte. Er war ein sehr ehrlicher Mensch. Es wäre ihm nie eingefallen zu lügen. Glaube ich zumindest. Aber er war auch ein Träumer. Wäre er an jenem Tag nicht bei Regen Rad gefahren, hätte er später sicher einen kreativen Beruf ergriffen. Illustrator vielleicht. Er liebte die Kunst und war sehr talentiert. Mit elf malte er mir zum Muttertag einen wunderschönen blauen Vogel, weil er wusste, dass ich Vögel liebe.
Als er starb, hatte er noch nicht mal das Teenageralter erreicht, geschweige denn das Erwachsenenalter, weshalb man kaum sagen kann, wie er sich entwickelt hätte. Wenn ein junger Mensch stirbt, wird man von zweierlei Phantomen heimgesucht: Dem Phantom, wer dieser Mensch gewesen ist, und dem Phantom, was aus ihm geworden wäre. Sein Tod hinterließ in meinem Innern eine klaffende Lücke, die sich nie mehr schließen ließ. Jahrelang kostete es mich übermenschliche Anstrengung, auch nur einen einzigen Tag durchzustehen.
Es erfüllte mich mit Grauen, dass das Leben allen Ernstes ohne ihn weiterging. Die Wut ließ sich kaum beherrschen. Vor allem die Wut auf mich selbst. Ich hätte ihn niemals bei Regen aufs Rad lassen dürfen.
Ich weiß, auch Sie haben Trauer erfahren, Maurice, und das mit ihrer Mutter tut mir sehr leid. Die ersten beiden Tage nach Daniels Tod war ich außer mir. Außer mir. Eine interessante Redewendung, nicht wahr? Ich war anwesend, aber auch nicht anwesend. Ich beobachtete mich selbst in der dritten Person. Eine Figur in einem Leben, das aussah wie mein Leben, es aber nicht war. Daniel fehlte mir so sehr, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, mir selbst zu fehlen. So ist das mit der Trauer. Sie löscht einen selber aus. Ich meine, biologisch funktioniert man augenscheinlich noch. Man atmet, nimmt Dinge wahr und redet, ist aber eigentlich nicht mehr am Leben.
»Ich hab dich lieb«, flüsterte ich dort am Grab. »Ich bin mal eine Weile weg, werde aber jeden Tag an dich denken. Auf Wiedersehen.«
Und dann holte ich tief und zitternd Luft, wie immer, wenn ich in seiner Nähe war, schluckte die Tränen runter und ging die paar Meter zu Karls Grab hinüber. Es kam mir immer wie ein Gang durch die Zeit vor. Kennen Sie das bei Friedhöfen? Jede Gräberreihe eine andere Zeit, weiter und weiter. Karls Grabstein war aus Marmor, aber schwarz. Er hatte sich ausdrücklich einen schwarzen Marmorgrabstein gewünscht.
»Irgendwie rockt das mehr«, pflegte er zu sagen. Er selber war zwar ungefähr so harmlos wie ein Käsesandwich, aber er mochte Rockmusik, und seine Lieblingsband war Black Sabbath. Das ist wohl die Erklärung.
KARL WINTERS
20. Januar 1952–5. Oktober 2020
Liebender Vater und Ehemann.
Das Wort ›Vater‹ war mit Schmerz belastet, ja, aber die Liebe traf zu. Als wir in den Bungalow zogen, bestand Karl darauf, so viel wie möglich von Daniel mitzunehmen, seine alten Star Wars-Figuren, Spielzeugautos, Comics, Zeichenblöcke, tausend Dinge. Als habe er sich in eine Art Museumskurator verwandelt. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil es mich erstickte, von all den Erinnerungen an Daniel umgeben zu sein. Doch selbst nach Karls Tod schenkte ich nichts davon weg.
»Karl, ich habe einen Entschluss gefasst«, sagte ich, wie ich da auf meinen frisch operierten Beinen stand, zu seinem Grabstein.
Sein Schweigen glich dem Schweigen von früher (immer dann, wenn er ahnte, dass ich gleich etwas sagen würde, das ihm missfiel). Ich sah förmlich, wie er die Augenbrauen hochzog. Er war nie besonders gesprächig gewesen, und dass er nun tot war, machte es nicht gerade einfacher.
»Ich gehe nach Spanien. Auf die Balearen. Ausgerechnet nach Ibiza.« Ich zuckte ein bisschen zusammen bei diesem Wort und sprach die Kursivschrift quasi laut mit. Der ganze Friedhof hörte meinen Widerwillen. »Bitte sei mir nicht böse deswegen.«
Karl war auf Ibizas großer Nachbarinsel Mallorca gewesen. Er hatte vor Jahren mal drei Tage in Palma verbracht, bei einem Tiefbau-Fachkongress, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch mit Mallorca verband sich in meinem Kopf, der voller Vorurteile steckte, etwas anderes als mit Ibiza. Mallorca war die in sich ruhende ältere Schwester mit überlegenem Lächeln. Ibiza, so stellte ich mir vor, war der freche, laute, gestrauchelte kleine Bruder. Ibiza war anrüchig.Es kam gleich nach Las Vegas, Cancún, Rio im Karneval und einer Vollmondparty in Thailand. Alles Orte, die ich nie im Traum besucht hätte, selbst wenn ich wohlhabend gewesen wäre. Ein Partyort für junge Leute, die einen Grund zum Feiern hatten. Für Reiche mit ihren Yogamatten. Jedenfalls das Gegenteil von mir. Ich war alt und eingerostet, mein Kontostand deprimierte mich, ich hatte seit Jahrzehnten nicht mehr getanzt und war der festen Überzeugung, dass es für mich keinerlei Grund zum Feiern gab.
Mit einem Wort, ich steckte voller Vorurteile. Natürlich hatte ich keine Ahnung von Ibiza. Für mich war das einfach nur ein Wort. Ein Synonym für Lärm und Gaudi. Und wie gesagt, ich hatte schon vor langer Zeit – in einer Art masochistischer Selbstbestrafung – beschlossen, dass Spaß für mich tabu war; dass ich ihn nicht verdiente.
»Ich werde bestimmt keine Nachtclubs besuchen …«, beruhigte ich Karls Grab. Jetzt säuberte ich die Vase, versenkte den neuen Steckschwamm darin und drückte die Chrysanthemen-Stiele fest hinein. Das tat ich jedes Mal, aber heute besonders energisch. Ich wollte nicht, dass die Blumen weggeweht wurden. Sie sollten so lange wie möglich Karls Grab schmücken.
»Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen werden. Aber ich spiele ganz bestimmt nicht mit dem Gedanken, unseren Bungalow zu verkaufen oder so was in der Art. Es gibt wirklich keinen konkreten Plan. Ich schaue einfach mal, wie es läuft. Nur ein Tapetenwechsel.«
Eine Träne lief mir über die Wange, hinter einer Wolke kam die Sonne hervor, ich spürte ihre Wärme. Ich wischte die Träne weg und lächelte einer anderen Witwe zu, die geschäftig einen noch neuen Marmorgrabstein blankpolierte. Ich starrte ins Gras, das auf einmal hell leuchtete. Wenn man um Menschen trauert, sieht man ihre Botschaften überall. Selbst im Sonnenlicht auf einem Grashalm. Die ganze Welt vermittelt, was sie uns mitteilen wollen.
Und dann sagte ich zu Karl, was einem immer so leichtfällt, wenn es zu spät ist:
»Ich liebe dich, mein Schatz. Bis bald.« Und ohne groß nachzudenken fügte ich hinzu: »Verzeih mir, was ich getan habe.«
Der hohe Felsen
Im Flugzeug nach Ibiza saßen in der Reihe hinter mir ein paar junge Leute, die sich begeistert über Nachtklubs unterhielten. Es klang wie eine neue und doch halbwegs vertraute Sprache. Eine Art Code: »Also … morgen Ushuaïa, Montag DC-10 zur Circoloco, Mittwoch Amnesia, Freitag Ushuaïa und später Hï, Samstag Pacha …«
Mir wurde klar, dass ich nie jung gewesen war. Schon mit einundzwanzig hätte ich dieses Programm – durchtanzte Nächte, auf Sonnenliegen verpennte Tage – zu strapaziös gefunden.
Aber die jungen Leute waren reizend. Regenbogenbunt gekleidet, quirlig wie Labradore. Sie hatten auszurechnen versucht, was die Tickets kosten würden, und als ich ihnen dabei half, hatten sie nach Luft gejapst und ihre Pläne noch mal überdacht. Sie waren überschwänglich dankbar. Als ehemalige Lehrkraft sieht man in jedem Erwachsenen das Kind und stellt sich vor, wie es sich wohl im Unterricht verhalten hätte. Das gilt besonders für Menschen, die der Kindheit gerade mal so entwachsen sind.
Das Publikum im Flugzeug war bunt gemischt.
Links von mir versuchte ein attraktiver Spanier mit langem Haar, Flipflops und einem Feder-Tattoo am Unterarm mit Zen-verdächtiger Geduld in einem Buch zu lesen. Zu meiner Rechten saß mit hochgeschlagenem Kragen eine aufdringlich parfümierte, nervige Frau mittleren Alters, die sich über den Gang hinweg mit einer kaltäugigen Person namens Valerie über Immobilienpreise auf den Balearen unterhielt: »Auf Ibiza bezahlst du heute Unsummen. Unsummen! Es ist plötzlich wieder so Chichi! Schickimicki. Ich würde eine der anderen Inseln wählen. Menorca – nicht Mallorca – ist der beste Ort zum Investieren. Sagt Hamish. Momentan der absolute Käufermarkt. Ich kenne einen, der hat dort eine Finca umgebaut und ihren Wert vervierfacht. Vervierfacht!«
Vor mir ein Frauentrio in den besten Jahren, unterwegs in ein Agroturismo-Retreat, für eine Woche Yoga und Wellness; irgendeinen Hippie-Markt und den Sonnenuntergang an einem Strand, dessen Namen ich gleich wieder vergessen hatte, wollten sie auf keinen Fall verpassen. Eine der Frauen schien sogar wild entschlossen, eine Woche lang weder auf Instagram zu posten, noch in TikTok reinzuschauen.
Ein Teenager unterhielt sich mit seiner Mutter leise über TikToker, YouTuber, einen Rapper namens 21 Savage and andere Symbole einer neuen Welt, die ich damals nicht mal ansatzweise begriff. Er hatte ein liebevolles Verhältnis zu seiner Mutter. Ich verdrängte den Gedanken an Daniel und versuchte mich einfach nur für die beiden zu freuen. Die Mutter wirkte noch sehr jugendlich. Da sie auf der anderen Seite des Ganges saßen, erfasste ich sie mit einem Blick. Sie trug einen schwarzen Bob und ein T-Shirt mit der Aufschrift »Taylor Swift: The Eras Tour«. Das Wort »Eras«, Zeitalter, setzte sich in meinem Kopf fest. Ich dachte über den Eintritt in ein neues Zeitalter nach. Nicht, indem man auf einem Friedhof durch Grabsteinreihen in der Zeit zurückging, sondern innerhalb des eigenen Lebens. Indem man einen klaren Bruch mit dem vollzog, was einmal war. In der Geologie geschieht dies oft nach einer Extinktion, nicht wahr? Das Mesozoikum endete mit einem Meteoriteneinschlag und dem Massensterben der Dinosaurier. Ich fragte mich, ob für mich ein neues Zeitalter anbrach oder ich zu viel Vergangenes mitnahm. Das ist die Herausforderung, vor die uns das Leben stellt, oder? Vorwärtszuschreiten, ohne das auszulöschen, was war. Zu wissen, was man festhalten und was man loslassen muss, ohne sich selbst zu zerstören. Der Versuch, nicht Meteorit und Dinosaurier zugleich zu sein.
Ganz vorne im Gang, direkt bei der Toilette, saß ein Paar in meinem Alter. Die beiden hatten freundliche Stimmen. Sie studierten aufmerksam ein Buch mit dem Titel Unbekannte Spaziergänge: Ibiza und Formentera und unterhielten sich über irgendeinen Beitrag zu Ibiza, den sie in Start the Week in Radio 4 gehört hatten. Ich spürte einen Anflug von Traurigkeit. Ach, jemanden zu haben, für unbekannte Spaziergänge zu zweit … Die beiden wirkten so vertraut. Ich musste an eine bittersüße Naturdoku denken, die ich einmal gesehen hatte, über eurasische Biber. Sie paaren sich auf Lebenszeit, um sicherzustellen, dass sie immer genügend Baumrinde zum Fressen haben. Stirbt einer von ihnen zu früh, ist auch der andere mehr oder weniger erledigt.
Ich wünschte, ich hätte jetzt Karls Hand drücken können. Meine Beine bereiteten mir kaum Probleme. Ich hatte eigentlich keine Schmerzen, nur eine milde Knöchelschwellung, aber das war ich gewohnt. Ich machte meine Wadenübungen und bewegte ein bisschen die Füße, ein langsamer, unsichtbarer Stepptanz, um den Kreislauf anzuregen. Allmählich begannen meine Hüften vom Sitzen zu schmerzen. Ich versuchte es zu ignorieren. Gelenkschmerzen waren wie traurige Gedanken: Je mehr man sich mit ihnen beschäftigte, desto schlimmer wurden sie, andererseits kam man nicht davon los, eben weil es so verdammt weh tat. Ein Teufelskreis.
Es belastete mich, hier inmitten der lebendigen Geräuschkulisse so stumm und reglos im Flieger zu sitzen. Ich starrte auf die Ringe an meiner linken Hand. Den Ehering und den Rubin des Verlobungsrings. Ich erinnerte mich an Karls zweiten Heiratsantrag, in der Bibliothek, in die wir vor dem Regen geflohen waren.
Karls ersten Antrag hatte ich abgelehnt, sechs Jahre zuvor in einem indischen Restaurant in Hull, weil wir zu jung waren und wenigstens einer von uns beiden vernünftig sein musste.
Als der Pilot die aktuelle Reiseflughöhe durchgab, war ich in den Anblick des roten Edelsteins vertieft, in die Erinnerungen, die er barg. Aber ich riss mich zusammen, bevor ich zu sentimental wurde.
Apropos getriggerte Erinnerungen: Da war eine Mutter, die ihr Baby den Gang auf und ab trug. Sie wiegte das Kleine sanft in ihren Armen und küsste es auf den Kopf. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, wo mir ein solcher Anblick sehr weh tat. Eine Zeit, wo ich den Lehrerberuf aufgeben wollte, um nicht mit all den Kindern konfrontiert zu werden, die am Leben waren und zur Schule radelten, ohne von Lastwagen erfasst zu werden. Ich zwang mich, das Baby anzulächeln. Es begann zu weinen.
»Tut mir leid«, sagte ich leise zu der Mutter.
Sie lächelte und nickte mir beruhigend zu.
Ein nervöser Steward schob einen Getränkewagen vor sich her. Ich nahm einen Gin Tonic, was gar nicht zu mir passte und angesichts meiner Venen-Op wohl auch nicht empfehlenswert war. Andererseits befolgte ich die ärztlichen Anweisungen ohnehin nicht konsequent.
Eigentlich hätte ich zwischendurch immer wieder aufstehen sollen, um meinen Kreislauf in Schwung zu halten, aber es war mir peinlich, und deshalb blieb ich die meiste Zeit sitzen und machte nur immer wieder meine Übungen.
Es gab Turbulenzen. Den Clubgängern schien das Spaß zu machen.
Das Baby weinte erneut.
Der Sinkflug begann.
Durchs Fenster erspähte ich eine felsige Küstenlinie, zerklüftete grüne Hügel. Zahllose goldene Strände. Eine mit weißen Bungalows und mittelhohen Hotel- und Wohnkomplexen übersäte Landschaft. Draußen im Mittelmeer sah ich eine kleine Insel. Einen atemberaubend hohen unbewohnten Felsen, der Es Vedra, wie ich bald erfahren sollte. Selbst vom Kabinenfenster aus, weit entfernt und noch vor den kommenden Ereignissen, erfüllte mich sein Anblick mit Angst und Staunen. Hätte ich dieses Gefühl besser wahrgenommen, wäre ich gleich im Flughafengebäude geblieben und mit der nächsten Maschine zurückgeflogen. Damals aber waren meine Sinne abgestumpft, und ich ahnte nicht, was mir bevorstand.
Irgendwann landeten wir.
Während alle anderen aufstanden und hektisch ihr Handgepäck aus dem Gepäckfach holten, um ihre Reise auf der Insel fortzusetzen, saß ich einen Moment still da. Ich atmete ein paar Mal tief durch und blieb einfach sitzen. Als sei ein Teil von mir noch oben in den Wolken, und ich müsste erst mal auf ihn warten.
Wenn man eine Zahl von einer Seite der Gleichung auf die andere bringt, nennt man das bekanntlich Äquivalenzumformung. Ich fühlte mich wie eine solche Zahl. Als hätte ich nicht nur einen kurzen Flug in einen anderen Teil Europas unternommen, sondern wäre transformiert worden. Als hätte ich etwas Unsichtbares überquert und würde nun irgendwie umgestaltet. Umgewertet. Eine Versetzung von Elementen. Es war das vage, aber mir durchaus nicht fremde Gefühl, die Ordnung der Dinge durcheinandergebracht zu haben.
Der Flughafen beeindruckte mich. Ein elegantes Gebäude, blitzblank, sauber, effizient. Als ich an mehreren Mietwagenfirmen vorbei dem Ausgang zustrebte, bemerkte ich zwei Frauen, beide ungefähr dreißig, die sich voneinander verabschiedeten. Die eine, die mir den Rücken zuwandte, hatte blondes Haar. Die andere, mit dunkler, wild zerzauster Mähne, trug eine Brille, kurze Jeans und ein T-Shirt. Das T-Shirt fiel mir wegen Einstein auf – das Foto, auf dem er allen die Zunge rausstreckt. Die Frau wirkte traurig. Die beiden liebten sich, doch die Blondine flog ohne die andere weg. Ich ging langsam an ihnen vorbei.
Die dunkelhaarige Frau bemerkte meinen Blick. Sie lächelte spontan, ohne sich durch meine Neugier belästigt zu fühlen. Es war ein freundliches Lächeln, das mich in dieser lärmigen Umgebung etwas beruhigte. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich die junge Frau bald kennenlernen sollte, ja, dass wir sogar Freundinnen werden würden. Und ich denke oft daran zurück, wie ich sie da stehen sah, kurz nach meiner Landung. Wie seltsam das war. Teil eines Musters, das ich selbst heute noch nur vage erahnen kann.
Als ich ins Freie trat, traf mich die Hitze, als hätte man eine Backofentür geöffnet.
Ich sah mich um und versuchte mich zu orientieren. Am Gebäude stand in riesigen Lettern Eivissa. Das war katalanisch. Ibiza ist eine spanische Insel, man spricht hier Spanisch, aber Katalanisch ist die Amtssprache.
Eivissa. Ein schöner Name. Er klang wie eine Verheißung. Welche Art von Verheißung, sollte ich schon bald erfahren.
Mir wurde klar, was für ein verrücktes Unterfangen das war. Was tat ich hier? Ich kannte keine Menschenseele. Ich war seit Jahren nicht mehr im Ausland gewesen. Ich sprach kein Wort Spanisch, außer »muchas gracias«, »por favor« und »patatas bravas«. Und doch war ich jetzt hier. Definitiv auf die andere Seite der Gleichung versetzt.
Im Ausland. Allein. Und schon ein kleines bisschen ängstlich.
Irgendwas mit A
Ich hatte nur ein Schottenkaro-Köfferchen dabei, eine Adresse und ein Kuvert mit einem Schlüssel. Das war alles. Eine kondensierte Welt.
»Welches Hotel?«, fragte mich der Taxifahrer lächelnd, als er mein Gepäck im Kofferraum des leuchtend weißen Wagens verstaute, hinter dem eine ganze Schlange ebensolcher Taxis wartete. Er war ein Muskelpaket. Arme, die einen Ochsen niederringen konnten. Er schob die Sonnenbrille auf den Kopf, nahm Blickkontakt auf. Er sprach zwar mit starkem Akzent, aber sein Englisch war ausgezeichnet. Ich halte viel davon, Menschen nach ihrem Gesicht zu beurteilen: Er hatte ein ehrliches Gesicht und das Lächeln eines Muttersöhnchens. Ich mochte ihn. Trotzdem kam mir hier alles sehr fremd vor. Die brodelnde Hitze, die Schilder auf Spanisch und Katalanisch, der exotisch blaue Himmel, die Autokennzeichen, das elegant-moderne kamelbraune Flughafengebäude. Ich starrte zu den schwindelerregend hohen Palmen empor wie ein Baby zu riesigen Fremden. Gestrandet. Verwirrt. Ich hatte keine Ahnung, was ich hier sollte. Nachdem ich es die letzten vier Jahre gerade mal zum Tesco-Markt in der Canwick Road geschafft hatte, kam ich mir an diesem milden Abend am Taxistand neben den riesigen Palmen, im Lärm hektischer Menschen und rollender Koffer wie eine Abenteurerin vor. Ein weiblicher Don Quichotte in Klamotten von Marks & Spencer.
»Hallo. Hola. Hm, es ist kein Hotel. Sondern ein Haus … Casa… Casa… Casa…« Ich hatte die schreckliche Angewohnheit vieler Briten, zu glauben, das einzige Hindernis zu sprachlicher Verständigung bestehe darin, Wörter nicht oft genug zu wiederholen. Ich gab ihm einen Zettel mit der Adresse. Er starrte darauf, als sei er überfordert. Oder beunruhigt. Ich nannte ihm die Straße, obwohl sie ja auf dem Zettel stand. »Carretera Santa Eulalia.« Obwohl ich das bestimmt falsch aussprach, ging er höflich darüber hinweg.
Er starrte immer noch auf den handgeschriebenen Zettel. Seine Miene drückte eindeutig Besorgnis aus.
»Meine Handschrift ist schrecklich«, sagte ich entschuldigend. Aber darum ging es nicht.
»Ich kenne dieses Haus …«, meinte er leise. Sein Lächeln war erloschen. »Ich war da schon mal …«
»Oh, tatsächlich?«
Er nickte und blickte sich um. Der nächste Taxifahrer in der Schlange, ein älterer, kahlköpfiger Mann, stand an sein Fahrzeug gelehnt und rauchte eine Zigarette. Als er uns einen genervten Na-wird’s-bald- Blick zuwarf, stiegen wir in den Wagen.
»Alles okay?«, fragte ich.
Er schwieg einen Moment. Dann schien er sich zusammenzureißen und fuhr los.
»Si. Ich denke schon. Dieses Haus … Es kommt ein kleines Stück nach der Gokartbahn, ja?«
»Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Bin zum ersten Mal hier. «
»Besuchen Sie Familie?«
Familie. Ein so freundliches und doch schmerzliches Wort. »Nein. Nein. Ich besuche niemanden. Ich bin nur hier, um in dem Haus zu wohnen. Ich habe die Frau gekannt, die dort gelebt hat.«
Er schien etwas sagen zu wollen. Überlegte es sich dann aber anders.
Wir fuhren an Palmen und Straßenlokalen vorbei, an riesigen sonnengebleichten Plakatwänden mit Werbung für Diskos und Nachtklubs und überholten einen Gockel, der unbekümmert die Hauptstraße entlangspazierte. Vor einer schlichten Bar saßen in der Hitze lachend zwei alte Männer und spielten Schach. Neben ihnen stand ein zerbeulter alter Fanta-Limón-Automat. Wir passierten zwei teure Designer-Gartencenter, vor denen sich im grellen Sonnenlicht Töpfe mit Kakteen und Olivenbäumen drängten.
Der Fahrer hatte sein Fenster einen Spalt weit geöffnet. Ich roch den Duft von Wacholder, Pinien und einem Hauch von Zitrusfrüchten. Ein liebliches mediterranes Flair.
Die Insel war grüner als erwartet. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte sie mir eher karg vorgestellt. Natürlich war sie heiß und trocken, die Häuser reflektierten das blendend weiße Sonnenlicht, doch als wir uns immer weiter vom Flughafen entfernten, sah ich dicht mit Pinien bedeckte Hänge.
Etwas von der Straße zurückgesetzt standen schöne Villen, eingebettet zwischen Bäumen. Eines dieser Gebäude lag näher an der Straße. Leuchtende Büschel rosafarbener und violetter Bougainvilleablüten entfalteten an den Hausmauern ihre Pracht. Mir fiel der spiralig verdrehte Stamm eines Johannisbrotbaums auf.
»Ich kenne das Haus …«, wiederholte der Fahrer. Er schien dem, was er mir sagen wollte, schon etwas näherzukommen. »Es steht dort an der Straße ganz allein. Da sind Leute reingegangen. Sehr oft.«
»Leute?«
»Ja.«
»Aha. Was für Leute denn?«
»Alle möglichen Leute. Da war ein Mann, der hatte nur eine Badehose an. Er war schon alt, mit Bart. Ein Taucher. Sie wissen schon … Gerätetauchen.«
»Hat er sie denn gekannt?«
»Glaub schon. Ich habe ihn zweimal dorthin gebracht. Beim letzten Mal hatte er eine Frau dabei. Eine viel jüngere Frau.«
»Waren die mit Christina befreundet?«
»Keine Ahnung. Sie muss jede Menge Freunde gehabt haben. Ganze Familien kamen sie besuchen. Auch Touristen. Briten, Deutsche, Spanier. Ein reicher Mann, gut gekleidet – ich habe ihn von einem Restaurant abgeholt, in der Nähe des Hard Rock Hotel. Er hatte da gegessen. Das teuerste Restaurant der Welt. Wussten Sie das? Das teuerste Restaurant der Welt ist hier auf Ibiza. Nicht in Paris. Nicht in New York. Nicht in Dubai. Sondern hier bei uns.« Der Fahrer sagte dies mit einer sonderbaren Mischung aus Stolz und Verachtung. »Ihm gehören Hotels … Hab seinen Namen vergessen … Irgendwas mit A… Kürzlich war eine Frau da, die hat geweint.«
»Geweint?«
»Ich hab sie gefragt, ob alles okay sei, und sie sagte, das würde sie bald wissen, nach dem Besuch. Aber es sind noch seltsamere Dinge passiert.«
»Was denn?«
»Einmal habe ich dort abends etwas … Verrücktes gesehen.«
»Etwas Verrücktes?«
Er nickte mir im Rückspiegel zu. »Ja. Ein Licht. Ein gewaltiges Licht. Es kam aus dem Haus. Aus den Fenstern … Ich bin da mal vorbeigefahren … Wie soll ich das beschreiben? Konnte nichts mehr sehen, wäre fast von der Straße abgekommen …«
Ich hätte gern noch mehr erfahren, aber in diesem Moment meldete sich sein Funksprechgerät, und jemand fragte ihn etwas auf Spanisch, und er antwortete, und ich verstand kein Wort mehr.
Die Insel war definitiv weder einsam noch menschenleer, aber ich sah schon, wie verführerisch sie wirkte, meinen Vorurteilen zum Trotz. Es lag irgendetwas in der Luft. Ich war gespannt auf Christinas Haus. Beziehungsweise mein Haus, auch wenn es schwerfiel, etwas sein Eigen zu nennen, das man noch nie zuvor gesehen hatte. Und eigentlich nicht verdient hat. Als hätte man irrtümlich einen Preis verliehen bekommen.
Aber ich spürte etwas. Nur ganz flüchtig, aber angenehm. Was ich ungewöhnlich fand. Mich flog ein Gefühl an, das ich als junger Mensch beim Reisen empfunden habe. Ein absurdes Gefühl, aber ich will es trotzdem erwähnen, falls auch Sie, Maurice, es vielleicht von sich kennen. Es ist das Gefühl, dass man die ganze Welt auf einmal erlebt. Es quadriert – nein, kubiert das Jetzt – geht sogar in die vierte Dimension. Was ich sagen will: Das Reisen verwandelt die Erfahrung in einen Tesserakt. Ja, das Erleben explodiert in die vierte Dimension. Und die Erkenntnis, dass es so viele Gegenwarten gleichzeitig gibt, ist verwirrend. Sich vorzustellen, wie viele Taxifahrer weltweit gerade in diesem Moment in ihre Funksprechgeräte sprechen! Wie viele Frauen in diesem Augenblick gebären! Wie viele Leute gerade ein Sandwich essen. Oder ein Gedicht schreiben. Oder die Hand eines geliebten Menschen halten. Oder aus dem Fenster starren. Oder mit den Toten reden.
»Sie haben vorhin ein Licht erwähnt …«, sagte ich, leise und etwas zerstreut, weil wir in diesem Moment einen Laden passierten, der an der Straße lag, Sal de Ibiza, in hübschem Türkis. Doch dann brachte mich irgendetwas aus dem Gleichgewicht. Meine Sinne schärften sich wie die eines Tiers, das plötzlich einen Fressfeind wittert. Auf dem staubigen Boden vor dem Laden lag ein rotes Fahrrad. Für mich bestand eines der größten Probleme im Leben darin, dass es immer noch rote Fahrräder gab. Ich tat, was ich immer tat, wenn ich ein rotes Rad erblickte oder sonst etwas, das mich intensiv an Daniel erinnerte: Ich lenkte mich mit Mathematik ab. Auf einem Straßenschild stand Santa Eulalia 3, Sant Joan 21, Portinatx 25. Also rechnete ich im Kopf Prozentzahlen aus. 25 Prozent von 3 ergeben 0.75.3 Prozent von 21 ergeben 0.63.21 Prozent von 25 ergeben 5.25. Manche Leute machen Atemübungen. Die drei Frauen im Flugzeug praktizierten Yoga. Mir half die Mathematik. Sie lenkte mich ab. Sie ließ mich einen Moment lang vergessen, dass es Dinge gibt, die man nicht zerlegen oder herausrechnen kann.
Salz
Der Fahrer hatte bemerkt, dass ich das Fahrrad anstarrte, und dachte, ich interessierte mich für den Laden. Offenbar wollte er seine verlegene Reaktion beim Anblick des Adresszettels wiedergutmachen.
»Ibiza ist eine Salz-Insel. Man erntet das Salz in Ses Salines. In diesen Salz … na, Sie wissen schon …« Er beschrieb pantomimisch etwas Großes, Flaches, weil ihm das richtige Wort nicht einfiel.
»Pfannen?«, schlug ich vor.
»Genau. Salzpfannen. Die sind schön. Die müssen Sie sehen. Besonders wenn die … rosa Vögel da sind.«
»Flamingos?«
»Ja. Genau. Sehr sehenswert. Mein Vater hat in den Salinen gearbeitet, und sein Vater ebenfalls, und der Vater seines Vaters war auch Salinenarbeiter, und der Vater vom Vater vom Vater …« Ich hatte es begriffen. »Sehen Sie, Señora, Ibiza hat in seiner Geschichte viele verschiedene Invasionen erlebt … Aber das Salz blieb immer das beste Salz der Welt. Wir haben den Fisch gesalzen, den die Herrscher aßen.«
Später erfuhr ich dann, dass Ibizas Taxifahrer oft auch Fremdenführer und Insel-Chronisten sind.
»Und jetzt gibt es eine Touristeninvasion«, sagte ich. Mein Zittern beim Anblick des Fahrrads hatte sich wieder gelegt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: