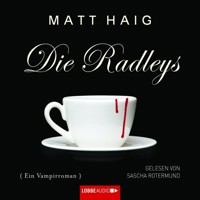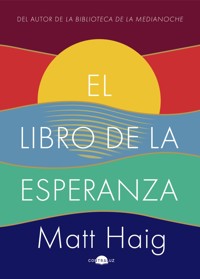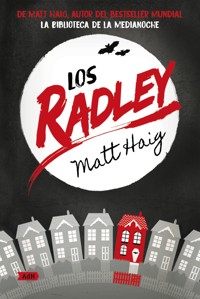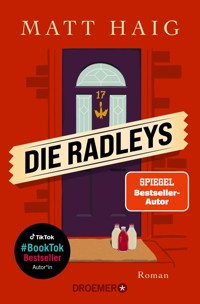
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Autor des großen SPIEGEL-Bestsellers und der Tik-Tok-Sensation »Die Mitternachtsbibliothek« Die Radleys sind eine ganz normale Mittelschichts-Familie, nur ein bisschen verbissener ... denn sie sind heimliche Vampire! »Und das ist der kluge, witzige und trotzdem spannende Vampirroman, auf den wir schon seit Beginn des Dauer-Hypes verbissen gewartet haben.« Brigitte Clever, witzig und ganz und gar ungewöhnlich: der besondere Roman von Matt Haig - wird momentan für Sky verfilmt. Die Radleys sind eine ganz normale Familie. Doch warum flüchtet jedes Tier vor Tochter Clara, und warum kann Sohn Rowan trotz Lichtschutzfaktor 60 nicht in die Sonne? Was die beiden nicht wissen: ihre Eltern Helen und Peter haben ihnen ein klitzekleines Detail verschwiegen. Die Radleys sind abstinente Vampire. Doch nach einem blutigen Vorfall müssen sie ihren Kindern endlich reinen Wein einschenken. Es kommt aber noch ein weiteres Problem auf die Radleys zu: Peters Bruder Will, ein ganz und gar nicht abstinenter Vampir ... Entdecken Sie auch "Die Mitternachtsbibliothek" und "Der fürsorgliche Mr. Cave" bei Droemer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Matt Haig
Die Radleys
Roman
Aus dem Englischen von Friederike Levin
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Radleys sind eine ganz normale Familie. Doch warum flüchtet jedes Tier vor Tochter Clara, und warum kann Sohn Rowan trotz Lichtschutzfaktor sechzig nicht in die Sonne? Was die beiden nicht wissen: Ihre Eltern Helen und Peter haben ihnen ein klitzekleines Detail verschwiegen. Die Radleys sind abstinente Vampire. Doch nach einem blutigen Vorfall müssen sie ihren Kindern endlich reinen Wein einschenken. Es kommt aber noch ein weiteres Problem auf die Radleys zu: Peters Bruder Will, ein ganz und gar nicht abstinenter Vampir ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Freitag
Orchard Lane Nummer siebzehn
Das Gästezimmer
Träumen
Ein plötzlicher Schmerz
Die Rolle
Sechsundvierzig
Realismus
Fantasy World
Faktor sechzig
Irish Setter
Auf Tod und Sterben tagt das Frühgestirn
Fotografie
Faust
Hinter dem schützenden Vorhang
Etwas Böses
Ein Thai-Blattsalat mit mariniertem Hühnchen an Chili- und Limonendressing
Copeland
Tarantel
Empfang
Das Blut, das Blut
Stille
Bela Lugosi
Die dunklen Felder
Mein Name ist Will Radley
Die unendliche Einsamkeit von Bäumen
Silicealotion
Zehn nach zwölf
Eine bestimmte Art von Hunger
Kruzifixe und Rosenkränze und Weihwasser
Ein bisschen wie Christian Bale
Samstag
An des Meeres einsam stiller Küste
Rührei
Das verlorene Volk
Hübsch
Geschmackvolle Dekoration
Das tantrische Diagramm eines rechten Fußes
Neue Klamotten
Eine kleine Panikattacke
Rettet die Kinder
Das ruderlose Boot
Paris
Hinter der Eibe
Wasser
Blutrote Wolken
Geschöpf der Nacht
Black Narcissus
Pinot rouge
Sonntag
Freak
Game over
Polizei
Delikatess-Schinken
Die Sonne versinkt hinter einer Wolke
Als neunzehnhundertdreiundachtzig jemand vom Fahrrad fiel
Wir sind Monster
Die Nacht vor Paris
Blutleere Farce einer Ehe
Jahrtausende
Verrückt, böse und gefährlich, ihn zu kennen
Panik und Laichkraut
Saturn
Montag
Mister Polizei-Enzyklopädie
Kontrolle
Die drei Phiolen
Lesekreis
Ein ungewöhnlicher Gedanke für einen Montag
Transsilvanien
Verschönerungstag bei den Radleys
Klasse
The Plough
Gehweg
Ein Gespräch über Blutegel
Ein Angebot
Beherrschung liegt uns im Blut
Ein diabolisches Lächeln erscheint auf ihrem Gesicht
Schuhkarton
Knoblauchcreme
Currysoße
Imitation von Leben
Der Kuss
Das Fox and Crown
Thirsk
Atom
Mitleid
Der Zettel
In einer verlorenen Welt, die einst ihr gehörte
Baby
Höher und höher und höher
Aus der nassen finsteren Luft
Das Gesicht seines Vaters
Veränderung
In die Finsternis
Mutterleib
Wenige Nächte später
Raphael
Ein Song, den er kennt
Selbsthilfe
Nur ein klitzekleiner Tropfen
Mythen
Freitag
Unsere Instinkte sind falsch. Tiere verlassen sich auf ihre Instinkte, um zu überleben, aber wir sind keine wilden Tiere. Wir sind keine Löwen oder Haie oder Geier. Wir sind zivilisiert, und Zivilisation funktioniert nur, wenn wir unsere Instinkte unterdrücken. Tun Sie also das Ihre für die Gesellschaft und unterdrücken Sie die finsteren Begierden in sich.
Handbuch für Abstinenzler
(zweite Ausgabe), Seite 54
Orchard Lane Nummer siebzehn
Die Straße ist ruhig, vor allem nachts.
Zu ruhig, würde man denken, als dass sich ein Monster zwischen den hübschen, schattigen Gässchen niederlassen könnte.
Um drei Uhr morgens fällt es im Dörfchen Bishopthorpe in der Tat leicht, jene Lüge zu glauben, die seine Bewohner verbreiten: Hier leben gute und friedvolle Menschen ihr gutes und friedvolles Leben.
Zu dieser Stunde hört man nur Laute, die die Natur selbst hervorbringt. Den Ruf einer Eule, einen bellenden Hund in der Ferne oder, in einer frischen Nacht wie dieser, das obskure Wispern des Windes in den Platanen. Selbst wenn man sich an die Hauptstraße stellte, gleich vor das schicke Bekleidungsgeschäft oder das Pub oder den Hungry Gannet, den Feinkostladen, würde man nur selten Verkehrslärm hören und das schimpfliche Graffito an der Wand des ehemaligen Postamtes kaum sehen (wobei das Wort »FREAK« gerade noch lesbar ist, wenn man genau hinschaut).
Jenseits der Hauptstraße, in Gegenden wie der Orchard Lane, würde man auf einem nächtlichen Spaziergang an den Altbauvillen der Anwälte und Doktoren und Projektmanager vorbeischlendern, würde alle Lichter gelöscht vorfinden und die Gardinen zugezogen, um die Nacht auszuschließen. Jedenfalls so lange, bis man bei Nummer siebzehn ankäme und ein Leuchten hinter den Gardinen eines Fensters im Obergeschoss bemerken würde.
Und wenn man stehen bliebe, um jene kühle und tröstliche Nachtluft zu inhalieren, würde man zunächst sehen, dass Nummer siebzehn ansonsten mit den Häusern seiner Umgebung im Einklang steht. Vielleicht ist es nicht ganz so groß wie das seines nächsten Nachbarn, Nummer neunzehn, mit der breiten Auffahrt und dem eleganten Regency-Stil, es kann sich aber durchaus behaupten.
Das Haus sieht genauso aus wie das Heim einer Familie auf dem Land und fühlt sich auch genauso an. Nicht zu groß und nicht zu klein, nichts, was das Auge stören könnte. Ein Traumhaus, wie jeder Makler versichern würde, und gewiss perfekt, um Kinder großzuziehen.
Aber kurz darauf würde man merken, dass etwas nicht stimmt. Nein, »merken« ist vielleicht zu viel gesagt. Man würde vielleicht nicht aktiv realisieren, dass sogar die Natur um dieses Haus herum stiller erscheint, dass kein Vogel und auch sonst nichts zu hören ist. Jedoch könnte ein unbewusstes Gefühl Anlass geben, sich über den Lichtschimmer zu wundern und eine Kälte wahrzunehmen, die nichts mit der Nachtluft zu tun hat.
Wenn jenes Gefühl stärker würde, könnte Angst daraus werden, weshalb man die Szene am liebsten verlassen und wegrennen würde, es aber wahrscheinlich nicht täte. Man würde das nette Haus und den Minivan in Augenschein nehmen und sich denken, dass es sich hier um den Besitz vollkommen gewöhnlicher Menschen handelt, die für die Außenwelt keinerlei Bedrohung darstellten.
Wer sich diesem Gedanken hingäbe, würde sich irren. In Orchard Lane Nummer siebzehn wohnen die Radleys, und obwohl sie sich größte Mühe geben, sind sie alles andere als normal.
Das Gästezimmer
Du musst schlafen«, redet er sich ein, was aber nichts nützt.
Das Licht, das an jenem Freitag um drei Uhr in der Frühe brennt, gehört zu ihm, zu Rowan, dem älteren der beiden Radley-Kinder. Er ist hellwach, obwohl er das Sechsfache der empfohlenen Dosis von Wick Medinait geschluckt hat.
Er ist um diese Uhrzeit immer wach. In einer guten Nacht fällt er gegen vier in den Schlaf und wacht um sechs oder kurz danach wieder auf. Zwei Stunden qualvollen, rastlosen Schlafes mit gewalttätigen Albträumen, die er nicht versteht. Aber heute ist keine gute Nacht, weil sich sein Ausschlag aufdringlich bemerkbar macht, der Wind hinter dem Fenster pfeift und er weiß, dass er wahrscheinlich ohne jede Ruhephase zur Schule gehen wird.
Er legt sein Buch beiseite. Byrons Gesammelte Gedichte. Er hört, dass jemand den Flur entlanggeht, nicht zur Toilette, sondern zum Gästezimmer.
Die Tür zum Wäscheschrank wird geöffnet. Ein leises Rumoren und dann ein kurzer Moment Stille, bis er hört, dass sie das Zimmer wieder verlässt. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Schon oft hat er gehört, wie seine Mutter mitten in der Nacht aufstand und ins Gästezimmer ging, ohne jemals zu ergründen, was sie eigentlich dort tut.
Dann hört er, wie sie wieder zu Bett geht und seine Eltern hinter der Wand unverständliche Worte flüstern.
Träumen
Helen legt sich wieder ins Bett, ihr ganzer Körper steht unter Spannung wegen der Geheimniskrämerei. Ihr Ehemann gibt einen merkwürdig gegähnten Seufzer von sich und kuschelt sich an sie.
»Was um alles in der Welt tust du da?«
»Ich versuche, dich zu küssen«, sagt er.
»Bitte, Peter«, sagt sie, Kopfschmerz pocht hinter ihren Augen. »Es ist mitten in der Nacht.«
»Im Gegensatz zu all den anderen Zeiten, zu denen du auch nicht von deinem Ehemann geküsst werden möchtest.«
»Ich dachte, du schläfst.«
»Habe ich auch. Ich habe geträumt. Einen ziemlich aufregenden Traum. Einen nostalgischen, genauer gesagt.«
»Peter, wir könnten die Kinder wecken«, sagt sie, obwohl sie weiß, dass bei Rowan noch Licht brennt.
»Komm schon, ich will dich bloß küssen. Es war so ein schöner Traum.«
»Nein. Du lügst. Du willst mehr. Du willst …«
»Na und, weshalb machst du dir Sorgen? Wegen der Bettwäsche?«
»Ich will einfach nur schlafen.«
»Was hast du gemacht?«
»Ich war auf der Toilette.« Sie hat sich an diese Lüge so sehr gewöhnt, dass sie ihr nichts mehr ausmacht.
»Deine Blase. Sie wird immer schwächer.«
»Gute Nacht.«
»Erinnerst du dich noch an die Bibliothekarin, die wir mit nach Hause genommen haben?«
Sie kann das Lächeln in seiner Frage hören. »Mein Gott, Peter. Das war in London. Wir reden nicht mehr über London.«
»Aber wenn du an Nächte wie diese denkst, macht dich das nicht …«
»Nein. Das war in einem anderen Leben. Daran denke ich nie.«
Ein plötzlicher Schmerz
Am Morgen, kurz nach dem Aufwachen, setzt sich Helen auf und nippt an ihrem Wasser. Sie schraubt das Röhrchen mit den Ibuprofen-Tabletten auf und legt sich eine auf die Zunge, sacht wie eine Oblate bei der heiligen Kommunion.
Sie schluckt, und genau in dem Moment, als die Tablette ihren Schlund hinabgleitet, durchzuckt ihren Ehemann – nur wenige Schritte entfernt im Badezimmer – ein plötzlicher Schmerz.
Er hat sich beim Rasieren geschnitten.
Er betrachtet das Blut, das auf seiner feuchten, öligen Haut schimmert.
Wunderschön und tiefrot. Er tupft es ab, begutachtet den Fleck, den es auf seinem Finger hinterlassen hat, und sein Herz schlägt schneller. Sein Finger nähert sich Zentimeter für Zentimeter seinem Mund, aber bevor er dort ankommt, hört er etwas. Schnelle Schritte, die sich dem Badezimmer nähern, dann den Versuch, die Tür zu öffnen.
»Dad, kannst du mich bitte reinlassen … bitte«, sagte seine Tochter Clara, während sie heftig gegen das massive Holz hämmert.
Er folgt ihrer Bitte, und Clara stürzt hinein und beugt sich über die Toilettenschüssel.
»Clara«, sagt er, als sie sich erbricht. »Clara, ist alles in Ordnung?«
Sie richtet sich auf. Ihr blasses Gesicht über der Schuluniform sieht zu ihm auf, die Augen hinter den Brillengläsern verzweifelt.
»O Gott«, sagt sie und beugt sich wieder über die Schüssel. Sie erbricht sich noch einmal. Peter riecht es und sieht es auch. Er zuckt zusammen, nicht wegen des Erbrochenen, sondern weil er weiß, was es zu bedeuten hat.
In wenigen Sekunden sind alle da. Helen kauert neben ihrer Tochter nieder, streicht ihr über den Rücken und erklärt ihr, es sei alles gut. Und in der Tür steht Claras Bruder Rowan, mit dem Sonnenblocker Faktor sechzig in der Hand, den er noch auftragen muss.
»Was ist mit ihr los?«, fragt er.
»Gar nichts«, sagt Clara, die kein Publikum will. »Ehrlich, jetzt ist alles in Ordnung. Ich fühl mich gut.«
Und die Aussage bleibt im Raum hängen, lauernd, und mit ihrer übel riechenden Falschheit die Luft verpestend.
Die Rolle
Clara gibt sich größte Mühe, ihre Rolle den ganzen Morgen weiterzuspielen, sie macht sich ganz normal für die Schule fertig, trotz des elenden Gefühls im Magen.
Man muss wissen, dass Clara am vergangenen Samstag von einer Vegetarierin zur überzeugten Veganerin aufgerüstet hat, um Tiere dazu zu bringen, sie ein bisschen mehr zu mögen.
Weil die Enten ihr Brot nicht nahmen, die Katzen sich nicht von ihr streicheln ließen und die Pferde auf der Koppel an der Thirsk Road jedes Mal verrücktspielten, wenn sie an ihnen vorbeiging. Sie kann den Schulausflug nach Flamingo Land nicht vergessen, bei dem sämtliche Flamingos in Panik gerieten, noch bevor sie am See angekommen war. Oder ihre kurzlebigen Goldfische – Rhett und Scarlett –, die einzigen Haustiere, die ihr je erlaubt worden waren. Ein absoluter Horror, als sie am ersten Morgen an der Wasseroberfläche schwammen, auf dem Rücken, ihre Schuppen hatten jede Farbe verloren.
Im Moment spürt sie die Augen ihrer Mutter in ihrem Rücken, während sie die Sojamilch aus dem Kühlschrank nimmt. »Weißt du, wenn du wenigstens richtige Milch trinken würdest, dann ginge es dir bestimmt viel besser. Kann sogar fettarm sein.«
Clara fragt sich, wie Milch durch Entfetten veganer werden soll, reißt sich aber zusammen und lächelt. »Mir geht’s gut. Mach dir bitte keine Sorgen.«
Inzwischen sind alle da, in der Küche. Ihr Vater trinkt seinen frischen Kaffee, und ihr Bruder verschlingt sein morgendliches Fleischsortiment aus dem Feinkostladen.
»Peter, sag du es ihr. Das macht sie krank.«
Peter braucht etwas Zeit. Die Worte seiner Gattin müssen den breiten roten Fluss seiner Gedanken durchschwimmen und sich triefend und erschöpft an das schmale Ufer väterlichen Pflichtgefühls retten.
»Deine Mutter hat recht«, sagt er. »Du machst dich krank.«
Clara schüttet die anstößige Milch über ihr Nussmixmüsli, während ihr mit jeder Sekunde übler wird. Sie würde gerne darum bitten, das Radio leiser zu stellen, weiß aber, wenn sie das tut, wird man sie nur für noch kränker halten.
Wenigstens ist Rowan auf ihrer Seite, auf seine ihm eigene, schlaffe Art. »Das ist Soja, Mum«, sagt er mit vollem Mund. »Kein Heroin.«
»Sie muss aber Fleisch essen.«
»Es geht mir gut.«
»Sieh mal«, sagt Helen. »Ich finde wirklich, du solltest heute nicht zur Schule gehen. Ich rufe für dich an, wenn du willst.«
Clara schüttelt den Kopf. Sie hat Eve versprochen, am Abend mit ihr auf Jamie Southerns Party zu gehen, und deshalb muss sie zur Schule, sonst darf sie abends ganz sicher nicht ausgehen. Und außerdem wird sie ein Tag voller Pro-Fleisch-Propaganda nicht weiterbringen. »Ehrlich, ich fühle mich viel besser. Mir wird nicht wieder schlecht.«
Ihre Mutter und ihr Vater tauschen eine ihrer codierten Augenbotschaften aus, die Clara nicht übersetzen kann.
Peter zuckt mit den Schultern.
(»Die Sache mit Dad ist«, hatte Rowan einmal gesagt, »eigentlich kümmert ihn so ziemlich alles einen Scheiß.«)
Helen fühlt sich ebenso besiegt wie vor ein paar Tagen, als sie die Sojamilch in den Einkaufswagen stellte, während Clara mit Magersucht drohte.
»Gut, du kannst zur Schule gehen«, sagt sie schließlich. »Aber bitte sei vorsichtig.«
Sechsundvierzig
Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat – manchmal mit fünfzehn, manchmal mit sechsundvierzig –, fällt einem auf, dass jenes Klischee, das man schon so lange aufrechterhält, nicht funktioniert. Genau das passiert Peter Radley im Moment, während er auf einer Scheibe Vollkorntoast mit Butter herumkaut und die zerknitterte Frischhaltefolie anstarrt, in der sich der übrige Laib befindet.
Der vernünftige, gesetzestreue Erwachsene mit einer Frau, einem Auto und zwei Kindern und regelmäßigen Spenden an WaterAid.
Er hatte nur Sex gewollt, gestern Nacht. Harmlosen, menschlichen Sex. Und was war Sex? Sex war nichts. Nicht mehr als eine Umarmung mit Bewegung. Eine blutleere Sache mit Körperreibung. Na gut, selbst wenn er sich gewünscht hätte, dass etwas anderes daraus entsteht, hätte er sich beherrschen können. Er hatte sich schließlich siebzehn Jahre lang beherrscht.
Gut, leck mich, denkt er.
Es fühlt sich gut an, Fluchen, sogar in den Gedanken. Er hatte im British Medical Journal gelesen, neueste Erkenntnisse ließen darauf schließen, dass man mit dem Akt des Fluchens Schmerzen lindern könnte.
»Leck mich«, murmelt er, so leise, dass Helen ihn nicht hören kann. »Leck. Mich.«
Realismus
Ich mache mir Sorgen um Clara«, sagt Helen, während sie Peter die Lunchbox reicht. »Sie ist erst seit einer Woche Veganerin und wird eindeutig krank. Was machen wir, wenn das irgendwas auslöst? Wenn alles außer Kontrolle gerät?«
Er hört sie kaum. Er starrt einfach nur nach unten, in das finstere Chaos seiner Aktentasche.
»Verflixt viel Müll ist da drin«, murmelt er.
»Peter, ich mache mir Sorgen um Clara.«
Peter wirft zwei Stifte in den Abfall. »Ich mache mir auch Sorgen um sie. Ich mache mir sogar große Sorgen um sie. Aber einen Lösungsvorschlag willst du von mir ja wohl nicht hören, oder?«
Helen schüttelt den Kopf. »Nicht schon wieder, Peter. Nicht jetzt. Die Sache ist ernst. Ich wünschte, wir könnten wenigstens versuchen, uns wie erwachsene Menschen zu benehmen. Ich will wissen, was wir deiner Meinung nach tun sollen.«
Er seufzt. »Ich denke, wir sollten ihr die Wahrheit sagen.«
»Was?«
In der stickigen Küchenluft atmet er tief ein. »Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir es den Kindern sagen.«
»Peter, wir müssen sie schützen. Wir müssen alles schützen. Du musst realistisch sein.«
Er schnallt die Aktentasche zu. »Ach ja, Realismus. Passt nicht so ganz zu uns, oder?«
Sein Blick fällt auf den Kalender. Die Ballerina von Degas und die Kalendertage sind mit Helens Handschrift übersät. Erinnerungen an Lesekreistreffen, Theaterbesuche, Badmintonturniere, Zeichenkurse. Der endlose Nachschub an Verpflichtungen. Heute auch: Essen mit Felts bei uns – 19.30 Uhr – Lorna macht Vorspeise.
Peter stellt sich seine hübsche Nachbarin vor, wie sie ihm gegenübersitzt.
»Tut mir leid«, sagt er. »Ich bin bloß ein bisschen gereizt. Eisenmangel. Manchmal gehen mir all die Lügen einfach auf die Nerven, verstehst du?«
Helen nickt. Sie versteht.
Mit einem Blick auf die Uhr hastet Peter in Richtung Tür.
»Die Müllabfuhr kommt heute«, sagt sie. »Und die Recyclingtonne muss raus.«
Recycling. Peter seufzt und nimmt den vollen Behälter mit Bechern und Flaschen mit. Leere Gefäße, die auf ihre Wiedergeburt warten.
»Ich fürchte bloß, je länger sie nicht isst, was sie essen muss, desto größer wird ihr Verlangen …«
»Ich weiß, ich weiß. Wir lassen uns was einfallen. Aber ich muss jetzt wirklich gehen – ich bin sowieso schon spät dran.«
Er öffnet die Tür, und sie sehen den unheilvoll blauen Himmel mit seiner gleißenden Warnung.
»Geht das Ibuprofen zur Neige?«, fragt er unvermittelt.
»Ja«, sagt sie. »Ich glaube schon.«
»Ich gehe auf dem Heimweg bei der Apotheke vorbei. Meinem Kopf geht’s verflucht schlecht.«
»Ja, meinem auch.«
Er küsst sie auf die Wange und streicht ihr in einem Anflug von Zärtlichkeit sacht über den Arm, eine mikroskopische Erinnerung daran, wie es einmal zwischen ihnen war, dann ist er weg.
Seien Sie stolz, sich wie ein menschliches Wesen zu benehmen. Halten Sie sich an die hellen Stunden des Tages, suchen Sie sich einen anständigen Job und umgeben Sie sich mit Menschen, die ein sicheres Gespür für den Unterschied zwischen Gut und Böse haben.
Handbuch für Abstinenzler (zweite Ausgabe), Seite 89
Fantasy World
Auf der Karte sieht Bishopthorpe wie das Skelett eines Fischs aus.
Die Hauptstraße ist das Rückgrat mit dünnen kleinen Seitensträßchen und Sackgassen, die nirgendwo hinführen. Ein toter Ort, an dem junge Leute nach mehr hungern.
Es gibt recht viele verschiedene Geschäfte an der Hauptstraße, wie in Dörfern üblich. Aber bei Tageslicht sieht man, was sie sind – ein willkürlicher Mix aus Nischenprojekten, die eigentlich nicht zusammengehören. Der sehr edle Feinkostladen beispielsweise residiert neben Fantasy World, einem Geschäft für Kostümbedarf, das man – wenn die Kostüme im Fenster nicht wären – leicht für einen Sexshop halten könnte (und in der Tat gibt es ein Hinterzimmer, wo »neuestes Spielgerät für Erwachsene« angeboten wird).
Das Örtchen ist eigentlich nicht mehr autark. Es gibt kein Postamt mehr, und im Pub und dem Fish & Chips Shop liefen die Geschäfte früher besser. Es gibt eine Apotheke, neben der Praxis, und ein Geschäft für Kinderschuhe, das wie Fantasy World hauptsächlich Kunden beliefert, die aus York oder Thirsk anreisen. Und das war’s dann auch schon.
Für Rowan und Clara ist Bishopthorpe nichts Halbes und nichts Ganzes, man ist auf Busse und Internetverbindungen und andere Fluchtwege angewiesen. Ein Ort, der so tut, als sei er der Inbegriff des idyllischen englischen Dorfes, dabei sieht er wie die meisten nur wie eine Edelboutique aus, aber innen drin gibt’s nur schäbige Klamotten.
Und wenn man hier lang genug lebt, muss man sich irgendwann entscheiden.
Man kauft sich so eine Klamotte und tut so, als würde sie einem gefallen. Oder man sieht der Wahrheit ins Gesicht und erkennt, wer man wirklich ist.
Faktor sechzig
Draußen im Tageslicht ist Rowan schockiert, wie blass seine Schwester ist. »Was glaubst du, was du hast?«, fragt Rowan, während sie an der Tonne mit dem Recyclingmüll vorbeigehen, über der sich die Fliegen versammeln. »Weshalb dir schlecht ist, meine ich.«
»Ich weiß es nicht …« Ihre Stimme verebbt wie der Gesang der verängstigten Vögel, die ihre Nähe spüren.
»Vielleicht hat Mum recht«, sagt er.
Sie hält inne, um Kraft zu sammeln. »Sagt der Junge, der zu jeder Mahlzeit rohes Fleisch isst.«
»Also, bevor du endgültig über mich herfällst, sollte ich dir sagen, dass es so etwas wie echte Veganer nicht gibt. Will sagen: Weißt du, wie viele Lebewesen in einer Karotte leben? Das sind Millionen. Eine Pflanze ist so etwas wie eine Mikrobenmetropole, du löschst also eine ganze Stadt aus, wenn du eine einzige Karotte kochst. Denk darüber nach. Jede Suppenschüssel ist eine Apokalypse.«
»Das ist eine …« Sie muss wieder aufhören zu sprechen.
Rowan fühlt sich schuldig, weil er sie aufregt. Seine Schwester ist die einzige Freundin, die er hat. Und vor allem die Einzige, vor der er so sein darf, wie er ist.
»Clara, du bist sehr, sehr blass«, sagt er leise. »Sogar für deine Verhältnisse.«
»Ich würde mir wünschen, dass nicht alle andauernd davon reden«, sagt sie und hat sich im Kopf eine Reihe von Fakten zurechtgelegt, die sie aus den Foren auf vegan.power.net herausgefunden hat. Beispielsweise dass Veganer neunundachtzig werden und nicht so oft an Krebs erkranken und einige sehr gesunde Hollywoodfrauen wie Alicia Silverstone und Liv Tyler und die zugegebenermaßen etwas verschlafene, aber dennoch strahlende Zooey Deschanel niemals tierische Produkte auf ihre Zunge lassen. Aber um das auszusprechen, müsste sie sich zu sehr anstrengen, also lässt sie es bleiben.
»Bei dem Wetter wird mir einfach schlecht«, sagt sie, als die letzte Übelkeitswelle ein wenig abgeklungen ist.
Es ist Mai, und der Sommer fängt früh an, insofern könnte sie recht haben. Rowan leidet selbst. Empfindlich, halb gehäutet, sogar unter der Kleidung und dem Sonnenblocker Faktor sechzig.
Rowan entdeckt die schimmernde Perle einer Träne im Auge seiner Schwester, was am Tageslicht liegen, aber auch Verzweiflung sein könnte, also behält er seine Antiveganer-Kommentare für sich. »Vielleicht hast du recht«, sagt er. »Wird schon werden. Ganz bestimmt. Und Hanf steht dir ganz bestimmt großartig.«
»Witzig«, presst sie mühsam hervor.
Sie gehen am ehemaligen Postamt vorbei, und Rowan ist deprimiert, weil das Graffito immer noch da ist. »Rowan RADLEY IST EIN FREAK.« Dann kommt Fantasy World, wo die Piraten durch Mannequins in neonfarbenen Discofähnchen ersetzt wurden, über denen ein Banner mit der Aufschrift »Hier kommt die Sonne« prangt.
Tröstlich wird es auf der Höhe des Hungry Gannet, wo Rowan durchs Fenster in Richtung Kühltheke späht, die im hinteren Teil des unbeleuchteten Raumes glüht. Wie er weiß, warten dort Serrano- und Parmaschinken darauf, dass sie gegessen werden. Doch dann zwingt ihn ein schwacher Knoblauchduft, den Blick abzuwenden.
»Hast du immer noch vor, heute Abend auf die Party zu gehen?«, fragt Rowan seine Schwester, während er sich die müden Augen reibt.
Clara zuckt mit den Schultern. »Weiß ich noch nicht. Ich glaube, Eve will, dass ich mitkomme. Kommt darauf an, wie es mir geht.«
»Gut, ja, du solltest nur mitgehen, wenn du …«
Rowan hat den Jungen vor sich entdeckt. Es ist ihr Nachbar, Toby Felt, der zur gleichen Bushaltestelle geht. Ein Tennisschläger ragt aus seinem Rucksack, wie der Pfeil am Piktogramm für das männliche Geschlecht.
Er ist ein dünner, wieselartiger Junge, der einmal – vor mehr als einem Jahr – Rowan ans Bein uriniert hat, als Rowan zu lange vor dem benachbarten Urinal stand, weil er nicht pinkeln konnte.
»Ich bin ein Hund«, hatte er gesagt, mit kaltem, spöttischem Blick, während er den gelben Strahl auf ihn richtete. »Du bist ein Laternenpfahl.«
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragt Clara.
»Ja. Alles in Ordnung.«
Jetzt kommt Millers Fish & Chips Shop in ihr Blickfeld, mit seinem schmuddeligen Schild (auf dem ein Fisch eine Pommes isst und lacht, weil das komisch ist). Das Haltestellenhäuschen befindet sich genau gegenüber. Toby ist bereits angekommen und redet mit Eve. Und Eve lächelt über das, was er sagt, und bevor Rowan merkt, was er tut, kratzt er sich am Arm, womit er seinen Ausschlag zehnmal verschlimmert. Er hört Eve lachen, als die gelbe Sonne über den Dächern auftaucht, und Licht und Lachen versetzen ihm gleichermaßen einen Stich.
Irish Setter
Peter befördert die leeren Dosen und Flaschen über den Kies zum Gehweg, als er Lorna Felt auf ihrem Rückweg zu Nummer neunzehn entdeckt.
»Hallo, Lorna«, sagt er. »Bleibt es bei heute Abend?«
»Ja, natürlich«, sagt Lorna, als ob es ihr gerade wieder eingefallen wäre. »Das Essen. Nein, wir haben es nicht vergessen. Ich mache einen kleinen Thaisalat.«
Für Peter ist Lorna Felt kein richtiger Mensch, sondern eine Zusammenfassung von Ideen. Immer wenn er ihr wundervoll glänzend rotes Haar betrachtet, ihre gepflegte Haut und die teuren pseudoexzentrischen Kleider, hat er eine Idee von Leben im Kopf. Die Idee von Erregung. Von Verführung.
Die Idee von Schuld und die Idee von Horror.
Sie lächelt neckisch. Ein freudiges Werbeversprechen. »Oh, Nutmeg, lass das. Was ist bloß mit dir los?«
Bis zu diesem Moment hat er nicht gemerkt, dass sie ihren Irish Setter bei sich hat, obwohl der ihn vermutlich schon eine geraume Weile anknurrt. Er beobachtet, wie der Hund zurückweicht und vergeblich aus seinem Halsband zu schlüpfen versucht.
»Wie oft hab ich dir das schon gesagt, Peter ist absolut harmlos.«
Absolut harmlos.
Während er die spitzen Zähne des Hundes betrachtet, eine prähistorische und bestialische Zackenlinie, merkt er, dass ihm etwas schummrig wird. Eine Art Schwindel, der mit der aufsteigenden Sonne am Himmel zu tun haben könnte, vielleicht aber auch mit dem Duft, der ihm mit der leichten Brise zugetragen wird.
Etwas Süßliches, raffinierter als der Extrakt von Holunderblüte in ihrem Parfüm. Etwas, das sich seinen getrübten Sinnen nur noch sehr selten bietet.
Aber es ist da, unverkennbar echt.
Der betörende Duft ihres Blutes.
Peter geht so dicht wie möglich an der Hecke entlang, um von dem spärlichen Schatten möglichst viel abzubekommen. Er bemüht sich, nicht zu viel über den bevorstehenden Tag nachzudenken, oder über die lautlose Anstrengung, die es kosten wird, einen Freitag zu überstehen, der sich von den zahllosen Freitagen der Vergangenheit praktisch in nichts unterscheidet. Freitage ohne jeden Reiz, seit sie von London hierhergezogen sind, um ihre alten Gewohnheiten und Wochenenden wilder, blutiger Zügellosigkeit hinter sich zu lassen.
Er ist gefangen in einem Klischee, das nicht für ihn geschaffen ist. Ein gutbürgerlicher Mann mittleren Alters mit der Aktentasche in der einen Hand, der die volle Last von Schwerkraft und Moral und sämtlichen repressiven menschlichen Kräften auf seinen Schultern spürt. Nahe der Hauptstraße kommt einer seiner älteren Patienten auf einem Elektromobil angefahren. Ein alter Mann, dessen Namen er eigentlich wissen müsste.
»Hallo, Doktor«, sagt der alte Mann mit einem zögerlichen Lächeln. »Komme später mal vorbei.«
Peter tut so, als ob ihm die Information etwas sagen würde, und tritt dem Fahrzeug aus dem Weg. »Ja, natürlich. Bin schon gespannt.«
Lügen. Überall verdammte Lügen. Immer der gleiche verklemmte alte Eiertanz des Menschengeschlechts. »Cheerio!«
»Ja, bis dann.«
Fast bei der Praxis angekommen, dicht an der Hecke, sieht er einen Lkw der Müllabfuhr langsam auf sich zukommen. Der Blinker leuchtet auf, bereit, um links in die Orchard Lane einzubiegen.
Peter blickt beiläufig zu den drei Männern auf den Vordersitzen hoch. Er sieht, dass einer der drei, der dem Gehweg am nächsten sitzt, Peter direkt ins Gesicht starrt, und Peter lächelt ihm zu, wie das in Bishopthorpe üblich ist. Aber der Mann, den Peter noch nie gesehen hat, wirft ihm einen hasserfüllten Blick zu.
Ein paar Schritte weiter bleibt Peter stehen. Der Wagen ist jetzt eingebogen, und der Mann starrt ihn immer noch an, mit jenen Augen, die zu wissen scheinen, wer er wirklich ist. Peter schüttelt leicht den Kopf, wie eine Katze, wenn sie Wasser abbekommt, und läuft weiter den schmalen Pfad zur Praxis hinauf.
Elaine ist schon da, hinter der Glastür, und sortiert Patientenakten. Er versetzt der Tür einen Stoß nach vorn, um noch einen sinnlosen Freitag ins Rollen zu bringen.
Auf Tod und Sterben tagt das Frühgestirn
Die Müdigkeit überkommt Rowan in narkoleptischen Schüben, und ein solcher bricht gerade über ihn herein. Er hat letzte Nacht ungefähr zwei Stunden geschlafen. Über seinem Durchschnitt. Wenn er jetzt doch genauso wach wäre wie um drei Uhr morgens! Seine Augenlider werden schwerer und schwerer, und er stellt sich vor, er wäre jetzt da, wo seine Schwester ist, die mit Eve redet, einfach so wie ein ganz normaler Mensch.
»Morgen, Lahmarsch.«
Rowan sagt nichts. Jetzt wird er keinen Schlaf mehr abbekommen. Und außerdem ist Schlafen sowieso zu gefährlich. Er reibt sich die Augen, holt seinen Byron-Band heraus und versucht, sich auf eine Zeile zu konzentrieren. Irgendeine Zeile. Irgendwas mitten in »Lara«.
Auf Tod und Sterben tagt das Frühgestirn.
Er liest die Zeile wieder und wieder, versucht alles andere auszublenden. Aber dann hält der Bus, und Harper – der auf Rowans Liste von gefürchteten Personen an zweiter Stelle steht – steigt ein. Harper ist eigentlich Stuart Harper, aber sein Vorname ist im Jahr Nummer zehn von ihm abgefallen, irgendwo auf dem Rugbyfeld.
Auf Tod und Sterben tagt das Frühgestirn.
Harper schiebt seinen gigantischen Körper den Gang entlang, und Rowan hört, wie er sich neben Toby setzt. Irgendwann während der Fahrt spürt Rowan, dass ihm etwas wiederholt auf den Kopf patscht. Nach einigen Patschern erkennt er, dass es Tobys Tennisschläger ist.
»He, Lahmarsch, was macht der Ausschlag?«
»Lahmarsch«, höhnt Harper.
Zu Rowans Erleichterung haben sich Clara und Eve noch nicht umgedreht.
Toby bläst ihm von hinten ins Genick.
»He, Freak, was liest du da? He, Robin Rotkehlchen … Was liest du da?«
Rowan dreht sich halbwegs um. »Ich heiße Rowan«, sagt er. Oder er sagt es mehr oder weniger. Das »Ich heiße« ist ein raues Flüstern, seine Kehle findet die Stimme nicht rechtzeitig.
»Pimperzwerg«, sagt Harper.
Rowan versucht, sich auf seine Zeile zu konzentrieren.
Auf Tod und Sterben tagt das Frühgestirn.
Toby bleibt weiter beharrlich.
»Was liest du da? Robin. Ich habe dich was gefragt. Was liest du da?«
Rowan hält zögernd das Buch hoch, das Toby ihm sofort aus der Hand reißt.
»Schwul.«
Rowan dreht sich auf seinem Sitz um. »Gib es mir zurück. Bitte. Ich … hätte gern mein Buch zurück.«
Toby schubst Harper. »Das Fenster.«
Harper scheint unsicher und zögerlich, er steht aber trotzdem auf und schiebt das schmale Oberlicht auf. »Mach schon, Harper. Tu es.«
Rowan sieht nicht, wie das Buch die Hände wechselt, wohl aber, wie es wie ein Vogel im Sturzflug hinten auf die Straße flattert. »Childe Harold« und »Lara« und »Don Juan« in wenigen Sekunden gleichzeitig verloren.
Er will sich gegen sie wehren, aber er ist schwach und müde. Außerdem hat Eve seine Demütigung noch nicht mitbekommen, und er will nichts tun, was dazu führen könnte.
»Ach lieber Robin, es tut mir entsetzlich leid, aber offensichtlich hat jemand deinen schwulen Gedichtband verlegt«, sagt Toby mit theatralischer Stimme.
Leute, die in ihrer Nähe sitzen, lachen ängstlich. Clara dreht sich um, irritiert. Eve auch. Sie können sehen, dass die Leute lachen, aber nicht, aus welchem Grund.
Rowan schließt die Augen. Wünscht sich zurück ins Jahr 1812, in eine dunkle und einsame Pferdekutsche, und Eve mit einer Haube auf dem Kopf neben sich.
Sieh mich nicht an. Bitte, Eve, sieh mich nicht an.
Als er die Augen wieder aufschlägt, wurde ihm sein Wunsch erfüllt. Nun ja, zur Hälfte. Er befindet sich immer noch im einundzwanzigsten Jahrhundert, aber seine Schwester und Eve unterhalten sich, ohne bemerkt zu haben, was gerade geschehen ist. Clara klammert sich an die Lehne des Vordersitzes. Ihr ist schlecht, unverkennbar, und er hofft, dass sie sich nicht im Bus erbrechen muss, aber sosehr er es hasst, im Zentrum von Tobys und Harpers Aufmerksamkeit zu stehen, würde er nicht wollen, dass sie sich auf Clara stürzen. Doch irgendwie, durch irgendein unsichtbares Signal, greifen sie seine Befürchtung auf und fangen an, über die beiden Mädchen zu reden.
»Eve gehört heute Abend mir, Harps. Meine Flöte ist bereit, Alter, ich sag’s dir.«
»Ja?«
»Keine Sorge. Du kommst auch zum Zug. Scheißstechers Schwester ist ziemlich scharf auf dich. Echt, ohne Witz.«
»Was?«
»Sieht man doch.«
»Clara?«
»Die braucht ein bisschen Farbe und die Brille weg, dann lohnt sich der Versuch.«
Rowan spürt, wie sich Toby vorbeugt, um ihm zuzuflüstern: »Wir haben da eine Anfrage. Harper hat’s mit deiner Schwester. Wie viel nimmt die doch gleich pro Nacht? Einen Zehner? Weniger?«
Rowan kocht innerlich vor Wut.
Er will etwas sagen, schafft es aber nicht. Er schließt die Augen und malt sich ein Horrorszenario aus. Toby und Harper, beide auf ihren Plätzen im Bus, aber rot und gehäutet wie anatomische Zeichnungen, mit Muskelsträngen und Haarbüscheln auf den Köpfen. Das Bild wird weggeblinzelt … Und Rowan unternimmt nichts, um seine Schwester zu verteidigen. Er sitzt einfach da, schluckt seinen Selbsthass hinunter und fragt sich, was Lord Byron wohl getan hätte.
Fotografie
Es ist nur eine Fotografie.
Ein erstarrter Moment aus der Vergangenheit.
Ein physisches Ding, das sie anfassen kann, etwas aus der Zeit vor den Digitalkameras, und sie hat nie gewagt, es auf ihrem iMac einzuscannen. »Paris 1992« steht mit Bleistift auf der Rückseite. Als ob sie je nötig gehabt hätte, das aufzuschreiben. Sie wünscht, das Foto würde gar nicht existieren, sie hätten den armen, unwissenden Passanten niemals gefragt, das Bild aufzunehmen. Aber es existiert, und da sie weiß, dass es existiert, kann sie es nicht zerreißen oder verbrennen oder es einfach nur nicht ansehen, sosehr sie sich auch bemüht.
Weil er darauf ist.
Ihr Konverter.
Ein unwiderstehliches Lächeln leuchtet aus dieser unvergesslichen Nacht. Und sie selbst, lachend, so unverkennbar glücklich und unbeschwert steht sie da, mitten auf dem Montmartre im Minirock mit blutroten Lippen und einem gefährlichen Glitzern in den jungen Augen.
»Du blöde Kuh«, sagt sie zu ihrem früheren Ich, während sie denkt: Ich könnte immer noch so aussehen, wenn ich wollte, oder fast so gut. Und ich könnte immer noch so glücklich sein.
Obwohl das Bild im Lauf der Zeit und in der Wärme seines Verstecks ausgeblichen ist, hat es immer noch den gleichen schaurig-schönen Effekt.
»Reiß dich zusammen.«
Sie legt es in den Wäscheschrank zurück und kommt mit dem Arm an den Wasserboiler. Sie lässt den Arm da. Der Boiler ist heiß, aber sie wünscht sich, er wäre noch heißer. Sie wünscht sich, er wäre heiß genug, um sie zu bestrafen und ihr so viel Schmerz zuzufügen, wie sie braucht, um diesen wunderschönen, lang verlorenen Geschmack zu vergessen.
Sie reißt sich zusammen und geht nach unten.
Zwischen den Ritzen der Fensterläden zur Straße hindurch beobachtet sie den Müllmann, der die Auffahrt hinaufläuft, um ihren Müll abzuholen. Was er dann aber nicht tut. Jedenfalls nicht sofort. Er öffnet den Deckel einer Tonne, reißt einen der schwarzen Beutel auf und wühlt darin herum.
Sie sieht, dass sein Partner etwas zu ihm sagt, worauf er den Deckel zuklappen lässt und die Tonne zum Lkw rollt.
Sie wird angehoben, umgekippt, geleert.
Der Müllmann blickt zum Haus. Er sieht sie, und seine Augen blinzeln kein einziges Mal. Er steht einfach da und starrt.
Helen tritt zurück, vom Fenster weg, und ist erleichtert, als der Lkw eine Minute später die Straße weiterbrummt.
Faust
Deutsch findet in einem großen alten Saal statt, in dem acht Glühlampen von der hohen Decke herabhängen. Zwei dieser Lampen befinden sich in dem flackernden Schwebezustand zwischen Leuchten und Nicht-Leuchten, den Rowans Kopf nicht verträgt.
Rowan sitzt da, hinten in der Klasse tief nach unten gerutscht auf seinem Stuhl, und hört zu, wie Mrs. Sieben mit ihrer üblichen Theaterstimme aus Goethes Faust vorliest.
»Welch Schauspiel!«, sagt sie mit verschränkten Händen, als würde sie das Aroma einer Mahlzeit preisen, die sie gerade zubereitet hat. »Aber ach, ein Schauspiel nur!«
Sie blickt von ihrem Buch auf in die verstreuten ausdruckslosen Gesichter der Siebzehnjährigen.
»Schauspiel? Wer weiß es?«
Ein Theaterstück. Rowan kennt das Wort, hebt aber nicht die Hand, da ihm wie immer der Mut fehlt, freiwillig vor der ganzen Klasse laut zu sprechen, besonders wenn Eve Copeland in dieser Klasse ist.
»Weiß es jemand? Wer weiß es?«
Wenn Mrs. Sieben eine Frage stellt, reckt sie die Nase hoch, wie eine Haselmaus, die nach Käse schnüffelt. Heute wird sie allerdings hungern müssen.
»Ihr müsst das Wort ableiten. Schau-Spiel. Schauen und spielen. Es ist eine Show. Ein Spiel. Etwas, das im Theater stattfindet. Goethe hat die Verlogenheit der Welt angeprangert. ›Was für eine Show! Aber ach – leider – ist es nur eine Show!‹ Goethe sagte ziemlich oft ›ach‹«, sagt sie lächelnd. »Er war Herr Ach.« Sie lässt den Blick durch den Raum schweifen, unheilvoll, bis er bei Rowan hängen bleibt, genau im falschen Moment. »Nun, dann lassen wir uns von unserem eigenen Herrn Ach helfen. Rowan, könntest du die Passage auf der nächsten Seite lesen, Seite sechsundzwanzig, es fängt an mit … warte mal …« Sie lächelt, als sie etwas entdeckt. »›Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Brust‹, zwei Seelen leben – oder hausen – leider! in meiner Brust oder in meinem Herzen … lies weiter, Herr Ach! Worauf wartest du?«
Rowan sieht die Gesichter, die ihn anstarren. Die ganze Klasse reckt die Hälse, um den lächerlichen Anblick eines Jugendlichen nicht zu verpassen, der vor Schreck erstarrt, weil er laut vorlesen soll. Nur Eve hält ihren Blick weiter auf ihr Buch gesenkt, möglicherweise bei dem Versuch, seine Verlegenheit zu mindern. Eine Verlegenheit, die sie schon einmal miterlebt hat, letzte Woche im Englischkurs, als er vorlesen musste, was Othello zu seiner Desdemona sagt (»L-l-let me see your eyes«, hatte er in die Shakespeare-Schulausgabe geflüstert. »L-l-look in my face«).
»Zwei Seelen«, sagt er und hört unterdrücktes Kichern. Und dann ist seine Stimme ganz allein da draußen, und zum ersten Mal fühlt er sich heute tatsächlich wach, aber es ist kein gutes Gefühl. Es ist die Wachsamkeit von Löwenbändigern und zögerlichen Gipfelstürmern, und er weiß, über ihm lauert die Katastrophe.
Überaus ängstlich schreitet er von einem Wort zum nächsten, wohl wissend, dass seine Zunge jederzeit etwas falsch aussprechen kann. Die Pause zwischen »meiner« und »Brust« dauert fünf Sekunden und diverse Lebenslängen, und seine Stimme wird mit jedem Wort schwächer, zittriger.
»Ich bin der Geist der st-stets verneint«, liest er.
Trotz seiner Nervosität spürt er eine seltsame Verbundenheit mit den Worten, als ob sie nicht zu Johann Wolfgang von Goethe gehören würden, sondern zu Rowan Radley.
Ich bin die Haut, die nie gekratzt.
Ich bin der Durst, der nie gelöscht.
Ich bin der Junge, der nichts kriegt.
Warum ist er so? Und was verneint er? Was würde ihn stark genug machen, um seiner eigenen Stimme zu trauen?
Eve hält sich an einem Kugelschreiber fest, den sie zwischen den Fingern rollt und so konzentriert im Blick behält, als wäre sie eine Seherin und der Kugelschreiber könnte ihr die Zukunft weissagen. Sie ist seinetwegen verlegen, er spürt es, und der Gedanke quält ihn. Er sieht Mrs. Sieben an, aber ihre hochgezogenen Augenbrauen sagen ihm, dass er weiterlesen muss, dass seine Folter noch nicht zu Ende ist.
»Entbehren sollst du!«, sagt er in einem Tonfall, dem jeder Hinweis auf das Ausrufezeichen fehlt. »Sollst entbehren!«
Mrs. Sieben unterbricht ihn hier. »Noch einmal, sag es mit Leidenschaft. Das sind leidenschaftliche Worte. Du verstehst sie doch, Rowan, oder? Also, noch einmal. Sag es lauter.«
Alle sehen ihn wieder an. Eve auch, eine oder zwei Sekunden lang. Sie genießen es, so wie die Leute Stierkämpfe oder grausame Gameshows genießen. Er ist der blutende, aufgespießte Bulle, dessen Qualen verlängert werden sollen.
»Entbehren sollst du«, sagt er noch einmal lauter, aber nicht laut genug.
»Entbehren sollst du!«, beschwört Mrs. Sieben. »Das sind starke Worte, Rowan. Sie brauchen eine starke Stimme.«
Sie lächelt freundlich. Was glaubt sie, was sie da tut?, fragt er sich. Charakterbildung?
»Entbehren sollst du!«
»Lauter! Mehr Begeisterung, noch einmal!«
»Entbehren sollst du!«
»Lauter!«
Sein Herz pocht und hämmert. Er liest die Worte und wird sie brüllen müssen, um Mrs. Sieben loszuwerden.
Entbehren sollst du! Sollst entbehren!
Das ist der ewige Gesang!
Er holt tief Luft, schließt seine Augen, aus denen fast die Tränen fließen, und hört seine Stimme so laut wie nie zuvor.
Erst als er fertig ist, merkt er, dass er auf Englisch gebrüllt hat. Aus dem bisherigen erstickten Kichern wird schallendes Gelächter, und die Leute brechen hysterisch über ihren Pulten zusammen.
»Was ist daran witzig?«, erkundigt sich Eve verärgert bei Lorelei Andrews.
»Warum sind die Radleys bloß so irre?«
»Er ist nicht irre.«
»Nein. Das stimmt. Auf einem Planeten mit lauter Freaks würde er überhaupt nicht auffallen. Ich hatte allerdings an die Erde gedacht.«
Rowan schämt sich nur noch mehr. Er sieht Loreleis karamellfarbene Haut und ihre boshaften Bambiaugen und stellt sie sich auf einem Scheiterhaufen vor.
»Gute Übersetzung, Rowan«, sagt Mrs. Sieben, um das Gelächter zu ersticken. Ihr Lächeln ist jetzt gütig. »Ich bin beeindruckt. Ich wusste nicht, dass du so präzise übersetzen kannst.«
Und ich erst recht nicht, denkt Rowan. Aber dann registriert er jemanden hinter dem Drahtglas der Tür. Jemand aus einer anderen Klasse schießt den Korridor entlang. Es ist seine Schwester, die zur Toilette rast, eine Hand auf den Mund gepresst.
Hinter dem schützenden Vorhang
Peters vierzehnter Patient des Tages ist hinter dem schützenden Vorhang, um sich Hose und Unterhose auszuziehen. Peter bemüht sich, nicht darüber nachzudenken, was er bei der Untersuchung in den nächsten Minuten tun muss, während er den Latexhandschuh überstreift. Er sitzt einfach da und überlegt, wie er Clara dazu bringen kann, wieder Fleisch zu essen.
Nervenschädigung?
Anämie?
Mangel an Vitamin B und Eisen kann in der Tat ernsthafte Gesundheitsschäden verursachen. Es gibt da ein Risiko, das noch nicht bestand, als die Kinder kleiner waren: Leute, die anderer Meinung sind als er, wie die Schulschwester, die bezweifelte, dass es Photodermatose sei, als Rowan sie wegen seines Hautausschlags befragte. Ist es das alles noch wert? Ist es all die Lügen wert? Ist es das wert, die Kinder krank zu machen? Das Teuflische daran ist, dass seine Kinder glauben, es sei ihm egal, dabei ist es in Wirklichkeit eher so, dass er sich keine Sorgen machen darf – jedenfalls nicht so, wie er gerne möchte.
»Scheiße.« Er formt das Wort mit dem Mund, lautlos. »Verfluchte. Scheiße.«
Natürlich ist Peter lange genug praktizierender Arzt, um zu wissen, dass Beschwichtigung auch schon eine Art Medizin ist. Er hat oft genug gelesen, dass Placeboeffekte und Herumtricksen mit dem guten Glauben tatsächlich funktionieren. Er kennt Studien, die belegten, dass Oxazepam bei der Behandlung von Angstzuständen besser funktioniert, wenn die Tablette grün ist, während sie bei Depressionen gelb sein sollte.
Manchmal rechtfertigt er seinen Selbstbeschiss auf die gleiche Weise. Er färbt die Wahrheit ein wie eine Pille.
Aber in letzter Zeit fällt ihm das immer schwerer.
Während er dasitzt und auf den alten Mann wartet, glotzt ein Poster von seiner Pinnwand auf ihn herab, wie immer.
Ein großer roter Blutstropfen in der Form einer Träne.
Darunter in Blockbuchstaben die Worte des Blutspendedienstes: »SEI HEUTE EIN HELD. SPENDE BLUT.«
Die Uhr tickt.
Kleidung raschelt, und der alte Mann räuspert sich.
»Gut«, sagt der alte Mann. »Das … ich bin … Sie können …«
Peter schlüpft hinter den Vorhang, tut, was sein Job verlangt …
»Da ist nichts, was da nicht hingehört, Mr. Bamber. Braucht bloß ein bisschen Creme, das ist alles.«
Der alte Mann zieht seine Unterhose und seine Hose wieder an und sieht aus, als würde er gleich vor Scham weinen. Peter schält seinen Handschuh ab und lässt ihn sorgsam in dem kleinen Eimer verschwinden, der für solche Zwecke bereitsteht. Der Deckel klappt zu.
»Wie gut«, sagt Mr. Bamber. »Ach wie gut.«
Peter blickt dem alten Mann ins Gesicht. Sieht die Altersflecken, die Falten, das unordentliche Haar, die etwas getrübten Augen. Einen Moment lang schreckt ihn das Wissen um seine eigene Zukunft, die er sich selbst auferlegt hat, so sehr, dass er kaum sprechen kann.
Er wendet sich ab und blickt auf ein weiteres Poster an der Wand. Eines, das Elaine dort aufgehängt haben muss. Ein Bild von einem Moskito und eine Warnung für Urlauber vor Malaria.
»EIN BISS GENÜGT.«
Er bricht fast in Tränen aus.
Etwas Böses
Claras Handflächen sind rutschig vom Schweiß.
Sie spürt, dass etwas Furchtbares in ihr steckt. Irgendein Gift, das aus ihrem Körper entfernt werden muss. Etwas Lebendiges in ihr. Etwas Böses hat von ihr Besitz ergriffen.
Einige Mädchen betreten die Toilette, und jemand versucht, die Tür zu ihrer Kabine zu öffnen. Clara verhält sich still und bemüht sich, gegen ihren Brechreiz anzuatmen, kann aber nicht verhindern, dass sie die Übelkeit in rasendem Tempo überkommt.
Was geht mit mir vor?
Sie erbricht sich noch einmal und hört Stimmen von außen.
»Okay, Miss Bulimie, dein Mittagessen müsste inzwischen draußen sein.« Eine Pause. Dann: »Mein Gott, wie das stinkt.«
An der Stimme erkennt sie Lorelei Andrews.
Leises Klopfen ertönt an der Tür. Dann wieder Loreleis Stimme, aber freundlicher. »Ist alles in Ordnung mit dir da drin?«
Clara hält inne. »Ja«, sagt sie.
»Clara? Bist du da drin?«
Clara antwortet nicht. Lorelei und noch jemand kichern.
Clara wartet, bis sie gegangen sind, dann spült sie das Erbrochene hinunter. Draußen im Flur lehnt Rowan an den Wandfliesen. Es tut ihr gut, ihn zu sehen, den Einzigen, den sie im Moment noch ertragen kann.
»Ich hab gesehen, wie du über den Flur gerannt bist. Geht’s wieder?«
Toby Felt geht genau in diesem Moment vorbei und bohrt ihm dabei seinen Tennisschläger ins Kreuz. »Ich weiß, dass du dich nach ein bisschen Abwechslung sehnst, Lahmarsch, aber sie ist deine Schwester. So was tut man einfach nicht.«
Rowan fällt keine Antwort dazu ein, oder jedenfalls keine, die er laut auszusprechen wagt.
»Der ist so ein Idiot«, sagt Clara schwach. »Ich weiß nicht, was Eve an dem findet.«
Clara merkt, dass sie ihren Bruder damit aufregt, und wünscht sich, sie hätte nichts gesagt.
»Du hattest doch gesagt, dass sie ihn nicht leiden kann«, antwortet er kleinlaut.
»Na ja, das hatte ich gedacht. Ich dachte, kein Mensch mit einem voll funktionsfähigen Gehirn könnte ihn mögen, aber vielleicht habe ich mich geirrt.«
Rowan bemüht sich krampfhaft, Gleichgültigkeit vorzutäuschen. »Ach, ist mir eigentlich egal. Soll sie doch mögen, wen sie will. Wir leben schließlich in einer Demokratie.«
Es läutet.
»Versuch sie einfach zu vergessen«, rät Clara, als sie zu ihren jeweiligen Unterrichtsstunden gehen. »Wenn du willst, dass ich nicht mehr mit ihr befreundet bin, dann mache ich das.«
Rowan seufzt. »Sei nicht blöd. Ich bin keine sieben mehr. Ich fand sie einfach nur ganz nett. Es war nichts.«
Da schleicht sich Eve von hinten an.
»Was war nichts?«
»Nichts«, sagt Clara, die weiß, dass ihr Bruder zu nervös sein wird, um zu antworten.
»Nichts war nichts. Ein ziemlich nihilistischer Gedanke.«
»Wir stammen aus einer Familie von Nihilisten«, sagt Clara.
Wenn man sein Leben lang abstinent bleibt, kann man zwangsläufig nicht wirklich wissen, was man verpasst. Aber der Durst ist immer da, tief im Inneren, liegt allem zugrunde.
Handbuch für Abstinenzler (zweite Ausgabe), Seite 120
Ein Thai-Blattsalat mit mariniertem Hühnchen an Chili- und Limonendressing
Hübsche Kette«, hört Peter sich zu Lorna sagen, nachdem er ihr zu lange auf den Hals gestarrt hat.
Glücklicherweise lächelt Lorna geschmeichelt und berührt die schlichten weißen Perlen. »Ach, die hat mir Mark vor Jahren gekauft. Auf einem Markt in Santa Lucia. Auf unserer Hochzeitsreise.«
Mark, der erst jetzt bemerkt, dass sie irgendeine Kette trägt, scheint das neu zu sein. »Ich war das? Kann mich nicht erinnern.«
Lorna scheint gekränkt. »Ja«, sagt sie traurig. »Du warst das.«
Peter versucht, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Er sieht zu, wie seine Frau die Frischhaltefolie von Lornas Vorspeise entfernt, dann beobachtet er Mark, der so prüfend an seinem Sauvignon blanc nippt, als wäre er in einem Weinberg an der Loire aufgewachsen.
»Ist Toby auch zu der Party gegangen?«, fragt Helen. »Clara wollte unbedingt, obwohl sie sich nicht ganz wohlgefühlt hat.«
Peter erinnert sich, dass Clara vor einer Stunde zu ihm kam, während er seine E-Mails checkte. Sie fragte ihn, ob es in Ordnung sei, wenn sie ausginge, und er hatte geistesabwesend Ja gesagt, ohne wirklich mitzubekommen, was sie fragte, und dann hatte ihn Helen vorwurfsvoll angesehen, als er nach unten kam, aber nichts gesagt, während sie die Kasserolle mit Schweinefleisch zubereitete. Vielleicht würde sie sich später noch darauf stürzen. Und vielleicht hatte sie recht. Vielleicht hätte er nicht Ja sagen dürfen, aber er ist nicht Helen. Er kann nicht ständig auf Draht sein.
»Keine Ahnung«, sagt Mark. Und dann zu Lorna: »Ist er hingegangen?«
Lorna nickt, über ihren Stiefsohn scheint sie nicht gern zu sprechen. »Ja, ich glaube schon, allerdings sagt er uns nie, wo er hingeht.« Sie richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Salat, den Helen gerade aufträgt. »Da ist er ja. Ein Thai-Blattsalat mit mariniertem Hühnchen an Chili- und Limonendressing.«
Peter hört das, aber die Alarmglocken schweigen still. Und Helen hat bereits einen Bissen im Mund, also glaubt er, es müsste gehen.
Mit seiner Gabel spießt er etwas Huhn und angemachte Brunnenkresse auf und schiebt beides in den Mund und fängt binnen Sekunden an zu würgen.
»O Gott«, sagt er.
Helen weiß Bescheid, hatte aber keine Gelegenheit, ihn zu warnen. Irgendwie hat sie es geschafft, zu schlucken, und jetzt spült sie sich den Mund mit Wein, um den Geschmack loszuwerden.
Lorna ist sehr besorgt. »Stimmt was nicht? Ist er zu scharf?«
Er hatte nichts gerochen. Der Geruch muss zwischen dem Chili und allem anderen verloren gegangen sein, aber der strenge, faulige Geschmack auf seiner Zunge ist so intensiv, dass er bereits würgt, bevor er in seinem Hals ankommt. Er steht auf, mit der Hand auf dem Mund, und wendet sich von ihnen ab.
»Mensch, Lorna«, sagt Mark mit einem harten, aggressiven Unterton in der Stimme. »Was hast du mit dem Mann angestellt?«
»Knoblauch!« Peter keucht das Wort hervor, zwischen Würgereizen, als würde er den Namen eines unbezwungenen Feindes verfluchen. »Knoblauch! Wie viel ist da drin?!« Er reibt sich mit dem Finger über die Zunge, versucht, den Ekel abzuwischen. Dann erinnert er sich an den Wein. Er schnappt sich sein Glas. Während er den Inhalt hinunterstürzt, sieht er durch den Schleier seiner wässrigen Augen, wie Lorna verzweifelt auf die Überreste ihrer verhängnisvollen Vorspeise in der Schüssel starrt. »Im Dressing ist welcher und ein bisschen in der Marinade. Es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass du …«
Wie immer ist Helen sofort am Ball: »Peter ist ein bisschen allergisch gegen Knoblauch. Er wird’s überleben, da bin ich sicher. Mit Schalotten hat er das auch.«
»Ach«, sagt Lorna ehrlich verblüfft. »Wie seltsam. Knoblauch ist so ein nützliches Antioxidans.«
Peter greift nach seiner Serviette und hustet in den weißen Stoff, dann kippt er noch mehr Weißwein hinterher. Er behält den letzten Schluck im Mund und spült damit wie mit Mundwasser. Schließlich schluckt er auch den letzten Rest hinunter.
»Tut mir leid«, sagt er, während er sein leeres Glas abstellt. »Wirklich. Es tut mir so leid.«
Seine Frau sieht ihn mit einer Mischung aus Mitleid und Missbilligung an, während sie ein soßenfreies grünes Blatt in den Mund schiebt.
Copeland
Fahrt ihr dieses Jahr weg?«, fragt Helen ihre Gäste.
Mark nickt. »Wahrscheinlich. Sardinien oder so.«
»An die Costa Smeralda«, ergänzt Lorna, während sie Peter ansieht und ihren Finger über den Rand ihres Weinglases kreisen lässt.
»Ach, Sardinien!«, sagt Helen und spürt, wie sie ein seltenes Glücksgefühl durchströmt. »Sardinien ist wunderschön. Wir sind mal eine Nacht hingeflogen, weißt du noch, Peter?«
Ihre Gäste sehen verwirrt aus. »Eine Nacht?«, fragt Mark beinahe misstrauisch. »Was, ihr habt bloß eine Nacht da verbracht?«
Helen erkennt ihren Fehler. »Ich meinte, dass wir nachts geflogen sind«, sagte sie, während ihr Ehemann die Augenbrauen hochzieht, mit einem Mal-sehen-wie-du-da-wieder-rauskommst-Blick. »Das war schön, die Landung in Cagliari … mit all den Lichtern und so. Natürlich sind wir eine Woche geblieben. Ich meine, wir haben für Kurztrips viel übrig, aber hin und zurück in einer Nacht wäre doch ein bisschen übertrieben!«
Sie lacht, ein bisschen zu laut, dann steht sie auf und trägt den nächsten Gang auf. Eine knoblauchfreie Schweinefleisch-Kasserolle, bei der sie sich fest vornimmt, keinen weiteren Fauxpas zu begehen.