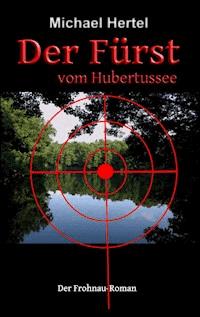
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der SPD-Funktionär Horst Adelmann wird im Berliner Stadtteil Frohnau ermordet. Für die Lokaljournalistin Ulrike Manteuffel ist das ein gefundenes Fressen, um im Leben des Ermordeten herumzuschnüffeln. Dabei entdeckt sie eine Parteirevolte, einen eklatanten Fall von Wahlfälschung sowie einen mutmaßlichen Bauskandal und kommt dem Mörder ziemlich nahe. Der Roman "Der Fürst vom Hubertussee" erschien erstmals im Jahr 2010 zum 100-jährigen Bestehen der "Gartenstadt Frohnau" und gilt als der (erste) Frohnau-Roman. Jetzt erscheint das Werk des gebürtigen Frohnauers Michael Hertel in neuer, preiswerter Auflage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Der SPD–Parteifunktionär Horst Adelmann wird im Berliner Ortsteil Frohnau ermordet. Für die Lokaljournalistin Ulrike Manteuffel ist das ein gefundenes Fressen, um im Leben des Ermordeten herum zu schnüffeln. Bei dieser Gelegenheit kommt die Journalistin auch dem Mörder ziemlich nahe. Mit einem Augenzwinkern wird hier Lokalpolitik der 1970–er Jahre unter die Lupe genommen.
Der Autor
Michael Hertel, im Jahre 1954 in Berlin-Frohnau geboren, kennt die Gartenstadt wie seine Westentasche. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend in Frohnau, machte eine Ausbildung zum Journalisten, arbeitete anschließend als Redakteur und Reporter bei verschiedenen Printmedien, schrieb u. a. für die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und Die WELT. Der Autor lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.
Prolog
Die Geschichte spielt in einem kleinen Ort namens Frohnau. Frohnau war und ist zweierlei: einerseits seit 1920 ein Ortsteil der deutschen Hauptstadt, andererseits aber auch so etwas wie eine in sich geschlossene, gutbürgerliche Kleinstadt. Diese Abgeschlossenheit war in den 1970–er Jahren umso größer, als der im französischen Sektor gelegene Ortsteil West–Berlins im Westen, Norden, Osten und Südosten durch Mauer und Stacheldraht der DDR–Grenze umschlossen und mit dem Rest der geteilten Stadt im Wesentlichen durch drei Straßen verbunden war. Solche Abgeschiedenheit würde man im Allgemeinen als „Provinz” bezeichnen. Doch auch in der vermeintlichen Provinz passieren bisweilen politische Umwälzungen beträchtlichen Ausmaßes.
Handlung und handelnde Personen dieses Buches sind rein fiktiv. Die Handlung spielt in Kreisen und Umkreisen der SPD, könnte aber so oder ähnlich auch in anderen demokratischen Parteien Deutschlands abgelaufen sein. Niemand muss befürchten, in diesem Buch beschrieben zu sein, weil die Akteure nie existiert haben. Es sollte sich aber auch niemand einbilden, nicht gemeint zu sein.
Michael Hertel
Im düsteren Saum zwischen Straße und Seeufer hatte der Schatten wenig Mühe, mit seiner Umgebung zu verschmelzen. Der Herbstabend war unangenehm kühl und feucht. Dicke Wolken lagen in der Luft. Nur der steife Nordwest hatte sie bislang daran gehindert, abzuregnen. Der Wind zerrte an den Wolken, trieb sie auseinander und vor sich her. In Wellen lösten sich bunte Blätter von mächtigen Buchen und knorrigen Eichen, taumelten auf den Waldboden oder die gekräuselte Oberfläche des Sees herab. Zwischen Blätterrauschen und knarrenden Kiefern schien der Schatten auf etwas zu warten. Von Westen her näherte sich auf Kopfsteinpflaster eine Limousine. Keine fünfzig Meter vom Schatten entfernt hielt der schwarze Mercedes am Straßenrand. Ein Mann im dunkelblauen Anzug stieg aus. Es war Horst Adelmann. Er öffnete die linke Fondtür, zog einen dunklen Mantel vom Rücksitz und warf ihn sich über die Schultern. Erst schien er Anstalten zu machen, in Richtung des Schattens zu gehen, dann folgte er jedoch einem an der Straße beginnenden Trampelpfad in Richtung Seeufer. Adelmann passierte den Schatten in etwa 20 Metern Entfernung, überquerte einen kleinen Wall und schritt langsam den abfallenden Waldweg zum Ufer des Hubertussees hinunter. Dann blieb er stehen, sah sich flüchtig um und wartete. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, war er von vier Männern und zwei Frauen umzingelt. Die Gruppe redete auf Adelmann ein. Nach einem heftigen Disput versuchte dieser zu fliehen. Doch der kräftigste der Männer war schneller, griff sich Adelmann und drückte ihn gegen einen Kiefernstamm. Dann kam es zu einem Handgemenge. Adelmann stöhnte auf und brach zusammen. Die Gruppe schlug und trat mehrmals auf den am Boden Liegenden ein und entfernte sich dann schnell vom Tatort. Adelmann blieb am Boden liegend zurück. Allein und offensichtlich verletzt. Er sollte nur noch Minuten zu leben haben.
Der Morgen danach. Ulrike Manteuffel drehte ihren kunstledernen Chefsessel zur Seite, griff mit der Rechten nach ihrem Becher und trank bedächtig den lauwarmen Kaffee. Anschließend ließ sie den Blick zufrieden und erleichtert über den Schreibtisch schweifen. Die sonst gut bestückte, bisweilen chaotisch überladene Tischplatte bot einen ziemlich übersichtlichen Eindruck – wie jeden Freitag, wenn die aktuelle Ausgabe der Lokalzeitung „Der Nord–Berliner” frisch gedruckt und in Packen verschnürt an die Zeitungskioske ausgeliefert war. Der Freitag war für die Chefredakteurin des wöchentlich in den Berliner Nord–Bezirken Reinickendorf und Wedding erscheinenden Blattes der schönste Tag: Man trudelte erst gegen 10 Uhr 30 in den Waidmannsluster Redaktionsräumen ein, also rund eine Stunde später als sonst. Man setzte sich hinter den Schreibtisch, genoss in aller Ruhe ein Tässchen Kaffee, studierte den „NB” und die Tagespresse ausgiebig, wartete auf Reaktionen der Leserschaft und knüpfe in selten entspannter Atmosphäre den ein oder anderen telefonischen Kontakt, der in einer hektischen Produktionswoche von Montag bis Donnerstag auf der Strecke geblieben war; für die mittelfristigen Geschichten, die Hintergrundstorys, die man sich immer vorgenommen hatte, aber meistens wegen knappen Personals und der Hektik nie geschrieben wurden. Auf diese Weise wurde die Liste der Themen, über die man im Laufe eines Reporterjahres zu schreiben sich fest vorgenommen hatte, immer länger. Ulrike Manteuffel, Mitte 30, verheiratet, mittelgroß, schlank, starke Raucherin, war die zur Zeit einzige Frau im Club der Berliner Zeitungs-Chefredakteure. Für diesen Freitag hatte sie sich fest vorgenommen, sich einmal etwas gründlicher mit den Interna der Reinickendorfer SPD zu befassen. Anlass gab es genug. Sie brauchte nur auf die erste Seite ihres Hausblattes zu schauen. „Adelmann neuer SPD–Chef” titelte der NB mit der Überzeile „Hauchdünne Mehrheit für den Frohnauer Beamten”. Die SPD hatte erwartungsgemäß einen neuen Kreisvorsitzenden bekommen. Horst Adelmann, den Mann aus der Gartenstadt Frohnau. Das war nun wirklich keine Überraschung gewesen. Glaubte man dem parteiinternen Klatsch, stand der jetzt 54–jährige seit mindestens einem Jahr als neuer „Kreisfürst” fest. Überraschend an der Wahl war eigentlich nur die äußerst knappe Mehrheit, mit der Adelmann am vergangenen Sonnabend im Reinickendorfer Ernst–Reuter–Saal von der Kreisdelegiertenversammlung gewählt worden war. Das allein ließ schon genügend Raum für Spekulationen. Nun ja, dachte Manteuffel, es war ja bekannt, dass Adelmann zwar zu den gewieftesten, nicht aber zu den beliebtesten Genossen im Berliner Norden zählte. Da ließen sich sicherlich einige kleine Schweinereien aufdecken. Vielleicht würde es ihr sogar eines Tages gelingen, bis zur legendären Gruft vorzustoßen, in der Adelmann die ihm massenweise nachgesagten Kellerleichen deponiert haben musste. In diesem Moment klingelte das Telefon. Manteuffel nahm den Hörer ab, wobei sie in Gedanken noch bei dem von ihr aufzudeckenden Parteiskandal war. Am Telefon meldete sich Nadine Volkhardt, die Sekretärin des SPD–Kreisbüros. Während sie auf Manteuffel einredete, wechselten ihre Gesichtszüge von hintersinnig lächelnd zu aschfahl. „Waaaas”, rief sie mit ungewohnt spitzer Stimme ins Telefon, um gleich wieder zu verstummen und nur noch Gestotter von sich zu geben wie „Das kann doch nicht ... nein, nein ... Das glaub ich nicht ...”. Dann schüttelte sie nur noch mechanisch den Kopf, um schließlich mit resignierend–kraftloser Geste aufzulegen. Minutenlang starrte sie auf ein Poster an der Wand, das die barock anmutende Villa Borsig auf der Halbinsel Reiherwerder hinter leicht kabbeligen Fluten und bunten geblähten Segeln zeigte. Dann schüttelte sie erneut den Kopf, erhob sich langsam aus ihrem Sessel, meldete sich in der Telefonzentrale ab und griff sich ihren kleinen Fotokoffer. Was Manteuffel eben von Nadine Volkhardt erfahren hatte, war nichts weniger als eine Sensation. Es war aber auch eine Tragödie ersten Ranges, deren Tragweite ihr noch nicht bewusst war. Horst Adelmann, der frisch gekürte Kreisvorsitzende der SPD–Reinickendorf, der kommende Mann in der Berliner SPD, war tot. Ermordet.
Stunden später traf Manteuffel im SPD–Kreisbüro in Alt–Reinickendorf ein. Die Haustür stand offen, drinnen ging es zu wie im Taubenschlag. Manteuffel traf auf viele unbekannte, aber auch einige bekannte Gesichter und fragte sich zu Nadine Volkhardt durch. Sie fand die zierliche Mitfünfzigerin mit blonder Dauerwelle in der Küche, umringt von überwiegend jüngeren SPD–Mitgliedern. Die sah Manteuffel in der Küchentür, kam ihr entgegen und ließ sich von ihr umarmen. „Ulrike – gut, dass du kommst”, brachte sie heraus und drückte sich fest an sie. „Gleich wird sich die gesamte Pressemeute der Stadt auf uns stürzen. Ich hoffe, du hilfst mir ...” „Klar, Nadine. Ich wäre auch schon eher gekommen. Aber da ich selbst auch zur Pressemeute gehöre, musste ich erst mal zum Tatort fahren”, antwortete Manteuffel.
„Und?”
„Da ist natürlich der Teufel los. Die ganze Gegend rund um den Hubertussee ist weiträumig abgesperrt. Ganze Hundertschaften der Polizei sind damit beschäftigt, den Tatort abzuschirmen und das Gelände nach irgendwelchen Spuren abzusuchen. Zu sehen gibt es dort aber leider gar nichts.”
„Weißt du schon mehr über die Tat?”
„Nein. Vor Ort bekommt man von der Polizei keinerlei Auskünfte. Und wie läuft es bei euch?”
„Das Telefon klingelt permanent. Nach dem zwanzigsten Anruf innerhalb von zehn Minuten konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich sagen sollte. Es gibt auch noch keine offizielle Stellungnahme der Partei. Für solche Dinge war immer Adelmann zuständig. Seinen Stellvertreter Dr. Rellingen habe ich noch nicht erreichen können. Der macht zur Zeit auf Mallorca Urlaub.”
„Was machst du jetzt mit den Anrufen?”, fragte Manteuffel.
„Ich hab den Telefondienst an Uta Schulze abgegeben. Die ist routiniert und hat die Ruhe weg.”
In diesem Moment kam Bewegung in die kleine Kaffeeküche. In der Tür stand Hauptkommissar Jürgen Schäfer von der Wache im Erdgeschoss des Hauses. Er und Nadine Volkhardt kannten sich gut. Normalerweise duzten sie sich. Jetzt aber schlug der Uniformierte einen formellen Ton an und fragte in der Runde nach Frau Volkhardt.
„Hier bin ich, Herr Hauptkommissar”, antwortete Nadine.
„Hallo, Frau Volkhardt, kann ich sie einmal kurz sprechen?”
Nadine Volkhardt ließ Manteuffel mit einem gequälten Lächeln stehen, schob den Polizeibeamten aus der Küche und ging mit ihm in den gleich nebenan liegenden Materialraum.
„Was gibt es denn, Jürgen?”, fragte sie.
„Ich kann mir vorstellen, dass du im Moment nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Es tut mir sehr leid, aber ich bin hier im offiziellen Auftrag wegen dieser Geschichte.”
„Brauchst du irgendwelche Unterlagen?”
„Später, später vielleicht. Da meldet sich bestimmt auch noch die Fachdienststelle der Kripo. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Uta Schulze. Hilft die nicht hier im Kreisbüro aus?”
„Ja, das stimmt. Was willst du denn von ihr?”
„Es klingt jetzt vielleicht ein wenig dramatisch. Aber es heißt, sie habe eventuell etwas mit dem Fall Adelmann zu tun. Ich soll sie zu einer Befragung ins Präsidium bringen.”
„Wie, sie hat etwas mit dem Fall Adelmann zu tun? Machst du Witze, Jürgen? Das kann nicht sein. Uta ist eine junge Studentin. Ihr Vater ist SPD–Abteilungsvorsitzender in Waidmannslust. Uta arbeitet seit geraumer Zeit für mich, ist absolut zuverlässig.”
„Mag alles sein, aber ich habe meine Anordnungen. Es wird sich alles aufklären. Ist sie hier?”
„Ja, sie versucht gerade mit der Presse fertig zu werden. Aber wenn du meinst, dann hole ich sie her.” Schon war Nadine verschwunden und kam mit Uta Schulze, einer 20–jährigen, schlanken Schönheit mit pechschwarzem Haar, gekleidet mit buntem T–Shirt und Jeans, zurück.
„Sind Sie Uta Schulze?”, fragte Schäfer förmlich.
Die junge Frau nickte kurz.
„Sie müssen zu einer Befragung in Sachen Adelmann ins Polizeipräsidium. Kommen Sie bitte mit.”
Bevor sich Uta in Bewegung setzen konnte, hielt Volkhardt sie an der Schulter zurück: „Mach dir keine Sorgen. Ich rufe deinen Vater an, damit er mit einem Anwalt nachkommt.”
Uta nickte dankbar und folgte wortlos dem Uniformierten. Manteuffel hatte sich inzwischen in den Vorraum des Kreisbüros begeben, um von dort aus die Szene besser überblicken zu können. Natürlich wollte sie wissen, welcher ihrer Kollegen hier gleich eintrudeln würde. Außerdem konnte es ja sein, dass einer von den Großköpfen der Reinickendorfer SPD vorbei kam. Zunächst aber sah sie, wie der Polizeibeamte von vorhin Uta Schulze vor sich her in Richtung Ausgang schob. Das machte den Eindruck einer offiziellen Amtshandlung.
Nadine Volkhardt erschien in der Tür ihres Büros, winkte Manteuffel zu sich und schloss die Tür sofort wieder. „So, ich habe den Telefondienst erneut delegiert. Wir können reden.” Die Haltung Nadine Volkhardts nötigte Manteuffel Respekt ab. So mancher wäre in diesem Irrenhaus schon zusammengebrochen. Nadine Volkhardt aber hatte alles im Griff, selbst am Tage nach der Ermordung ihres Chefs. Manteuffel wusste auch, dass sich Nadine nicht bei jedem Pressefutzi so viel Mühe geben würde wie bei ihr. Aber die beiden verband eine jahrelange Freundschaft. Sie sahen sich auf vielen Veranstaltungen, Feiern und Empfängen und natürlich beim Friseur. Nadine hatte irgendwann Vertrauen zu Manteuffel gefasst und ihr kleine Informationshäppchen zugesteckt. Und Manteuffel hatte sich von dem Moment an regelmäßig revanchiert und sie auf dem Laufenden gehalten.
„Also, um deine erste Frage gleich abzubiegen, ich weiß nicht, was Uta mit der Sache zu tun hat. Schäfer hat mir nichts gesagt.”
„Das wäre nicht meine erste Frage gewesen. Es ist komisch. Als ich heute Morgen an meinem Schreibtisch saß, kam mir plötzlich die Idee, mich mit den Hintergründen der Adelmann–Wahl vom vergangenen Wochenende zu beschäftigen. Dafür ist es jetzt allerhöchste Zeit, denke ich. Die nackten Fakten von heute bekomme ich von der Polizeipressestelle. Aber ich glaube, es steckt eine interessante Geschichte dahinter. Vielleicht ist die Tat nur das Ende dieser Geschichte.”
„Das kann sein. Und ich will dir auch gern helfen, diese Geschichte auszugraben. Ich glaube aber, dass es eine ziemlich lange, ziemlich komplexe Geschichte ist.”
„Kannst du damit vielleicht jetzt anfangen?”
„Also, meiner Ansicht nach hat das Ganze vor etwa einem Jahr angefangen. Da ging es um die Wahl des neuen Kreisgeschäftsführers ...”
Blaulicht flackerte durch die hohen Fenster des Tagungsraumes. Mehrere Helfer standen um die mitgebrachte Trage. Zwei Sanitäter hatten sich links und rechts daneben gekniet. Einer hielt den Kopf eines Mannes hoch, während der Andere ihm eine Atemmaske überstülpte, und ein Arzt eine Vene des Mannes sucht, um ihm eine Spritze zu geben. Um die Gruppe herum stand ein Kreis von sechzehn mehr oder weniger hilflos–neugierigen Männern und Frauen. Die Szene erschien irreal. Eben noch hatten sich die Mitglieder des Reinickendorfer SPD-Kreisvorstandes geschäftsmäßig mit der Neuwahl eines Kreisgeschäftsführers beschäftigt, hatten ihre Stimmzettel abgegeben, um anschließend in Ruhe die Auszählung abzuwarten. Josef Strickler, der alternde Abteilungsvorsitzenden von Reinickendorf–West, hatte zusammen mit Nadine Volkhardt die Stimmen ausgezählt und anschließend das Ergebnis verkündet: „Genossen, ich gebe hiermit das Ergebnis der Wahl zum Kreisgeschäftsführer bekannt. Wir haben 16 abgegebene Stimmen. Auf den Genossen Klaus Albertshäuser entfielen sieben, auf die Genossin Marianne Schmidt acht Stimmen, bei einer Enthaltung. Damit stelle ich fest, dass die Genossin Schmidt gewählt ist.”
Sofort entstand ein ziemliches Stimmengewirr mit einzelnen halblauten Unmutsäußerungen. In der anschließenden Sitzungspause bildeten sich im Vorzimmer verschiedene Gesprächskreise. Der Kreisvorsitzende Manfred Krieckelstein, ein untersetzter Mann von 62 Jahren mit dichtem silbrigem Haar in einem grauen, unauffälligen Anzug, blieb dagegen am Kopf des Tisches sitzen. Den Blick auf den Ausgang gerichtet, stützte sich Volkhardt mit der Rechten gegen seine Stuhllehne. Von vorn sah es eher aus, als wolle sie den Kreisvorsitzenden stützen, der schwer angeschlagen wirkte. Minutenlang konnte Krieckelstein mit gesenktem Kopf nur vor sich auf die Tischplatte starren. Dann erst bemerkte er, dass Nadine Volkhardt nach wie vor neben ihm stand. Er warf ihr einen dankbaren Blick zu, nahm schließlich ihre Linke fest in seine Hände. „Ja, in diesem Irrenhaus bist du die einzig Verlässliche. So, wie ich mich fühle, mag sich Cäsar gefühlt haben, als ihm Brutus den Dolch zwischen die Rippen gestoßen hatte. Hier bei uns hat Brutus zwar nicht öffentlich seinen Dolch gezückt. Aber wir wissen doch alle, wer den Brutus gibt. Dabei war ich mir so sicher ...”
„Manfred, das war nur eine Schlacht, aber nicht der Krieg.”
„Lieb gemeint, Nadine. Aber wir wissen beide, dass dies das Ende meiner Parteikarriere ist. Wenn ich Glück habe und Brutus gnädig ist, gibt es für mich noch einen passablen Abschiebeposten fürs Altenteil.”
„Nun mach mal halblang, Manfred. Du tust ja gerade so, als wärst du selbst eben abgewählt worden. Dabei ging es nur um die Position des Kreisgeschäftsführers.”
„Das glaubst du doch selbst nicht. Dazu bist du schon zu lange in dieser Partei und kennst die Gesetze ganz genau. Natürlich bin ich eben abgewählt worden. Denn erstens ist der Kreisgeschäftsführer der einzige bezahlte Posten der SPD-Reinikkendorf, der nicht vom Wählervotum abhängig ist. Und zweitens war Albertshäuser mein Kandidat, der Mann, der dieses Amt zuletzt kommissarisch ausgeübt hat. Und wenn dieser Mann abgelehnt wird, heißt das nichts anderes, als dass ich als Vorschlagender in meiner Position nicht mehr über eine Mehrheit im Kreisvorstand verfüge. Das ist dasselbe wie eine Abwahl. Ich werde wohl zurücktreten müssen.”
Für Krieckelstein war die Sache erledigt. Er wollte sich nicht länger Hohn und Spott seiner Genossen aussetzen und erhob sich energisch. Doch in diesem Moment wurde er im Gesicht ganz blass und begann, nervös nach Luft zu schnappen. „Nadine, mir ist schlecht”, brachte er gerade noch hervor, bevor er zusammensackte und das Bewusstsein verlor. Wenige Minuten später war der Krankenwagen da.
„Das war der Anfang vom Ende der Ära Krieckelstein, und der Beginn der – wie wir seit heute wissen – recht kurzen Ära Adelmann”, fasste Volkhardt zusammen. „Jetzt muss ich aber wieder das Kommando im Büro übernehmen, bevor hier alles zusammenbricht.”
„Ich muss zugeben, dass ich eher verwirrter als aufgeklärter bin. Was ist - pardon: war - dieser Adelmann für einer?”
„Darüber könnte man stundenlang reden. Aber bitte nicht jetzt. Wenn du eine Hintergrundgeschichte schreiben willst, solltest du dir auf jeden Fall einige Seiten freihalten. Denn die Geschichte Adelmanns ist die Geschichte der SPD-Reinickendorf, wenn man die letzten fünf Jahre betrachtet.”
„Ich verstehe. Aber sag mir noch bitte, mit welchen Leuten ich sprechen muss.”
„Natürlich mit seiner Frau Eva. Die gehört zu den treibenden Kräften im Hintergrund. Mit seinem Intimus Hansjörg Heinrich, mit Schiederkorn, seinem einstigen Lehrer und Weggefährten. Ganz sicher mit Gessler, seinem Gegenspieler und natürlich mit Adelmanns Stellvertreter, Dr. Martin Rellingen. Da wären auch noch Jürgen Schlegel, Detlef Lesczak, Paul Hetzer und ...”
„Ist ja gut, ist ja gut. Das reicht erst mal.”
„Ich kann dir nur sagen, wenn du es machst, mach es richtig. Dann kommst du um das ein oder andere Interview nicht herum.”
„Okay, und was ist mit Uta Schulze?”
„Ja, die hat natürlich auch einschlägige Erfahrungen mit Adelmann gemacht.”
Einige Tage drückte sich Manteuffel um die unangenehme Pflicht, von der sie wusste, dass sie nicht zu umgehen war. Sie gehörte eigentlich nicht zu den Menschen, die Dinge gern vor sich her schoben, aber in diesem Fall hatte sie doch hart mit sich zu kämpfen. Schließlich gab sie sich einen Ruck und rief Eva Adelmann noch vor der Beerdingung ihres Mannes an. Sie kannte die Witwe des Opfers bislang nur aus der Entfernung. Gelegentlich hatten sie sich in der Hermsdorfer Praxis ihrer gemeinsamen Kosmetikerin getroffen. Und davor, erinnerte sich Ulrike Manteuffel, bei Verbandsspielen auf dem Hermsdorfer Tennisplatz. Erst bei dieser Gelegenheit hatte sie überhaupt erfahren, dass die Adelmann ebenfalls Tennis spielte. Natürlich bei der renommierten TV Frohnau, in der 2. Damenmannschaft. Ein paar Wochen später traf man sich erneut zufällig auf der Anlage des Hermsdorfer Sport–Clubs an der Boumannstraße, und Ulrike hatte die unverhoffte Ehre, für eine fehlende Doppelpartnerin einspringen zu dürfen. Beim anschließenden Plausch im Clubrestaurant hatte Eva Ulrike das Du angeboten. Mehr oder weniger unverbindlich verabredeten sie sich zu einem Einzel. Aber irgendwie kam es nie dazu, und Ulrike war froh darüber, denn die Adelmann spielte ziemlich gut, während Ulrike nach Meinung ihres Mannes Gerhard eher zur Kategorie „Freizeitspielerin” gehörte. Manteuffel hatte weder die Nähe der Adelmanns gesucht, noch diesen einmal geknüpften Kontakt gepflegt. Ob das journalistisch klug gewesen war, bezweifelte sie jetzt. Aber sie hatte das Gefühl gehabt, sich nicht in diese Polit– und Parteiszene hineinsaugen lassen zu dürfen, weil dabei leicht die journalistische Unbefangenheit auf der Strecke bleiben konnte. Auch Horst Adelmann hatte sie auf einem Sommerfest der SPD näher kennen gelernt. Er war ihr damals sehr schnell unsympathisch, weil er fürchterlich mit ihr zu flirten versuchte. Nun also musste es sein: Eva Adelmann. Zu ihrem Erstaunen war das Gespräch leichter als gedacht.
„Ich habe alle Interview–Wünsche abgelehnt, Frau Manteuffel. Aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme”, hatte die Witwe sie gleich ermutigt.”
„Und warum?”
”Ich kenne Sie und weiß, dass Sie keinen Unsinn schreiben. Wenn ich Ihnen Hintergrundinformationen gebe, dann nur, weil ich Ihnen vertraue.”
„Das können Sie hundertprozentig, Frau Adelmann”, versicherte Manteuffel. Daraufhin lud die Witwe Manteuffel in ihr Frohnauer Haus am Edelhofdamm ein.
Eine attraktive Frau mit halblangem, blondem Haar öffnete die Tür des stattlichen Hauses, das wohl aus den Gründerjahren Frohnaus stammen musste. Sie war mit einem schwarzen Angora–Pullover und einem grauen, halblangen Rock bekleidet. Das Schwarz ihrer Kleidung kontrastierte auf reizvolle Weise mit ihrer Haarfarbe. Zu Manteuffels Überraschung gab sich die Witwe ziemlich gefasst. Manteuffel wurde in das geräumige Wohnzimmer gebeten. An der Nordwestseite des Zimmers gab es eine Essecke vor einem großen Sprossenfenster, das auf den Vorgarten und die Straße blickte. Der Esstisch war für zwei Personen als Kaffeetafel mit weißen Stoffservietten und Meißener Porzellan gedeckt.
”Ich hoffe, Sie trinken auch so gern Kaffee wie ich. Und etwas Kuchen habe ich auch. Allerdings nur gekauften. Zum Backen habe ich im Moment nicht die Nerven.”
Nun saßen sie also zusammen am Tisch. Manteuffel versuchte so zurückhaltend wie möglich aufzutreten und hatte Schwierigkeiten, einen Anfang zu finden. ”Frau Adelmann, auch wenn es Ihnen sicherlich schwer fällt. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, Ihren Mann näher kennen zu lernen. Bitte erzählen Sie mir von ihm, von seinen Träumen, seinen politischen Zielen. Für mich ist sein Tod wahrscheinlich genauso unbegreiflich wie für Sie.”
”Sie müssen wirklich nicht drum herum reden. Sie wollen doch wissen, wie es zu dieser Tat kam. Nun, wir wissen heute, dass mein Mann seinen Mörder wohl am Hubertussee getroffen, vielleicht sogar erwartet hat. Und wir wissen, dass der Mörder mit einem Messer zugestochen hat. Ein einziger Stich mitten ins Herz; gezielt und sofort tödlich.”
”In einer politischen Partei hat man ja nicht nur Freunde”, machte Manteuffel einen neuen Anlauf.
”Das ist sehr zurückhaltend formuliert. Man könnte auch sagen, dass mein Mann von politischen Gegnern umzingelt war. Und sicher wurde er von einigen auch gehasst.”
„Sie meinen also, der Mörder Ihres Mannes ist in Parteikreisen zu suchen?”
„Etwas anderes kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.”
„Ich bewundere Ihre Direktheit. Dann sollten wir aber auch – wie Helmut Schmidt sagen würde – Butter bei die Fische tun. Nennen Sie mir bitte Namen.”
„Ulrike, ich darf Sie doch UIrike nennen?”, fragte Eva Adelmann und griff nach Manteuffels linker Hand. „Sie müssen verstehen, dass ich niemanden beschuldigen will und kann. Jemanden politisch zu hassen und ihn zu erstechen sind ja wohl auch zweierlei Dinge. Ich kann Ihnen lediglich – und das auch nicht für Ihre Zeitung – erklären, wer die Feinde meines Mannes waren. Aber es wäre zu profan, jetzt einfach eine Liste von Namen herunter zu rattern. Also lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, damit Sie sich besser in die in der Partei herrschende Atmosphäre hinein versetzen können”. Sie fischte sich mit der Gabel eine Ecke ihres Kuchenstücks. ”So, wie wir heute hier sitzen, haben vor noch nicht einmal einem Jahr mein Mann und Ralf Schiederkorn zusammen Kaffee getrunken. Ich weiß es noch wie heute. Ich hatte eigens eine besonders leckere Käsesahnetorte gebacken ...”
Z ufrieden schaute Horst Adelmann auf den Kaffeetisch, der durch das hereinfallende Sonnenlicht festlich funkelte. Eva hatte die schwere weiße Damast–Tischdecke, Meissener für zwei Personen und das Familiensilber aufgelegt und war gegangen: „Ich fahr zu Katharina. Hier störe ich doch nur”, hatte sie gesagt und ihrem Horst noch einen Abschiedskuss auf die Wange gedrückt.
Adelmann, ein gut aussehender, immer gebräunter Mitfünfziger hatte nicht geantwortet. Eigentlich hätte er seine fünfzehn Jahre jüngere Frau gern dabei gehabt. Sie war es schließlich, die mit ihrer jugendlichen Dynamik seine Karriere angeschoben hatte. Bevor er in der Partei aktiv wurde, war er einfacher Angestellter im Sozialamt gewesen, musste sich im Publikumsdienst fast täglich mit ebenso dreisten wie ordinären Leuten herumschlagen. Das einzig Gute war, dass er im Amt auch seine Eva kennen gelernt hatte.
„Du kannst viel mehr. Mach was aus dir”, hatte sie ihn angetrieben. Und er machte. Zunächst einmal heirateten sie und traten in die SPD ein. Anfangs schreckte ihn das Ganze eher. Was er bei den häufigen Treffen in den Hinterzimmern Frohnauer Kneipen vorfand, war ein müder Haufen, der stundenlang über unwichtigste Themen diskutieren konnte.
„Die brauchen Struktur und Führung”, hatte Eva kritisiert. Adelmann gehorchte. Er übernahm einen Kassierer–Job und leckte den Mitgliedern in seinem Kassierbezirk jeden Monat Beitrags–, Bildungs– und Wahlkampfmarken in die Parteibücher mit dem grünen Plastikeinband. Nachdem er ein Jahr lang bewiesen hatte, dass nie auch nur ein Pfennig an seinen Abrechnungen fehlte, war er für höhere Weihen erkoren. Der damalige Abteilungsvorsitzende Ralf Schiederkorn nahm ihn eines Tages nach einer Abteilungsversammlung am Biertresen zur Seite und fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, als sein Stellvertreter zu kandidieren: „Du weißt doch, dass Chemnitz die Brocken hingeworfen hat. Spielt die beleidigte Leberwurst, bloß weil er einmal in einer völlig unwichtigen Sachfrage den Kürzeren gezogen hat. Außerdem war der sowieso von der falschen Fraktion. Dass er mir bei den letzten Wahlen unterlegen war, hat der nie richtig verwunden. Bis zu den nächsten Parteiwahlen sind es noch fast zwei Jahre. Solange kann ich hier nicht ohne Vertreter arbeiten.”
„Was soll das heißen, die falsche Fraktion?”
„Nun bist du schon eine ganze Weile in der Partei und weißt immer noch nicht, dass es bei uns verschiedene Glaubensrichtungen gibt? Dann wird es aber Zeit, dass du mal aufgeklärt wirst, lieber Horst”, schmunzelte Schiederkorn. „Am Besten, ich schicke dich auf eine Schulung unseres Ernst–Reuter–Kreises. Ich darf doch wohl annehmen, dass du von deinen Anschauungen her keine von diesen linken Ratten bist”.
„Ach so meinst du das. Klar, auf mich kannst du dich verlassen. Aber warum sollten die Leute mich wählen?”
„Ganz einfach, weil ich dich vorschlage”, antwortete Schiederkorn lachend. Er sollte Recht behalten. Ohne nennenswerte Gegenstimmen wurde Horst Adelmann zum stellvertretenden Abteilungsvorsitzenden gewählt. Im Jahr darauf musste Schiederkorn beruflich für längere Zeit in die USA und räumte seinen Posten. Auf seiner letzten Abteilungsversammlung schlug der scheidende Vorsitzende Adelmann als Nachfolger vor: „Liebe Genossen”, hatte er seine kurze Abschiedsrede beendet. „Ich will den Parteiwahlen nicht vorgreifen, die ja bekanntlich in diesem Jahr anstehen. Wir Frohnauer haben immer einen ruhigen Kurs gesteuert, ohne diese Zickereien zwischen den Flügeln. Ich denke, damit sind wir gut gefahren. Wir haben uns den Sachthemen für den Bürger zugewandt, während andere Parteiarbeit so verstanden haben, sich mit viel Lust und Engagement gegenseitig zu zerfleischen. Ich hoffe, liebe Genossen, dass diese gute Tradition auch in Zukunft erhalten bleibt. Um die Kontinuität zu wahren, möchte ich euch Horst Adelmann als Kandidaten für meine Nachfolge vorschlagen. Er hat im zurückliegenden Jahr als mein Stellvertreter bewiesen, dass er es versteht, mit viel Fleiß zum Wohle von Partei und Bürger zu arbeiten.”
Die Worte und der anschießende Applaus klangen ihm noch Jahre später im Ohr. Seine Wahl war glatt über die Bühne gegangen. Eva konnte zufrieden sein. Sie besaß einige für die Parteiarbeit höchst wertvolle Eigenschaften. Zum Beispiel konnte sie total festgefahrene Verhandlungen durch einen auflockernden Spruch an der richtigen Stelle wieder in Gang bringen und zum Erfolg führen. Sie konnte aber auch genau das Gegenteil bewirken, nämlich einen ihr unsympathischen Menschen mit einer spitzen Bemerkung völlig und unvermittelt aus der Fassung bringen.
Noch ganz in Gedanken versunken, riss ihn ein Klingeln wieder in die Realität zurück. Betont langsam öffnete er die Tür zum Flur, trat an die Haustür und schaute durch den Spion. Es war Schiederkorn. Er setzte seine freundlichste Miene auf und öffnete: „Mensch Ralf, alter Junge. Komm rein”, rief er und streckte dem Gast seine Rechte entgegen.
„Ein wunderschönes Haus habt ihr inzwischen. Oder sollte ich sagen, eine Villa?”, antwortete Schiederkorn, den Kopf leicht schief haltend, so dass sich sein sonst schlabberiges Doppelkinn straffte und schräge Falten warf. „Ich kann mich noch an eure kleine Mansardenwohnung erinnern, wo sich Eva immer auf der Couch räkelte, während wir am Küchentisch die Zukunft Berlins planten.”
„Komm, ich nehme dir den Mantel ab. Hier rechts geht es zur Kaffeetafel”, zeigte Adelmann den Weg aus dem Flur. Als der Gastgeber folgte, hatte sich Schiederkorn schon mit einem angestrengten Schnaufen in einem Sessel niedergelassen. „Gut siehst du aus, Ralf.”
”Das ist ja auch kein Wunder. In den acht Wochen seit meiner Rückkehr bin ich von einer Party zur nächsten herum gereicht worden, bis ich endlich auch einen Termin beim grossen Vorsitzenden bekommen habe.”
„Es tut mir leid, Ralf. Kein böser Wille, aber die Parteiwahlen stehen vor der Tür. Und diesmal wird es wohl nicht mehr so ruhig zugehen, wie noch zu deinen Zeiten.”
„Was heißt hier, meine Zeiten? Das hört sich so an, als wäre ich ein alter Sack und gehörte schon auf die Müllhalde der Geschichte. Erinnere dich bitte mal, dass ich sogar einige Lenze weniger auf dem Buckel habe als du.”
„So habe ich das doch nicht gemeint. Das waren noch Zeiten, als wir beide diese Abteilung geführt haben. Keiner hat dazwischen gefunkt, niemand hat gewagt, uns anzupinkeln. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ich vermute mal, dass du in den USA auch Nachrichten aus der Heimat empfangen konntest und die Bilder von diesen dauernden Demonstrationen kennst. Das fing ja schon an, als du selbst noch Vorsitzender warst. Aber bis Frohnau war das damals nie durchgeschlagen. Wir saßen doch hier noch auf der Insel der Glückseligen.”
„Ist mir schon alles klar. Du meinst also, die Parteilinken spielen verrückt. Aber seit wann gibt es die in Frohnau?”
„Na ja, das ist alles etwas diffus. Woher weiß man, wer ein Linker ist und wer nicht?”, stellte Adelmann die Gegenfrage.
„Man weiß es in dem Moment, wenn die Delegiertenlisten auf den Tisch kommen. Diejenigen, die nicht auf deiner Liste stehen – das sind die Linken.”
„So einfach ist das?”, fragte Adelmann grinsend.
„Genau so einfach ist das.”
„Im Moment gibt es vor allem Gerüchte über mögliche Kandidaturen. Die Linke auf Kreisebene jedenfalls gibt mächtig Gas. Du weißt vielleicht, dass die letzten Parteiwahlen schon recht knapp ausgegangen sind. Inzwischen ist unsere Mehrheit im Kreisvorstand schwer abgebröckelt. Da fehlt nicht mehr viel, und die Mehrheit kippt.”
Jetzt erst fiel Adelmann auf, dass die ganze Kaffeetafel noch unberührt vor ihnen stand. „Ralf, jetzt nimm erst mal ein Stück Kuchen. Ich hol inzwischen den Kaffee.” Schiederkorn schnappte sich den vorbildlich geputzten Tortenheber aus Sterlingsilber und schob ihn zielsicher unter ein Stück Käse-Sahne. Adelmann kam mit einer Glaskanne zurück und goss den Kaffee in die hohe Porzellankanne mit dem Zwiebelmuster. „Erbstück von meiner Schwiegermutter, genau wie das Haus.” Adelmann senkte kurz die Stimme: „Evas Mutter ist letztes Jahr an Krebs gestorben.”
„Das tut mir Leid. Und du hast ja sogar an Schlagsahne gedacht. Davon nehme ich auch einen kleinen Löffel für den Kaffee. Danke. Und ich habe gehört”, fuhr Schiederkorn fort, „dass du Ambitionen auf den Kreisvorsitz hast. Du willst also zu einem von zwölf Kreisfürsten Berlins aufsteigen. Da oben ist die Luft aber ziemlich dünn.”
„Ich sehe schon, du bist so gut informiert wie eh und je. Offensichtlich hast du die letzten acht Wochen nicht nur auf Partys verbracht.”
„Doch, doch, eben gerade. Man muss nur auf die richtige Party gehen. Da gibt es nicht nur knackige Hintern zu tätscheln, sondern auch die heißesten Neuigkeiten zu hören. Apropos Kreisvorsitzender: ich habe gehört, Krieckelstein hat einen Herzinfarkt erlitten. Wie geht es dem alten Kämpen?”
„Ach was, Herzinfarkt. Es war nur eine Kreislaufschwäche. Solche Sachen werden immer so aufgebauscht. Es hat ihn wohl ein wenig aus den Socken gehauen, dass sein Kandidat nicht zum Kreisgeschäftsführer gewählt worden ist.”
„Dafür hat es aber deine Kandidatin geschafft. Ich sehe schon, hier wird der rote Teppich für den neuen König von Reinickendorf ausgerollt.”
„Also, das mit dem Kreisvorsitz ist bislang nicht mehr als ein Gerücht. Aber immerhin zeigt der Vorfall mit Krieckelstein doch, dass der seinen Laden nicht mehr im Griff hat. Er ist zu alt, körperlich offensichtlich nicht in bester Verfassung. Vor allem ist er viel zu gutmütig gegenüber den Linken. Die nutzen solche Schwächen gnadenlos aus. Das reicht von der Solidaritätsadresse für die Palästinenser bis zur Forderung nach völkerrechtlicher Anerkennung der DDR. Bislang konnten wir durch Verfahrenstricks noch das Schlimmste verhindern. Aber stell dir mal vor, wie das in der Presse wirken würde. Der Kreisvorstand der Reinickendorfer SPD spricht sich für die völkerrechtliche Anerkennung der DDR aus.”
„Du meinst also, es wird Zeit zum Handeln?”
„Höchste Zeit”, erwiderte Adelmann mit Nachdruck.
„Es herrscht Krieg. Und wenn wir jetzt nichts tun, werden wir untergehen.”
„Das klingt spannend”, antwortete Schiederkorn und schaute ihn von der Seite mit einem süffisanten Lächeln an. „Für so einen Kampf muss man gewappnet sein – mit reichlich Munition und natürlich guten Leuten. Ich wollte dir heute sagen, dass ich wieder da und zu allen Schandtaten bereit bin.”
„Nun, Ralf, ich freue mich darüber. Versprechen kann ich dir allerdings nichts. Es gibt immerhin schon eine vorläufige interne Liste auf Kreisebene”, antwortete Adelmann.
„Du wirst das schon hinkriegen. Da bin ich ganz optimistisch.” Mit diesen Worten erhob sich Schiederkorn und klopfte Adelmann gönnerhaft auf die Schulter. „Ich muss jetzt los, habe noch einen Termin mit Senatsdirektor Rüssen.”
„Dass sich das lohnt, wage ich zu bezweifeln”, antwortete Adelmann unvermittelt bissig.
„Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Adelmann, bildete dieser Schiederkorn mit seinem Auftauchen – oder besser Wiederauftauchen – eine Art Störfaktor für die bestehende Harmonie innerhalb der Partei. Wie ist Ihr Mann denn damit umgegangen, und welche Rolle spielte dieser Rüssen dabei?”, hakte Manteuffel nach.
„Nun, ich weiß nicht, ob Sie die Gedankenmuster eines nicht unbedeutenden Parteifunktionärs nachvollziehen können. Es gibt so vieles zu bedenken, wenn man für die SPD arbeitet ...”
Schiederkorn war also zurück. Aber niemand hatte gewusst, was er plante. Immerhin, er hatte Kontakt zu Senatsdirektor Volker Rüssen aufgenommen. Rüssen sollte ihm wo möglich bei der Suche nach einem gut dotierten Job behilflich sein, falls Schiederkorn nicht wieder in die Anwaltskanzlei eintrat, die einst sein Vater geleitet hatte. Adelmann kannte Rüssen, aber er wusste nicht, wie eng dieser mit Schiederkorn stand. Einen Moment lang spielte er mit dem Gedanken, Rüssen anzurufen. Dann aber ließ er den Gedanken wieder fallen. Rüssen kam aus Steglitz. Und Steglitz war rechts, aber trotzdem mochte Adelmann die Steglitzer Führung nicht. Unter denen gab es Rüpel, die sich rücksichtslos auf jeden Posten stürzten, der irgendwo zu kriegen war. Die in Steglitz hielten sich sowieso für sozialdemokratisches Kernland – aus welchem unerfindlichen Grund auch immer. Hinter Rüssen, das wusste Adelmann, stand der Oberrüpel Joachim Zuchtmeister. Nomen est omen. Nach zuverlässigen innerparteilichen Quellen hatte sich Zuchtmeister sein Abgeordnetenmandat per Telefonterror gesichert. Er hatte einst seine Wahlkreis–Konkurrentin um das Mandat im Berliner Parlament mit nächtlichen Anrufen so lange bearbeitet, bis diese kurz vor der entscheidenden Parteiwahl entnervt aufgab. Der Rest war dann nur noch Formsache. Wegen der kurzfristigen Absage konnte die Linke keinen aussichtsreichen Ersatzkandidaten mehr auf den Schild heben. Die Nominierung Zuchtmeisters durch die Partei lief ebenso glatt ab wie die anschließende Abstimmung, denn Zuchtmeister kandidierte in einem sicheren Wahlkreis. Seit diesem Coup saß der Mann fest im Sattel und wurde auch bald darauf Chef des SPD–Kreises Steglitz, erinnerte sich Adelmann. Manchmal war ihm der Kampf innerhalb der Partei widerlich, das Gebuhle und Gezerre zu primitiv, um sich einzumischen. Anfangs kam er mit der hemdsärmeligen Art einiger Genossen überhaupt nicht zurecht. Doch schnell wurde ihm klar, dass mit Schüchternheit kein Blumentopf zu gewinnen war. Zurückhaltung wurde als Schwäche ausgelegt oder kurzerhand und dreist als Zustimmung gewertet.
Wer sich den Luxus einer eigenen Meinung erlauben wollte und diese möglichst auch noch durchzusetzen gedachte, musste die Klappe aufreißen, musste Mitstreiter finden, Bündnisse schmieden und meistens auch noch hinter dem Vorhang dezent nachhelfen. Die kleinen und großen Spielregeln hatte auch Adelmann lernen müssen. Er tat es, und zwar schneller und gründlicher, als es einigen seiner Parteifreunde lieb war. Die SPD, das war jetzt seine Partei, sein Zuhause. Hatte es ihn anfangs eher erschreckt, mit diesen vielen unterschiedlichen Menschen reden und umgehen zu müssen, so hatte er inzwischen im wahrsten Sinne des Wortes den Bogen raus. Den meisten Parteimitgliedern gegenüber fühlte er sich überlegen. Das Ganze hatte etwas von einer Hundedressur. Der eine möchte gekrault werden. Ein anderer war nur aufs Fressen aus. Andere ließen sich von Trieben leiten, wieder andere brauchten gelegentlich die Peitsche, damit sie weiter funktionierten. Inzwischen machte es einfach Spaß, neue Genossen kennen zu lernen und herauszufinden, in welche Kategorie sie einzuordnen waren. Seine Diagnosen waren schnell und präzise. Und lagen diese erst vor, war die Behandlung ein Kinderspiel. Sein Spiel!
Und jetzt wollte also Schiederkorn wieder mitmachen. Adelmann schien plötzlich einen leichten Schmerz an einem Schneidezahn zu spüren. Genau genommen, war er der politische Ziehsohn von Schiederkorn. Und das bedeutete, dass man mit ihm durch dick und dünn zu gehen hatte. Das war eigentlich Gesetz. Für Schiederkorn musste gut gesorgt werden. Adelmann wusste genau, was für die Partei gut, und was schlecht war. Man konnte sich drehen und wenden wie man wollte: Schiederkorn war zu diesem Zeitpunkt einfach fehl am Platz. So schön hatten die Genossen alles ausgedacht, so schöne Listen gemacht und verhandelt. Mit viel Mühe, Schweiß und unzähligen Gläsern Bier auf Marathonsitzungen in verräucherten Hinterzimmern hatte man am Ende ein für alle Beteiligten tragfähiges Ergebnis erreicht. Das Strickmuster lautete: zwei rechts, eins links, eine Frau; die großen Abteilungen und die wichtigsten Arbeitsgemeinschaften wie Gewerkschaften, AWO–Rentner und Selbstständige bedacht. Daraus wurde eine dichte, komplizierte, aber sehr ausgewogene Liste von Kandidaten für den nächsten Kreisvorstand sowie die Landesparteitagsdelegierten gestrickt. Diesmal waren die Machtverhältnisse in der Kreisdelegiertenversammlung, kurz „KDV”, umso wichtiger, als die Kreisdelegierten im kommenden Jahr auch über die SPD–Kandidaten für die Bezirksverordnetenversammlung, das Bezirksamt, sowie die Wahlkreiskandidaten zum Abgeordnetenhaus zu entscheiden haben würden.
Natürlich hatte Adelmanns Truppe der Linken auch ein paar Konzessionen machen müssen. Die Liste stellte ein sensibel ausbalanciertes Gleichgewicht dar. Die Linke kriegt den Stellvertreter und findet sich mit der rechten Mehrheit im Kreisvorstand ab. Das war ausgemacht. Das war ein wunderbares Geschäft, wenn man bedachte, dass die Linke an der Basis sogar die Mehrheit erobern konnte. Alles war in bester Ordnung gewesen – bis heute.
M it der Vorstellung, eine kurze Parteigeschichte des Horst Adelmann notieren und das Thema abhaken zu können, war Manteuffel zu Eva Adelmann gefahren. Nun wusste sie, dass die Sache nicht so einfach war. Sie musste sich eingestehen, dass das Gespräch mit der Witwe sie eher verwirrt hatte. Zu kompliziert, zu – ja: unnormal – im Vergleich zum „echten” Leben schienen ihr nun diese ganzen Vorgänge innerhalb der Partei zu sein. Plötzlich kam sich Ulrike Manteuffel geradezu naiv vor, sich auf ein solches Vorhaben eingelassen zu haben. Und vielleicht auch noch geglaubt zu haben, einer staunenden Öffentlichkeit durch ihr Geschreibsel demnächst den Mörder auf einem Silbertablett liefern zu können. Manteuffel ahnte, dass sie bislang gerade einmal an der Oberfläche gekratzt hatte. Allerdings war es nicht ihre Art, die Flinte schnell ins Korn zu werfen. Im Gegenteil. Der ganze Nebel, der über dieser Geschichte zu liegen schien, stachelte ihren Ehrgeiz an. Jetzt wollte sie es wissen, den Nebel durchdringen und Klarheit schaffen. Zumal die Polizei und die mediale Konkurrenz auch nur mit Wasser kochten. Jeder Hinweis, jedes Indiz konnte in dieser Situation von Bedeutung sein. Was war zum Beispiel von einer Frau zu halten, die so gar nicht den üblichen Klischees einer trauernden Witwe entsprechen wollte. Ruhig und gelassen hatte sie sich im Gespräch gegeben, von tiefer Trauer keine Spur. Immerhin hatte ihr das Gespräch neue Anknüpfungspunkte gegeben. Einer war der Genosse Hansjörg Heinrich. Der war jetzt für ein Interview fällig. Eva Adelmann hatte den stellvertretenden Abteilungsvorsitzenden von Borsigwalde als „Intimus” ihres Mannes bezeichnet. Andere Parteifunktionäre hatten diese Einschätzung Manteuffel gegenüber mehr oder weniger nachdrücklich bestätigt. Bislang wusste Manteuffel jedoch sehr wenig über diesen Heinrich. Sicherlich hatte sie ihn des öfteren auf Kreisdelegiertenversammlungen gesehen, vielleicht auch mal ein paar Worte mit ihm gewechselt. Aber der Mann wirkte immer blass und zurückhaltend. Das waren in einer Partei wenig gefragte Eigenschaften, wenn man politische Karriere machen wollte. Heinrich also war offensichtlich von Manteuffel unterschätzt worden, musste sich die Journalistin jetzt eingestehen. Er war anscheinend von vielen unterschätzt worden. Bei der Polizei galt er als wichtiger Zeuge. Aber der Mann war nicht auffindbar, er war wie vom Erdboden verschluckt. Gab es dafür eine harmlose Erklärung? War er vielleicht nur – wie Dr. Rellingen – in den Urlaub gefahren? Dagegen sprach, das in der Partei durchsickernde Gerücht, Heinrich habe sich am Abend der Tat mit Adelmann treffen wollen. Vielleicht am Hubertussee? Wie auch immer, Manteuffel musste sich zunächst mit anderen Informanten begnügen. Angefangen bei Adelmanns innerparteilichen Gegnern, den Linken. Da gab es deren Chef Berthold Gessler, ein mäßig intelligenter, biederer Kleinbürger, den sich Manteuffel partout nicht als Mörder vorstellen konnte. Aber es existierte ein Spannungsfeld zwischen ihm und Adelmann, denn Adelmann hatte es in den vergangenen Jahren geschafft, sich zum Buhmann und Hassobjekt dieser Fraktion aufzubauen. Es galt also, Gessler ein wenig in die Mangel zu nehmen. Der hatte sich bei Manteuffels erster Interview–Anfrage geziert, und das war ihr ganz recht gewesen. Denn sie wusste wenig von Gessler, wollte ihn lieber einkreisen, Informationen sammeln, um ihn dann besser aus der Reserve locken zu können. Den Gessler schnappe ich mir, wenn der am wenigsten an mich denkt. Überraschungseffekt nennt man so etwas. Zunächst einmal waren die Hilfstruppen Gesslers dran. Die Kandidaten hießen Jürgen Schlegel, Frohnauer Juso–Vorsitzender, und sein neuer Kumpel Andreas Karthaus, beide FU–Studenten ...
Andreas streifte durch eine dieser stillen, gekrümmten, von Büschen und Bäumen der liebevoll gepflegten Privatgärten teils überwucherten Frohnauer Straßen. Sein Ziel war eine bestimmte Adresse im Horandweg. Er hatte beschlossen, seinen neuen Bekannten Jürgen Schlegel zu besuchen. Schließlich waren sie ja nicht nur Kommilitonen, sondern auch noch Frohnauer, wie sie zum gegenseitigen Erstaunen bei einem zufälligen Gespräch auf einem Flur in der FU–Rostlaube festgestellt hatten. Wie war es eigentlich möglich, einen Frohnauer etwa gleichen Alters über Jahre nicht kennen gelernt zu haben?, fragte sich Andreas. Natürlich, Frohnau ist zwar so etwas wie ein Dorf innerhalb der großen Stadt. Aber mit seinen vielleicht 18.000 Einwohnern doch mehr als ein kleiner Marktflecken. Immerhin gab es drei Grundschulen, so dass man sich mit etwas Glück – oder Pech – im Grundschulalter nicht begegnete. Nein, dachte Andreas, die richtige Antwort konnte nur lauten, dass Jürgen Zugereister war. Seine Eltern müssen ihn eines Tages gepackt haben, um sich aus irgend einer Provinz loszueisen. Denn Provinz war aus Sicht der Berliner alles, was in Westdeutschland lag. Dort gab es reichlich Gegenden, wo man mit einem B–Kennzeichen am Auto schon mal gefragt wurde, ob man aus West– oder Ost–Berlin käme. Auch aus Frohnauer Sicht war das ein Unding, denn schließlich verstand man sich doch als vornehmen Teil der nach wie vor einzigen und wahren deutschen Hauptstadt.
Jürgen ist sicher erst frisch in der Stadt und wird dann als erstes an dieser chaotischen Uni, an der man gerade erfährt, wo man vor einer Stunde an einem Seminar hätte teilnehmen sollen, diesem rädelsführerischen Pack orthodoxer Kommunisten und pseudolinker Steinzeitfaschisten ausgesetzt. Gedankenverloren prallte Andreas beinahe gegen ein ziemlich heruntergekommen wirkendes Fahrzeug, das quer zum Gehweg aufgebockt war. Darunter schauten zwei Beine hervor, die in einer ölverschmierten, fadenscheinigen Hose steckten. „Ist das hier eine neue Art zu parken, oder verlangen Sie Wegzoll”, zeterte Andreas. Langsam robbte sich die zu den Beinen gehörende Person unter dem Wagen frei. Unterarme ölverschmiert, Oberarme von ähnlich verdreckten aufgekrempelten Ärmeln bedeckt, Gesicht und Blondhaar unter einem dicken Schmierfilm nur schwer identifizierbar.
„Das ist ja toll, dass du jetzt kommst, Andreas. Du kannst hier gleich mal helfen.” Erst die Stimme verriet Andreas, dass es sich nur um Jürgen handeln konnte.
„Also, ehrlich gesagt ist das nicht meine Welt. Ich glaube sogar, eines der wichtigsten Motive für mein Studium war es, sich nicht berufsbedingt im Dreck suhlen zu müssen”, gab Andreas amüsiert zurück und reckte seine Arme ruckartig über den Kopf, als Jürgen ihm gerade die Hand geben wollte. „So, so, proletarisch verschmierte Pfoten und bürgerliche Manieren von sich weisen, aber in beruflicher Hinsicht wie ein Vollspießer argumentieren – das haben wir gerne. Aber keine Angst, ich wollte dich jetzt nicht zu einem gemütlichen Ölwechsel einladen. Doch ich gehe davon aus, dass du schon mal in einem Auto gesessen hast und Kupplungs– von Brems– und Gaspedal unterscheiden kannst.”
„Also, den Führerschein habe ich noch geschafft, trotz intensiven Studiums des Marxismus–Leninismus”, grinste Andreas. „Na, dann schieb mal deinen dicken Hintern auf den Fahrersitz. Wir müssen probieren, ob das neue Getriebe in dem kleinen Renner funktioniert. Der Einbau war 'ne Sauarbeit.” Andreas wanderte mit gespieltem Interesse um den offensichtlich einst froschgrünen Wagen, der an zahlreichen Stellen hässlich braune und graue Grundierungsstellen aufwies. „Kleiner Renner? Für mich sieht das Gerät einem Fiat 500 verdammt ähnlich. Und bei allem verständlichen Besitzerstolz weiß sogar ich, dass ein Fiat 500 die lahmste Krücke zwischen hier und Zwickau ist. Und Zwickau ist die Stadt, wo vom Kapitalismus befreite Arbeiter in sozialistischer Präzisionsarbeit den legendären Trabant produzieren.”
„Sag mal, Andreas. Hat dir vielleicht irgend jemand auf dem Weg von der Uni zu mir ins Gehirn geschissen?”, erwiderte Schlegel ziemlich aufgebracht. „Das hier ist kein Fiat 500, sondern ein Steyr Puch 650 TR, von mir und meinem Bruder zu einem konkurrenzfähigen Rallye–Fahrzeug aufgemotzt. Der bringt es bei seinen rund 500 Kilo auf über 40 PS oder noch mehr. Du kannst mir glauben. Der geht ab wie Schmidts Katze, da legst du die Ohren an. Du kannst gern mal eine Probefahrt machen.”
„Ach weißt du, ich hab gerade meinen Sturzhelm nicht dabei. Wo, sagtest du, soll ich drauf drücken?” Andreas öffnete die Fahrertür und war im Begriff einzusteigen. „Was ist das denn? Soll das ein Autositz sein oder doch eher der Schleudersitz aus einer Apollo–Kapsel?”
„Schon klar, dass du noch nie einen Schalensitz gesehen hast. Aber keine Angst, du musst jetzt keine Gebrauchsanweisung lesen, und schleudern tut das Gerät auch nicht, solange du die Finger vom Zündschlüssel lässt. Schieb einfach deinen Arsch da rein. Auch die Gurte brauchen wir jetzt nicht. Aber wenn ich „jetzt” rufe, dann trittst du das Kupplungspedal langsam ganz durch. Das Kupplungspedal ist unten im Fußraum dieser linke Hebel dort. Und der wird mit dem Fuß, am Besten dem linken Fuß, bedient.”
„Danke für diese umfassende Einführung in die Geheimnisse des Kraftwagens. Aber bei dem Opel Rekord meiner Eltern geht das genau so.”
„So, so. Ich verkneif mir jetzt mal den Spruch mit dem Popel.” „Hätte mich überhaupt nicht getroffen. Ich brauche den Wagen weder für Männlichkeitsrituale, noch will ich damit irgend welche billigen Messing–Pokale abstauben. Aber selbst in dieser Stadt gibt es Ecken, die man weder mit der BVG noch mit der S–Bahn erreicht.”
Jürgen blieb einen Moment wie erstarrt stehen, öffnete den Mund in gespielter Empörung und schaute Andreas mit großen Augen an. „Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du zu den miesen Typen gehörst, die Ulbrichts Stacheldraht finanzieren?”
Verlegen scharrte Andreas mit dem Fuß im Sand des Bürgersteigs, um schließlich einzuräumen, dass er tatsächlich die S–Bahn benutzte. „Du weißt doch selbst, wie weit es von Frohnau zur FU nach Dahlem ist. Soll ich vielleicht mit dem Zwölfer eine dreiviertel Stunde bis zum Leo zuckeln, dann mit der U 9 bis Spichernstraße und dort Richtung Krumme Lanke umsteigen? Ulbricht hin, Stacheldraht her. Ich gehe ein paar Minuten bis zum Bahnhof Frohnau, steige ein und nach vielleicht fünfzig Minuten in Lichterfelde–West wieder aus. Dann hab ich nur noch zehn Minuten Fußweg.”
„Und bei einem Zwischenstopp in Friedrichstraße holst du dann Fluppen und Scharlachberg aus dem Intershop und verkaufst das Zeug an die Kommilitonen, was?”, ergänzte Jürgen mit wissendem Lächeln. „Ich gebe zu, es ist manchmal echt praktisch, mit der S–Bahn zu fahren. Aber eigentlich darf man sich solch sozialistischen Luxus bei uns nicht erlauben”. „Warum solltest du dir den Luxus zügigen Fortkommens in der Stadt nicht erlauben können? Nur weil du ein Juso bist?”
„Wenn man in der SPD was werden will, sollte man sich von linientreuen Genossen nicht beim S–Bahnfahren erwischen lassen. Das musst du bedenken, wenn du bei uns mitmachen willst. Denn da gibt es leider in unserem Verein noch viele Uneinsichtige, die glatt behaupten, dass wir mit S–Bahnfahren den Stacheldraht für Ulbrichts Stein gewordene Abgrenzungspolitik bezahlen – was natürlich völliger Quatsch ist. Schon deshalb Quatsch, weil seriöse Verkehrswissenschaftler nachgewiesen haben, dass der S–Bahnbetrieb in West–Berlin der DDR ausschließlich Verluste einbringt und nur aus politischen Gründen aufrecht erhalten wird,” erklärte Jürgen.
„Du strebst also auch noch eine große Parteikarriere an. Wie ist das doch in glorreichen Zeiten einmal formuliert worden: Und ich beschloss, Politiker zu werden”, konterte Andreas.
„Das finde ich jetzt völlig bescheuert. Du solltest schließlich wissen, dass uns Sozialisten die Zukunft gehört. So jedenfalls kann man es diesseits und jenseits des antifaschistischen Schutzwalls allenthalben hören und lesen.”
„Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt, nicht wahr? Aber S–Bahnfahren ist verboten!”, hakte Andreas nach. „Was wird denn noch alles verlangt? Sicherlich muss man ordentlich und sauber gekleidet sein. Sonnabends vor der Sportschau baden, oder? Und da soll ich eintreten?”
„Über dieses Thema sollten wir vielleicht ein anderes Mal weiter reden. Im Moment brennt mir dieses Scheiß–Getriebe ein bisschen auf den Nägeln. Am Wochenende steht nämlich ein Rennen an, und ich möchte ungern das Startgeld verfallen lassen. Und übrigens fahr ruhig weiter mit der S–Bahn. Ich fahre ja auch gern Holzklasse. Aber bitte nicht weitersagen.”
D ieser Schlegel ist nichts anderes als ein leicht idealistisch angehauchter Sozialromantiker, dachte Ulrike Manteuffel. Solche Typen muss es in der SPD wohl auch geben. Der hat mir ja geradezu sein Herz ausgeschüttet. Klingt nicht nach eiskaltem Mörder. Dazu noch sein S–Bahn–Spleen. Spleens können bisweilen schicksalhaft sein ...
Jürgen Schlegel saß im hintersten Waggon eines S–Bahnzuges nach Wannsee, über Gesundbrunnen, Friedrichstraße, Schöneberg und versuchte, das mit hellen Glasurziegeln verkleidete Diensthäuschen auf dem Bahnhof Frohnau ins Blickfeld zu bekommen. Dazu musste er die linke Gesichtshälfte an die schmutzige Scheibe drücken. Die Stille schien nun schon eine Ewigkeit zu herrschen. Dabei saß er erst seit etwa drei Minuten in einem dieser urigen, mindestens 40 Jahre alten Waggons mit ihren wunderbaren bequemen hellen Lattenholzbänken, die bei Sonnenschein wie von Gold überzogen schimmerten. Noch war der Zugabfertiger in seiner blassblauen Uniform nicht aus dem Häuschen getreten. Vielleicht, dachte er, sitzen gerade zehn Menschen in diesem Halbzug. Manchmal waren einige der Fahrgäste auch innerhalb des Zuges zu hören aber praktisch nie zu sehen, weil es sich jeder von ihnen in seinem kleinen, von hellhölzernen Trennwänden abgeteilten Separee gemütlich gemacht hatte. In der Eisenbahnersprache gab es außerdem Viertel–, Dreiviertel– und Vollzüge. Vollzüge auf dem Vollring, das klang so kraftvoll wie Vollmilch, Vollbad oder volle Pulle, dachte Schlegel. Vollzüge auf dem Vollring, die hatte es wirklich gegeben. Das war fast vor seiner Zeit, jedenfalls vor der Zeit, an die er sich bis in solche sprachlichen Details zurück erinnern konnte. Vollring, das wusste Schlegel nur von alten Bildern, konnte man damals auf den Zielschildern der Ringbahnzüge lesen, die in rund einer Stunde wie Satelliten um das Zentrum Berlins gekreist waren. Gesundbrunnen, Ostkreuz, Papestraße, Westkreuz, Gesundbrunnen. Was war jetzt noch davon übrig geblieben? Reste, die er in Gesundbrunnen betrauern konnte. Ocker–rote Züge, die am Ringbahnsteig hielten, wenige Fahrgäste ausspuckten, dann müde einige Meter weiter Richtung Osten schlichen, in Höhe des Stellwerks kehrten und in gleichem Tempo an die andere Bahnsteigkante rollten. Zwischen Nordbahn– und Ringbahnsteig waren weitere Gleise und Bahnsteige aus einer Zeit angeordnet, die Schlegel als großes Chaos und Gewimmel in Erinnerung hatte. Das war die Zeit, als er die Hand seiner Mutter immer ganz fest drückte, wenn sie am Gesundbrunnen ausstiegen. Menschenmassen schoben sich damals scheinbar ziellos hin und her, und man musste gewaltig aufpassen, um in dem Trubel nicht unterzugehen. Jetzt wucherte zwischen den Bahnsteigen eine immer dichter werdende grüne Wand von Unkraut, jungen Birken und Büschen, die seiner Meinung nach auf einem Bahngelände nichts zu suchen hatte.





























