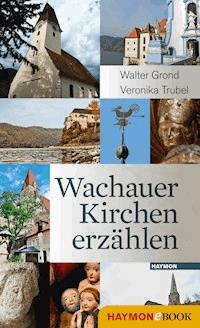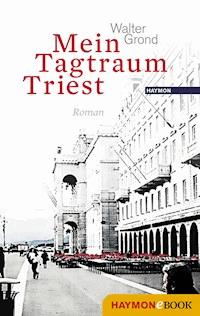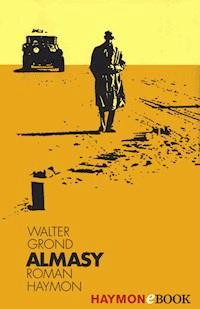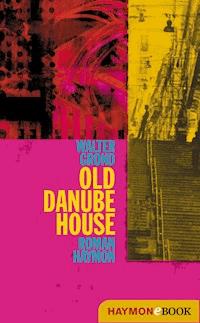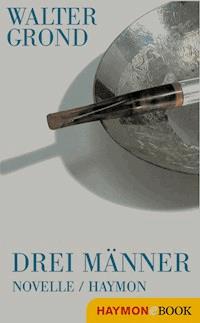Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was hält den pathologischen Horizont unserer Gegenwart zusammen? Wieso funktioniert unsere Gesellschaft anscheinend so reibungslos, obwohl ihre Basis längst weggebrochen ist? Walter Grond stellt keine geringere Frage als die, wie unsere Welt am Beginn des 21. Jahrhunderts funktioniert - und führt statt einer einfachen Antwort tief hinein in den Großstadtdschungel zwischen Orient und Okzident, wo Menschen und Kulturen sich begegnen und verlieren, wo Ideen und Identitäten, Geschichten und Erinnerungen aufblitzen und verglühen, wo alles verbunden ist und doch jedes Leben für sich steht: Der Journalist Paul Clement bereitet sich auf eine Reise vor, die ihn auf den Spuren Gustave Flauberts durch Ägypten führen soll, als er vom Selbstmord seines ehemaligen Freundes Johan erfährt. Die Reise zu seinem Begräbnis wird zu einer Reise zurück in seine Bohèmejahre, in eine Zeit, in der alles möglich und alles erklärbar erschien, in der man genau wusste, wofür und wogegen man kämpfte ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAYMONverlag
Waltera Grond
Der gelbe Diwan
Roman
Aggsbach Dorf, 2003 bis 2009
Die finanzielle Unterstützung des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur und der Literar-Mechana erlaubte mir die ungestörte Arbeit an dem Roman.
Dafür möchte ich mich bedanken.
© 2009
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7521-3
Umschlag- und Buchgestaltung:
Kurt Höretzeder, Büro für Grafische Gestaltung, Scheffau/Tirol
Umschlagbild: Felix Vallotton: La Blanche et la Noire (1913)
Diesen Roman erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
„The groan of the living calling him backfrom the sign of the dead.“Mark Z. Danielewski, House of Leaves
Für meine Frau Christine
1
Winzige Öltropfen spritzen auf, da der Fischkutter unruhiges Wasser durchschneidet, treffen den Vogel, der über dem Fangeimer am vorderen Deck flattert und nun, um der Bugwelle auszuweichen, im engen Bogen zum Kajütendach hochfliegt. Sein Kreischen dringt nicht an das Ohr des Skippers, halb taub vom Dröhnen der Schiffsmotoren steht der am Steuerrad, in Falllinie unter dem Vogel, der das ölige Nass aus seinem Gefieder zu schütteln versucht. Während im Bordfernseher die Frühnachrichten beginnen, beißt der Skipper ein Stück von seinem belegten Brot, mit Blick auf das Echolot steuert er, keine Untiefe vor sich, zum Hafen.
Vom Fenster seines Arbeitszimmers aus folgt Paul Clement der Möwe, die nach dem missglückten Krabbenraub zum Ufer hin gleitet. Ein Folgetonhorn weckte ihn aus dem Schlaf, kurz nach halb sieben, pünktlich wie jeden Tag, wenn die Pendler-Fähre in den nahen Hafen einläuft. Die Kinder sind noch im Bett. Dort unten, wo einmal satte Wiesen lagen, zwängt sich die Straße zwischen dem Wasser und der Häuserzeile hindurch, kein Fluss eigentlich, sondern ein gemauerter Durchstich vom Hafen zu den alten Fabriksgründen. Zu dieser Jahreszeit sind nicht nur die einzeln verbliebenen Weiden entlaubt, es zeigt auch das Menschengemachte seine ganze Gebrechlichkeit, die Laternen den Rost, das Schutzglas die Sprünge, dahinter die Schlieren von verschmorten Insekten, und die Straße ihr Inneres, dort an der Baustelle, wo die Maschinen den Asphalt aufschnitten, Halden von Schutt und Müll.
Inzwischen taucht vom Hafen her ein Lastkahn auf, ein antiquiertes Modell, dessen ungedämmte Motoren hier oben das Fensterglas zum Vibrieren bringen. Da der Nebel bis über die Wasseroberfläche einfällt, verschwinden gar die roten Positionslichter, das Stadtviertel am anderen Ufer taucht ins Nichts. Dann lösen sich Schwaden aus dem gestaltlosen Grau, und über dem Wasser bilden sich Wölkchen. Ein Sog entsteht, reißt ein Loch, durch das Lichtbündel dringen. Darin drehen sich Dunstfetzen, bis sich aller Nebel hebt, die Öffnung weitet und der Himmel zum Vorschein kommt, helles Azurblau. Eine Bühne, auf der alles weit voneinander weg rückt, von einem Licht getroffen, das Paul Clement nur aus dem Orient kennt, es fällt auf Häuser, Lagerhallen und Schlote, während die dem Licht abgewandte Seite im Dunkeln bleibt.
Gerade fällt der Nebel wieder ein, schließt sich der Schleier über der Stadt, da lässt ein Klingelton den Staunenden am Fenster aufhorchen. Ein zweites, ein drittes Mal, ein schriller Klang. Paul Clement blickt auf die Uhr, schon sieben, gewiss Behle, seine geschiedene Frau, die dienstags die Kinder zur Schule bringt. Er muss ihr noch mitteilen, dass er in Kürze verreisen wird, sie soll, wenn sie die Kinder zu sich nimmt, den beiden nicht wieder diese Nanny vorsetzen, eine Tamilin, die kein Wort mit den Kleinen spricht.
Er löst sich aus der Fensternische, geht hinüber zum Arbeitstisch, sucht nach dem Telefon, im Durcheinander von Notizen und Karten, bis ihm eine aufgeregte Stimme aus dem Hörer entgegen schlägt: „Paul, bring du die Kinder zum Bus, ich bin schrecklich in Eile!“
„Nein, heute nicht“, erwidert er, lenkt das Gespräch auf seine bevorstehende Reise, er muss mit dem Fotografen die Motive besprechen.
„Du fährst fort?“
„Nach Ägypten, ein altes Reisetagebuch wird neu aufgelegt, sie wollen eine Reportage von mir.“
„Und die Kinder?“
„Ich kann den Auftrag nicht ablehnen.“
Ihr tiefes Durchatmen kennt er, sie wird unwirsch. Bestimmt wird sie ihm gleich die Energie, die ihr die Agentur abfordert, vorhalten, seine Unentschlossenheit beklagen, dass er sich nur durchs Leben schwindelt, auf eine arrogante Weise genügsam, unerträglich eingebildet, wenn er sie immer noch seine Frau nennt, sich andauernd über Tatsachen hinweg setzt.
„Fünf vor acht“, sagt sie aber nur, „sei pünktlich vor der Haustür.“
Ein triumphierendes Lächeln legt sich um Clements Mund. Ein Unglücklicher ist er nicht, eher ein Gleichgültiger. Man kann ihn nicht auffällig nennen, von durchschnittlicher Größe, schlanker Statur, er ginge als Hugenotte durch, ein alemannischer Typ. Fügt sich, bald fünfzig, ins Leben, nicht unklug, hat seinen Witz nicht verloren. Bereist, um nicht ängstlich zu werden, seit zwanzig Jahren den Orient, verdient mit seinen Reportagen gutes Geld. Und wartet nun, ehe er die beiden Kinder weckt, auf Behle, beobachtet, wie sie am Gehsteig auftaucht und bis zur Höhe der Agentur, die unweit seiner Wohnung liegt, herauf schlendert, einem Gespenst aus den Wolken gleich an seinem Fenster vorbeizieht.
Für die jugendliche Frau in ihren Jeans und der roten Strickjacke spürt Clement noch immer eine wilde Bewunderung. Sie bleibt stehen, die unvermeidliche Zigarette im Mund, hält die Hand vor die Brust und hüstelt, ihre Bronchien sind chronisch entzündet. Ihr Haar ist wirr nach oben gebunden, und so desorientiert sie auch wirkt, so bewegt sie sich doch geschickt zwischen den Autos hindurch, als sie unversehens die Straße quert.
Fast andächtig betrachtet Clement ihren langen Hals, die hohe Stirn, die breiten Backen, ist verwundert, dass er keine Vorstellung mehr von ihrem nackten Körper hat. Bevor sie das Haus betritt, zertritt sie die Zigarette auf dem Asphalt, greift mit verächtlicher Miene nach dem Türgriff.
Nicht zum ersten Mal nimmt sich Paul Clement vor, Behle darauf anzusprechen, was in ihm vorgeht, ein Seliger, dem Aufschub gewährt ist, sinniert er vor dem Badezimmerspiegel, gerade als ihm die Rasierklinge eine Wunde ins Kinn ritzt.
2
Kaum sind Kleopátra, die Dreizehnjährige, und ihr um fünf Jahre jüngerer Bruder aus dem Haus, verzieht sich Clement in sein Arbeitszimmer, nimmt das alte Reisetagebuch zur Hand und macht es sich auf dem gelben Diwan bequem. Nicht unsüffisant lässt er sich ins Jahr 1849 zurück versetzen, als ein damals unbekannter Provinzschriftsteller aus Frankreich mit dem Schiff in Alexandria landete, von dort den Nil aufwärts bis nach Wadi Halfa reiste und mit seiner Feder das halb arabische, halb europäische Treiben in Ägypten festhielt. Den Mann im Teehaus beschrieb, in weißen Beinkleidern, mit Tarbusch auf dem Kopf und einer grünen Brille auf der Nase, die ihm das Aussehen eines phantastischen Tieres gibt, halb Kröte, halb Truthahn. Die Beduinin beschrieb, die auf dem Markt Trauben verkauft, ihre männlichen Arme, ihr Gesicht ziemlich platt, die Zöpfe mit Bändern durchflochten, mit Fett lackiert. Das herankommende Kamel, von vorn, in Verkürzung, den Fellachen dahinter und zwei Palmbäume, im Hintergrund die ansteigende Wüste.
In kühlem Tonfall, dabei ganz auf sich selbst bezogen, hielt der junge Mann seine Beobachtungen fest, ein Bewunderer all dessen, was lebt, zugleich voller Abscheu gegenüber der menschlichen Dummheit. Ein träumerischer Kerl von achtundzwanzig Jahren, in dem hundert Hoffnungen und tausend Abneigungen einander kreuzten, der einmal gern Korsar gewesen wäre, dann wieder Renegat, auch Maultiertreiber, Kameldulenser, aus seiner Heimat, ja aus sich selbst heraus wollte, mit dem Rauch seines Kamins und den Blättern seiner Akazien auf Wanderschaft zu gehen beabsichtigte.
Clement stellt sich vor, wie all die seltsamen Dinge und Menschen, denen dieser Träumer begegnen würde, nach und nach in seiner Schreibstube Platz nahmen, ein Sammelsurium aus Fotos, Gemälden, Teppichen, Amuletten, Waffen, Musikinstrumenten, sogar von zwei Mumienfüßen wird die Rede sein, einem Brahma aus vergoldetem Holz, einer großen Metallschale mit Arabesken, einem Gipsabguss der Psyche und einem krötenförmigen Tintenfass auf seinem runden Arbeitstisch. Er lebte inmitten einer idyllischen Landschaft, in einem Dorf an der Seine, wo er sich mehr in einer Meeresbucht als an einem Fluss wähnen konnte. An seinen Fenstern glitten die Schiffsmasten vorüber wie auf einer Bühne, während sich hinter dem Haus ein steiler Abhang auftürmte, ein dramatischer Winkel mit hohen Zypressen, deren Kronen die atlantischen Winde durchwühlten, ein Park mit Spalierbäumen und einer langen Terrassenallee, darin ein alter Pavillon, in dem er seinen Freunden aus seinen Romanen vorlas.
Sein Vater, Chirurg in Rouen, hatte das ehemalige Kloster unweit der Stadt kurz vor seinem Tod erworben, den Landsitz in Croisset aber selbst nicht mehr nützen können. Daher lebte Gustave allein mit seiner Mutter und seiner Nichte, der Tochter seiner verstorbenen Schwester, in diesem streng geführten Haushalt einer Witwe, normannisch sparsam, nur ein Stück entfernt von den neuen Fabrikschloten, den Bergwerken, der Getreidebörse, den Kolonialwarenläden, Banken und Baumwollwebereien.
Längst fühlte er sich von der modernen Barbarei, der Ungeniertheit, dem religiösen Irrsinn seiner Zeit derart abgestoßen, dass er sich inbrünstig wünschte, fernab der Gegenwart zu verweilen, in einer wilden menschlichen Wirklichkeit, einem utopischen Märchen in ferner vergangener Welt, aber erst ein ärztliches Attest, das wegen seiner Kränklichkeit zur Reise in den Orient riet, konnte seine Mutter umstimmen, es heißt, ihr Gesicht wäre, als sie ihm die Erlaubnis zur Reise nach Ägypten gab, noch eisiger als sonst gewesen, während das seine errötete.
Clement malt sich den Abschied des jungen Mannes aus, als er seine Reise antritt, wie er zerschlagen im Zugabteil sitzt und in Gedanken die Stimme des Hausmädchens rufen hört, Gnädige Frau, Monsieur Gustave ist wieder da, wie ihn das schmerzverzerrte Gesicht seiner Mutter beinahe zerreißt und er sich daher beim ersten Halt in Paris in Ess- und Saufgelage stürzt, ein Bordell aufsucht, in der Oper bourgeoise Spießer beargwöhnt und in einem Salon über den herannahenden Sozialismus diskutiert. Im Orient zu finden hofft, was er zu Hause vermisst, und doch die gespitzte Feder neben das Blatt Papier auf seinen Schreibtisch legt, um einmal den begonnenen Absatz ohne Verzögerung beenden zu können, und der Hure in Paris das genaue Datum nennt, zu dem er sie erneut aufsuchen wird.
3
An jenem Dezembertag, als Clement auf den Spuren des alten Orientreisenden die Vergangenheit heraufzubeschwören beginnt, schneit es und friert es nicht. Weil es am Morgen feucht ist, gegen Mittag aber, sobald die Sonne hervorkommt, angenehm warm wird, knospen im Scheunenviertel, wo Clement wohnt, Büsche und Blumen. An den Fensterscheiben schwirren lästige Fliegen, taumeln bei Einbruch der Dunkelheit den Glühbirnen entgegen und fallen tot auf die Teppiche nieder.
Gegen Abend taucht die untergehende Sonne die Raffinerien und Kräne in ein orangefarbenes Licht, gebrochen in unzähligen Partikeln von Staub und Öl. Der Himmel sinkt näher auf die Stadt herab, während sich von unten eine Neonlampen-Wolke, die über dem Scheunenviertel ihr Epizentrum zu haben scheint, in alle Richtungen ausbreitet, zum südlichen Hafen wie zu den Bergen im Norden.
Vom Lesen auf dem Diwan, den Clement seit dem Morgen nur für eine Tasse Tee und eine kleine Mahlzeit verließ und später, um für die Kinder zu kochen, lenkt das Leuchten nicht ab. Nur aus Gewohnheit läuft das Radio, das Clement nicht anders als den Lärm aus dem Kinderzimmer wahrnimmt, einem dämmernden Wachhund nicht unähnlich, da sagt eine weibliche Stimme etwas von einem Todesfall, Clement meint den Namen seines Freundes Johan verstanden zu haben. Liest weiter, während ihm Johans alkoholische Exzesse in den Sinn kommen, blättert um, will nicht wahrhaben, was er eben hörte, und hat doch schon eine Vorstellung von dessen leblosem Körper. Ihm wird übel. Er kennt doch Johan als Inbegriff übermenschlichen Aufbäumens, unmöglich, dass dieses Kraftbündel nicht mehr lebt, da erklärt die Stimme aus dem Radio, der dreiundsechzigjährige Schriftsteller habe sich in Saint-Marc-sur-Mer, einem Dorf an der französischen Atlantikküste, das Leben genommen.
Aus dem Jenseits bewegt sich ein Wesen auf Clement zu, formt sich oberhalb seiner Stirn zu einem Gesicht und setzt sich vor seinen Augen fest. Es hat Johans kantige Backenknochen, seine vollen weichen Lippen, ist begrenzt von seinem schütteren Haar. Hasserfüllt starrt es ihn an. Diese Wutaugen! Dunkle Pupillen, getrübtes Weiß unter buschigen Brauen, ein Organ, dem alle Tragödien eingeschrieben sind, all die Erinnerungen, die während des Sterbens aus Johans Augenhöhlen gedrängt haben mochten, Parasiten, die sich jetzt einen neuen Wirt suchen.
Als Clement sich aufrichten will, fühlt er sich an der Schulter gepackt und auf den Diwan zurückgeworfen. Gezwungen, in Johans Protestgesicht zu schauen, das an Tagen wie diesen, da die kapitalistische Allianz das Land zwischen Euphrat und Tigris besetzt hält, ein zynisches Heil auf den hingerichteten Saddam Hussein ausrufen würde, wie ehedem eines auf Ho Chi Minh, auf Pol Pot, ein Salam auf den Diktator, aus heller Empörung, dass die Amerikaner den bärtigen Mann als Tier der Welt vorführen ließen, ihm vor laufender Kamera den Mund aufrissen, die Zähne abtasteten und ihn schließlich exekutierten. Johans biblischer Zorn hält Gericht, es gab Tage, bedeutet er ihm, da klang auch für Clement das Wort Anarchist schön und süß.
Im Regal stehen Johans Bücher gereiht, zwischen Basaltsteinen, die Clement an der Atlantikküste sammelte. Eine Kindheit in Bulak, dem Elendsviertel der Stadt, wo der Traum der Landflüchtigen endet und die Mutter ihre Brut nicht schützen kann. Eine Jugend ohne Vater, der nicht aus dem Flöz zurückkehrte, die Geschichte eines jungen Mannes, der auf wunderliche Weise diesem Unleben entkommt und Schriftsteller wird, Zeuge der Hölle, Meister von Wörtern, die für ihn zum eigentlichen Leben werden, das Künstlerdasein zu seiner Vision.
Die wilden romantischen Jahre fallen Clement ein, Saint-Marc-sur-Mer, der Sandstrand, die Exzesse, der Suff, die Schreie in die Nacht. Johans Philosophenidol, die Symbiose von Revolution und Literatur, Befreiung und Feinsinn, Gerechtigkeit und Lust, Geist und Trieb, Müßiggang und Verschwendung, ein Leben, in dem sich Träume erfüllen, frei und schier endlos wie das Meer, archaisches Glück, vorweggenommene Zukunft.
Gottlos und doch tief religiös, ungehorsam, zugleich streng, unverschämt, aber verletzlich, ein Lästerer, der selbst keinen Widerspruch ertrug, so einer war Johan. Verachtete Clements Absicht, nur Journalist zu werden, etwas derart Profanes, redete nächtelang auf seinen jungen Freund ein, bis in die Morgenstunden, ehe er ihn eines Tages aus einer Spelunke ins Auto zerrte und halb betrunken mit ihm nach Frankreich aufbrach, in sein Atlantis, auf Parkplätzen einnickte, in Raststationen Wäsche und Zahnbürsten kaufte, weiter trank und wieder einnickte, bis es zum dritten Mal dämmerte und sie endlich in Saint-Marc-sur-Mer einlangten, mit einer Weinflasche in der Hand den Strand entlangliefen, bei rauschender Brandung. Mit den Wellen empfingen sie die Seelen aller Seemänner, die gerade über das Meer kreuzten, all die ungeborenen und verstorbenen Gestalten, die sie beide dazu veranlassten, wie Kinder zu jauchzen und die Flasche bacchantisch zu leeren, es war Herbst und kühl, und endlich schliefen sie tief und fest ein.
Nicht ohne Selbstironie pflegte Johan von einem Revolutionär, den er nur den Poète nannte, zu erzählen. Dieser hatte einst Saint-Marc-sur-Mer zur Landebahn in die Freiheit auserkoren, um Monsieur Hulot die Ehre zu erweisen, jenem Pfeife rauchenden Filmhelden, der in dem Badeort mit seinem bizarren Tennisspiel und der lauten Musik für Unruhe sorgt. Im Hôtel de la Plage, wo Die Ferien des Monsieur Hulot gedreht worden war, verbrachte der Poète die erste Nacht seines europäischen Exils, und später, in Paris ein gefeierter Mann, manches Wochenende, um sich zu entspannen.
Mit zittrigen Fingern zieht Clement ein Buch aus dem Regal. Jahrzehnte später, nach dem Bruch ihrer Freundschaft, sollte Johan seinen Traumpfad zum inneren Exil umdeuten und ein Haus nicht weit von jenem Hotel entfernt anmieten. Wann immer Clement in den letzten Jahren nach ihm fragte, erhielt er zur Antwort, Johan sei inzwischen verstummt, eine hilflose Seele in einem gealterten Körper. Wird ihn nun das Pathos des Nachruhmes ereilen? Wird man erneut die Stimme des Rebellen beschwören, der die Elendsviertel salonfähig machte? Über das Verstummen seiner Schreibmaschine sinnieren und sich an Vermutungen erregen, warum er just, als Gerüchte auftauchten, er sitze endlich wieder über einem Roman, sein Schicksal so grausam besiegelte?
Ungewöhnlich wach nimmt Paul Clement das leise Surren der Niedervoltlampen wahr, das Knarren des Parkettbodens bei jedem Schritt, wird sich der Spiegelungen im Fenster bewusst, des Arbeitstisches, der Lampe, der Briefstapel, nur das Licht der Straßenlaternen dringt von draußen durchs Glas. So sehr ihn auch die Nachricht von Johans Tod erschüttert, fühlt er sich doch seltsam belebt. Die Gegenstände um ihn herum regen ihn an, das Papier, der angenagte Bleistift, das verrotzte Taschentuch auf dem Tisch, sie alle sind Geister, die um den dichten Schleier tanzen, der über seiner Vergangenheit liegt.
Dort oben hockt Johans Seele, in der Decken-Stuckatur, spürt er, dass ihr nichts entgeht? Sie sieht die Fältchen auf Clements Stirn, sein Schmunzeln über all die Kindereien, die sie gemeinsam getrieben haben, das Leuchten in seinen Augen, eine Art Ergriffenheit, mit der die mittelalterlichen Mönche den Schein um die Heiligenfiguren malten, und die Johan, den einst väterlichen Freund, erfasste, sobald er über die Sorgen und Mühen einfacher Menschen sprach.
4
Unerträglich ist, was Clement erfährt. Noch vor nicht allzu langer Zeit hielt sich Johan in der Stadt auf, kehrte offenbar mit dem letzten Geld nach Frankreich zurück und schritt, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen, zu seinem Richtplatz. Der Zeitpunkt ist nicht mehr zu eruieren, der Leichnam lag wochenlang in der Scheune, Gerüchte um einen Schlachtschussapparat, das Haus etwas abseits, keine Tiere, keine Nachbarn, kein Briefträger, zu dieser Jahreszeit kaum Spaziergänger.
Wieder und wieder lässt Clement den Freund in Gedanken zur Scheune gehen, den Weg vom Haus zur gekachelten Waschküche, diese Richtstrecke, laut hallende Schritte, letzte Muskelanstrengung, die alle Hinterbliebenen schuldig spricht. Da sind Johans Füße, seine Schuhe, die noch Abtritte auf der Erde hinterlassen, sein Zeigefinger, der den Bolzen spannt, ist die Kälte zu erahnen, bereits jenseits von Hass und Vergeltung, ist in Augen zu blicken, aus denen das Nichts spricht, ein letzter und endgültiger Wunsch: die Auslöschung.
5
Während des Fluges nach Paris, unterwegs zu Johans Begräbnis, irgendwo über den französischen Alpen, spürt Paul Clement die unsägliche Kälte, die den Freund erfasst haben musste, um seine eigenen Fersen, spürt, wie sie langsam die Beine hochkriecht, wie sich ein Gürtel um die Brust, dann um den Hals schnürt. Wendet er sich zum Fenster, blendet ihn die Sonne, und schiebt sich eine silbrige Wolke dazwischen, überblickt er eine zerklüftete Berglandschaft, spitze schroffe Felsen, Schnee und Eis. Panisch umklammern seine Hände das Knie, er schließt die Augen und atmet tief durch, er kennt diese pure Angst, kennt sie von damals, an Johans Seite, wenn sein Herz raste, und er, ohne dass jemand etwas ahnte, zu sterben fürchtete, mitten im Trubel.
Dann, im Zug von Paris nach Nantes, weicht die Panik einem nicht unangenehmen Dämmerzustand. Wie von außerhalb blickt er auf sich selbst, in eine vergangene Zeit, sieht einen Kerl, der seine Jugend überlebt hat, schaut auf die Kühe dort draußen, Schweine und Ziegen, die auf den flachen Winterweiden stehen, und meint sich zugleich mit Johan im Abteil, beobachtet, wie sie einst beide, an Angers und Ancenis vorbei, durch das Abteilfenster die Loire-Atlantique erspähten. Was er damals als Zeichen nahenden Glücks deutete, stimmt ihn jetzt schwermütig: die überdachten Unterstände, das Vieh im Freien, die Flecken unangetasteten Moors, das Schilf, die Salzlacken, diese kultivierte und zugleich wilde Landschaft. Später, in Nantes, wo er auf den Bus nach Saint-Marc-sur-Mer wartet, lässt er sich im Lärm eines Cafés treiben. Beobachtet die Serviererin in ihrem kurzen Rock, nicht unhübsch, umworben von männlichem Jammer, wird sie nach Sperrstunde allein nach Hause gehen, einsam und umso selbständiger.
Im Schutz des Flüchtigen lässt sich das Mittelmäßige als gut denken, das Leben verklären, wird das Mittelmäßige zum Gespinst eines Reisenden. Lässt sich jene betörende Kurzweile empfinden, die Johan dazu verführt haben mochte, dies alles hier für ein besseres Leben zu halten, nur weil es sich vor einem anderen Hintergrundgeräusch abspielt. Auch er stieg in Nantes aus dem Zug, jedes Mal, wenn er sich ans Ende Europas aufmachte, saß zuletzt vielleicht in diesem Café, und vielleicht trug die junge Serviererin dieselben hautfarbenen Strümpfe.
Von dieser Stadt des Jules Verne ist es nicht mehr weit bis zum Meer, wie Johan so begeistert zu erzählen verstand. Indes musste längst aller Glanz aus seinen Augen gewichen, der Bohemien am utopischen Geist verzweifelt gewesen sein, wehrlos der Unverfrorenheit gelauscht haben, mit der die Nachfahren der Sklavenhändler von Nantes auch heute noch das Grand Siècle des Negerhandels feiern, das der Stadt einst den Reichtum bescherte. Sich auf seinem Traumpfad eingestanden haben, dass in diesem Hafen hundert Jahre lang, bis ins Jahr 1794, Schiffe aus Westafrika Station gemacht hatten, um das Ebenholz, wie man die lebende Ladung nannte, Kinder und Frauen und Männer, für die Überfahrt nach Amerika aufzupäppeln, und dass man im Jahrhundert der Aufklärung und der Französischen Revolution, als dessen leidenschaftlichen Nachfahren sich Johan begriff, nicht einmal die Luken der ankernden Dreimaster dichtmachen musste, ja das Jammern und Flehen der Sklaven niemanden aufbrachte, sondern sogar zum Ruhm der Negerhändler beitrug. Freilich wird das historische Unrecht Johan nicht in den Selbstmord getrieben haben. Aber so wie Nantes einmal die Bühne für seine kühnsten Träume gewesen war, musste diese Stadt für ihn auf dem Weg zur gekachelten Scheune, in der er die ganze Welt auslöschen würde, der für ihn hoffnungsloseste Ort des Abschieds gewesen sein.
Den Aschenbecher kippt die Serviererin in den Mülleimer, hält den Deckel mit dem Knie hoch, dreht den Lappen flink gegen den Uhrzeigersinn. Die Fernsehnachrichten wird Clement zwei Stunden später noch einmal in der Rezeption des Dorfhotels hören. Der Bus, der ihn nach Saint-Marc-sur-Mer bringt, durchsticht schon die Dunkelheit, aber, endlich dort angekommen, wird sich Clement fragen, ob er gerade den Windfang des Cafés in Nantes verlässt und sich die Fahrt ans Meer vorstellt, oder, schon hier im Hotel, in Gedanken seiner Melancholie im Café nachhängt.
Etwas Orientierungsloses ist an der Idee vom Tod. Clement muss in den Bus gestiegen sein, und der wird sich aus Nantes hinausbewegt haben, denn als er kurz vor der Hafenstadt Saint-Nazaire aus dem Moorland an die Stelle gelangt, wo der Kontinent in den Atlantik abbricht, erfasst Paul Clement wie einst der Zauber des Herumirrens. Saint-Nazaire, eine Stadt mit atlantischen Häuschen, gepfählt von den Kränen im Hafen, niedergedrückt von den deutschen Bunkern, die seit Kriegsende als Werfthallen dienen und nun im Scheinwerferlicht prächtig wirken, kontrastiert von einer Brücke, die draußen die Bucht überragt, ebenso hell, von einer olympischen Himmelsleiter. Nicht überall ist die Küste steil, aber überall karg, umbrandet, wie es gewöhnlich nur Inseln sind. Kaum einen Fleck auf der Landzunge gibt es, der nicht mit schmucklosen Einfamilienhäusern, Einkaufszentren und Wohnsilos verbaut ist.
In Clements Vorstellung war Saint-Marc-sur-Mer zyklopischer, stilvolle Landhäuser säumten die Dorfstraße, auch prächtige Villen, Ferienhäuser, dann fiel das Land zum Meer hin ab, in zwei Serpentinen ging es hinunter bis zum Dorfplatz, einem Busbahnhof eigentlich. Von hier waren es noch hundert Schritte bis zum Strand, standen alte Häuser dicht aneinandergedrängt, eine Apotheke, eine Boutique, eine Boucherie, drei Hotels.
Während Clement in der Vergangenheit schwelgt, reiht sich der Bus in einen Kreisverkehr ein, rund um einen künstlichen Teich. Im Wasserbecken drängen sich Schwärme von Möwen, wuchernde Appartementanlagen sieht er nun, die Fensterläden fast alle geschlossen. Dieser Schritt auf dem Kiesel, dieser Mann, dem der Wind den Mantel zu Flügeln aufbläht, dieser Koffer, in dem viel zu viele Sachen stecken, diese Verlorenheit, durchdrungen vom salzigen Geruch des Windes. Clement hört die Schritte des Verstorbenen neben sich, ein sägendes Knirschen, das nach Sühne schreit, doch auch dafür, muss er sich sagen, ist es zu spät.
Als er das Hôtel de la Plage betritt, schlägt ihm mit der feuchtwarmen Luft ein Vexierbild entgegen. Dort drüben hat er den Fernseher in Erinnerung, auf einem schmucklosen Tischchen, gegenüber dem Sofa, alles wirkte so vorläufig damals, die Abendnachrichten, das leise Gemurmel, die Bilder an der Wand, ohne ersichtliche Ordnung gehängt. Die Bodenvase war leer, und durch die Glastür, die zur Strandveranda führte, fiel der Blick auf das Meer, erst allmählich wurde man sich dessen bewusst. Nun sind die alten Holztäfelungen verschwunden, hat sich das Schummrige in eine helle Halle verwandelt, wird man von Neonlicht empfangen, von pastellfarbenen Stofftapeten, gekachelten Böden, Zentralheizungskörpern unter den Fenstern, nur die gerahmten Schwarz-weiß-Fotos an den Wänden halten einen Hauch von früher fest.
Junge Leute mit derben Gesichtern, Hotelangestellte, beobachten den Mann in der Rezeption, den Clement sofort als den alten Maître wiedererkennt. Wie die zwei weißen Porzellanlöwen, die ihn flankieren, wirkt er ganz und gar fehl am Platz, und hält sich, nicht anders als damals, keinesfalls mit Höflichkeiten auf, erklärt, eine Dame wünsche Monsieur Clement in ihrem Zimmer zu sprechen.
Deren Name huscht so entstellt über seine Lippen, dass Clement mehrmals nachfragen muss, und doch weiß er, dass es sich nur um Rafaela handeln kann. Der Maître hat Clement, den jungen Mann in Johans Gefolge, nicht vergessen, und präsentiert ihm also das kostbare Wesen, das Johan einst in Besitz nahm, jene Frau, die den Schriftsteller liebte, geduldig jede seiner Eskapaden ertrug.
Von Besuchern, die er abwies, erzählt der Maître, der für Johans Begräbnis noch einmal seine Livree anlegte, die Zimmer sind alle belegt, erklärt pathetisch, „Monsieur Johan war ein amüsanter Herr, wir haben ihn am Ende sehr bedauert“.
Im Übrigen hält er das Restaurant heute Abend geschlossen, verwies die Reporterbande, wie er die übrigen Gäste nennt, in ein Lokal nebenan, bringt aber gern, wenn Clement es wünscht, eine Flasche Wein auf das Zimmer.
Wenig später hört Clement das leise „Grüß dich, Paul“, tritt nach so vielen Jahren Rafaela gegenüber, sie hält ihm die Wange zum Kuss hin, bittet ihn freundlich ins Zimmer. Nur wenig jünger als Johan, hat die Zeit kaum Spuren an ihr hinterlassen, sie sieht jung aus, eigentlich alterslos, wie damals, als ihre tänzelnden Bewegungen ein wenig überkommen anmuteten, so wie sie jetzt um einen Deut zu jugendlich wirken. Nun tritt ihr toskanischer Großvater noch deutlicher aus ihrem Gesicht hervor, dessen große dunkle Augen, die gerade Nase, das schwarze Haar, das sie schulterlang trägt, über den Augenbrauen gerade geschnitten.
Mit sanfter Stimme schildert Rafaela ihre Trennung von Johan. Auf dem Bild aus ihrem Portemonnaie, über das sie mit den Fingerkuppen streicht, erkennt Clement den einstigen Freund kaum wieder. Dicke Wülste unter den Augen, aufgeschwemmte Backen, kraftlose Augen, das war nicht der Mann, den sie beide geliebt hatten.
Zwei Jahrzehnte ziehen an ihnen vorbei. Rafaelas Trennung von Johan, bald nach dem Bruch der Männerfreundschaft, die jahrelangen Besuche Johans, wie er gereizt reagierte, weil Rafaela ihm nicht mehr folgen wollte. Was er ihr vorschwärmte, wie ihn Saint-Marc-sur-Mer wieder zum Schreiben bringe, anfangs mochte sie es, wenn er nachts an ihrer Tür stand, so eroberisch, wie er sein konnte.
Sie bietet Clement den einzigen Stuhl an, vor dem kleinen Tisch mit der Schreibunterlage und dem Wandspiegel, dreht mit einer eleganten Bewegung den Korken aus der Flasche, gießt Wein in die Gläser, wischt mit einem Tuch den Flaschenrand ab. Und während sie aus den Stiefeletten schlüpft und aufs Bett gleitet, sich in den Damensitz begibt, die Beine geschlossen, angewinkelt und seitwärts gelagert, sagt sie charmant, „Cher Paul, es ist schön, dich wiederzusehen.“
Ihr Benehmen könnte nicht taktvoller sein, diese feinen Manieren, diese Wohlerzogenheit, die Johan so betont neben sich wissen wollte, etwas Kostbares, das er begehrte und das ihn doch im Innersten unberührt ließ. Bevorzugt in solchen Hotelzimmern hatte er sich ihrer bedient, ein Freibeuter, in dessen Leben Geld zum Verschwenden da war, ein flüchtiges Bett der richtige Ort, um ein wohlerzogenes Mädchen um den Verstand zu bringen. Wie brüsk Johan jahrelang Rafaelas Wunsch von sich gewiesen hatte, in Saint-Marc-sur-Mer ein Haus zu erwerben, davon konnte, so seine Häme, nur eine Häusliche träumen. Und dann, nach der Trennung, mietete er eines an, war unvermutet Rafaela die Streunerin geworden, die bei ihm vorbeischaute, er wollte unbedingt, dass sie in seinem hübschen Häuschen mit Garten nächtigte, über der Schlucht, vor dem unendlichen Ozean, wollte die Zeit zurückdrehen, am Ort seiner Träume etwas Endgültiges tun.
„Am Ende war alles verkehrt.“
Und nun möchte Rafaela etwas über Clements Arbeit erfahren, sie las seine Reportagen, und wenn sie erwähnt, dass sich manch einer nach Paul erkundigt, schwingt kein Vorwurf in ihrer Stimme mit.
„Du kannst ruhig rauchen, Paul.“
„Habe ich aufgegeben.“
„Tatsächlich? Du siehst gut aus.“
Dabei dreht sie mechanisch den Stiel zwischen den Fingern im Kreis, starrt auf den Wein, der leicht im Glas hin- und her schwappt. Beim Abschied küsst sie Clement auf die Stirn, umarmt ihn, und die Gedanken schweifen in die gemeinsamen Jahre, aber dort ist nichts, was einer von ihnen ausdrücken könnte, ist alles leer und verlassen, nichts geblieben. Nur ein Gefühl, dass Johans Tat vollkommen war, und er, Clement, von sich selbst keinen rechten Begriff hat.
6
Am folgenden Tag ist Rafaela weit hinten im Trauerzug zu finden, schweigsam zurückhaltend, ein pietätvoller Zaungast. Im Durcheinander fällt die Frau mit dem Kopftuch und den Sonnenbrillen nicht auf, und später beim Leichenschmaus wird der Maître die Bemerkung fallen lassen, sie sei abgereist.
Schattenhafte Wesen ziehen vorbei, es könnten Gestalten aus einem Roman sein, wie ihn Johan über die bürgerliche Welt schreiben würde, seine Nichte ließ den Sarg auf einem Wagen zum Strand schaffen, und weil ihn kein Kreuz zum Grab begleitet, wurde der Schrein mit Quasten und Tüchern verhängt. Eine ansehnliche Gesellschaft versammelt sich am Bootssteg. Während die Kinder unbekümmert mit Muscheln und Schneckenhäusern spielen, lungern die Frauen und Männer um den Sarg herum, in zerknitterten Samthosen, dunklen Sakkos, schwarzen Salonkleidern, Federhüten, fingerlosen Handschuhen, statt Weihrauch gibt es den Zigarettenqualm, statt Gebeten ein Flüstern und Hüsteln, Klingeltöne dringen bis zur Straße herauf. Später spielt ein Grammophon Schlagermusik und die Tochter von Johans Bewunderin liest im altmodischen Kleidchen einer Alice im Wunderland aus den Romanen des Verstorbenen vor.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!