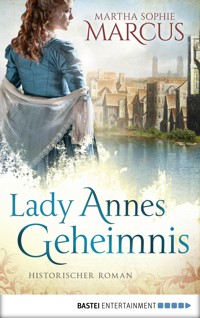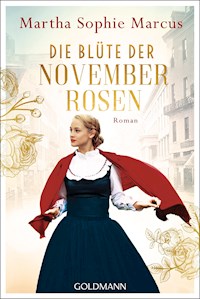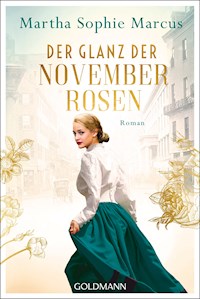
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fünf-Schwestern-Saga
- Sprache: Deutsch
Hannover Mitte des 19. Jahrhunderts: Als Töchter des Lokomotivfabrikanten Georg Brinkhoff wachsen Sophie und ihre Schwestern in Reichtum auf. Aber anders als ihre Familie sieht Sophie die Nöte der Arbeiter. Als sie sich für soziale Gerechtigkeit engagiert, lernt sie den verheirateten Fabrikschmied Karl kennen. Es ist für beide Liebe auf den ersten Blick. Doch hin- und hergerissen zwischen ihrer verbotenen Beziehung und dem Pflichtgefühl gegenüber ihrer Familie heiratet sie schließlich den Ingenieur Ernst Drave, für den sie nichts empfindet. Ihre Liebe zu Karl ist jedoch stärker denn je. Und so beginnen beide ein gefährliches Doppelleben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Hannover, Mitte des 19 Jahrhunderts: Als Töchter des Lokomotivfabrikanten Georg Brinkhoff wachsen Sophie und ihre Schwestern in Reichtum auf. Aber anders als ihre Familie sieht Sophie die Nöte der Arbeiter. Als sie sich für soziale Gerechtigkeit engagiert, lernt sie den verheirateten Fabrikschmied Karl kennen. Es ist für beide Liebe auf den ersten Blick. Doch hin- und hergerissen zwischen ihrer verbotenen Beziehung und dem Pflichtgefühl gegenüber ihrer Familie heiratet sie schließlich den Ingenieur Ernst Drave, für den sie nichts empfindet. Ihre Liebe zu Karl ist jedoch stärker denn je. Und so beginnen beide ein gefährliches Doppelleben …
Autorin
Martha Sophie Marcus, geboren 1972 im Landkreis Schaumburg, studierte Germanistik, Soziologie und Pädagogik und verbrachte anschließend zwei Jahre in Cambridge. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Lüneburg. Seit ihrem grandiosen Debüt »Herrin wider Willen« hat sie weitere erfolgreiche Romane veröffentlicht. Eine Fortsetzung von »Der Glanz der Novemberrosen« erscheint bei Goldmann unter dem Titel »Die Blüte der Novemberrosen«.
Martha Sophie Marcus
Der Glanz der Novemberrosen
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Copyright© 2020 by Martha Sophia MarcusDie Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln.Copyright© dieser Ausgabe 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur MünchenUmschlagfoto: © Archive World / Alamy Stock Photo; Arcangel / ILDIKONEER; Arcangel / JOANNACZOGALA; FinePic®, MünchenRedaktion: Eva WagnerBH • Herstellung: ikSatz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, MünchenISBN 978-3-641-25141-3V001www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Vorbemerkung
Die Familie Brinkhoff wurde nach dem Vorbild einer damals real existierenden Lindener Unternehmerfamilie geschaffen, doch bitte ich Folgendes unbedingt zu beachten:
Während die Darstellungen der Geschichte des Unternehmens und der Geschichte des Ortes Linden, die untrennbar miteinander verwoben sind, den historischen Begebenheiten folgen, ist die im Roman erzählte Familiengeschichte dennoch fiktiv. Die handelnden Personen, ihre persönlichen Eigenschaften, Handlungen und privaten Verstrickungen sind der Fantasie der Autorin entsprungen. Bitte verwechseln Sie die Familie des Romans nicht mit ihrem historischen Vorbild.
Personenliste
Familie Brinkhoff und Ehegatten
Georg Brinkhoff: Oberhaupt der Familie und des Brinkhoff’schen Unternehmens
Dora Brinkhoff: Georgs Ehefrau, genannt Dörchen
Großmama Grete: Georgs Mutter
Die Töchter der Brinkhoffs:
Dorette: geb. 1827
Sophie: geb. 1830
Minna: geb. 1836
Luise: geb. 1837
Johanna: geb. 1839
Agnes: geb. 1849, Dorettes Tochter
Alexander: geb. 1852, Sophies Sohn
Alfred Lonard: geb. 1826, Jungingenieur im Brinkhoff’schen Unternehmen
Ernst Drave: geb. 1817, Mitarbeiter der Hannöverschen Eisenbahnkommission
Fritz Drave: geb. 1821, Ernsts jüngerer Bruder, Maschinenbauingenieur
Die Behlings
Karl: geb. 1826, Arbeiter in den Brinkhoff’schen Werken, ausgebildeter Schmied
Lina: geb. 1826, Karls Ehefrau
Theo Repke: geb. 1828, Linas Bruder, Karls Freund
Marie: geb. 1852, Karls und Linas Tochter
Andere
William von Harder: Reiter- und Pferdeausbilder bei der hannoverschen Kavallerie
Emilie Eddelbüttel: Johannas gleichaltrige Freundin
Heinz Kohlmeyer: Vorarbeiter in der Werksschmiede bei Brinkhoff
Hanne Kohlmeyer: Heinz’ Ehefrau
Konrad: Bekannter von Theo
Herr Gutbrod: Übersetzer in der Brinkhoff’schen Maschinenfabrik
Mr. Newman: Fachmann für den Dampfhammer, zu Gast aus England
Matthias Hansen: Anführer der Bürgerwehr
Herbert: Arbeiter aus Karls Kolonne
Krischan Haase: Arbeiter, der nach Feierabend seine kranken, alten Eltern pflegt
Margot Kramer: Tagesmutter, die Arbeiterkinder betreut
Lotte: eine Frau aus Karls und Linas Nachbarschaft
Hellmann: Eisengießergeselle; einer der Anführer des Streiks
Gümmer: Hellmanns Freund
Klemens Riegler: der Offizier der militärischen Schutztruppe
Probst: Eigentümer der Weberei, in der Theo arbeitet
Regierende Könige
König Ernst August von Hannover (1771 – 1851): König von Hannover seit dem Ende der Personalunion 1837
König Georg von Hannover (1819 – 1878): Sohn und Nachfolger von König Ernst August. König von Hannover von 1851 bis zum Ende des Königreichs 1866
König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (1795 – 1861): König von Preußen ab 1840. Er lehnte 1849 die vom Parlament angetragene Kaiserwürde ab.
König Wilhelm (Friedrich Ludwig) von Preußen (1797 – 1888): Bruder und Nachfolger von König Friedrich Wilhelm. Er wurde 1871 erster Deutscher Kaiser.
Prolog
Linden, 1852
Im Haus der Draves herrschte Zwielicht. Nur vereinzelt drang ein Sonnenstrahl durch einen Spalt der zugezogenen Vorhänge und machte den in der Luft tanzenden Staub sichtbar. Gleichgültig, wie viel Sorgfalt die Bediensteten beim Staubwischen walten ließen, dagegen kamen sie nicht an.
Wie in einer Höhle lebte es sich hier derzeit, und das kam Sophie zupass. Seit acht Tagen trug sie dasselbe Kleid oder bloß ein Nachtgewand.
Es kam nicht darauf an, denn sie verließ das Haus nicht mehr, und sie empfing auch keinen Besuch. Nicht einmal ihre Mutter oder ihre Schwestern mochte sie noch sehen.
Nur einen einzigen Menschen hätte sie gern zur Seite gehabt, doch gerade an den durfte sie gar nicht erst denken, wenn sie kein Unheil heraufbeschwören wollte. Mit niemandem, auch nicht mit denen, die ihr am nächsten standen, durfte sie über ihn sprechen, und das war der wahre Grund, warum sie ihre Mutter und ihre Schwestern jetzt nicht um sich haben wollte. In ihrem Zustand konnte es zu leicht passieren, dass sie vor lauter Angst mit Geständnissen herausplatzte, die sie bei klarem Verstand niemals ablegen würde.
Ihr Umstandskleid war ein wenig feucht von der Sommerhitze, und es spannte über ihrem mächtigen Bauch, obwohl es das weiteste Gewand war, das sie besaß. Vielleicht hätte sie doch die Schneiderin bitten sollen, noch ein letztes Mal die Nähte auszulassen. Andererseits konnte es nicht mehr lange dauern, bis sie es nicht mehr benötigte. Jederzeit musste es so weit sein.
Unruhig legte sie das Buch aus der Hand, in dem sie ohnehin nicht las, und erhob sich aus ihrem Sessel. Wovor fürchtete sie sich so sehr? Alle Tage brachten Frauen Kinder auf die Welt, ohne daran zu sterben. Und in Wahrheit konnte niemand einem Säugling ansehen, wer der Vater war, auch wenn manche Leute so taten, als könnten sie es. Sie musste endlich aufhören, daran zu denken.
Mit behäbigen Schritten schlenderte sie aus dem Salon und ging in ihre Bibliothek. Bevor ihr Mann in die Kanzlei gefahren war, hatte er einen Brief von einem englischen Geschäftspartner auf ihr Pult gelegt und sie gebeten, ihm die Übersetzung aufzuschreiben. Vielleicht war ein wenig geistige Arbeit eher geeignet, sie abzulenken. Dabei konnte sie an ihrem Pult stehen, das war ein Vorteil. Denn vom Sitzen schmerzte ihr Rücken heute infernalisch.
Tatsächlich ließ der Schmerz für eine Weile nach, doch nur, um noch heftiger wiederzukehren. Die Übersetzung war halb fertig, da gab sie auf. Länger konnte sie sich nicht konzentrieren. Mit zusammengebissenen Zähnen verließ sie die Bibliothek und suchte nach der nächsten Beschäftigung. Ein letzter Blick auf die Säuglingsausstattung und die Kinderstube? Doch dort war seit Wochen alles bereit, dafür hatte ihre fiebrige Betriebsamkeit gesorgt. Dennoch …
Winzig war die Kleidung und viel zu kostbar für ein Wesen, dessen ganze Existenz vorerst darin bestehen würde, sie zu beschmutzen und zu ruinieren. Sophie musste lächeln, weil ihr die Ausgaben trotzdem nicht leidtaten. Wie schwierig die Umstände sich auch immer gestalten mochten: Für dieses Kind, das in ihr wuchs, würde ihr nichts zu gut sein. Sie würde es lieben und jeden Augenblick dankbar dafür sein, dass sie ihm ihre Liebe offen zeigen durfte.
Der Schmerz wallte erneut in ihr auf, und nun begriff sie. Eine Welle von Euphorie und Furcht zugleich breitete sich in ihr aus. Das Warten hatte ein Ende, bald würde sie ihr Kind in den Armen halten. Voll neu erwachter Energie griff sie zum Glockenstrang und läutete dem Dienstmädchen.
Eine Dreiviertelstunde später hörte sie die eiligen Schritte ihres Ehemanns durch die Halle unten und die Treppe zu ihrem Schlafzimmer heraufkommen, dann klopfte er an die Zimmertür.
Obwohl die Schmerzen noch einmal zugenommen hatten und ihr bereits eine Ahnung davon vermittelten, wie schwer ihre Aufgabe werden würde, zwang sie sich zu einer gefassten Miene.
»Ernst, wie rücksichtsvoll von dir. Aber du hättest nicht gleich kommen müssen. Sicher wird es noch lange dauern. Siehst du, die Hebamme ist schon hier. Aber der Doktor ließ ausrichten, es wäre früh genug, wenn er in einer Stunde zu uns hereinsieht.«
Seine Eile ließ darauf schließen, dass er aufgeregt war, doch seine Haltung verriet es nicht. Er sah sie so undurchdringlich an, wie er es beinah seit Beginn ihrer Ehe stets tat.
»Ich hatte gerade einen Augenblick Zeit und wollte mich kurz vergewissern, dass alles plangemäß und nach deinen Wünschen eingerichtet ist. Wenn du mir bestätigst, dass meine Unterstützung hier nicht gefragt ist, werde ich in die Kanzlei zurückkehren.«
Undurchdringlich, undurchschaubar. Erhoffte er sich jetzt etwas Bestimmtes von ihr? Wünschte er sich, dass sie ihn bat zu bleiben oder dass sie seine Hilfe in Anspruch nahm? Oder war es doch so, wie sie insgeheim befürchtete: Ahnte er ihr Verbrechen und verhielt sich deshalb so kalt? Der Schmerz schwoll an und trieb ihr den Schweiß auf die Stirn. Pfeif drauf, würde ihr Liebster sagen. Pfeif auf die Diplomatie.
»Alles ist bestens eingerichtet«, stieß sie hervor und presste die Hände gegen ihren felsharten Bauch. »Und ehrlich gesagt wäre ich froh, wenn du nicht bleiben würdest. Bis später natürlich. Später, wenn dein Kind da ist.«
Er starrte sie an, als wäre sie eine Fremde. War das nur die Hilflosigkeit des Mannes gegenüber dem Spektakel der Geburt? Aber sollte ein werdender Vater nicht dennoch wenigstens flüchtig lächeln?
»Dann wünsche ich gutes Gelingen, meine Liebe«, sagte er. Und absurderweise kam er nicht näher, sondern verneigte sich nur schneidig, als wäre sie ein Kollege in der Eisenbahnkommission, der auf eine Geschäftsreise ging.
Sie nickte und rang sich das tapfere Lächeln ab, das bei ihm fehlte. »Danke. Wir lassen dich dann rufen.«
Die Hebamme hielt ihm die Tür auf und schloss sie hinter ihm, sobald er hinaus war.
»Sehr gut. Das ist eine Ablenkung weniger. Sie werden Ihre Kraft ganz für sich selbst brauchen, gnädige Frau. Denn das ist erst der Anfang.«
Das ist erst der Anfang. Das war ein Lieblingssatz ihres Vaters. Aber in Wahrheit hatte es viel früher angefangen, und Sophie erinnerte sich genau an den Tag.
1. Kapitel
Hannover, 18. November 1847
Sophie hielt die Lokomotive für das Sinnbild des Fortschritts und ihren Vater für das menschliche Gegenstück zur Lokomotive. Im Vorjahr war in der Brinkhoff’-schen Maschinenfabrik nach jahrelanger Vorbereitung der erste Prototyp einer eigenen Lok fertig geworden, und das Modell hatte der Königlich-Hannöverschen Staatseisenbahn so gut gefallen, dass sie sich endlich entschlossen hatte, den kommenden Bedarf an Zugmaschinen vor der eigenen Haustür in Linden zu decken statt bei Borsig in Berlin.
Sophie platzte schier vor Stolz auf ihren Vater. Er hatte den Erfolg der neuen Technik schon lange prophezeit und recht behalten. Dieses Jahr hatten sie bereits sieben Lokomotiven ausliefern können, und eine davon stieß soeben unter durchdringendem Geheul eine Dampfsäule aus, während sie auf ihren Einsatz bei der feierlichen Einweihung des neuen Bahnhofsgebäudes wartete. Zu Ehren des Königs trug sie seinen Namen »Ernst August«.
Von den Mündern der Zuschauer stieg ebenfalls weißer Dampf auf. Sophies jüngste Schwestern Luise und Johanna bliesen hinter dem Rücken der Eltern und der Großmutter ihren Atemhauch in die Luft und ruderten mit den Armen, als wären es Pleuelstangen. Sophie tat, als würde sie es nicht sehen, weil sie an diesem Tag keine Lust hatte, die strenge große Schwester herauszukehren.
Georg Brinkhoff, die menschliche Lokomotive, schlug den beiden jüngeren Herren, die rechts und links von ihm standen, beidhändig auf die Schultern. »Das ist erst der Anfang. Das ist alles erst der Anfang! Sie werden sehen, meine Herren. Und wir sind endlich vorne dabei!«
Alfred Lonard, der kürzlich eingestellte Maschinenbauingenieur, war nur ein paar Jahre älter als Sophie und wirkte, als würden ihn die vielen Menschen, die sich zu der Einweihungsfeier versammelt hatten, einschüchtern. Außerdem war ihm sein Zylinder zu eng, weshalb er immer wieder verstohlen eine Hand hob, um ihn zurechtzurücken. Sophie wartete die ganze Zeit darauf, dass ihm der hohe Hut vom Kopf geweht wurde.
Er räusperte sich und straffte die Schultern. »Wenn es nach mir geht, Herr Brinkhoff, dann sind wir nicht nur vorn dabei, sondern führen in einigen Jahren die Branche an.«
Sophies Vater lachte. »Kapitale Haltung, junger Freund! Solchen Ehrgeiz will ich bei meinen Leuten sehen. Mein lieber Herr Drave, nun kommt es nur noch darauf an, dass Sie beim Streckenbau der Staatseisenbahn den gleichen Schwung verbreiten. Das Land wird es uns eines Tages danken.«
Der angesprochene ältere der beiden anwesenden Brüder Drave, der früher kurzzeitig als Maschinensachverständiger für die Brinkhoff-Werke gearbeitet hatte, seit einigen Jahren aber zur Hannöverschen Eisenbahnkommission gehörte, holte eine kleine Blechdose mit Pfefferminzpastillen aus seiner Manteltasche und hielt sie anbietend in die Runde.
»Davon überzeugen wir Seine Majestät in diesem Leben nicht mehr. Jede Genehmigung, die wir einholen müssen, löst bei ihm Knurren aus. Wenn die Preußen nicht solchen Druck ausüben würden, dann würde Ernst August keinen einzigen Schritt Schiene mehr verlegen lassen. Dass er heute nicht anwesend ist, sagt ja schon alles.«
Georg Brinkhoff winkte ab, was sowohl den Pastillen galt als auch dem königlichen Widerwillen. »Wem sagen Sie das? Ich habe noch im Ohr, was er zur Frage der Eisenbahn zu sagen hatte: ›Ich will nicht, dass jeder Schuster und Schneider so rasch reisen kann wie ich.‹ Wenn es also nach ihm ginge, dürfte es Fortschritt nur für Könige und Fürsten geben. Umso wichtiger ist es, dass wir, die wir es besser wissen, fest zusammenstehen und ihn voranbringen. Und das tun wir! Wenn wir nächsten Monat die Strecke nach Bremen eröffnen, bedeutet das einen enormen Gewinn für unsere Industrie. Ich lade Sie jetzt schon ein, das mit mir zu feiern. Aber meine Herren, heute habe ich meiner Frau zur Feier unserer diesjährigen Porzellanhochzeit eine Fahrt mit dem Einweihungszug versprochen, und ich glaube, dass wir uns allmählich zum Bahnsteig begeben sollten. Meine Töchter bleiben in der Obhut ihrer Großmutter hier, bis wir zurückkehren. Wenn Sie den Damen Gesellschaft leisten und sie ein wenig beschirmen möchten – ich wäre Ihnen dankbar.«
Sophie nahm aus den Augenwinkeln wahr, wie ihre ältere Schwester Dorette bei diesen Worten hastig an sich herabsah, ihren umgeklappten Rocksaum mit dem Fuß zurechtstieß und das Schnürband ihres Huts weitete, damit es ihr bloß kein Doppelkinn machte. Unwillkürlich ahmte Sophie sie nach, doch beim Blick nach unten bemerkte sie vor allem, wie übertrieben lang die Pantalons von Ernst Drave waren. Alle Herren trugen die Hosen lang und strafften sie mit einem Band, das unter dem Schuh entlangführte. Doch seine waren so lang, dass er auf einem Stück des Saums herumtrat, das sich dabei mit Schmutz vollsog. Er hätte bei diesem feuchten Novemberwetter lieber Überschuhe tragen sollen, wenn es schon die lange Hose sein musste. So liederlich hätte ihre Mutter ihren Vater niemals aus dem Haus gehen lassen. Dem Mann fehlte offensichtlich eine Ehefrau.
»Ich denke, ich spreche für uns alle drei, wenn ich sage, dass es uns ein Vergnügen sein wird«, sagte er, und sein Atem duftete bis zu Sophies Nase nach Pfefferminz.
Sophies Mutter drehte sich zu ihr und Dorette um und schob die elfjährige Minna in ihre Richtung, die bisher vor ihr gestanden hatte. »Ihr habt es gehört, Mädchen. Seid brav und fallt den Herren und Großmama nicht lästig. Vater und ich sind bald zurück, der Zug fährt nicht weit. Gebt acht, dass die Kleinen nicht zu nah an die Pferde gehen. Man weiß nie, was die tun, wenn die Lok losrattert. Und bleibt vom Gleis weg. Da ist es gefährlich, und der Ruß verdirbt euch die Kleider.«
Großmama Grete schüttelte missmutig das Haupt. »Das ist wider die Natur des Menschen, so schnell zu fahren. Und dat Gedrüüs! Davon wird man ja doof. Gut, dass Großvater Johann das nicht mehr mit ansehen muss. Mich kriegen keine zehn Pferde in so einen Eisenbahnwagen!«
Sophies Vater lächelte ihr zu, während er seiner Frau den Arm reichte. »Es will dich ja gar keiner zwingen, Muttern. Wenn du nur auf die Kinder achtgibst. Nun komm, mein Dörchen, dass wir nicht die Begrüßungsrede verpassen.«
Mutter Dörchen hakte ihren Georg unter, und die beiden spazierten durch die Menschenmenge zum Haupteingang des neuen Bahnhofs, vorüber an einer mit Fässern vollbeladenen, sechsspännig gefahrenen Bierkutsche, die gerade entladen wurde, damit die Festlichkeit auf keinen Fall zu trocken verlief. Ja, besser war es, sich nicht zu nah bei den Pferden aufzuhalten. Sogar den nervenstarken, schweren Kaltblütern war das zischende Maschinenungetüm sichtlich schon im Stillstand und aus der Entfernung unheimlich.
Ernst Drave wandte sich seinem jüngeren Bruder zu. »Sag, Fritz, hast du nicht Lust, uns allen einen Punsch von der Bude da drüben zu holen? Die Damen möchten sich vielleicht damit aufwärmen? Es ist ja doch recht frisch, wenn man hier so lange auf dem Fleck steht. Was meinen Sie, Fräulein Dorette? Und gnädige Frau Brinkhoff?«
Es versetzte Sophie einen kleinen Stich, dass er sie übersah. Als ob Dorette mit ihren zwanzig Jahren bedeutend erwachsener gewesen wäre als sie mit ihren siebzehn!
Dorette trat vor, sodass sie nun deutlich näher bei den Herren stand als bei ihren Schwestern. »Ein warmes Getränk wäre eine Freude. Das ist ein wunderbarer Einfall.«
Die vier berieten darüber, was genau geholt werden sollte, und Sophie machte eine rasche Bestandsaufnahme der jüngeren Brinkhoffs. Die Kleinen, Luise und Johanna, spielten mit ihrer Freundin Emilie, die sie heute hatte begleiten dürfen, unter Großmama Gretes wachsamen Augen ein Hüpfspiel auf einem flink in den ungepflasterten Boden gekratzten Hinkekästchen. Dabei brach zwischen Johanna und Emilie schon der erste Streit ums Anfangendürfen aus.
Minna, die vierte im Schwesternquintett, starrte mit weit aufgerissenen Augen den Eltern nach. Bei ihr saß das Band ihrer niedlichen, kleinen Capote unter dem Kinn noch so stramm, wie ihre Mutter es beim Aufbruch gebunden hatte. Und weil sie äußerst folgsam war, würde es auch so bleiben. Sie tat Sophie ein bisschen leid, weil sie mit ihren elf Jahren noch hoffnungsloser zwischen den Stühlen saß als sie selbst. Für Hüpfspiele in der Öffentlichkeit war sie zu alt, für Gespräche mit den Herren viel zu jung.
Doch das war kein ausreichender Grund, um ein so elendes Gesicht zu ziehen. Weil die am Bahnhofsportal aufgestellte Blaskapelle nun voller Enthusiasmus einen Marsch blies und Sophie nicht gegen die Geräuschkulisse anschreien wollte, beugte sie sich zu ihrer halbwüchsigen Schwester herab.
»Du ziehst eine Grimasse, als müsstest du sauren Hering essen. Was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen?«
Minna sah sie mit Tränen in den Augen an. »Ich bin so dumm, Sophie. Ich hätte zuhause noch mal gehen sollen. Mutter hat es mir geraten. Aber …«
Sophie seufzte tief. »Ist es schrecklich dringend?«
Heftig nickend faltete Minna die Hände wie zum flehenden Gebet. »Ich kann es bald nicht mehr halten.«
Großmama Grete verhandelte mit den Hüpfmeisen die Regeln für ihr Spiel und überwachte gleichzeitig mit strengen Seitenblicken, dass Dorette und die jungen Herren den korrekten Abstand zueinander einhielten. Sie war also eindeutig unentbehrlich. Und Dorette würde böse werden, wenn Sophie sie von den charmanten Herren fortriss, um sie mit ihrer kleinen Schwester auf die Suche nach einem stillen Örtchen zu schicken. Also nickte sie Minna zu und ging zu ihrer Großmutter, um das eilige Vorhaben zu erklären.
Die blickte besorgt auf Minna. »Wat mutt, dat mutt. Aber lasst euch nicht auf Geschwätz mit fremden Leuten ein und kommt gleich zurück.«
Eilig machten sie sich auf den Weg zu einem vielversprechend aussehenden Gesträuch am Rande des Platzes. Man hatte den Bahnhof am nordöstlichen Stadtrand ein Stück außerhalb der alten Stadtmauer eingerichtet, wo die Schienenstrecke ohne hohen Aufwand entlanggeführt werden konnte. Außer dem neuen Bahnhofsgebäude mit seinem nur grob und vorläufig befestigten Vorplatz gab es hier vor allem Wiesen und Hecken. Dummerweise waren diesseits der Geleise die herbstlich kahlen Sträucher nicht blickdicht, und überall tummelten sich Schaulustige. Jenseits der Strecke hingegen, auf der Rückseite des Bahnhofs, gab es gewiss genug heimliche Winkel.
Hastig nahm sie Minna bei der Hand. »Wir gehen auf die andere Seite. Da ist es ganz einfach. Keine Angst, der Zug fährt noch nicht.«
»Mir ist alles gleich. Hauptsache, wir finden jetzt gleich etwas«, quetschte Minna gequält zwischen den Zähnen hervor.
Sie huschten über den flachen Bahndamm und fanden tatsächlich rasch einen passenden Winkel. Kurz darauf lachte Sophie über Minnas erleichterte Miene, als die wieder aus der Hecke auftauchte.
»So dumm bin ich nie wieder«, sagte die Kleine.
»Das werden wir sehen«, erwiderte Sophie und schnippte ihr gegen die Haubenkrempe.
Weit gemächlicher als auf dem Hinweg spazierten sie zurück zum Bahndamm. Eine Gruppe von zehn Arbeitern kam aus der anderen Richtung über die Wiese und wollte offenbar ebenfalls auf die andere Seite. Drei von ihnen trugen beschriftete Schilder an langen Stangen, doch die Worte waren aus der Entfernung nicht zu lesen. Die Entschlossenheit, mit der die Männer marschierten, wirkte allerdings bedrohlich, deshalb hielt Sophie Minna am Arm zurück und verlangsamte ihren Schritt.
»Warte. Lass die mal vorgehen, denen wollen wir lieber nicht zu nahe kommen.«
Minna gehorchte, war aber mit etwas ganz anderem beschäftigt. »Ich würde schrecklich gern mit dem Zug mitfahren. Schade, dass es nur so wenig Plätze gibt.«
»Du wirst schon eines Tages die Gelegenheit bekommen.«
Auf der anderen Seite des Bahndamms stießen sie gleich wieder auf die Arbeiter, die dort angehalten hatten und sich berieten. Sophie schlug einen Bogen um sie und fand sich mit Minna vor dem Nebeneingang des Bahnhofs wieder, von dem aus man direkt auf den Bahnsteig gelangte. Gerade da kam der Trupp mit den Schildern ihnen nach. Kurzentschlossen nahm Sophie Minna wieder an die Hand und ging mit ihr ins Gebäude.
»Na komm. Wenn du schon nicht mitfahren kannst, dann wollen wir dem Zug wenigstens nachwinken«, sagte sie.
Minna runzelte die Stirn. »Mutter hat doch verboten, dass wir …«
»Das hat sie doch nur wegen der Kleinen gesagt. Wir geben einfach gut acht. Und so schlimm rußt es auch gar nicht.«
Glücklicherweise war Minnas Wunsch, den Zug aus der Nähe zu sehen, noch größer als ihre Angst vor Mutters Schelte. Und sie war mit ihrem Wunsch nicht allein. Die Begrüßungsrede war offensichtlich schon vorüber, und bis auf ein paar Nachzügler hatten die geladenen Fahrgäste die Wagen bereits bestiegen. Dennoch war das Gedränge auf dem Bahnsteig so lebhaft, dass Sophie sich zum Weitergehen genötigt fühlte, bis sie schließlich ein Plätzchen gefunden hatte, von wo aus sie gut sehen konnten, ohne weitergeschoben zu werden.
Erst jetzt ließ sie den Blick über die Wagenfenster schweifen und sah sofort ihre winkende Mutter, die sie schneller entdeckt hatte als umgekehrt. Sie winkten zurück, und gleich darauf erschien das Gesicht ihres Vaters neben dem ihrer Mutter. Die beiden wechselten ein paar Worte, und dann rief ihr Vater sie heran.
Sophie stellte sich neben dem Fenster auf die Zehenspitzen, um zu verstehen, was er sagte, und Minna, die gleich wieder ein schlechtes Gewissen hatte, versteckte sich mit gesenktem Kopf halb hinter ihr.
»In unserem Abteil ist ein Platz frei geworden, weil eine Dame nun doch nicht mitfahren kann. Ihr großmütiger Gatte bietet uns gerade an, dass wir den Platz übernehmen. Sophie, frag Minna mal, ob sie mitfahren möchte. Aber schnell, es geht gleich los.«
Sophie lächelte. »Da muss ich nicht fragen. Ich bringe sie zum Einstieg, ja?«
Ihre Mutter lehnte sich weiter zu ihr heraus. »Aber du gehst dann zurück zu den anderen. Nicht dass du hier allein stehen bleibst!«
Wenig später bliesen ein paar Trompeter einen Tusch, die Dampfpfeife der Lokomotive heulte, dass es Sophie durch Mark und Bein ging, und für einen Augenblick wurde der Geruch nach Kohlenrauch und Maschinenöl so stark, dass sie die Luft anhielt. Eine dichte Dampf- und Rauchwolke breitete sich über den Bahnsteig aus, Ascheflocken schwebten herab und setzten sich bei den Leuten ins Haar und auf die Kleider. Erst in ganz langsamem, dann in schneller werdendem Rhythmus stieß die Lok ihre fauchenden Dampfstöße aus, und die Pleuelstangen begannen sich zu bewegen.
Da rollte er los, der Fortschritt, und Sophie applaudierte begeistert. Die gewaltige Kraft der Maschine aus der Nähe zu erleben ließ ihr einen Schauder der Ehrfurcht über den Rücken laufen. Beinah vergaß sie, ihren Eltern und Minna zu winken, und tat es erst, als sie kaum noch zu sehen waren.
Als der Zug in der Ferne verschwunden war, wandte sie sich dem Ausgang zu, kam jedoch nicht weit. Offenbar hatten sich die Arbeiter mit ihren Schildern so vor der Tür postiert, dass man nur einzeln an ihnen vorübergehen konnte. Dass viele Leute das tatsächlich taten, fand sie ein wenig töricht. Schließlich war die Begrenzung des Bahnsteigs noch provisorisch, sodass man ihn auch anderswo verlassen konnte. Sie kehrte um und strebte der nächstbesten Lücke in dem weißen Holzzaun zu. Doch als sie die Stelle erreichte, versperrten ihr zwei hagere junge Männer den Weg. Sie standen mit verschränkten Armen da und sahen aus, als wenn sie mit den anderen Arbeitern im Bunde wären, was Sophie ärgerte.
»Verzeihen Sie, hätten Sie die Freundlichkeit, mich durchzulassen? Ich möchte gern gehen.«
Der Schmalere der beiden, der fast noch ein Junge war und in Kleidung steckte, die nicht nur schäbig, sondern auch zu groß war, schnaubte herablassend. »Das ist hier nicht der Ausgang.«
Herablassend schnauben konnte sie auch, allerdings trat sie dabei vorsichtshalber einen Schritt zurück, um einen größeren Abstand zwischen sich und die Männer zu bringen. »Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin gar nicht so dumm, dass ich es für den Ausgang halte. Dennoch kann ich den Bahnsteig hier verlassen, und ich möchte es tun. Höflich wäre es, wenn Sie mir das ohne Aufhebens ermöglichen würden. Also?«
Der Zweite gab die abweisende Haltung mit den verschränkten Armen auf und nahm gemächlich seinen Filzhut ab. Seine Kleidung war ordentlicher als die des Ersten, und sie passte ihm. Er war auch ein paar Jahre älter. »Sind Sie eine Tochter von Herrn Brinkhoff?«
Woher wusste er das? Sie hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Wahrscheinlich hatte er sie gerade mit ihrem Vater zusammen beobachtet.
Sie nickte würdevoll. »In der Tat.«
Er vermied es, sie direkt anzusehen, und strich sich mit der Linken durch das zerzauste Haar, ohne dass es dadurch glatter wurde. »Dann gehören Sie zu den Herrschaften, die heute durch den richtigen Ausgang gehen und sich anhören sollten, was die Leute da zu sagen haben. Keine Angst, die werden Ihnen nichts tun. Sie wollen nur gehört werden.«
Seine Stimme war tief und sanft, sein ganzes Auftreten weniger feindselig als das des anderen. Zu wissen, wer sie war, und ihr dennoch den Weg zu verstellen, war allerdings eine Unverschämtheit, die sich auch mit einer noch so sanften Stimme nicht wettmachen ließ.
»Ich kann mir schon denken, was die Leute wollen. Mich geht das nichts an. Vater sagt es oft genug: Die Arbeiter wollen immer mehr Geld für weniger Arbeit und denken nicht darüber nach, wie das bezahlt werden soll. Ob ich mich dahinten im Gedränge hin und her schubsen und anschreien lasse, wird für niemanden einen Unterschied machen, außer dass es mir lästig und unangenehm ist.«
Nun sah er ihr auf einmal doch ins Gesicht, als würde er sie erst jetzt richtig wahrnehmen. Kräftig blau waren seine Augen, genau wie ihre eigenen, und sein Blick machte sie nervös.
»Glauben Sie immer alles so leicht, was Ihr Vater sagt? Haben Sie wirklich noch nie selbst darüber nachgedacht, warum Sie und Ihre Familie sich ein schönes Haus und all die teuren Sachen leisten können, während Arbeiterfamilien Angst haben müssen, dass ihnen die Kinder verhungern? Ganz ehrlich, das wüsste ich gern. Werden junge Frauen wie Sie wirklich so dumm gehalten?«
Sein Gefährte stieß ihn an. »Lass, Karl, das bringt nichts. Du siehst es doch. Mit Vernunft oder Betteln um Mitgefühl kommt man nicht weiter. Ich habe es dir gesagt: Streik ist das Einzige, was Erfolg bringen kann. Lass das Fräulein zu ihrem Kindermädchen zurückgehen.«
Karl schüttelte den Kopf. »Nee, warte mal. Ich würde die Antwort gern hören. Also, Fräulein Brinkhoff, sagen Sie mal: Wissen Sie, wie eine Arbeiterfamilie lebt?«
Sophie spürte, wie sie vor Ärger und Scham rot wurde. Wie konnten diese zwei Lumpen es wagen, ihren Vater anzugreifen? Ihm verdankten sie es doch, dass sie überhaupt Arbeit hatten! Leider hatte der Mann aber recht damit, dass sie nicht viel über den Alltag von Fabrikarbeitern wusste. Ihre Eltern achteten sorgfältig darauf, dass ihre Schwestern und sie mit der Unterschicht wenig zu tun hatten. Ihr Vater erzählte zwar gern Geschichten aus seiner Kindheit, als er mit seinen Eltern noch in einer baufälligen Hütte gewohnt hatte, doch das war lange her.
»Mein Großvater war ein einfacher Handwerker. Unseren Wohlstand verdanken wir seiner Willenskraft und seinem Fleiß. Es ist nicht recht, uns das zu missgönnen. Wer glaubt, er hätte nicht genug, der muss sich eben höhere Ziele setzen und brav dafür arbeiten. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.«
Die letzten Sätze hatte sie wortwörtlich von ihrem verstorbenen Großvater übernommen, der sie oft genug ausgesprochen hatte. Und da er der lebende Beweis für die Wahrheit seiner Behauptungen gewesen war, durfte man sie wohl glauben.
Karl sah sie noch immer an und machte dabei ein Gesicht, als würde er einen Wasserspeier bestaunen, der ihn zwar verblüffte, dem er aber lieber nicht zu nahe kam.
»Die Zeiten haben sich wohl geändert, seit Ihr Großvater seine Ziele erreicht hat. Heute braucht ein Mann vor allem erst einmal Geld, wenn er etwas erreichen will. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass es bei Ihrem Großvater anders war. Ist es nicht so, dass ihm damals jemand einen Kredit gegeben hat, damit er eine Kalkbrennerei pachten konnte? Ich nehme an, dass er wohlhabende Freunde oder Verwandte hatte. Was glauben Sie, was geschieht, wenn mein Freund Theo oder ich heute einen Bankier um einen Kredit bitten?« Er legte die Hand auf die Schulter seines Freundes, um ihr zu zeigen, wer Theo war.
Noch immer klang seine Stimme ruhig, obwohl die Situation alles andere als entspannt war. Dass sie hier in der Öffentlichkeit ein Streitgespräch führten, gehörte sich ganz und gar nicht. Unwillkürlich blickte sie sich nach Zeugen um, doch niemand achtete auf sie. Sie zuckte mit den Schultern.
»Ich bin sicher, dass mein Großvater Kredit erhielt, weil seine Geldgeber von seiner Geschäftstüchtigkeit überzeugt waren. Ob Sie oder Ihr Freund Theo Kredit erhalten würden, weiß ich nicht. Ich kenne Sie ja nicht. Und nicht jeder hat die Begabung, als Geschäftsmann zu überzeugen. Es kann ja auch nicht jeder zum Unternehmer werden.«
Karl lächelte spöttisch, und Sophies Herz machte einen kleinen Satz, weil er ihr schon wieder so direkt in die Augen sah. Das hatten die Herren, denen sie bisher begegnet war, noch nie auf diese Art gewagt. Sofort wich sie seinem Blick aus und sah nach unten, allerdings ohne den Kopf zu senken, weil es sich sonst angefühlt hätte, als würde sie sich vor ihm ducken. Seine dunkelgraue Wolljoppe war abgetragen, aber akkurat geflickt, die Hose ebenso. Sie hatte unauffällige Flicken auf den Knien und war keinesfalls so lang, dass er darauf herumtrat. Feucht war der Saum dennoch – wahrscheinlich, weil er wie die anderen Arbeiter über die Wiesen gekommen war, wo das Gras etwas höher stand. Sophie hatte sich in ihren feinen, aber undichten Halbstiefeln auf dem kurzen Marsch zum Gebüsch selbst nasse Füße geholt.
»Sie meinen, ein Unternehmer kann auch dann nicht jeder werden, wenn er sich die Ziele höher setzt und brav dafür arbeitet?«, fragte er. »Haben Sie sich selbst beim Reden zugehört, Fräulein? Wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Aber vielleicht denken Sie später wenigstens einmal darüber nach, ob Sie die Welt nicht anders sehen würden, wenn Sie davon ausgingen, dass es dem Großteil Ihrer Leute auch mit noch so viel Fleiß nicht offensteht, ihre Lage zu verbessern.«
Er trat zur Seite, wie es sein Freund Theo vorher schon getan hatte, und lud Sophie mit einer Geste ein, durch die Lücke im Zaun zu schlüpfen. Sie wusste, dass sie einfach hätte gehen sollen, doch sie ertrug die Vorstellung nicht, dass dieser Karl-Kerl sie nun endgültig für dumm hielt.
»Ach, und wie wäre es, wenn Sie einmal darüber nachdenken würden, welche Wahl mein Vater hat? Sie tun so, als würde er sich einen Dreck um seine Arbeiter kümmern, und das ist eine Gemeinheit. Er hat schon vor zehn Jahren eine Speiseanstalt für sie eingerichtet. Und was ist mit der Krankenkasse? Die war auch sein Einfall, und er hat sie durchgesetzt. Außerdem: Wo wären Sie denn alle, wenn er unsere Fabriken nicht aufgebaut hätte? Würde es Ihnen dann etwa bessergehen? Sie können doch froh sein, wenn es ihm gelingt, sein Unternehmen wirtschaftlich zu führen.«
Nun starrte sie ihm offen ins Gesicht, und er wich aus und ließ seinen Blick über den Bahnsteig schweifen. Sein Tonfall veränderte sich nicht, er sprach so nachsichtig mit ihr, wie gutmütige Menschen mit Kindern sprachen.
»Ich habe nicht behauptet, dass Ihr Vater ein Unmensch ist. Und die Krankenkasse ist eine gute Sache. Aber eine vorgesetzte Mahlzeit in der Speiseanstalt – das sind nur Almosen. Davon kann eine Familie nicht leben, während so einer Teuerung wie jetzt. Die Fabrikanten müssen endlich einsehen, dass ein Lohn nur gerecht ist, wenn man davon anständig leben kann. Und gerecht und anständig ist es auch nicht, wenn ein Mann jeden Tag mehr als zwölf Stunden arbeiten muss. Aber wahrscheinlich können Sie sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Früh in der Dunkelheit in die Fabrik, den ganzen Tag an den Maschinen, abends in der Dunkelheit todmüde wieder heraus – da bleibt nicht viel vom Leben, außer dem Sonntag. Und sogar der ist den Fabrikanten nicht immer heilig.«
Sophie konnte sich nicht entscheiden, ob sie sich durch seinen sanften Ton eher verärgert oder entwaffnet fühlte. Und tatsächlich brachte er sie dazu, sich zum ersten Mal vorzustellen, wie sich das Leben für jemanden anfühlte, der täglich länger als zwölf Stunden in der Fabrikhalle arbeitete. Das machte sie ein wenig kleinlaut.
»Immerhin haben Sie heute zur Feier des Tages frei bekommen. Dass Sie das ausnutzen, um allen das Fest hier zu verderben, finde ich auch nicht gerade anständig«, sagte sie dennoch.
Theo stieß einen tiefen Seufzer aus. »Karl!«, sagte er mahnend.
Der winkte ab und wandte sich ihr wieder zu. »Gestehen Sie mir wenigstens zu, dass ich nicht ganz unrecht habe?«
Sie ahnte, dass hier der Teufel um ihren kleinen Finger bat, und zögerte mit der Antwort. Doch ihre Ehrlichkeit siegte, und sie nickte. »Ein wenig recht haben Sie, und ein wenig recht habe ich. Vielleicht werde ich mich an einem anderen Tag einmal mit meinem Vater darüber unterhalten. Wer sind Sie denn eigentlich? Arbeiten Sie im Eisenwerk?«
Sein Blick wurde so durchdringend, als wollte er durch ihre Augen in ihre Seele sehen. »Ich arbeite in der Maschinenfabrik. An der Ernst August habe ich etliche Nieten eingeschlagen. Wenn Sie mit Ihrem Vater sprechen und ihn ein wenig zugänglicher für unsere Anliegen machen könnten, wäre das eine großartige Sache. Doch ich nehme eher an, dass er Ihnen erklären wird, dass die Verhältnisse eben so sind, wie Gott sie gewollt hat, und dass er daran nichts ändern kann und will. Und Sie werden es so hinnehmen und sich die nächste Tasse heiße Schokolade eingießen lassen, während unsere Frauen weiter Wassersuppe für die Kinder kochen.«
»Karl, jetzt hör auf damit! Gehen Sie lieber, Fräulein Brinkhoff. Sie haben nun schon mehr gehört, als wenn Sie den richtigen Ausgang genommen hätten. Sicher wartet Ihre Familie auf Sie«, mischte Theo sich ein.
»Ich kann jetzt noch nicht wissen, was ich am Ende glauben werde. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich die ›Verhältnisse‹ in nächster Zeit genauer betrachten werde. Und nun sollte ich in der Tat gehen«, sagte sie und nickte beiden hoheitsvoll zu.
Sie erwiderten ihr Nicken schweigend und ließen sie durch. Mit hocherhobenem Haupt wollte sie über den Bahnhofsplatz davonschreiten, ohne sich noch einmal umzusehen.
»Behling. Karl Behling ist mein Name«, rief der Mann mit der sanften Stimme ihr nach, und sie drehte sich prompt zu ihm um. »Wenn Sie mehr über unser Leben und die Verhältnisse erfahren möchten, dann kommen Sie mal in die Fabrik. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen.«
Sein Blick, seine Miene, seine Haltung: Alles an ihm lud sie ein, seine Worte zu erwidern. Das ging zu weit. Trotzdem nickte sie unwillkürlich, bevor sie sich wieder abwandte.
»Bist du verrückt?«, hörte sie Theo hinter ihr noch sagen. »Warum zur Hölle sagst du ihr deinen vollen Namen? Willst du deine Arbeit verlieren?«
»Lass mal. Ich glaube, die ist nicht so«, sagte Karl.
Und das machte Sophie in völlig unerklärlichem Maße stolz.
***
Karl war selbst nicht froh darüber, dass die Männer für ihren Protest die Bahnhofseinweihung gewählt hatten. Im Grunde hätte er lieber ebenso gefeiert wie die Bürger, die sich auf dem Vorplatz bei Blasmusik Bier und Bratwürste gönnten. Immerhin war der Zug, der eben aus der Stadt gedampft war, auch sein Werk. Und die Begeisterung, mit der die Bürger sich über ihren neuen Bahnhof und die Aussicht auf das Reisen mit der Eisenbahn freuten, hätte eigentlich auch für die Arbeiter ein Grund sein sollen, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Deshalb gab ein winziger Teil von ihm dem niedlichen, weiß behandschuhten Fräulein Brinkhoff recht, wenn sie beklagte, dass sie den Feiernden die Stimmung verdarben.
Der vernünftigere Teil von ihm wusste allerdings, dass er und die anderen sich an diesem Tag keine Wurst hätten leisten können – abgebrannt, wie sie alle waren. Und gerade deshalb war es eben der richtige Tag, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen.
»Was soll das heißen, ›Die ist nicht so‹?«, fragte Theo und starrte ihn fassungslos an. »Kennst du sie insgeheim schon länger? Auf mich wirkte sie nämlich wie jede andere verwöhnte Gaffeltange ihrer Klasse. Die geht nun zu ihrem Ollen und erzählt, dass da ein Herr Behling in seiner Fabrik arbeitet, der die Gesellschaftsordnung umstürzen will. Und denn?«
»Wir wussten doch alle, dass uns hier jemand erkennen kann. Ich kneife nicht davor. Brinkhoff kann mir nicht verbieten, mich hinzustellen und den Leuten zu erzählen, wie es mir und meinen Freunden geht. Und ich wette mit dir, dass dieses Fräulein nicht heimtückisch ist. Sie wird uns nicht anschwärzen. Die hat so was Verständiges im Blick. Na, was soll’s. Ich glaube, wir können gehen, der Bahnsteig ist leer.«
Er hätte noch genauer erklären können, warum er dem Fräulein nichts Böses zutraute, aber das war nichts für Theos Ohren. Mit ihr zu sprechen hatte bei Karl ein seltsames Flattern in der Brust verursacht. Hübsch war sie, und nicht nur hübsch herausgeputzt, obwohl es ihrem Kleid gewiss nicht an rosigen Volants und Rüschen mangelte. Aus dem Tuch und Taft von so einem Kleid hätte man auch drei machen können. Aber so etwas beeindruckte ihn nicht. Ihre Haltung war es vielleicht gewesen, ihre Augen auf jeden Fall. Da war so ein Vorwärtsdrang an ihr, der nicht nur damit zu tun hatte, dass sie an ihm vorbeiwollte. Im Gegenteil – er hatte das Gefühl gehabt, dass ein Teil von ihr gar nicht an ihm vorbei, sondern eher zu ihm hin gewollt hatte.
Sie interessierte ihn, und das passierte ihm zum ersten Mal bei einer Dame der besseren Gesellschaft. Die meisten von denen waren für ihn so unsichtbar wie er für sie.
Theo stampfte mit den Füßen auf. »Worauf warten wir dann noch? Ich habe nasse Füße, mir ist schlotterkalt, und der Weg ist weit. Ich hoffe, Lina hat Kohlen aufgetrieben und die Stube ein bisschen eingeheizt. Bin gespannt, was die zu deinem Geplauder mit dem Fräulein sagt. Sie wird dir schön den Kopf waschen, nehme ich an.«
Karl setzte seinen Hut auf und ging durch die Lücke im Zaun. Zurück nach Linden würden sie auf dem geraden Weg durch die Stadt wandern, statt sich hinter dem Bahnhof über die Wiesen zu schlagen, wo sie sich auf dem Hinweg mit den anderen getroffen hatten. Die würden jetzt auch wieder auseinandergehen und den Heimweg jeder für sich allein antreten. So waren sie schwerer zu fassen, falls ihnen noch jemand Scherereien wegen ihres Auftritts machen wollte und ihnen die Polizei nachschickte.
Er wünschte nur, Theo und er hätten einen Bissen Proviant für die Reise. Eine Dreiviertelstunde würden sie mindestens laufen. Leider hatte er seine letzten Pfennige Lina gegeben. Blieb nur zu hoffen, dass sie davon etwas zu essen besorgt hatte.
»Warum willst du Lina davon erzählen? Je weniger sie weiß, desto weniger Sorgen macht sie sich«, sagte er.
Theo lachte freudlos. »Man sollte meinen, dass du deine Frau besser kennst. Sie weiß genau, dass sie mehr Grund zur Sorge hat, je weniger du ihr erzählst.«
»Dummes Zeug. Ich erzähl ja nie viel. Sag mal, du hast wohl auch keinen verirrten Pfennig mehr in der Tasche?«
»So weit kann sich bei mir kein Pfennig verirren, dass ich ihn nicht längst aufgespürt hätte.«
Sie gingen durch die nicht allzu dicht gedrängte Menschenmenge auf dem Vorplatz, und Karl konnte dem Drang nicht widerstehen, nach Fräulein Brinkhoff Ausschau zu halten, obwohl er ihrer Familie ganz gewiss nicht begegnen wollte. Tatsächlich entdeckte er sie in einiger Entfernung. Sie stand bei drei Herren und einer weiteren jungen Dame in gerüschtem Kleid und bekam gerade einen dampfenden Becher gereicht. Er wandte den Blick ab, um Theo nicht auf seine Neugier aufmerksam zu machen. Mochte der seiner Schwester ruhig von dem Gespräch auf dem Bahnsteig erzählen, das würde er schon herunterspielen können. Aber er wollte nicht den Spott der beiden aushalten müssen, wenn sie auf den Gedanken kamen, dass er so ein Bürgerfräulein interessant fand. In dem Fall würde er lieber jeden Tag gleich noch zwei Stunden länger arbeiten als die üblichen zwölf.
Erst als er mit seinem Freund und Schwager den Bahnhofsvorplatz verließ, blickte er noch einmal zurück. Doch es hatten sich zu viele Menschen zwischen sie und ihn gedrängt, er sah sie nicht mehr. Zu seinem Erstaunen nagte das Bedauern darüber mindestens so stark an ihm wie der Hunger in seiner Magengrube.
2. Kapitel
Linden, 25. Februar 1848
Sophies Mutter trug die Vase mit den sechs eisernen Rosen vom Kaminsims zu ihrem Platz am Esstisch und setzte sich. Einzeln nahm sie die Rosen aus der Vase und reinigte jedes Blütenblatt und jedes Stengelgrübchen mit einem weichen Pinsel, bevor sie die täuschend echt bemalten Kunstwerke auf ein ausgebreitetes Geschirrtuch legte. Keine der Rosen war genau wie die andere, man konnte sie leicht unterscheiden. Nach der Geburt ihrer Jüngsten hatte ihr Mann ihr für jedes Kind, das sie ihm auf die Welt gebracht hatte, von einem Kunstschmied eine Rose anfertigen lassen. Aus Eisen hatten sie sein müssen, weil das Eisen ihm so viel bedeutete. Fünf für die lebenden Schwestern waren es und eine Knospe für ihren als Kleinkind verstorbenen Bruder.
Unzählige Male hatte Sophie ihrer Mutter schon bei der Rosenreinigung zugesehen und unlängst durchschaut, dass sie sich diese Arbeit mit Vorliebe vornahm, wenn etwas sie beunruhigte.
»Machst du dir Sorgen, dass die Revolution auch zu uns kommt, Mutter?«, fragte sie.
Am Vormittag hatte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet: In Frankreich hatten sich die Bürger gegen ihren König aufgelehnt und ihn gewaltsam zur Abdankung gezwungen. Angeblich war das Land nun wieder eine Republik, in der nur noch das Volk herrschte.
Ihre Mutter legte Dorettes Rose ab und nahm die von Luise zur Hand. »Ich bin froh, dass die Politik mich nichts angeht. Aber euer Vater ärgert sich, weil er glaubt, dass diese Sache dem Geschäft schaden wird. Und wir haben im vergangenen Jahr einige Verbindlichkeiten angehäuft. Ich muss überlegen, wie wir unseren Frühlingsball ausstatten, ohne das Haushaltsbudget zu überschreiten. Jedenfalls müssen wir bald die Einladungen versenden. Deine Handschrift ist die feinste, Sophie. Ich gehe davon aus, dass du das Adressieren übernimmst.«
Dorette, die am Fenster saß und mit gerunzelter Stirn einen Riss im Seidenfutter ihres Reithuts ausbesserte, sah zu ihnen herüber. »Mir soll es zwar auch recht sein, wenn es nur eine kleine Tanzgesellschaft wird. Aber ich glaube nicht, dass irgendwelche Revolution bis ins hannöversche Land kommt. Hier ist alles anders als in Frankreich. Unser alter König mag ein Knurrhahn sein, aber er drangsaliert doch niemanden bis aufs Blut. Mir kommt es vor, als kämen bei uns alle Klassen recht gut miteinander aus.«
Sophie hatte oft an ihre Begegnung mit Karl Behling zurückgedacht, aber bis zu diesem Morgen nicht ernsthaft geplant, die Fabrik aufzusuchen. Nicht einmal mit ihrem Vater hatte sie über die Angelegenheit gesprochen, weil sich kein passender Zeitpunkt dafür gefunden hatte. Er war in letzter Zeit so stark mit der Unternehmensführung beschäftigt, dass er jeden Abend erst spät heimkam.
Doch was sie heute über die Revolution gehört hatte, weckte ihre Wissbegier. Wie dachten wohl die Lindener Arbeiter über das Geschehen? Zu gern hätte sie Herrn Behling danach gefragt. Aber welchen Anlass konnte sie dafür finden, die Werkshallen zu betreten? Müßig blätterte sie die ungelesene Seite in dem Lehrbuch der englischen Sprache um, das vor ihr auf dem Tisch lag. Ihr Vater würde sich gewiss wundern, wenn sie auf einmal so dringendes Interesse an den Arbeitsstätten zeigte. Aber sie würde sich etwas einfallen lassen. Wo ein Wille war, da war auch ein Weg.
26. Februar 1848
Obgleich die Mahlzeiten immer ein wenig angespannt verliefen, wenn ihr Vater zugegen war, freute nicht nur Sophie sich darüber, dass er seine Anwesenheit für den Samstagabend fest zugesagt hatte. Johanna, Luise und Minna hatten sich vorgenommen, ihn mit dem Vortrag einiger Gedichte zu beeindrucken, die sie in der Schule auswendig gelernt hatten, Dorette wollte ihn davon überzeugen, dass sie einen neuen Sattel für ihre Stute brauchte, und Großmama war der Ansicht, dass er zu viel arbeitete und Erholungspausen im Kreis seiner Familie dringend nötig hätte. Ihre Mutter betrachtete ohnehin jeden Abend, an dem er fehlte, als schlimmen Verlust. Gemeinsame Mahlzeiten waren ihr so wichtig, dass sie am liebsten sogar täglich zwei davon auf die Bühne gebracht hätte, wenn das mit den alltäglichen Verpflichtungen zu vereinbaren gewesen wäre.
Dabei verursachte jede dieser Inszenierungen gerade für sie einen hohen Aufwand, denn sie bestand darauf, dass ihre Tafel in Anwesenheit des Hausherrn hohen Ansprüchen genügte. Der Tisch musste makellos eingedeckt werden, und Nachlässigkeiten bei der Garderobe der Familienmitglieder und des Personals wurden nicht geduldet. Ihr Gatte sollte nie davor zurückscheuen müssen, ohne Vorankündigung Gäste mitzubringen.
In Wahrheit tat er das nur so selten, dass Sophie sich nicht an das letzte Mal erinnern konnte. Wenn er Geschäftsfreunde ins Haus brachte, war ihre Mutter in der Regel rechtzeitig davon unterrichtet.
Deshalb überraschte es sie alle, als er an diesem Samstagabend ohne Vorwarnung in Begleitung seines Ingenieurs Alfred Lonard das Esszimmer betrat. Sophie hatte den jungen Mann seit dem Tag der Bahnhofseinweihung nicht mehr gesehen, jedoch ihren Vater mehrfach seinen Arbeitseifer loben hören. Sie vermutete, dass in diesem Eifer der Grund dafür lag, dass Herr Lonard viel schmaler und bleicher auf sie wirkte als bei ihrer letzten Begegnung. Mit seinem zarten Bartflaum, den großen braunen Augen und seinen unbeholfenen Bewegungen wirkte er zudem wie ein Jungvogel, der darum bat, bemuttert zu werden.
Was auch ihre Mutter offenbar so empfand, denn sie ließ ihm nicht einmal Zeit, seinen Mantel abzulegen, bevor sie ihm die Speisefolge aufzählte.
»Wie wunderbar, dass Sie uns heute mit Ihrem Besuch beehren, lieber Herr Lonard. Mögen Sie Escalopps mit Senfsoße? Aber gewiss mögen Sie das, es ist die Leibspeise meines Gatten, und die Herren wissen ja, was gut ist, nicht wahr? Zuvor ein Süppchen von zartem Krebsfleisch und Gemüse, reichlich nahrhafte Kartoffelklöße zum Hauptgang, und für später zaubert unsere Köchin ein paar feine Süßspeisen. Luise, häng den Mantel des Herrn in Vaters Arbeitszimmer vor den Ofen, damit er nachher schön warm und trocken ist.«
Alfred Lonards Wangen färbten sich flüchtig rosa. »Ihr Gatte war so freundlich, mir zu versichern, dass es Ihnen keine Ungelegenheiten machen würde, wenn ich ihn begleite. Nehmen Sie bitte keine besondere Rücksicht auf mich. Ich bin sehr dankbar für die Einladung.«
Es war ein wenig putzig anzusehen, wie die zehnjährige Luise, die Herrn Lonard knapp bis zur Schulter reichte, ihm aus dem Mantel half, als er Schwierigkeiten damit hatte, aus den Ärmeln freizukommen. Sophie sah, wie ihre kleine Schwester verstohlen über seine Ungeschicklichkeit schmunzelte, als sie das Esszimmer mit dem Mantel verließ. Wenn ihre Mutter das kleine Grinsen ebenfalls gesehen hatte, würde es nachher Schelte setzen.
Ihre Mutter hatte inzwischen durch das Dienstmädchen ein weiteres Gedeck auflegen lassen, und bald darauf saß der Gast zur Linken ihres Vaters und löffelte gemeinsam mit ihnen die nach Dill duftende, recht salzige Suppe. Im Schein der Kerzen, die sich im Tafelsilber spiegelten, sah sein Gesicht schon nicht mehr ganz so bleich aus. Dorette saß ihm direkt gegenüber, während Minna und die beiden Kleinen seine linke Seite flankierten. So hatte ihre Mutter es eiligst eingerichtet. Sophie hatte ihren Platz neben Dorette.
»Wir haben heute einen Grund zum Feiern«, sagte ihr Vater, als das Dienstmädchen begann, die Suppenteller abzutragen. »Herr Lonard hat die Lösung für ein technisches Problem bei unserem neuen Lokomotivenmodell gefunden. Die Einzelheiten würden euch zweifellos langweilen, aber zur Kenntnis möchte ich es euch doch geben, dass wir hiermit wieder einen Schritt auf unserem Weg gegangen sind. Die Brinkhoff’sche Maschinenfabrik wird in Zukunft immer genannt werden, wenn man über Lokomotiven spricht.«
Sophies Mutter hob ihr Glas zum Toast. »Bravo, Herr Lonard. Wir sind stolz auf Sie.«
Dorette tat es ihr gleich. »Ja, bravo. Obgleich ich gestehe, dass ich ein schönes Pferd jeder Lokomotive vorziehe. Pferde sind weit anmutiger und angenehmer zu streicheln.«
Die Gesichtsfarbe von Herrn Lonard wurde erneut rosig. »Ich verstehe Ihren Einwand, Fräulein Dorette. Doch ist das Pferd nicht jederzeit so vertrauenswürdig wie eine gut gepflegte Maschine, nicht wahr? Die meisten Tiere neigen zu einer gewissen Unberechenbarkeit, die ich, offen gestanden, schon immer ein wenig beunruhigend fand.«
Er warf Sophies Vater einen verstohlenen Seitenblick zu, als wollte er sich vergewissern, dass das Eingeständnis seiner kleinen Schwäche bei seinem Vorgesetzten keine Ablehnung hervorrief. Er erinnerte Sophie an die linkische Minna, die ihren Eltern oft ebensolche Blicke zuwarf, weil sie meistens von der Sorge gequält wurde, ihnen zu missfallen.
Der Herr des Hauses lachte gutmütig und lehnte sich bequem im Stuhl zurück, um dem Dienstmädchen zu ermöglichen, seinen Teller fortzunehmen.
»Unsere Dorette ist der einzige Mensch, den ich kenne, der sich durch kein Pferd einschüchtern lässt. Möge es noch so ungestüm und schreckhaft sein – meine Tochter wird ihm einen Sattel auflegen! Aber, Dorette, du solltest nicht unterschätzen, wie anmutig eine gut gemachte Maschine auf jemanden wirken kann, der etwas davon versteht. Und Herr Lonard ist der richtige Mann, um unseren Maschinen nach und nach jede Plumpheit auszutreiben. Ich schätze seine Begabung sehr und hoffe, dass er unserem Unternehmen noch lange erhalten bleibt.«
Herr Lonard richtete sich noch etwas gerader auf. »Das ist wirklich zu gütig, Herr Brinkhoff. Und ich versichere Ihnen, dass ich mich Ihrem Unternehmen tief verbunden fühle. Mir ist bewusst, dass wir in einem harten Konkurrenzkampf stehen und es etliche Widrigkeiten zu bewältigen gilt. Aber, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Ihre neue Rolle im Gewerbeverein wird sicher einen positiven Einfluss auf die Gesamtlage haben.«
»Das wollen wir hoffen. Doch davon später, wenn wir beide nach dem Essen noch ein Gläschen zu uns nehmen. Denn die Damen interessieren diese trockenen Sujets in der Regel nicht. Nicht wahr, Dörchen? Das Geschäftliche halten wir möglichst fern von unserer Tafel.«
Sophie sah endlich ihre Chance gekommen.
»So trocken finde ich das gar nicht, Vater. Gerade vorhin dachte ich bei mir, wie gern ich einmal die Fabrik besuchen würde. Wir haben allen Grund, stolz auf das zu sein, was du in deinem Unternehmen leistest, und ich hätte gern ein genaueres Bild davon.«
Die beiden Herren sahen sie an, als hätte sie sich einen Elefanten als Schoßtier gewünscht, und ihr Vater schüttelte sacht den Kopf.
»Du machst dir keine Vorstellung davon, wie schmutzig es in den Werkshallen ist, mein Phinchen. Du würdest dir ganz gewiss ein Kleid ruinieren. Ungefährlich ist es auch nicht, wenn man nicht weiß, was man tut. Auch würden das Werk und die eiligen Bewegungen auf dich wohl nur wie ein großes Durcheinander wirken, denn du würdest ja nicht verstehen, was vorgeht. Und erklären kann man es dort kaum, denn der Lärm … Ich sage nicht Nein, aber überleg es dir noch einmal. Ich rate dir jedenfalls davon ab.«
Er sah sie liebevoll an, und sie nickte errötend. Herr Lonard musste sie jetzt für schrecklich dumm halten. Aber immerhin hatte ihr Vater ihr nicht gleich alle Hoffnung genommen.
»Wenn Sophie eine Führung durch die Fabrik bekommt, dann möchte ich das auch«, warf Dorette ein. »Ich bin doch neugierig, ob mir jemand die Anmut der Maschinen begreiflich machen kann.«
Ihre Mutter stieß ein leises »Ts!« aus, was der schärfste Tadel war, den sie ihren Töchtern in Anwesenheit von Gästen jemals zukommen ließ. »Vater hat es doch schon gesagt, Dorette. Ihr Mädchen würdet in der Fabrik nur stören. Frauen sind dort fehl am Platz.«
Das allerdings konnte Großmama Grete nicht so stehen lassen. Sie hob mahnend den Zeigefinger. »Na, na, na! Als Grootvader Johann noch war, da bin ich oft in die Kalkbrennerei oder zur Ziegelei gegangen, um ihm sein Essen zu bringen. Und wenn er was neu angeschafft oder eingerichtet hatte, hat er’s mir immer gern gezeigt. Auch wenn man als Fruunsminsch vielleicht nicht viel davon versteht, dann ist es doch, wie unsere Sophie sagt: Man hat ein besseres Bild davon, worum es geht. Und wenn es etwas gab, wobei ich helfen konnte, dann hab ich das auch gern getan und mit angefasst.«
»Das waren noch andere Zeiten, Muttern«, erwiderte Sophies Vater. »Gerade dass du so viel arbeiten musstest, mahnt mich, dass es meinem Weib und unseren Mädchen anders ergehen soll. Für Frauen des besseren Standes gibt es doch im Haus genug zu tun, da müssen sie nicht noch Arbeit leisten, für die sie nicht geboren sind.«
»Aber es ist doch auch schön, wenn man bei einer wichtigen Arbeit helfen kann«, wandte Sophie ein. Die Worte waren heraus, noch bevor sie davor zurückschrecken konnte, noch einmal das Wort zu ergreifen.
»Das ehrt dich«, sagte ihr Vater. »Aber wenn du deiner Mutter hilfst, dann hilfst du auch bei einer wichtigen Arbeit. Glaubt nicht, dass ich unterschätze, was es bedeutet, einen großen Haushalt wie den unseren zu führen. Wenn es euch eines Tages gelingt, für eure Ehemänner ein ebenso schönes Heim zu schaffen, dann dürft ihr darauf stolz sein.«
Luise rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Für ihre Verhältnisse hatte sie erstaunlich lange stillgesessen und den Mund gehalten, doch nun platzte es aus ihr heraus.
»So gut wie Mutter wird das keine von uns schaffen. Aber ich werde einfach viel mehr Kinder bekommen, die mir dann alle helfen müssen.«
»Ich wünsche dir, dass deine Kinder alle so einsichtig und hilfsbereit werden wie die meinen, Luise. Auf die Art wird dein Haushalt gewiss gut gedeihen«, sagte ihre Mutter.
Es war unnachahmlich, wie sie einen tadelnden Blick mit einem zarten Lächeln verbinden konnte, fand Sophie. Luise erstarrte unter der durchdringenden mütterlichen Aufmerksamkeit auf ihrem Stuhl prompt wieder zum Sinnbild der wohlerzogenen und hilfsbereiten jungen Dame.
Die kleine Johanna hingegen schien auf dem Platz neben Luise zu schrumpfen. Als jüngstes Familienmitglied hatte sie die wenigsten ernst zu nehmenden Pflichten im Haushalt. Das war ihr auch mit ihren acht Jahren schon bewusst. In diesem Moment schämte ihre Kleine sich vielleicht dafür, dass sie zum Gedeihen des Haushalts wenig beitrug, doch im Allgemeinen war es ihr nur allzu recht, wenn sie bei der Verteilung von Aufgaben übersehen wurde. Mucksmäuschenstill zog die kleine Träumerin sich dann mit einem Buch in einen Winkel zurück, wo sie möglichst niemandem auffiel.
Wie verschieden sie alle waren! Die Selbstsicherste von ihnen war Dorette, vielleicht weil sie als Älteste schon ihr Leben lang daran gewöhnt war, dass man sie ernster nahm als die jüngeren Geschwister. Vielleicht lag es aber auch daran, dass sie tatsächlich seltener Grund hatte, an ihren Entscheidungen zu zweifeln. Wenn Dorette zielsicher ein Kleid, ein Pferd, ein Accessoire oder ein Bonmot auswählte, dann passte es stets auffallend gut zu ihr und den Umständen. Und wenn sie sich auf eine neue Mode einließ, dann konnte man sich darauf verlassen, dass dieser Mode bald auch andere folgten. Manchmal hätte Sophie ihrer großen Schwester gern Tinte dafür auf den Rock gegossen, dass sie so von sich selbst überzeugt war und es auch sein durfte.
Wie Herr Lonard sie wohl sah? Bewunderte er Dorette, oder war sie ihm zu vorlaut und zu direkt? Besonders wohl schien er sich in ihrer familiären Runde nicht zu fühlen, und das war schade, denn Sophie mochte ihn. War es angebracht, ein neues Gesprächsthema aufzubringen? Was war unverfänglich und doch interessant genug, um mit ihm bei Tisch darüber zu sprechen?
»Herr Lonard, darf ich fragen, ob Sie die Einladung zu unserem Frühlingsball erhalten haben?«, preschte sie mit dem nächstbesten Einfall vor. »Unser Kutscher sagte, er hätte sie bei Ihrer Haushälterin abgegeben.«
»Oh ja, vielen Dank. Sie gab sie mir gerade heute früh. Wie unaufmerksam von mir, dass ich mich noch nicht für Ihre Freundlichkeit bedankt habe. Ich hole das hiermit nach. Leider weiß ich heute noch nicht, ob es mir möglich sein wird zu kommen. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Zudem muss ich Sie auch warnen: Ich bin kein herausragender Tänzer. Obwohl ich den gelegentlichen musikalischen Abend liebe und mir Mühe gebe mitzuhalten.«
Dorette lächelte ihn an. »Ich glaube, Sie stellen Ihr Licht unter den Scheffel. Die beiden Herren Drave nannten Sie neulich einen begeisterten und schwungvollen Tänzer.«
Wie Lonards Blick an Dorettes Lippen hing, wenn sie sprach! Sophie konnte sich gerade noch davon abhalten, mit den Augen zu rollen. Da hatte sie ihre Antwort: Zweifelsfrei bewunderte er ihre Schwester. Eilig ergriff sie das Wort, um nicht gleich wieder aus dem Gespräch gedrängt zu werden.
»Wovon hängt es denn ab, ob Sie kommen? Können wir etwas tun, um Ihre Entscheidung zu unseren Gunsten zu beeinflussen?«
Er räusperte sich und wandte sich ihr mit leichter Verzögerung zu. »Meine Entscheidung hängt mit einer Angelegenheit zusammen, die ich hoffe, heute Abend noch mit Ihrem Herrn Vater besprechen zu dürfen.«
Nun war er hochrot und so offensichtlich verlegen, wie er es gewiss nicht gewesen wäre, wenn er bloß über eine rein geschäftliche Sache hätte sprechen wollen. Sophie spürte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Was konnte der junge Mann wollen? War es kindisch, wenn sie annahm, dass es mit Dorette zu tun hatte oder gar mit ihr selbst? Aufregung breitete sich in ihr aus und machte ihre Hände fahrig. Sogleich ließ sie einen Tropfen Senfsoße auf das weiße Tafeltuch fallen, als sie sich an der Sauciere bediente. Glücklicherweise bemerkte niemand ihr kleines Missgeschick.