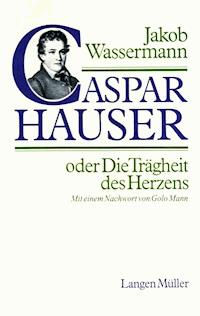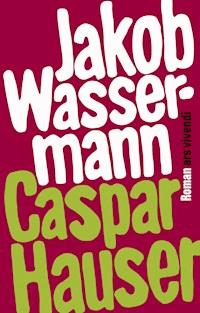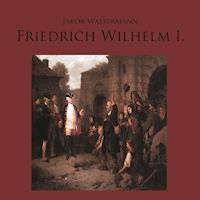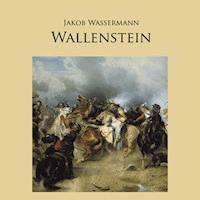Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei sehr ungleiche Freunde stellen gewissermaßen den Rahmen dieses Romans dar – der eine Arzt, der andere Privatgelehrter und der dritte angehender Diplomat. In ihrer Mitte aber bewegt sich Franziska, die mit ihrer Hilfe einen bemerkenswerten Start am Theater hinlegt. Sie liebt den einen, liebt den anderen und bald gesellt sich zu den Vieren noch der junge, aber eher introvertierte Ingenieur Hadwiger. Am Ende eines Sommers treffen sie sich alle in einem Landhaus, Franziska wie immer der strahlende Mittelpunkt der Gruppe. Sie hat einen wertvollen Spiegel mitgebracht, den sie den Freunden schenkt. Wichtiger aber ist noch, dass sie ihnen das Versprechen abnimmt, sich in genau einem Jahr an gleicher Stelle wieder zu treffen. Die Freunde finden sich rechtzeitig ein, nur Franziska erscheint erst im letzten Moment, um Jahre gealtert. Sie überrascht die Freunde mit der Idee, dass derjenige den Spiegel sein Eigen nennen soll, der die ergreifendste Geschichte erzählen kann. Es folgen denkwürdige Stunden, in denen unterhalten oder mit dem Leben abgerechnet wird.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jakob Wassermann
Der goldene Spiegel
Erzählungen in einem Rahmen
Saga
Ebook-Kolophon
Jakob Wassermann: Der goldene Spiegel. © 1911 Jakob Wassermann. Originaltitel: Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711488324
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Ich widme dieses Buch meiner Frau
O thou whose face hath felt the Winter’s wind
Whose eye has seen the snow-clouds hung in mist
And the black elm-tops ’mong the freezing stars
To thee the Spring will be a harvest time.
O thou, whose only book has been the light
Of supreme darkness which thou feddest on
Night after night when Phoebus was away,
Tho thee the Spring shall be a triple morn,
O fret not after knowledge, I have none,
And yet my songs comes native with the warmth
O fret not after knowledge, I have none
And yet the evening listens.
He who saddens
At thought of idleness cannot be idle,
And he’s awake who thinks himself asleep.
Keats
Franziska und die Freunde
Drei junge Leute von besonderer Art lernten auf einem Ball im Künstlerhaus ein siebzehnjähriges Mädchen kennen, das sehr liebreizend war, Franziska hiess, die Schauspielkunst studierte und das Leben liebte. Sie trug ihre Armut wie eine vorläufige Hülle, und die Daseinsstimmung, in der sie sich befand, wird am besten verglichen mit der morgendlichen Munterkeit eines kräftigen und entschlossenen Bergsteigers.
Was die jungen Männer betrifft, so waren es Söhne aus reichen und geehrten Familien, und sie standen in der Reihenfolge der Jahre zwischen dreiundzwanzig und achtundzwanzig, die der Freundschaft noch angemessen ist. Eine Aufzählung im Steckbriefstil mag die genauere Bekanntschaft mit ihnen vorbereiten. Rudolf Borsati war Arzt, mittelgross von Figur, ziemlich fett, doch immerhin elegant in der Erscheinung, von Bart und Haar blond wie türkischer Tabak, von Gemütsart verträglich, schmiegsamen Geistes und in den Manieren von charaktervoller Liebenswürdigkeit. Die Klientel brachte ihm nur geringen Verdienst, er selbst war sein treuester Patient, denn er beobachtete mit aufmerksamer Hypochondrie die Entstehung und den Wechsel einer grossen Zahl von Krankheiten in seinem eigenen Körper. Georg Vinzenz Lamberg, ein stattlicher, brünetter, passioniert aussehender Mensch, der im Gang und im Gehaben etwas Fürstliches hatte, eine rasche, aufsammelnde, entscheidende und entschiedene Selbstherrlichkeit, war Archäolog ohne Amt, Privatgelehrter ohne bestimmte Richtung, ein Sonderling mit leidenschaftlichen Neigungen, der sich zu den Dingen und den Kreaturen in ein Verhältnis voll Tyrannei und Abwehr begeben hatte. Am meisten auf das Äussere der Welt und das Tätige des Lebens gerichtet war Cajetan von Prechtl, deshalb hatte er auch Franziska zuerst für sich gewonnen. Er war angehender Diplomat, hatte Ehrgeiz, und in seinem altschmalen Gesicht sassen zwei dumpfglänzende Augen mit dem starken und weithinausschauenden Blick eines zielgewissen Schützen. Eine fantasievolle Welterfahrung war ihm eigen, die ebensogut auf einen Dichter wie auf einen künftigen Staatsmann schliessen lassen konnte und durch eine seltsame Verschwisterung politischer und romantischer Elemente jedenfalls bemerkenswert war.
Ihm glückte es, dem Direktor eines der ersten Theater für Franziska Teilnahme einzuflössen. Ihr Debüt war ein Triumph. Die Poesie ihres Lächelns, ihrer Geberde, ihrer Haltung verlieh der mittelmässigen Komödie einen Schein von Tiefsinn und Elan, und selbst diejenigen, die ihre Schönheit auf Kosten ihrer Begabung lobten, räumten ein, dass hier persönlicher Zauber wie Genie wirke. Borsati fand sein Gemüt bewegter, als er dem jüngeren Freund gestehen mochte, aber Cajetans wechselsüchtiges Herz hatte sich unlängst für eine andere entzündet, und nachdem sich die Beiden gegeneinander ausgesprochen, gelang es Borsati bald, Franziskas Gunst zu erwerben. Er erhob sie, indem er sie trug, und förderte sie, indem er ihr huldigte. Es war ein zartes Verhältnis und voll Kameraderie, doch konnte es den Lebensdurst des jungen Mädchens weder befriedigen, noch verringern; ihr war immer, als ob sie viel, als ob sie alles versäumte, und je mehr sie zur Frau reifte, je ungestümer fühlte sie sich aufgefordert, dem Ruf ihrer gestaltlosen, aber feurigen Träume zu folgen.
An einem bestimmten Abend in jeder Woche fanden sich Cajetan und Georg Vinzenz bei Franziska und Borsati ein, und bei gutem Essen und vortrefflichen Weinen verplauderten sie oft die halbe Nacht. Eines Tages brachte Borsati einen fremden jungen Mann zu diesem Symposion mit, einen Menschen von nicht sehr gepflegtem Äusseren und eckigem Betragen, der sich Heinrich Hadwiger nannte und Ingenieur war. Von den befremdeten Gefährten später unter sechs Augen zur Rede gestellt, erklärte Borsati, dass er Hadwiger schätze, und dass ihn ihre hochmütige Zurückhaltung nur desto schätzenswerter erscheinen lasse. Seiner Jugend und feindseligen Widerständen zum Trotz hatte Hadwiger den Auftrag erhalten, eine der neuen Gebirgsbahnen im Süden des Reichs zu bauen, und sein kühnes Projekt bildete das Staunen der Kenner. Aus den dürftigen Verhältnissen eines westfälischen Kohlendorfes stammend, war alles was er besass und vorstellte, Errungenschaft eines ungeheuren Fleisses und einer beispiellosen Willenskraft. Anfänglich der schlecht besoldete Beamte einer englischen Maschinenfabrik, hatte er sich zu einer heiklen Mission freiwillig gemeldet und wurde nach Ägypten und nach Brasilien geschickt, um die damals neuen Dampfpflüge einzuführen, was erst nach grossen Schwierigkeiten und abenteuerlichen Mühsalen gelang. Ein Brückenbau im Staate Illinois hatte ihn berühmt gemacht, und er zählte nun zu den Ersten seines Fachs. Soviel wusste man von ihm, doch ohne Zweifel war in seiner Vergangenheit etwas, was er nicht mitteilen mochte und was ihn verfolgte, das verriet sein Auge und sein Schweigen.
Bald brauchte Hadwiger inmitten der Freunde nicht nur geduldet zu werden, er wurde Freund mit ihnen. Freilich war sein Gefühl bisweilen beengt; ein Mensch, der einmal ums Brot gekämpft hat, trägt Narben im Gemüt, die im Kreise der Sorglosen heimlich zu bluten beginnen. Seine schwankende Stimmung liess auf eine unzufriedene Seele schliessen, sein rascher Hass nötigte zur Vorsicht gegen sein Urteil. Manchmal erregte er Gelächter, häufiger ein Lächeln. Wie die meisten Emporkömmlinge war er naiv und selbstgefällig, und er konnte sich in einer so umfassenden Weise loben, dass den Zuhörern bei allem Respekt das Herz im Leibe lachte.
Auch Franziska fand ihn spasshaft, doch liess sie sich seine wachsende Verehrung immer lieber gefallen. Er gehörte nach ihrer Meinung nicht zu den Männern, die man liebt; seine tiefe Anhänglichkeit belohnte sie durch Vertrauen. Als er des Bahnbaues wegen die Stadt verlassen hatte, blieb sie im Briefwechsel mit ihm. Cajetan befand sich um diese Zeit bei der Botschaft in Washington, und Lamberg, dessen Vater unlängst gestorben war, ging für einige Monate auf Reisen. Inzwischen löste sich der Bund Franziskas mit Borsati ohne Lärm noch Katastrophe, etwa wie ein schöner Spaziergang endet, und obwohl sie nach der Rückkunft der andern Freunde gern und oft an den regelmässigen Zusammenkünften teilnahm, führte sie ihr Leben fern von ihnen. Hie und da deutete ein Wort, ein Ausruf, eine Klage das Ermattende und Verzehrende ihrer Existenz an, doch bewahrte sie stets die ihr eigentümliche Heiterkeit und Leichtigkeit. Sie war schön; schön geworden, was mehr besagen will, als schlechthin schön. Voller Beseelung Auge, Hand und Schritt, voll Reife und Bewusstsein; Eitelkeit zeigte sie nur im Kleinen und Scherzhaften, im Ganzen Mass und Haltung, erworbene Würde, natürlichen Adel. Sie war eine jener Frauen, bei deren Anblick einem Manne das Herz still steht. Sie hatte etwas von der Wahrheit der Elemente, und etwas vom Glanz und der rührenden Einsamkeit der grossen Kunstwerke. Leben und Erlebnis hatte sie geläutert und erhoben, so wie sie manche Andere trüben und erniedrigen. Gleichwohl verschwendete sie sich; zum Genuss vorbestimmt, genoss sie umsomehr, je mehr ein begierdevolles Sinnenwesen sich ihr unter verführerischen Formen nahte. Sie bewegte sich in der grossen Welt, als ob sie darin geboren wäre; die Aussenseite ihres Daseins war ohne Geheimnis, man erzählte sich von ihr in allen Salons und Kaffeehäusern; was sie hinriss, was sie spannte, bezauberte, in Atem hielt, war den Freunden, insbesondere Borsati und Hadwiger, ein Rätsel und das Offensichtliche wie das Verborgene gab ihnen Anlass zu Befürchtungen aller Art, zumal es mit ihrer Gesundheit nicht zum Besten stand. Als Hadwiger einst sie zur Besinnung bringen wollte, versicherte sie ihm, dass sie selbst kaum wisse, wovon sie getrieben werde; vielleicht sei es der Tod; jeder Gedanke an den Tod jage sie wilder ins Leben hinein. Vor Jahren habe sie auf einer Bauernhochzeit getanzt, während im Dorf die Häuser zu brennen angefangen; Weiber und Männer seien fortgeeilt, doch sie habe einem Geiger ein Goldstück hingeworfen, damit er weiter spiele und mit ihrem Tänzer sich noch herumgeschwungen, bis der Feuerschein dicht an den Fenstern lohte.
So plauderte sie beim Probieren eines Hutes, und Hadwiger ging von ihr, weil sie so leer erregt zu ihm sprach wie in der Pause zwischen zwei Tänzen. Dann rief sie ihn wieder, in der Pause zwischen zwei Tänzen, schloss schwesterlich ihr Herz auf und nährte sein verschwiegenes Mitgefühl in ungewollter Grausamkeit.
Eines Tages gab sie die Rolle der Marianne in Goethes Geschwistern. Lamberg war im Theater, und ihm schien es, als rede sie von der Szene herab zu ihm allein. Eine gewisse hinschleppende Müdigkeit verwischte das Liebliche der Figur und verlieh ihr einen unwillkommenen Zug von Wehmut. Darüber ärgerte sich Lamberg. Nach der Vorstellung erwartete er Franziska am Bühnenausgang. Ihr schuldbewusstes Lächeln machte seine Strafpredigt überflüssig. Es war etwas Trauriges an ihr wie an einer Winterrose, die das offene Fenster scheuen muss. Lamberg führte sie in sein Haus, bewirtete sie, und seine unerwartete Wärme ergriff Franziska. Es war eine schöne Sommernacht, sie wandelten im Garten, scherzten und philosophierten. Schliesslich erzählte sie ihm, dass der Fürst Armansperg, Majoratsherr, Besitzer eines Hundertmillionenvermögens, Herr auf Günderau, Weilburg und Schloss Gamming, um ihre Hand angehalten habe. Seine Angehörigen, trostlos über diesen Entschluss, setzten alles daran, ihn an der Ausführung zu hindern, und sie selbst sei durch deren Ränke und Intrigen zu unverschuldeten Leiden verurteilt. Lamberg erwähnte, dass er den Fürsten vom Sehen kenne; eines der Armanspergschen Güter lag unweit von seinem Landhaus im Gebirge. Er schätze ihn auf sechzig, traue ihm aber Entschiedenheit genug zu, um einer Familien-Revolution die Spitze bieten zu können.
Noch einmal vergessen; um Eros willen noch einmal; die unbeschwerte Seele dem Gott entgegentragen: kurze Stunden. Er mag die Stunden zählen und sein heitres Antlitz verschleiern, wenn der Morgen dämmert; dann sende er den Schlaf, und die nüchterne Sonne erfüllte ihn mit Trauer um so viel Lust, die gewesen ist. „Wer weiss, ob ich dich überhaupt liebe,“ sagte Franziska; „vielleicht wollt’ ich mich nur überzeugen, ob ein wirkliches Menschenherz in dir steckt.“ — „Kann man davon Gewissheit erlangen?“ versetzte er in seiner stets auf Entfernung bedachten Art. Und sie wieder: „Blut und Atem sind auch schon etwas, wenn man sie spürt. Verbirg dich nicht so in deiner Kühle, denn du bist nicht so stark wie du dich stellst.“
Kurz darnach tauchte in den höheren Zirkeln der Gesellschaft ein Mann auf, der sich Riccardo Troyer nannte, von vielen als ein Däne, von andern als ein Italiener bezeichnet wurde, und dessen Reichtum durch eine verschwenderische Lebensführung unbezweifelbar schien. Man rühmte seine verlockenden Umgangsformen, und der Eindruck seines reckenhaften Körperbaues werde durch ein Gebrechen kaum verringert, hiess es; er hinke nämlich, wie Lord Byron, sei aber, wie Lord Byron, dabei ein vollendeter Reiter, Schwimmer und Fechter. Wem der Hinweis auf ein romantisches Genie von hundertjähriger Berühmtheit nicht zusagen wollte, dem wurde versichert, dass Riccardo Troyer an moderner Prägung nichts zu wünschen übrig lasse, da er durch Börsen- und Minenspekulationen grossen Stils zu seinem Vermögen gekommen sei. Legenden von Ehebrüchen und Entführungen, denen eine misstrauenswerte Gewöhnlichkeit anhaftete, wurden behend verbreitet, von Selbstmorden junger Frauen und Mädchen mittelst Wasser, Gift, Fenstersturz und Leuchtgas, und die obere Menschheitsregion, die sich so argwöhnisch gegen einen einheimischen Frack vom vorigen Jahre verhält, stand geblendet vor diesem ausländischen der letzten Mode, der von einem Zauberkünstler ohnegleichen getragen wurde; nicht einmal die Kunde von allerlei verwegenen Geldtransaktionen und Wechselgeschäften konnte die Glorie des Fremdlings beeinträchtigen.
Zur Zeit, als das Gerücht den Namen Franziskas mit dem des Abenteurers vorsichtig zu verbinden begann, weilte Lamberg seit Wochen auf dem Land. Er hatte die Freunde ermuntert, ihn zu besuchen, und Ende August, da der lästige Schwarm der Sommerfrischler schon verschwunden war, trafen alle ein. Cajetan war, drei Tage vor den andern, aus Rom gekommen und wohnte bei Lamberg, Borsati und Hadwiger logierten in einem entzückenden kleinen Hotel unten am Seeufer, eine Wegviertelstunde von Lambergs Villa entfernt. Es war an einem Nachmittag, die Freunde sassen teetrinkend im Gartenhaus unter mächtigen Ahornbäumen, und Cajetan hatte eben erzählt, dass er bei der Gräfin Seewald, der Schwester des Fürsten Armansperg, eine Visite gemacht und Franziska dort gesehen und flüchtig gesprochen habe, als sie selbst den Wiesenweg heraufkam, in ihrer herrlich aufrechten Haltung, mit dem blauseidenen Überwurf und dem bunten Hut wie eine wandelnde Blume anzusehn. Sie begrüsste die Freunde, sie nahm Platz, begehrte Tee zu trinken und plauderte in der lebhaft erregten Art, die innere Unruhe und Hast verbergen will. „Wie steht es nun? wirst du uns also verlassen?“ fragte Borsati mit zärtlichem Vorwurf. Franziska erwiderte weich: „Ihr sollt ein Andenken von mir haben.“ — „Wir haben es immer,“ versicherte Borsati galant. Sie liess den erinnerungsvollen Blick in seinen Augen ruhen und wiederholte: „Ihr sollt ein Andenken von mir haben.“
Sie hatte schon Abschied genommen, flüchtiger als die Gelegenheit zu fordern schien, da kehrte sie noch einmal zurück und sagte: „Wollt ihr heute übers Jahr wieder hier versammelt sein? Wollt ihr das? Dann verspreche ich euch, zu kommen.“ Die Freunde sahen einander verwundert an, doch Franziska fuhr fort: „Heut ist der erste September, — also übers Jahr am gleichen Tage bin ich wieder hier, und vorher werdet ihr mich wohl kaum sehen. Halten wir die Verabredung, machen wir’s wie die Brüder im Märchen, sagt ja und ich gehe froher von euch weg.“
„Muss es denn am selben Tag sein?“ fragte Cajetan.
„Gewiss, nur dann ist es bindend,“ versetzte sie.
Das Versprechen ward von jedem in ihre Hand geleistet und sie ging. Alle schauten ihr betroffen und teilnahmsvoll nach, wie sie fast fliegend rasch den umgrünten Pfad hinuntereilte. Sie fuhr am nächsten Tag in die Stadt zurück, und kaum eine Woche war vergangen, so brachten alle Zeitungen die Neuigkeit, dass Franziska, die schöne Schauspielerin, mit Riccardo Troyer verschwunden sei. Die Nachricht verursachte schon deshalb Bestürzung, weil man die Heirat Franziskas mit dem Fürsten Armansperg als nahe bevorstehend betrachtet und das Gewagte einer solchen Verbindung hatte vergessen wollen. Man wusste zu sagen, dass der Fürst ausser sich und nur mit Mühe verhindert worden sei, den Abenteurer polizeilich verfolgen zu lassen. Er war auf das Ereignis nicht im mindesten gefasst gewesen, einzelne Warnungen hatte er verächtlich aufgenommen, doch von der Stunde ab zog er sich von der Welt zurück und lebte einsam.
Während alles dies sich abspielte, erhielt Lamberg ein Paket und einen Brief Franziskas. Der Brief berührte die eingetretene Schicksalswendung mit keiner Silbe und war so kurz wie er überhaupt nur sein konnte. „Ich gebe euch, Georg Vinzenz, Heinrich, Rudolf und Cajetan zum Abschied und zur Erinnerung den goldnen Spiegel der Aphrodite, den mir ein teurer und nun verstorbener Freund geschenkt hat. Ich hab euch einmal davon erzählt, schlecht wie mir scheint, sonst wäret ihr gekommen, um das wunderbare Ding anzuschauen. Der Spiegel soll keinem gehören und jedem, keiner soll ein Vorrecht darauf haben, weil ihr mir alle gleich wert seid und es eine frohe Empfindung für mich ist, ihn als ein Sinnbild meiner Liebe und Dankbarkeit in eurem Besitz zu wissen. Lebt wohl, vergesst euer Versprechen nicht und denkt zuweilen an euer Geschöpf, eure Schwester, eure ewig getreue Franziska.“
Der Spiegel war in der Tat ein ausgezeichnet schönes Stück. Er war um das Jahr 1820 in den Ruinen eines kretischen Palastes aufgefunden worden, kam in die berühmte Sammlung Diatopulos und gelangte fünfzig Jahre später in die Hände des Herzogs von Casale. Im Jahre 1905, nach dem Tod des Herzogs, wurde, um dessen Schuldenlast zu tilgen, der Spiegel nebst vielen andern Kunstobjekten zu Paris versteigert, und dort hatte ihn der unbekannte Verehrer Franziskas erworben.
Die Freunde einigten sich dahin, dass jeder von ihnen den Spiegel für die Dauer von drei Monaten unter seinem Dach beherbergen sollte. Wären sie nicht Männer von Geschmack und Geist gewesen, so hätte Franziskas Gabe leicht Ärgernis stiften können. Keiner hatte Sicherheit; an wen die Reihe kam, der war zum voraus verstimmt über die Scheinhaftigkeit seines Rechts. Gemeinhin macht der Besitz die Dinge fremder; hier, wo der Gewinn schon den Verlust bedingte, hielt Ungewissheit das stets wieder entgleitende Gut doppelt lebendig. Hätte Franziska das Geschenk einem unter ihnen zugesprochen, so wäre für die andern keine Beunruhigung erwachsen, und der Erwählte hätte den Frieden der Gleichgiltigkeit nicht lange entbehrt. So wurde das Beschenkt- und Beraubtwerden zur gleichviel bedeutenden Pein.
Franziska blieb wie verschollen. Unter ihren zahlreichen Bekannten hatte niemand von ihr gehört, und der Urlaub, den sie vom Theater genommen, war längst überschritten. Es hiess, der Fürst Armansperg habe über Riccardo Troyer weitläufige Nachforschungen anstellen lassen, die zu einem bedenklichen Ergebnis geführt hätten. Auch davon wurde es allgemach still. Im Juli hielt sich Hadwiger einige Zeit in Paris auf und hörte, dass Troyer während des spanisch-marokkanischen Kriegs als Agent einer englischen Gewehrfabrik in Madrid tätig gewesen, dass er Betrügereien verübt und aus dem Land gejagt worden sei. Hadwiger konnte nicht vergessen; er war nicht fähig, sich ins Unwiderrufliche zu finden. Er grollte der Fügung, sein Gemüt war verdunkelt, und um der Gedankenspiele enthoben zu sein, arbeitete er Tag und Nacht.
So ging das kleine und das grosse Leben weiter. Im Juli bezog Lamberg seine Villa im Gebirg. Mit einer Köchin, dem Diener Emil und einem Affen verliess er die Stadt. Den Affen hatte er vor kurzem von einem holländischen Kaufmann erhalten und war förmlich verliebt in ihn. Es war ein junger Baam oder Schimpanse, der die Grösse eines achtjährigen Knaben hatte. Durch die Unterhaltungen mit dem sich selbst ernst nehmenden Tier erlangte er Einblick in die Fülle schönen Humors, von welcher der sich selbst ernst nehmende Mensch umgeben ist.
In der letzten Woche des August trafen Hadwiger, Borsati und Cajetan ein. Sie wohnten diesmal alle drei in dem Gasthaus am See, da Cajetan nicht begünstigt zu sein wünschte und das lieblich barocke Hotelchen ebensoviele Bequemlichkeiten bot wie Lambergs Junggesellenheim.
Was über den Spiegel beschlossen wurde
Sieben Seen, zwischen Felsen und Wälder düster gebettet die einen, im Schutz freundlicher Hänge leuchtend die andern, konnte das Auge des Betrachters von jedem beherrschenden Gipfel aus erblicken. Wege zogen hügelauf- und abwärts; feste weisse Wege; durchschnitten und umgürteten die langgestreckten Dörfer, begleiteten lärmende Bäche, verloren sich in Wiesen, schlüpften über Brücken und Stege und klommen windungsreich an den kraftvoll gestalteten Bergen empor. Hier ein Garten, daneben eine Wildnis, da eine Ruine, drüben eine gewaltige Wand, im Norden kahle Steinriesen, im Süden ein erhabenes Gletscherhaupt; so wurde das Bild geschlossen, das harmonisch im einzelnen wie gross im ganzen war.
Dem Gletscher fern gegenüber, um die ganze Weite eines Tals, eines ausgedehnten Plateaus und einer tiefen Senkung hinter dem Plateau von ihm entfernt, lag die Villa Lambergs. Der Mond stand am Himmel, und durch die offenen Fenster drangen die eifrig sprechenden Stimmen in die Stille der Landschaft, die durch die vereinfachenden Linien der Nacht geisterhaft entrückt schien. Das Abendessen war vorüber, Borsati, Cajetan und Lamberg sassen noch am Tisch, Hadwiger ging in sichtlicher Aufregung hin und her. Er nahm es den Freunden übel, dass sie so gleichmütig waren, — denn heute war der Tag, für den Franziska sie alle zum Stelldichein gebeten hatte. Sie war nicht gekommen, und es bestand wenig Grund zu der Hoffnung, dass sie noch kommen würde, jetzt, in den Stunden der Nacht. Wer weiss, wo sie ist; wer weiss, ob sie lebt, dachte er bekümmert. Dann grübelte er darüber nach, wie er es anfangen könnte, um das Gespräch auf die Erwägungen zu lenken, die ihn so schmerzhaft beschäftigten. Hatte er doch während der Dauer eines Jahres diesem Tag entgegengelebt, nichts weiter, und das Wort Franziskas war ihm für beide Teile als so unwiderruflich erschienen, dass kein Zweifel sich in sein Zutrauen mischte. Nun war es Abend, und es war ein Tag vergangen wie viele andere Tage vor ihm. Warum sprechen sie nicht von ihr? dachte er; ist es Verstellung oder Kälte? Das, was sie Haltung nennen oder jene Herzensglätte, die sie mir oft so fremd macht?
Er blieb vor dem goldenen Spiegel stehen, der auf seiner Runde seit einigen Wochen zu Lamberg zurückgekehrt war, und betrachtete in dumpfer Verlorenheit das Wunder aus alter Zeit.
Es war eine kreisrunde Scheibe aus ermattetem Gold; sie wurde mit hocherhobenen Armen von der Figur einer Göttin getragen, die auf einer köstlich gearbeiteten Schildkröte stand. Die Rückseite der Scheibe zeigte die Figur eines Jünglings, offenbar eines Narzissos, der in lässig schöner Art auf einem Felsblock sass, zwei lange Stäbe im rechten Arm und in kaum angedeutetem, nur mit wenigen Strichen graviertem Wasser die Umrisse seines Bildes beschaute. Tief am Rand war in griechischen Lettern das Wort Leäna eingeritzt, welches der Name der Hetäre sein mochte, die einst den Spiegel als Eigentum besessen hatte. Das ganze Kunstwerk war ungefähr zwei Handlängen hoch.
Cajetan erhob sich, trat zu Hadwiger und legte den Arm mit jovialer Geberde auf dessen Schulter. „Die weibliche Figur steht unvergleichlich da“, sagte er. „Sie trägt wirklich; jeder einzelne Muskel ihres Körpers trägt. Finden Sie nicht, Heinrich? Dabei ist doch Leichtigkeit in der Bewegung, wie man etwas hält, dessen Besitz die Kräfte erhöht.“
„Es ist eine edle Form“, bestätigte Lamberg, „und um zu ermessen, wie die Alten solche Dinge gearbeitet haben, muss man nur die Schildkröte ansehn. Welche Feinheit! Da fehlt kein Zug der Natur und doch gibt sie vor allem die Idee eines Postaments.“
„Man ist überzeugt, dass die Last für diesen Panzer gar nicht wiegt“, versetzte Cajetan.
„Mich dünkt bisweilen“, warf Borsati ein, „dass sich das Gesicht der Aphrodite durch einen fahleren Glanz von der Färbung des übrigen Gusses abhebt.“
Lamberg erwiderte, er habe es auch schon beobachtet. „Nur weiss ich eben nicht, was daran die Zeit verschuldet hat“, fuhr er fort. „Bekannt ist jedenfalls, dass der Bildhauer Silanion Silber in das Erz mischte, aus dem das Antlitz der Iokaste bestand, um durch die bleichere Schattierung den Tod anzudeuten. Und um die Raserei des Athanas auszudrücken, tat Aristonidas Eisen in die Masse, wodurch er eine charakteristische Rostfarbe erzeugte. Sieht es nicht aus, als ob die Züge der Venus von einem imaginären Mond bestrahlt seien?“
Hadwiger, der für diese Erörterungen wenig Interesse bewies, sah nach der Uhr. Lamberg fing den Blick auf und lächelte. „Warum lächeln Sie?“ fragte ihn Hadwiger stirnrunzelnd. — „Wo ich Ungeduld bemerke, muss ich stets lächeln“, antwortete Lamberg mit herzlichem Ton. — „Und Sie empfinden keine? Sie erwarten nichts?“ Lamberg schüttelte den Kopf. — „Und ihr erwartet auch nichts?“ wandte sich Hadwiger schüchtern und erstaunt an die andern beiden. „Ich habe Franziskas Wunsch schon damals für eine Laune gehalten“, bekannte Cajetan. — „Warum sind Sie dann gekommen?“ fragte Hadwiger fast schroff. — „Erstens, weil ich mit Vergnügen hier bin, zweitens, weil ich durch mein gegebenes Wort genötigt war, die Laune ernst zu nehmen“, war die Erwiderung. — „Und Sie auch, Rudolf?“ — „Ich glaube nie an Programme und bin misstrauisch gegen Verabredungen, weil sie fesseln und meist einseitig verpflichten“, sagte Borsati.
Cajetan brachte das Gespräch auf Riccardo Troyer. Er war dem berüchtigten Ausländer mehrmals in der Gesellschaft begegnet und rühmte ihn als einen Mann von grosser Welt, der einer souveränen Macht über die Menschen in jedem Fall und bis zur Frivolität sicher sei und, ob er nun geächtet oder bewundert werde, Merkmale einer dämonischen Besonderheit so deutlich an sich trage, dass man sich seinem Einfluss nicht entziehen könne. Borsati tadelte das Wort von der dämonischen Besonderheit als einen jugendlichen Galimathias; nach seiner Erfahrung seien die sogenannten dämonischen Menschen unverschämte Komödianten, sonst nichts. Aber Cajetan fuhr unbeirrt fort und sagte, er habe das Wesen nicht begriffen, das um Franziskas letzte Liaison gemacht worden, zumal die Ehe mit dem alten Armansperg keineswegs zu gutem Ende hätte führen können.
„Aber nie zuvor hat sie sich weggeworfen“, rief Hadwiger aus.
„Sie hat es auch in diesem Fall nicht getan“, antwortete Cajetan ernst und bestimmt. „Eine Frau wie sie folgt untrüglichen Instinkten, und selbst wenn sie den Weg ins Verderben wählt, liegt mehr Schicksal darin als wir ahnen. Sie hat sich niemals weggeworfen, das ist wahr. Wer sich hingibt, kann sich nicht wegwerfen, und es existiert eine Treue gegen das Gefühl, die von höherem Rang ist als die Treue gegen die Person.“
Es war elf Uhr geworden, und die drei Hotelbewohner verabschiedeten sich von Lamberg. Dieser stand auf dem Balkon und lauschte noch lange ihren in der Nacht verhallenden Stimmen. Weit drunten auf der Landstrasse rasselte ein Wagen. Georg Vinzenz trat ins Freie, befühlte das Gras und, da er es trocken fand, prophezeite er im stillen für den morgigen Tag schlechtes Wetter. Er ging dann in das obere Stockwerk des Hauses, öffnete die Tür zu einer dunklen Kammer und rief: „Quäcola!“ Das war der Name, den er dem Schimpansen gegeben hatte. Das Tier liess einen freudigen kleinen Schrei hören. Lamberg riegelte den Käfig auf, und der Affe folgte ihm aus dem Gemach, die Treppe hinab, in das beleuchtete Speisezimmer. Er setzte sich mit schlau betonter Bravheit und blickte lüstern nach einer mit Früchten gefüllten Schale, die auf dem Tische stand. Lamberg nickte und der Affe langte zu, ergriff eine Pflaume und biss hinein. Indessen hatte sich das Rollen jenes fernen Wagens genähert, Georg Vinzenz lauschte, eilte ans Fenster, hierauf vor die Türe, die Kutsche hielt, und Franziskas bleiches Gesicht sah aus dem Schlag. Georg Vinzenz begrüsste sie voll stummer Überraschung, und, nachdem er den Diener gerufen, damit er das Gepäck versorge, führte er sie ins Haus. „Du bist pünktlich wie ein Mitternachtsgespenst“, sagte er lächelnd und forschte in ihren Zügen, ob sie zu einem so scherzhaften Gesprächsbeginn aufgelegt sei. Sie erwiderte, an dem Gespensterhaften trüge nur die Eisenbahn schuld, und da sie eine weite Reise hinter sich habe, sei es unvermeidlich gewesen, dass sie erst in der Nacht ans Ziel gelangt sei. „Aber warum hast du mich nicht benachrichtigt?“ fragte er, und als sie verwundert schien, fügte er rasch hinzu: „Ich hätte dich sonst am Bahnhof erwartet.“
Sie trug ein dunkles Gewand. Ihre Sprache war leiser geworden, die Hand, die sie beim ersten Gruss in die seine gelegt, schmaler, kälter und schwerer. Der Mund sah wie von vielen vergeblichen Worten ermüdet aus, und unter den übermässig strahlenden Augen befanden sich zwei fahle Schatten. Lamberg schaute sie immer aufmerksamer an, sie wich unter seinem Blick, sie erkundigte sich, ob sie einige Tage in seinem Hause bleiben könne, und nachdem er eifrig bejaht hatte, ergriff sie mit beiden Händen seine Rechte und stammelte bittend: „Aber frag’ mich nicht! Nur nicht fragen!“
Er merkte selbst, wie wichtig es sei, nicht zu fragen. Das war nicht mehr Franziska; nicht mehr die schalkhafte, sprühende Franziska, die lebenshungrige. Es war eine Satte, eine Sieche, eine Hinfällige, eine mir letzten Kräften sich aufrecht Haltende, und ihr war eine Rast notwendig. Wie sie auf das Sopha hinfiel, den Kopf in die Arme wühlte und schluchzte! So hätte die unverwandelte Franziska niemals geweint; nicht durch Tränen, höchstens durch Lachen hätte sie Quäcola, den Schimpansen, zu einer bestürzten Flucht in den Winkel des Zimmers veranlasst.
Lamberg ging umher und dachte: hinter diesem Jammer liegen dunkle Wirklichkeiten. Aber er fragte mit keinem Blick seines Auges. Es wird die Stunde kommen, wo es ihr Herz zersprengt, wenn sie schweigt, sagte er sich. Seinem sanften Zuspruch gelang es, sie zu beruhigen.
Sie sassen noch lange beisammen in dieser Nacht. Der Heuduft von den Wiesen, die Harzgerüche aus dem Wald, das weitheraufklingende Rauschen der Traun, all das trug dazu bei, dass sie sich sammeln und besinnen konnte, denn sie glich einem Menschen, der aus schweren Träumen erwacht ist.
Lamberg teilte ihr mit, dass die andern Freunde hier seien, dass sie den Abend bei ihm zugebracht. Franziska hatte den goldenen Spiegel von seinem Gestell gehoben und blickte zerstreut auf das matte Metall der Scheibe. Plötzlich trat eine erschrockene Spannung auf ihre Züge, und sie flüsterte beengt: „Werden sie mich nicht fragen?“ Lamberg, der zum offenen Fenster gegangen war, entgegnete, ohne sich umzukehren: „Nein, Franzi, sie werden nicht fragen.“
Franziska seufzte und liess den Kopf sinken. So blieben sie eine Weile, die Frau mit dem goldenen Spiegel, der junge Mann, in den Mond schauend, und der Affe in taktvoll beflissener Aufmerksamkeit zwischen ihnen beiden.
Am folgenden Morgen ging Lamberg zu den Freunden ins Hotel, um sie von der Ankunft Franziskas zu benachrichtigen und was er an Aufklärung für geboten hielt, mit der ihm eigenen Mischung von Bestimmtheit und Diskretion zu äussern. Es wurde vereinbart, dass die Freunde erst am Abend kommen sollten, damit Franziska den Tag über ruhen könne. Dass man sie zu begrüssen hatte, als wenn nichts geschehen wäre, ohne fordernde Neugier mit ihr sprechen müsse, war selbstverständlich und die Art und Weise dem Takt jedes Einzelnen überlassen.
Mittags umwölkte sich der Himmel, und als nach Anbruch der Dunkelheit die drei zu Lamberg kamen, regnete es schon seit einigen Stunden. Franziska spielte mit Quäcola Ball, der dabei eine erquickende Gravität entfaltete; so oft der Ball zu Boden fiel, fletschte er wütend die Zähne und blickte seine Partnerin mit vorwurfsvollem Erstaunen an. „Wir lieben uns, wir zwei“, sagte Franziska zu den Freunden, indes der Affe von Lamberg aus dem Zimmer geführt wurde; „Quäcola ist mein letzter Anbeter.“
Während des Abendessens liess nur Hadwiger die wünschenswerte Haltung vermissen. Stumm sass er da und betrachtete das hingewelkte Geschöpf, ein Opfer unbekannter Schicksale, so dass Franziska, gerührt und verwirrt, ihm einmal lächelnd die Hand reichte. Doch gleich darauf nahm sie an dem lebhaften Gespräch der andern teil, sprach von Paris, von Marseille, von Rom, als ob sie allein dort gewesen und eine misslungene Vergnügungsreise gemacht härte. Als die Tafel aufgehoben war, legte sich Franziska auf die Ottomane, und fröstelnd bedeckte sie sich von den Füssen bis zum Hals mit einem dunkelhaarigen Schal.
Die jungen Männer hatten im Halbkreis um sie her Platz genommen, und Borsati, der Franziskas Augen auf dem goldenen Spiegel ruhen sah, bemerkte gegen sie scherzhaft übertreibend, es hätte nicht viel gefehlt, so wäre um das Geschenk Unfrieden entstanden. Lamberg griff das Thema mit Behagen auf und schilderte Cajetans spitzleutseliges Diplomatenwesen, Rudolfs cholerische Ungeduld, die so oft ihre Hülle von abgeklärter Mässigung zerriss und Heinrich Hadwigers finstern Neid mit vieler Laune, denn er war witzig wie Figaro.
„Georg macht es wie gewisse Diebe“, sagte Cajetan lachend, „indem sie fliehen, schreien sie: haltet den Dieb. Wer war und ist am meisten in den Spiegel verliebt, mein Teurer? Im übrigen ist meine Meinung noch immer die, dass es kindisch ist, eine solche Kostbarkeit von Wohnung zu Wohnung zu schleppen,“ fügte er ernst hinzu. „Jede Hausfrau wird zugeben, dass ihre Möbel durch häufigen Umzug beschädigt werden, und mich dünkt, dass auch das schöne Kunstwerk davon Schaden erleidet, vielleicht nur geistig, wenn ihr den Ausdruck erlaubt. Es gleicht beinahe einem Diamantring, der immer wieder an der Hand eines andern glänzt.“
„Lassen wir doch das Los entscheiden“, meinte Hadwiger plump, ein Wort, das der Entrüstung Lambergs und der schweigenden Verachtung der beiden andern anheimfiel.
„Ganz ohne Verdienst hoffen Sie zum unumschränkten Besitzer werden zu können?“ fragte Lamberg mit vernichtendem Hohn.
„Meine Möglichkeit ist nicht grösser als die Ihre“, versetzte Hadwiger bestürzt. „Ohne Verdienst? was heisst das? Soll der Spiegel eine Prämie für Leistungen werden? Wir können uns aneinander nicht messen.“
„Sagen Sie das aus Anmassung oder aus Bescheidenheit?“ erkundigte sich Borsati lächelnd.
„Was denkt unsere ausgezeichnete Franziska über den Fall?“ fragte Cajetan.
„Als echte Frau müsste sie den Spruch abgeben: wer mich am besten liebt, soll den Spiegel behalten“, entgegnete Borsati.
„Also ein weiblicher König Lear“, sagte Franziska sanft. „Dabei kommt die Cordelia am schlechtesten weg. Wenn ihr euch in den Haaren liegt, meine lieben Freunde, so muss ich wirklich glauben, dass mein Geschenk eine Torheit war. Aber ich kenne euch, ihr seid wie die Advokaten, die sich vor Gericht mörderisch beschimpfen und dann gemütlich miteinander zum Frühstück gehn. Soll ich einen Vorschlag machen? Nun gut. Ihr habt doch so manches erlebt, so vieles gehört und gesehen, ihr habt doch immer, wenn wir zusammen geplaudert haben, allerlei Amüsantes und Merkwürdiges zu berichten gewusst. So erzählt doch! Erzählt doch Geschichten! Wir haben ja wenigstens acht oder zehn Abende vor uns, so lang werdet ihr doch bleiben, hoff ich, und wer die schönste Geschichte erzählt, oder die sonderbarste oder die menschlichste, eine, bei der wir alle fühlen, dass uns tiefer nichts ergreifen kann, der soll den Spiegel bekommen. Vielleicht liebt mich der am meisten, der die schönste Geschichte erzählt, wer weiss. Und vielleicht, eines Tages, wer weiss, vielleicht gibt es eine Geschichte, die auch mich zum Erzählen bringt —“ Sie hielt inne und sah mit zuckendem Gesicht empor.
Alle schwiegen. „Ich denk’ es mir herrlich“, fuhr Franziska mit einiger Hast fort, als wolle sie ihre letzten Worte übertönen; „immer spricht eine Stimme, spricht von der Welt, von den Menschen, von Dingen, die weit weg und vergangen sind. Ich liege da und lausche, und ihr zaubert mir spannende Ereignisse vor, habt Freude daran, reizt einander, überbietet einander, — lasst euch doch nicht bitten, sagt ja! Fangt an!“
Wieder entstand ein Schweigen. „Ich halte das für ein verzweifeltes Unternehmen“, murmelte endlich Hadwiger mit der Miene eines Menschen, von dem Unmögliches gefordert wird.
„Nicht verzweifelt, aber etwas problematisch“, schränkte Borsati ein; „wer wird nicht dabei an den Spiegel denken?“
„Wer an den Spiegel denkt, kann uns nichts zu erzählen haben“, antwortete Lamberg und fügte mit Bedeutung hinzu: „Bei solchem Anlass darf man niemals an den Spiegel denken.“
„Bravo, Georg!“ rief Cajetan. „Ich sehe, Sie fangen schon Feuer. In Ihren Augen malen sich schon die Bilder aus wundersamen Geschichten. Nicht an den Spiegel denken, das ist es! Als Richter gleichen wir dann nicht den Zuhörern im Theater, denen ein müssiges Händeklatschen über einen unklar gespürten Eindruck hinweghilft, sondern wir krönen den Verkündiger eines Schicksals als Tatzeugen. Ich sehe keine Schwierigkeit, nicht einmal eine Verlegenheit. Es wird vieles sein, was uns aneifert; das Wort ist ja ein grosser Verführer.“
Die Pest im Vintschgau
Der Diener Emil brachte den Kaffee, und nachdem jeder seine Tasse ausgetrunken hatte, sagte Borsati: „Wenn ich im Geist zurückschaue, fällt mir ja dies und jenes auf, was des Berichtens wert wäre, aber wo ich selbst beteiligt bin, stört mich die Nähe, und wo es nicht der Fall ist, bin ich ungewiss, ob ich überzeugend oder wahr sein kann.“
„Wir sind nicht einmal wahr, wenn wir Vorfälle aus unserm eigenen Leben erzählen, um wie viel weniger, wenn es sich um fremde Erlebnisse handelt“, erwiderte Lamberg. „Ja, man lügt mehr, wenn man über sich selbst die Wahrheit sagt, als wenn man andere in erfundene Geschicke stellt.“
„Wir wollen Sachlichkeiten und keine Sentiments“, versetzte Cajetan missbilligend. „Jeder ist dann so wahr, wie seine Augen oder sein Gedächtnis wahr sind. Ich bin nicht grösser als mein Wuchs. Wer sich grösser macht, wird ausgezischt. Die Welt ist vom Grund bis zum Rand erfüllt mit den seltsamsten Begebenheiten, und die seltsamste wird wahr, wenn man ein Gesicht sieht, ein lebendiges Gesicht.“
„Famos. Ich will möglichst viel schöne Gesichter sehn“, sagte Franziska und nahm eine Miene des Bereitseins an.
„Jedes Gesicht ist schön im Erleiden des besondern Schicksals, zu dem sein Träger bestimmt ist“, entgegnete Lamberg.
„Darf ich etwas Ketzerisches sagen?“ begann Franziska wieder; „ich finde, dass der Sinn für die Schönheit immer geringer wird; man sucht stets noch etwas Anderes daneben, Seele oder Geist oder Genie, etwas, das mit der Schönheit gar nichts zu schaffen hat und einem nur den Geschmack verdirbt.“
„Es scheint in der Tat, dass man in früheren Zeiten die Schönheit mehr um ihrer selbst willen geachtet hat“, antwortete Lamberg. „Auch wurde ihr eine höhere Wichtigkeit zuerkannt. So wird von einer vornehmen Marquise berichtet, deren Name mir entfallen ist, und die im Alter von siebenundzwanzig Jahren an der Schwindsucht starb, dass sie die letzten Monate ihres Lebens auf einem Ruhebett zubrachte und beständig einen Spiegel in der Hand hielt, um die Verwüstungen zu beobachten, die die Krankheit in ihrem Gesicht erzeugte. Schliesslich liess sie die Fenster dicht verhängen, kein Mensch durfte mehr zu ihr, und sie duldete kein anderes Licht als die Lampe eines Teekessels.“
„Sogar das Volk besass einen echten Enthusiasmus für die Schönheit hochgestellter Frauen“, sagte Cajetan. „Im Jahre 1750 verdiente sich ein Londoner Schuster eine Menge Geld dadurch, dass er für einen Penny den Schuh sehen liess, den er für die Herzogin von Hamilton verfertigt hatte. Und als dieselbe Herzogin auf ihre Güter reiste, blieben vor einem Wirtshaus in Yorkshire, wo sie wohnte, mehrere hundert Menschen die ganze Nacht über auf der Strasse, um sie am nächsten Morgen in ihre Karosse steigen zu sehen und die besten Plätze dabei zu haben.“
„Demgemäss äusserte sich dann auch die Verliebtheit der Männer“, nahm Georg Vinzenz abermals das Wort; „ein Jüngling in einer burgundischen Stadt war von der Schönheit seiner Geliebten so hingerissen, dass er nach dem ersten Stelldichein, das sie ihm bewilligt hatte, in allem Ernst erklärte, er werde sich die Augen ausstechen, wie es die Pilger von Mekka bisweilen tun, wenn sie das Grabmal des Propheten gesehen haben, um ihre Blicke von nun ab vor Entweihung zu schützen.“
„Das muss ein Bramarbas gewesen sein“, behauptete Borsati; „ich glaube ihm nicht eine Silbe.“
„Warum?“ versetzte Cajetan. „Wir können uns kaum eine Vorstellung von der Energie und Glut machen, mit denen man sich damals einer Leidenschaft hingab.“
Borsati zuckte die Achseln. „Mag sein, dass er’s getan hätte“, sagte er, „was wir erdenken können, kann auch geschehn. Ich wehre mich nur dagegen, dass man aus unserer Zeit die grossen Empfindungen hinausredet, um eine nur durch die Ferne reizvolle Vergangenheit mit ihnen zu schmücken. Allerdings sehen die Leidenschaften, deren Zeugen wir selbst werden, anders aus als die mit dem Galeriestaub der Überlieferung, und ihre Verfeinerung oder Verdünnung auf der einen Seite bedingt meist ein finsteres und brutales Gegenspiel.“
Zum Beweis erzählte er folgende Geschichte.
„Vor zwei Jahren war ich auf einem mährischen Gut zu Gast. Man kannte mich in der nahgelegenen Stadt, und weil der ansässige Arzt über Land gefahren war, wurde ich eines Abends, ziemlich spät, in das Wirtshaus gerufen, wo ein junger Mann lag, der sich durch einen Pistolenschuss in die Lunge tödlich verletzt hatte. Der Fall war hoffnungslos, Linderung der Schmerzen war alles, was zu tun übrig blieb. Am folgenden Morgen sass ich lange an seinem Bett, er hatte Vertrauen zu mir gefasst und enthüllte mir, was ihn zu der Tat getrieben. Er war Student, fünfundzwanzig Jahre alt, Sohn vermögender Eltern. Bis zu seinem einundzwanzigsten Jahr hatte er, ich gebrauche seine eigenen Worte, gelebt wie ein Tier; leichtsinnig, verschwenderisch und in gewissenloser Verprassung von Zeit und Kräften. Sein Gemüt, ursprünglich zarter Regungen durchaus fähig, war verhärtet und abgerieben durch den beständigen Umgang mit Dirnen. Die Atmosphäre gemeiner Kneipen war ihm Bedürfnis und die Zudringlichkeit käuflicher Weiber Gewohnheit geworden. Er wusste kaum, wie anständige Frauen sprechen, und in unreifer Überhebung sah er in diesem Treiben die Krone der Freiheit. Da geschah es, dass er auf einer Ferienreise in ein vielbesuchtes Hotel kam und auf dem Schreibtisch seines Zimmers einen Brief fand, der unter Löschblättern lag, unvollendet und sicher dort vergessen worden war. Er gab mir den Brief zu lesen, den er wie einen Talisman von der Stunde ab immer bei sich getragen, der sein Leben verändert und zuletzt noch seinen Tod verschuldet hatte. Wie der Inhalt zu schliessen erlaubte, war das Schreiben von einem jungen Mädchen und an einen Freund gerichtet. Man kann sich etwas Ergreifenderes nicht denken. Furcht vor Armut und Schande, vor völliger Verlassenheit, Beteuerung vergeblicher Anstrengungen, Züge menschlicher Habsucht, Härte und Niedertracht, entdeckt von einem Wesen, das gläubig war und das noch immer, obwohl mit schwindendem Gefühl, auf eine wohlmeinende Vorsehung baute, das war der Text in dürren Worten, die nichts von der tiefen und natürlichen Beredsamkeit eines verzweifelnden Herzens ahnen lassen. Die Frage nach der Unbekannten war umsonst, sie war nicht einmal gemeldet worden, die Bediensteten des Hauses konnten ihm keinerlei Auskunft geben und wiesen auf den grossen Verkehr nächtigender Gäste hin. Anhaltspunkte über Namen und Wohnort enthielt der Brief nicht, und dem jungen Mann war zumut, als hätte er eine Stimme von einem unerreichbaren Stern vernommen. Es ergriff ihn eine brennende Unruhe, und durch Sehnsucht wurde er geradezu entnervt. Dass der Brief zu ihm gelangt war, erschien ihm als Fügung und Aufforderung zugleich; dass es eine Frau in der Welt gab, die so beschaffen war, so zu empfinden, so zu leiden vermochte, war ihm neu und erschütterte die Fundamente seines Lebens. Er studierte den Brief wie ein Egyptolog einen Papyrus, suchte Hindeutungen auf einen bestimmten Dialekt, auf eine bestimmte Sphäre der Existenz. Jede Silbe, jeder Federzug wurde ihm allmählich so vertraut, dass sich ein Charakterbild der Schreiberin immer fester gestaltete, dass er ein Antlitz sah, die Geberde, das Auge, dass er die Stimme zu hören glaubte, eine Stimme, die ihn ohne Unterlass rief. Er reiste von einer Stadt in die andere, wanderte tagelang durch Strassen, um Gesichter von Frauen und Mädchen zu finden, die dem erträumten Gesicht der Unbekannten ähnlich sein konnten, ging zu Wahrsagerinnen und Kartenlegerinnen, veröffentlichte Inserate in den Zeitungen und entfremdete sich seinen Freunden, seinen Eltern, seiner Heimat, seinem Beruf. In fatalistischem Wahn sagte er sich: unter den Millionen, die diesen Teil der Erde bevölkern, lebt sie; es ist meine Bestimmung, sie zu treffen; warum sollte ich nicht, wenn ich alle meine Sinne in der Begierde sammle? Unter den Tausenden, an denen ich täglich vorübergehe, weiss vielleicht einer von ihr; mein Wille muss so stark, mein Gefühl so elementar, mein Instinkt so untrüglich werden, dass ich den einen spüre und mir durch die Millionen einen Weg zu ihr bahne; misslingt es, so bin ich ein Zwitterding und nicht wert, geboren zu sein. Im Verlauf der Jahre wurde er schwermütig, auch ermattete wohl das Ungestüm seines Verlangens; es lässt sich ja denken, dass sich die Natur einer so beständigen Anspannung der Seelenkräste widersetzt. Nur sein Wandertrieb wurde nicht geringer, und so kam er denn auf einer Fahrt vom Norden her in jenen mährischen Ort, wo er den Zug verliess, weil ihm plötzlich vor der abendlichen Ankunft in der grossen Stadt, vielem Licht, vielem Lärm und vielen Menschen graute. Während er traurig und müde durch die dunklen Gassen schlich, gewahrte er am Fenster eines ziemlich abgelegenen Hauses ein altes Weib, das den Sims belagert hielt und ihn einzutreten bat. Er folgte willenlos und ohne Bedacht, als sei er an dem Punkt seines Lebenskreises angelangt, von dem er einst ausgegangen. In der Stube sah er sich einigen Mädchen gegenüber, denen er ohne Anteil beim Wein Gesellschaft leistete, und unter denen eine durch stumme Lockung ihn seiner Apathie zu entreissen vermochte, so dass er mit ihr ging. Es war alles so still in mir, sagte er, und als ich die elende Treppe hinaufstieg, war es, wie wenn dies nur eine Sinnestäuschung sei und ich in Wirklichkeit hinuntergezogen würde, immer tiefer bis ans letzte Ende der Welt. Als er das Mädchen bezahlen wollte, entfiel seiner Ledertasche der Brief; ein totes Ding, das leben und sprechen wollte, das den Augenblick der Entscheidung abgewartet hatte wie ein geheimnisvoller Richter. Das Mädchen bückt sich, nimmt den Brief in die Hand, wirft einen neugierigen Blick darauf, stutzt, wiederholt den Blick, schaut den jungen Mann an, eine Frage drängt sich auf ihre Lippen, ein Schatten auf ihre Stirn, er will ihr den Brief entreissen, da erweckt ihr Benehmen seine Aufmerksamkeit, er wird gleichsam wach, erkundigt sich in überstürzten Worten, ob sie die Schrift kenne, sie entfaltet das Papier, liest, Erinnerung überzittert ihre Stirn, durch Schminke, Elend und den Aufputz des Lasters hindurch zuckt eine Flamme von Bewusstsein, sie stürzt auf die Kniee, lachend ringt sie die Arme, und die ganze Unwiederbringlichkeit eines reinen Daseins schreit aus einem zertrümmerten und verfaulten als Gelächter empor. Nur noch vier Worte: Du bist’s? Ich bin’s! Dann eilte der junge Mensch hinweg und kurz darauf fiel der tötende Schuss.“
Die Zuhörer blickten vor sich nieder. Nach einer Weile sagte Cajetan: „Schade, dass ich den Brief auf Treu und Glauben hinnehmen muss. Könnt’ ich ihn lesen oder hören, so würde mir der junge Mensch verständlicher werden. Es hat sein Missliches, lieber Rudolf, bei so wichtigen Dokumenten auf den Kredit zu bauen, den man geniesst. Freilich bleibt ja die Verkettung der Umstände noch immer erstaunlich genug —“
„Es will mir nur nicht in den Sinn“, unterbrach ihn Franziska, „dass eine Person, die einen derartigen Brief zu schreiben imstande ist, in drei oder vier Jahren so tief sinken kann.“
„Drei oder vier Jahre Not?“ rief Hadwiger. „Das verwandelt, Franzi, das verwandelt! Ich habe in London eine Frau gekannt, die ihren Mann, ihre Söhne und ihren Reichtum verloren hatte. Zu Anfang eines Jahres hatte sie in einem der Paläste am Trafalgar-Square gewohnt, im Herbst desselben Jahres wurde sie in einer unterirdischen Morphiumhöhle, einer schauerlichen Katakombe des Lasters, erstochen.“
„Ja, was ist dann das, was man Charakter nennt?“ fragte Franziska kopfschüttelnd.
„Die Tugend der Ungeprüften“, versetzte Hadwiger schroff.
„Nun, so in Bausch und Bogen möcht ich diesen Ausspruch doch nicht gelten lassen“, fiel Borsati vermittelnd ein. „Es gibt —“
„Was? Eine Tugend? Gibt es eine Tugend, wenn man hungert? In den grossen Städten nicht. In den Romanen vielleicht. Not bricht Eisen, heisst es. Aber sie bricht auch, und viel bälder noch, das Herz und den Verstand.“
„Und doch gibt es Seelen, die sich bewahren“, sagte Borsati ruhig. „Und es muss sie geben, sonst würde ja die Idee der Sittlichkeit zur Lüge.“
Plötzlich erschallte aus dem oberen Stockwerk ein kreischendes Geschrei, dem ein Gepolter wie von umstürzenden Stühlen und das dumpfe Brummen einer Männerstimme folgte. „Quäcola verübt Unfug“, sagte Lamberg lächelnd und erhob sich, um der Ursache des Lärms nachzuforschen. Cajetan begleitete ihn aufregungslustig.
Dem Affen war es zur Nachtruhe zu früh gewesen, und da er die Tür seines Käfigs unversperrt fand, hatte er sich ins erleuchtete Badezimmer begeben, war in die Wanne gestiegen, hatte den Hahn geöffnet und zu seinem Entsetzen eine Wasserflut auf den Pelz bekommen. Emil eilte mit dem Besen herbei, um ihn zu züchtigen, Quäcola war triefend und zitternd vor ihm geflohen, und nun standen Tier und Mensch einander gegenüber, jenes zähnefletschend und schuldbewusst, die Backen in possierlicher Schnellbewegung, dieser mit der Würde des gekränkten Hausgeistes, rachsüchtig und entschlossen. Als Lamberg auf den Plan trat, wandte sich der Schimpanse mit höchst entrüsteten und den Diener anklagenden Gebärden zu ihm, Emil jedoch gab seinem Unwillen durch Worte Ausdruck. „Gnädiger Herr, mit der Bestie ist nicht zu wirtschaften“, sagte er. — „Sie müssen ihn belehren und erziehen“, antwortete Lamberg gefasst. — „Da ist Hopfen und Malz verloren, so lang ihn der gnädige Herr so verwöhnen“, war die Entgegnung. „’s ist ein falscher, treuloser Geselle, das ist er, ich verstehe mich auf —“ Schon wollte er sagen: auf Menschen, verschluckte aber die unpassende Bezeichnung und starrte melancholisch auf seinen Besen.
Lamberg schlichtete den Streit. Er überredete Quäcola,