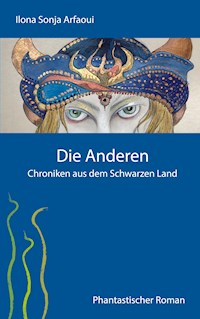Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eine heruntergekommenen Hazienda irgendwo in Mexiko. Die Bewohner: ein grausamer Vater, der blinde Sohn, die kranke Tochter, die soeben verstorbene Tochter und der jüngste Sohn Efrén, der von seinem Bruder Enrique, zu erfahren versucht, welche dunklen Geheimnisse sich hinter den Mauern des düsteren Hauses verbergen. Schließlich kommt Efrén einer geheimen Magischen Gilde auf die Schliche, die ihren Mitgliedern Wissen, Macht und Unsterblichkeit verspricht. Aber der Preis dafür ist hoch, das muss er am eigenen Leib erfahren, nachdem er gegen seinen Willen vom Vater in jene Magische Gilde eingeweiht wurde. Aus dem Klappentext: Was geschieht mit der im Laufe von Jahrhunderten angehäuften, die Seele zerfressenden Schuld? Gibt es für tiefsitzenden Hass Versöhnung, für schändlichen Verrat Vergebung? Ist Unsterblichkeit der Schlüssel für einen Neubeginn in Frieden mit sich selbst und anderen, oder bleibt am Ende nur der Fluch ewiger Verzweiflung?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1211
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wissen, Macht und Unsterblichkeit …
… werden Amadée versprochen, wenn er der Stimme des schwarzen Hexenmeisters folgt, in jenen geheimen Orden einzutreten, der im magischen Vermächtnis von Efrén de Alpojar so finster beschrieben wird. Soll er sein junges Leben in die Waagschale werfen und für immer Ordensmitglied werden, oder soll er die schriftlichen Aufzeichnungen von Efrén als Hirngespinste eines Verrückten betrachten, der behauptet, bereits im Mittelalter gelebt zu haben und unsterblich zu sein?
Was geschieht mit der im Laufe von Jahrhunderten angehäuften, die Seele zerfressenden Schuld? Gibt es irgendwann für tiefsitzenden Hass Versöhnung, für schändlichen Verrat Vergebung? Ist Unsterblichkeit der Schlüssel für einen Neubeginn in Frieden mit sich selbst und anderen, oder bleibt am Ende nur der Fluch ewiger Verzweiflung?
Amadée erhält einen erschreckenden Einblick in vergangene Zeiten sowie in eine düstere Parallelwelt, die als Draußen bezeichnet wird.
Ilona Sonja Arfaoui, Jahrgang 1950, lebt mit ihrem Mann und vier Katzen in Stuttgart. Bereits während sie mit dem Schreiben dieses Romans und einer Katzenkurzgeschichte begann, arbeitete sie als Werbeberaterin und Grafik-Designerin in der Werbeabteilung eines Verlages. 2019 ist ein weiterer Roman von ihr erschienen „Der König der Schatten“, der die Vorgeschichte des Hexenmeisters erzählt, das Finale zu den beiden Büchern „Die Anderen – Chroniken aus dem Schwarzen Land“ befindet sich in (www.ilonaarfaoui.com)Vorbereitung
In unserem Bestreben, Engeln gleich zu werden, sinken wir vielleicht tiefer als Menschen
Blaise Pascal: Pensées
Inhaltsverzeichnis
Inhalt | Erstes Buch
Erster Teil – Efrén de Alpojar
Efrén de Alpojar soll zu seinem Geburtstag die nötige geistige Grundlage erhalten
Diner mit weißen Bohnen, schwarzem Kater und toter Maus
Im Brunnenschacht
Ein schwarzes Geheimnis hinter dem Kleiderschrank
Erzählung eines mexikanischen Stallknechts mit folgenschwerem Nachspiel
Efrén de Alpojar möchte auf die nötige geistige Grundlage verzichten
Begegnung mit einer außerirdischen Art hinter dem Kleiderschrank
Efrén de Alpojar erhält nun doch die nötige geistige Grundlage - Der schwarze Hexenmeister I
Juana/Azunta – Der schwarze Hexenmeister II – Azunta/Juana
Azunta mach einen Fehler
Efrén de Alpojar macht einen Fehler
Der Weg ins Draußen I
Zweiter Teil – Der Schwarze I
Das Tal der Verdammnis
Die Stadt des Ersten Königs – Erste Beute
Efrén de Alpojar macht eine Reise in die Vergangenheit I
Gilles de Rais
Vor dem Tor der Stadt des Ersten Königs I
Dritter Teil – René de Grandier
Ein frommer Ritter wird Schwarzmagier
Der bluttrinkende Engel – Aufbruch in den Hundertjährigen Krieg
René de Grandier wird wider Willen Kindermädchen
Begegnung mit einer außerirdischen Art im Schlafzimmer
Gilles de Rais langweilt sich – René de Grandier macht einen Jäger zum Hirsch
Kätzchen trifft auf Gepard – Die verzauberte Buchmalertochter | Der Engel trinkt Blut I
Eine Beschwörung mit folgenschwerem Nachspiel – Druidenbegräbnis
Der Marschall von Frankreich sinniert über eine Heilige René de Grandier äußert einen schrecklichen Verdacht
Der Engel trinkt Blut II – Der Weg ins Draußen II
Der schwarze Hexenmeister III
René de Grandier trifft auf einen ehemaligen Pagen und wird Jäger des Zweiten Königs von Draußen
Vierter Teil – Geoffrey Durham
Efrén de Alpojar macht eine Reise in die Vergangenheit II
Ginevra McDuff macht einen Fehler – Geoffrey Durham und wird Zweiter König von Draußen und erhält ein Krönungsgeschenk
König Geoffrey heiratet und erhält ein Hochzeitsgeschenk – Edward Duncan glaubt einem Geheimnis auf der Spur zu sein
Edward und Elaine – Der schwarze Hexenmeister IV
Viviane Duncan macht einen Fehler – Kieran Duncan hat einen Einfall mit folgenschwerem Nachspiel
Der Krieg beginnt
König Geoffrey wird von seinem schlechten Gewissen gequält
Der schwarze Hexenmeister V – König Geoffrey erleichtert sein schlechtes Gewissen – Roger Duncan schließt einen Pakt mit König Kieran
Vor dem Tor der Stadt des Ersten Königs II
René de Grandier verkauft seine Seele und trifft alte Freunde – Jean T.’s Attraktion – Amaury de Craon hat ein Problem
René de Grandier trifft abermals einen ehemaligen Freund - Der bluttrinkende Engel stürzt in den Brunnenschacht
Die Jagd nach dem schwarzen Hexenmeister
Efrén de Alpojar schreibt einen Abschiedsbrief
Inhalt | Zweites Buch
Fünfter Teil – Kieran Duncan
Efrén de Alpojar kehrt zurück ins Draußen
Kieran Duncan sieht eine Möglichkeit seine Haut zu retten
König Geoffrey Diener verplappert sich – Begegnung mit einer irdischen Art im Schlafzimmer
Lyonel Duncan kämpft mit einer schwierigen Aufgabe – Percevale de Thouars macht eine grauenvolle Entdeckung
Percevale de Thouars lehrt einen italienischen Magier das Fürchten – Zwei ungebetene Gäste lehren Percevale, Lyonel und Viviane das Fürchten
Kieran Duncan legt einen Köder aus ? Lyonel Duncan glaubt endlich seine schwierige Aufgabe gelöst zu haben - Gilles de Rais wird noch einmal der Prozess gemacht
Der Sturm – Allianzen werden geschlossen
König Kieran langweilt sich
Die Rückkehrer
Guy Macenay sorgt für eine Überraschung
Viviane Duncan sorgt für eine Überraschung
Sechster Teil – Viviane Duncan
Viviane Duncan hat ein Problem mit ihren Haaren und macht eine Reise in die Vergangenheit
Drachenspiele
Geoffrey Durham kommt zu einer grundlegenden Erkenntnis – Viviane und Kieran entdecken ein Geheimnis mit folgenschwerem Nachspiel
Die Königin der Nacht – vorerst letzter Akt I
5. Viviane Duncan versucht zu helfen und fällt dem bluttrinkenden Engel in die Hände
Viviane Duncan weigert sich zu heiraten und bezieht eine Ohrfeige
Das Ende der Drachenspiele
Die Königin der Nacht – vorerst letzter Akt II
Das Tribunal der Söhne
Lawrence Duncan macht eine Reise in die Vergangenheit Ein König wird geopfert
Der Weg ins Draußen III
Siebter Teil – Der Schwarze II
Der schwarze Hexenmeister und seine Schwester
Der schwarze Hexenmeister und sein ehemaliger Schüler
Der schwarze Hexenmeister und sein König
Das Ende des schwarzen Hexenmeisters
Guy Macenay ist gezwungen eine weitere Reise in seine Vergangenheit zu machen
Die Königin der Nacht – letzter Akt
Was am Ende noch zu sagen ist
Personen
Glossar
Erstes Buch | Der Hexenmeister
Das herrschaftliche Haus mit dem gepflegten Vorgarten sah, trotz des düsteren Himmels und des endlosen Regens – so harmlos und so gemütlich aus. Amadée konnte das flaue Gefühl in seinem Magen nicht los werden. Er zog den zerknitterten Brief aus der Manteltasche – die Adresse stimmte. Obwohl er allmählich nass wurde und erbärmlich zu frieren begann, zögerte er noch einen Moment, fingerte den Brief aus dem Kuvert, um ihn zum x-ten Mal durchzulesen. Eine so harmlose altmodische Einladung im Zeitalter der E-Mails zu einem so beschaulichen Wochenende:
London, 26.10.2013.
Mein lieber Herr Castelon,
natürlich würde ich Sie jetzt gerne persönlich kennenlernen. Sollten Sie eine Entscheidung in unserer Angelegenheit getroffen haben, möchte ich Sie bitten, mich in meinem Haus in London aufzusuchen. Wir können dann alles Weitere persönlich besprechen. Ein Zimmer steht Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung und für die Fahrtkosten komme ich auf. Ich freue mich ehrlich auf Ihren Besuch.
Ihr Henry Stanford
Amadée knüllte den Brief zusammen, steckte ihn in die Manteltasche zurück und klingelte zaghaft, während er noch überlegte, in was er da hinein geraten war. Es vergingen nur einige Sekunden – als ob man ihn schon sehnsüchtig hinter der verschlossenen Tür erwartete – bis geöffnet wurde. Vor ihm stand ein schlanker erschreckend blasser Mann ungefähr um die Mitte vierzig, bekleidet mit einem Morgenmantel in grausam scheußlichen Farben. Amadée wurde einen Augenblick wie starr vor Schreck. Der Morgenmantel war in der Tat komisch und irgendwie spießig – so harmlos und so gemütlich. Sein Träger weder das eine noch das andere. Es waren vor allem die kohlschwarzen Augen seines Gegenübers, die in ihn einzudringen schienen, als wollten sie den letzten Winkel seiner Seele durchforschen. „Professor Stanford?“, versuchte Amadée fragen, brachte aber kein Wort heraus, kramte den Brief wieder aus der Manteltasche und hielt ihn seinem unheimlichen Gastgeber hin, bis er es endlich schaffte seinen Satz zu vollenden:
„Guten Abend, mein Name ist Castelon. Bitte verzeihen Sie meinen verwunderten Gesichtsausdruck, aber ich hatte eigentlich Professor Henry ...?“
Der Andere entschärfte auf der Stelle sein bedrohliches Aussehen mit einem breiten Grinsen, als er Amadée hieß einzutreten.
„Oh je, in Ihrem Gesicht steht ja das nackte Entsetzen. Tut mir leid, dass ich Sie in diesem Aufzug empfange, aber ich habe eine arbeitsreiche Nacht hinter mir und bin bis jetzt noch nicht dazugekommen mich anzukleiden“, fuhr er mit einer ungewöhnlich tiefen rauen Stimme fort, während ihm Amadée in einen geschmackvoll eingerichteten Aufenthaltsraum folgte. „Professor Henry Stanford ist mein Onkel. Mein Name ist Cecil Stanford. Bitte, so legen Sie doch endlich ab, Ihren Mantel und Ihre Befangenheit. Mein Onkel hat mich von Ihrer Ankunft unterrichtet, Herr Castelon. Leider musste er plötzlich für einige Tage verreisen. Ich hoffe, dass er bis Ende der Woche zurück ist.“
Amadée, von der langen Reise erschöpft, nickte ergeben verständnisvoll und machte es sich in einem der ausladenden Ledersessel bequem.
„Sie hatten sicher eine sehr anstrengende Reise“, versuchte Cecil das Gespräch erneut in Gang zu bringen und zündete sich eine Zigarette an.
„Wollen Sie auch?“
„Ja, gern, ich komme direkt von Lyon und hatte eine sehr anstrengende Reise“, entgegnete Amadée und schwieg, während sein Blick den Rauchwolken folgte. Er verabscheute diese Art peinlicher Konversation. Er merkte, dass es seinem Gegenüber ähnlich ging und beschloss deshalb nicht auch noch vom Wetter anzufangen, sondern gleich auf das Wesentliche zu kommen.
„Ich bin hier, weil ich mich, wie Sie sicher wissen – na ja, sagen wir mal – entschieden habe. Also ich bin bereit, Sir Henry bei seiner Arbeit zu unterstützen. Er hat Sie doch unterrichtet?“
Er ging einfach davon aus, dass Cecil unterrichtet war. Er war es.
„Aber ja doch, das hat er, der Gute“, grinste der ebenso sichtbar erleichtert. „Auch ich unterstütze ihn schon seit vielen Jahren. Aber wir sollten aufhören, um den heißen Brei herum zu reden. Sie wollen in unseren geheimen Orden eintreten?“
„Ganz richtig“, bestätigte Amadèe ebenfalls erleichtert mit nachdrücklichem Kopfnicken. „Mit meinem Erscheinen hier hat er meine Zusage. Ich kann kaum beschreiben, wie gespannt ich bin. Hoffentlich werde ich nicht wieder enttäuscht. Die meisten okkulten Organisationen sind uninteressant oder sterbenslangweilig. Sie glauben gar nicht, wie sehr mir das esoterische Geschwafel in den New Age Clubs auf den Geist geht. Mit so genannten Satanisten habe ich noch viel weniger am Hut. Sind doch alles unappetitliche Kindereien, nicht wahr?“
Er hielt inne. Jetzt plauderte er offensichtlich zu viel. Es waren Kamele, Kamele und Palmen – das konnte er inzwischen auf Cecils Morgenmantel erkennen. Idiotisch, dass er ausgerechnet auf so etwas achtete, aber jemand, der solche kitschigen Geschmacklosigkeiten am Leib trug, konnte nicht gefährlich sein, oder?
„Sie können unbesorgt sein. Bei uns wird nicht geschwafelt, da geht es ordentlich zur Sache. Und was Ihren Geist angeht, Ihnen wird garantiert ein großes Licht aufgehen, versprochen. Aber den Weg zur großen Erleuchtung soll ihnen lieber mein Onkel selbst weisen. Er legt darauf besonders wert und überlässt es nicht gern anderen. Ich habe lediglich die Aufgabe, Ihnen die Wartezeit zu verschönen.“
Amadée lächelte und erwiderte.
„Nun, dann muss ich mich wohl noch etwas in Geduld fassen. Ich glaube, wir beide werden sicher bis dahin noch andere interessante Gesprächsthemen finden.“
„Ich verspreche Ihnen, Sie nicht zu langweilen.“ War da ein leicht ironisches Lächeln, das Amadée einen Moment zu sehen glaubte? „Sie sehen irgendwie hungrig aus; jetzt plündern wir mal Professors Kühlschrank und Keller“, fuhr Cecil fort. Amadée verwarf vorerst seine Bedenken bezüglich seines Gastgebers und beschloss, sich endlich zu entspannen. Der bot seinem Gast nach einem aufwändigen Imbiss noch reichlich französischen Wein an und nachdem man ganz harmlos über Gott und die Welt geplaudert hatte, merkte Amadée, dass er müde wurde und bat auf sein Zimmer gehen zu dürfen.
„Verständlich“, erwiderte Cecil gähnend, obwohl er nicht im geringsten müde zu sein schien. „Möchten Sie noch einen Schluck Wein?“
Amadée brummte schon der Kopf, er verneinte dankend und erhob sich.
„Gut, dann zeige ich Ihnen Ihr Zimmer.“
Als sie die knarrende Treppe nach oben stiegen, wunderte sich Amadée, dass es in dem großen Haus keine Bediensteten gab. Cecil hatte seine Gedanken offenbar erraten.
„Wir stellen nur Personal ein, das dem Orden angehört. Den letzten Butler hat der Teufel geholt.“ Bevor sich Amadée über Cecils eigenwilligen Humor schockieren konnte, fuhr der fort: „Quatsch beiseite. Er begleitet meinen Onkel auf der Reise. Ich bin hier sozusagen die Vertretung. Ich wohne auch normaler Weise nicht hier. Bitte, Ihr Zimmer.“
Amadée verabschiedete sich und ließ sich gleich, nachdem er die Tür vorsichtshalber verschlossen hatte, ins Bett fallen. Kurz nach zwölf – er registrierte noch die Uhrzeit, bevor er einschlief.
Am frühen Morgen, gleich nach dem ungewohnt üppigen englischen Frühstück, begleitete er Cecil, der sich offenbar noch immer nicht von seinem wildgemusterten Kleidungsstück trennen konnte, in die Bibliothek. Sie beinhaltete zwar eine Menge kostbarer und seltener Bücher über diverse Geheimlehren, doch keines interessierte ihn im Augenblick sonderlich. Die meisten dieser Schriften kannte er sowieso. Auf die Frage, wo er Literatur zu der Magischen Gilde finden könne, erwiderte Cecil ohne Umschweife:
„Es handelt sich schließlich um einen Geheimorden, der angeblich schon seit langer Vorzeit existieren soll. Falls Sie Handbücher über Beschwörungen meinen, so etwas gibt es hier Urzeiten nicht mehr. Und warum wohl? Weil es zwischenzeitlich strengstens verboten ist, Beschwörungen aufzuschreiben. Diese bekommen Sie bei der richtigen Gelegenheit mündlich mitgeteilt und müssen sie auswendig lernen. Und davon werden Sie eine ganze Menge zu lernen haben.“
Diese Tatsache machte auf Amadée Eindruck und überzeugte ihn von der Ernsthaftigkeit des Ordens. Cecil gestattete ihm selbstverständlich gern, sich noch weiter umzusehen.
Mitten in einem Stapel alter Zeitschriften glaubte Amadée, fündig geworden zu sein. Es war eine Mappe mit zusammengehefteten Blättern, deren handgeschriebener Text auf ein Tagebuch oder ähnliches schließen ließ. Er hatte das Gefühl, auf etwas Wichtiges beziehungsweise Verbotenes gestoßen zu sein. Da er sich nicht ganz sicher war, ob Cecil seine Wahl akzeptieren würde, nahm er das Manuskript an sich, als er sich einen Moment unbeobachtet glaubte und schlug es hastig auf. Auf der ersten Seite stand lediglich das Datum: 23. Mai 1923. Bevor er jedoch weiterlesen konnte, unterbrach ihn Cecils Stimme, der scheinbar in seine Zeitung vertieft gegenüber im Sessel saß:
„Können Sie spanisch?“
„Aber ja doch …“, schreckte Amadée verwundert auf. „Da mein Vater Spanier ist, ist spanisch sozusagen meine zweite Muttersprache.“
Cecil schien diese Tatsache irgendwie zu amüsieren. Sein Gesicht kam hinter der Zeitung hervor. Er schaute Amadée kurz durchdringend an, schob mit seiner mageren Hand die schulterlangen schwarzen Haarsträhnen hinter die Ohren, zündete sich eine Zigarette (bereits die fünfte) an und fuhr hinter einem Schwall von Rauchschwaden fort:
„Na, dann werden Sie Freude an diesem Manuskript haben. Wie Sie sicher richtig gesehen haben, ist es in spanisch geschrieben. Eine ekelhaft pingelige Handschrift, wenn Sie mich fragen. Mein Onkel hat es vor einigen Jahren aus Mexiko mitgebracht. Er behauptet, es auf einer verfallenen Hazienda gefunden zu haben. Klingt richtig abenteuerlich, was? Offen gestanden, ich habe es noch nicht angerührt, denn meine spanischen Sprachkenntnisse sind so gering, dass sich ein Versuch auch nicht lohnen würde.“
„Hat Ihr Onkel es gelesen?“, fragte Amadée, ohne das Manuskript beiseite zu legen. Cecil zuckte die Achseln.
„Keine Ahnung. Er schreibt und spricht zwar sehr gut spanisch. Aber ich glaube kaum, dass er bis jetzt die Zeit dazu hatte. Jedenfalls hat er darüber noch kein Wort verloren.“
Amadée setzte sich mit dem Manuskript zurück in den Sessel.
„Erlauben Sie, dass ich es lese?“
„Aber klar doch“, ereiferte sich Cecil. „Ich habe nichts dagegen und Onkelchen bestimmt auch nicht, sonst würde er es wohl nicht so offen herumliegen lassen. Außerdem haben Sie mich jetzt richtig neugierig gemacht, sie können es mir ja anschließend übersetzen.“
Amadée nickte. Er war im Grunde froh, eine Möglichkeit gefunden zu haben, die Wartezeit bis zu Henry Stanfords Rückkehr zu überbrücken. Cecil war sicherlich ein witziger brillanter Gesprächspartner, aber auf der anderen Seite wurde Amadée seinen ersten Eindruck von ihm nicht los – er war einfach ein wenig zu unheimlich, trotz seiner Vorliebe für geschmacklose Morgenmäntel mit Kamelen und Palmen.
„Da ich zu einer mitteilsamen Sorte Mensch gehöre, werde ich mir das kaum verkneifen können“, versuchte er zu flunkern. „Ich kann es kaum erwarten. Ganz schön umfangreich dieses Skript.“
Nach kurzem Durchblättern stellte er befriedigt fest, dass das Manuskript noch gut erhalten und in der Tat pingelig, aber dafür leserlich geschrieben war. Dann zündete er sich eine Zigarette an und tauchte ab in das Jahr 1923.
Erster Teil | Efrén de Alpojar
Mexiko – Finis Terra 1917 – 1923
1.
Efrén de Alpojar soll zu seinem siebzehnten Geburtstag die nötige geistige Grundlage erhalten
Ich bin zurückgekehrt. Während meiner Abwesenheit ist im Haus alles unverändert geblieben. Fast drei Wochen soll ich fort gewesen sein – spurlos verschwunden – wie unser Pferdeknecht sich vorwurfsvoll ausdrückte. Mir kam diese Zeit allerdings vor wie eine Ewigkeit, denn von wo ich herkomme, scheint es keine Zeit mehr zu geben.
Ich glaube, ich bin verrückt. Seit zwei Tagen laufe ich regelmäßig jede Stunde zum Spiegel und bin überglücklich, wenn ich feststelle, dass mir wieder ein einigermaßen anständiges menschliches Gesicht entgegen schaut. Aber ich bin alt geworden in der so kurzen Zeit – alt? Alt! Natürlich, ich bin sehr alt. Nicht daran denken, sonst verliere ich wirklich den Verstand. Doch – daran denken – da musst du jetzt durch, Efrén. Die Stille im Haus macht mich traurig, aber was bedeutet das schon fast vertraute Alleinsein hier auf der Hazienda gegen die schreckliche Einsamkeit Draußen. Ich werde warten, bis mein Vater zurückkehrt, denn er ist mir noch eine Erklärung schuldig. In der Zwischenzeit werde ich schreiben. Erstens, um mir das Warten zu verkürzen und zweitens habe ich so viel unglaubliche Dinge erlebt, die ich unbedingt zu Papier bringen muss, um mir darüber klar zu werden, ob ich jetzt wirklich verrückt bin oder nicht.
Ich war schon wieder am Spiegel. Es ist keinerlei Eitelkeit. Ich kann es einfach noch immer nicht fassen, wieder wie ein normaler Mensch auszusehen, wo ich vor etlichen Tagen noch so etwas wie eine abgemagerte Kreatur aus einer anderen Welt war. Wie soll ich eine Erscheinung, die so wenig menschlich scheint, anders bezeichnen? Ein Phantom, ein Nachtmahr, ein ... also bleib bei Kreatur, Efrén.
Ich muss lachen, denn ich sehe gerade, wie sich mich ein eventueller Leser als diese Kreatur vorstellt – schätze zum Davonlaufen. Vorsicht, du wirst hysterisch, Efrén, reiß dich zusammen! Und mir vergeht das Lachen wirklich, wenn ich daran denke, dass ich nach meinem endgültigen Tod diese Gestalt wieder annehmen werde. Es sei denn, ich bestehe in diesem Leben eine Prüfung. Prüfung – lachhaft. Irgendeine Teufelei steckt mit Sicherheit dahinter. Immerhin besteht sie darin, dass ich mit einer schrecklicheren Kreatur, die ich von ganzem Herzen wie die Pest verabscheue, keinen Kontakt aufnehmen darf und irgendwie erwartet man von mir, dass ich es trotzdem tue. Ich lass mich überraschen, auf eine Überraschung mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Aber nun will ich nicht mehr vorweg greifen, sondern alles der Reihe nach aufschreiben. Ich werde viel Zeit und viel Papier brauchen. Von der ersten habe ich genügend und von dem zweiten hoffe ich, dass es reicht. Ich gehe ab jetzt nicht mehr zum Spiegel. Am besten, ich schmeiße ihn gleich weg. Ich bin schon so durcheinander, dass ich auf einmal nicht mehr weiß, ob ich mein Vorhaben überhaupt zustande bringe. Vor allem brauche ich einen Anfang. Also, wo fange ich an? Ich glaube mich zu erinnern, dass der ausschlaggebende Punkt an meinem siebzehnten Geburtstag war, als mein Leben als Magier begann.
Es regnete. Das ist kein Satz, um einen Einstieg zu finden. Es regnete an jedem meiner Geburtstage. Dieser trostlose Umstand drückte auf meine ohnehin permanent schlechte Stimmung. Mit unerbittlicher Regelmäßigkeit war, wie jedes Jahr, der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich fragte, für wen und für was meine Geburt in dieser Einöde irgendwo in Mexiko von Nutzen sein sollte. Gerade jetzt mit siebzehn Jahren schien mir mein Leben noch immer so sinnlos, begleitet von dem dumpfen Gefühl, dass ich wie auch meine Geschwister nur als Zielscheibe für die Spötteleien unseres Vaters herhalten durften. Unser Vater – ich spreche, beziehungsweise schreibe nicht gern über ihn. Aber, er ist nun mal derjenige, der mein Leben und sogar meinen Tod vollkommen beeinflusst hat und somit leider auch einer der Hauptakteure in diesem Trauerspiel. Don Rodrigo de Alpojar, Nachfahre eines alten spanischen Adelsgeschlechts, war ein bemerkenswert kaltherziger und zynischer Mensch, der sich kaum um unser Wohlergehen kümmerte und uns mit seinen bissigen Bemerkungen das Leben noch unerträglicher machte. Zum Glück ließ er uns oft allein, aber wenn er sich im Haus aufhielt, verursachte allein seine Gegenwart ein Gefühl von Angst und abgrundtiefer Abscheu.
In der letzten Zeit war mir aufgefallen, dass er sich häufig mit meinem älteren Bruder unterhielt, das heißt vielmehr, die beiden stritten sich, dass die Fetzen flogen. Um was es dabei ging, konnte ich nicht herauskriegen, obwohl ich es zu gern gewusst hätte. Aber zu lauschen wagte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auf jeden Fall wurde mir klar, dass mein Bruder seit längerer Zeit schon in der Gunst unseres Vaters bevorzugt wurde. Nach langem Grübeln, mit dem ich mir die schlaflosen Nächte vertrieb, kam ich zu dem Schluss, dass diese böse Geschichte vor einigen Monaten auf Don Rodrigos Kosten gegangen sein musste. Man stelle sich vor, ein Mensch verliert ganz plötzlich so einfach über Nacht sein Augenlicht. In diesem Haus gab es Geheimnisse, schreckliche Geheimnisse. Enrique wusste davon und ich nicht! Natürlich habe ich nach diesem grauenvollen Zwischenfall versucht, dahinter zu kommen und ihn mit mehr oder weniger feinfühligen Mitteln ausgehorcht. Ohne Erfolg. Er schwieg wie ein Grab. Eigentlich konnte ich Enrique nie so recht leiden, weil er als Ältester glaubte, die Rolle der verstorbenen Mutter übernehmen zu müssen und uns ständig bevormundete. Streng und beharrlich wie eine Betschwester. Noch bis zu dem Vorfall, der zu seiner mysteriösen Erblindung führte, nahm ich diese Marotte vollkommen gelassen hin. Aber seitdem gerieten auch wir beide häufiger aneinander, zumal ich sein klammheimliches, frömmelndes, heuchlerisches Geschwätz nicht mehr ertragen konnte. Er war zu dem blinden Seher geworden, der mich unermüdlich mit seinen merkwürdigen Andeutungen und düsteren Prophezeiungen aus der Fassung brachte. Seine Gegenwart stank regelrecht nach Unheil. Auf der anderen Seite tat er mir leid (was er selbstverständlich von mir erwartete). Er, der einst das Licht so sehr liebte, war von einem Tag auf den anderen dazu verdammt, für den Rest seines Lebens in Dunkelheit dahinzuvegetieren.
Manchmal, wenn er sich allein glaubte, murmelte er unverständliche Worte vor sich hin, aus deren Tonfall ich heraushörte, dass er vor irgendetwas grässliche Angst zu haben schien. Sobald er jedoch meine Gegenwart zu spüren schien, lächelte er wieder unverfänglich und wenn ich ihn besorgt fragte, ob ich ihm helfen könne (und das wollte ich wirklich), wurde sein Lächeln mit einer stumpfsinnigen Regelmäßigkeit mitleidig und ich bekam zum x-ten Mal zu hören:
„Lass nur, es ist nichts. Kümmere dich nicht um mich. Kümmere dich um Gottes Willen um nichts, was in diesem Haus vorgeht.“
Statt dankbar für diese gut gemeinte Warnung zu sein, kochte ich vor Wut, weil ich wusste, dass es zwischen ihm und unserem Vater ein Geheimnis gab, von dem ich ausgeschlossen war. Merkte Enrique denn nicht, dass er gerade mit solchen Worten meine Neugierde nur noch mehr anstachelte? Hielt er mich für einen Idioten? Also gut, sollte er sich weiterhin allein fürchten und auf meine ehrliche Anteilnahme verzichten. Ein schwieriges Unterfangen in einem einsamen Haus mit so wenigen Personen, und ohne Abwechslung. Natürlich waren meine Vorsätze zum Scheitern verurteilt und bei der nächsten Gelegenheit schrie ich ihn wieder an: Er wolle doch nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass er als Einziger in der Lage war, diese scheinbar schrecklichen Geheimnisse zu tragen. Aber Enrique lächelte und vergab, er vergab mir immer und immer wieder, und ich war der widerwärtige kleine Bruder, der sich in Grund und Boden zu schämen hatte. Ich beneidete ihn trotz seines grausamen Schicksals. Er hatte etwas Ungeheuerliches erlebt, vor allem hatte er gelebt – vielleicht miserabel gelebt, aber gelebt – und ich musste mein Leben in alltäglicher Monotonie und alltäglicher Langeweile fristen, was weiß ich!
Aber da waren noch meine beiden Schwestern. Zum Beispiel mit Juana, zwei Jahre jünger als ich, verstand ich mich sogar fabelhaft. Sie war ein für ihr Alter zu dünnes unterentwickeltes Mädchen mit unerschöpflicher Phantasie, das in der Lage war, mir zeitweise Abwechslung in den öden Alltag zu bringen. Ganz ehrlich: eigentlich war sie, nüchtern gesehen, nicht ganz richtig im Kopf – nur von einer mehr oder weniger schweren Geistesverwirrung schien unsere ganze Familie betroffen zu sein. Juanas Vorliebe zeigte sich im Erfinden von schauderhaften irrwitzigen Geschichten. Sie bekam Besuch aus dem Jenseits und wurde natürlich auch dorthin mitgenommen. Obwohl ich ihr kein einziges Wort glaubte, war ich oft so weit, dass ich mir wünschte, ebenso auf eine solche Reise gehen zu dürfen (heute würde ich liebend gern darauf verzichten). Besonders köstlich war Juana, wenn sie diese Geschichten musikalisch umzusetzen versuchte. Sie hatte eine erstaunlich gute Stimme und wenn die Stimmung im Haus auf dem Nullpunkt angelangt war, holte ich meine Gitarre und begleitete sie zu ihren grausam schröcklichen Balladen, wie sie ihre Kompositionen bezeichnete. Meistens ereilte darin Irgendwer irgendwann auf besonders schlimme und skurrile Weise der Tod. Und dieser Irgendwer hatte das selbstverständlich auch verdient. Juana legte äußerst viel Wert darauf, dass ihre Lieder immer mit der Moral von der Geschichte abschlossen. Ich konnte nicht anders, als mich zu amüsieren, mit wie viel Hingabe sie diese Moritaten vortrug. Wenn sie dem Schrecken noch mehr Ausdruck verleihen wollte, verzog sie ihr zartes hübsches Gesicht zu einer Grimasse, die mich allerdings zum Lachen reizte, in das sie schließlich notgedrungen mit einstimmen musste.
An diesem Abend war auch unsere kleine Gracía dabei (Enrique leistete uns ausnahmsweise Gesellschaft, selbst wenn er mit unserem eigenwilligen Humor wenig anzufangen wusste). In den großen Sessel gekuschelt lauschte sie mit großen ängstlichen Augen, um endlich erleichtert aufatmen zu können, wenn wir in unser albernes Gelächter fielen. Wir Geschwister hatten dieses ernste kränkelnde Kind sehr lieb, vielleicht gerade deshalb, weil wir ahnten, dass sie ihre kurze trostlose Kindheit wahrscheinlich nicht überleben würde.
Ausgerechnet dann, wenn wir glaubten, endlich etwas Behaglichkeit und Frieden in dieses düstere Haus gebracht zu haben, tauchte, als ob der Teufel es wollte, unser Vater auf. Er sagte uns nie, wohin er ging und nie, wie lange er fort blieb –- war uns auch eigentlich egal. Meine beiden Schwestern, die sich vor ihm fürchteten, sprangen sofort auf und verschwanden lautlos in ihre Zimmer, obwohl er ihnen nie etwas zu leide getan hatte. Jedes Mal, wenn Don Rodrigo den Raum betrat, glaubte ich, dass alles Lebende vor Kälte erstarrte. Er war ungewöhnlich groß, ausgezehrt wie ein Asket und seine Haltung immer ein wenig nach vorn gebeugt. Vor vielen Jahren musste er bestimmt ein schöner und stolzer Mann gewesen sein. Geblieben war ihm der unstete Blick aus seinen eisigen hellblauen Augen, und das schmale Gesicht mit den scharfen Wangenknochen gab ihm das Aussehen eines von Bitternis und Fanatismus geprägten Großinquisitors. So bezeichneten wir ihn unter vorgehaltener Hand. Ihm fehlte tatsächlich nur die passende schwarze Priesterkutte. Diese hätte ihm zweifelsohne besser gestanden, als der schäbige dunkle Anzug, in den er fast zweimal hinein passte.
Zuerst musterte uns Don Rodrigo abschätzend von oben bis unten, bis er ein Buch aus dem Schrank holte, sich in den Sessel, in dem vorhin noch Gracía gelegen hatte, fallen ließ und tat als ob er las. Mein Blick fiel auf Enrique – unser Vater war vollkommen lautlos erschienen – er saß wie erstarrt und wagte sich nicht zu rühren, bis Don Rodrigo plötzlich aufschaute und sagte:
„Bevor du vor Furcht noch einen Herzanfall bekommst, solltest du lieber nach oben auf dein Zimmer verschwinden.“
„Das hättest du gern. Ich habe keine Angst, aber in diesem Raum ist kein Platz für uns beide“, zischte Enrique, der seine Angst wieder unter Kontrolle hatte und erhob sich demonstrativ langsam.
„Nun, dann muss wohl einer von uns gehen.“
Eine weitere Aufforderung war nicht nötig und Enrique beeilte sich nun doch, nach oben zu gelangen. Ich blieb zurück – allein mit dem Großinquisitor – und ich fühlte mich weiß Gott mehr als unwohl. Also beschloss ich, ebenfalls schleunigst auf mein Zimmer zu flüchten. Noch nicht ganz bei der Treppe angelangt, rief mein Vater mich zurück.
„Setz dich wieder“, wurde ich aufgefordert. Mir schnürte es die Kehle zu und noch immer zur Flucht bereit, ließ ich mich behutsam auf der Stuhlkante nieder. Ich überlegte verzweifelt in Sekunden, was ich in den letzten Jahren verbrochen hatte, für das ich in diesem Augenblick garantiert zur Rechenschaft gezogen werden sollte.
„Du wirst heute siebzehn Jahre alt.“
Er wollte mir doch nicht etwa zu meinem Geburtstag gratulieren? Ich glaubte grinsen zu müssen, unterließ es jedoch, schließlich wusste ich nicht, was nach dieser umwerfenden Feststellung noch folgen würde. Ja, ich wurde genau siebzehn Jahre alt, genauso lange war ich sein Sohn und er schien diese Tatsache erst heute zu bemerken. Meine Beklommenheit wich der Neugierde. Sollte ich am Ende die Nachfolge meines Bruders antreten und somit in den großen Kreis der Beachteten aufgenommen werden?
„Keine Angst“, fuhr Don Rodrigo fort, „du brauchst nicht so misstrauisch drein zu schauen, ich reiß dir den Kopf nicht herunter. Ich wollte dich nur fragen, mit was du dich den ganzen lieben langen Tag beschäftigst?“
Jetzt musste ich wirklich grinsen, denn diese Frage war unangemessen und lächerlich. Ja, womit beschäftigte ich mich den lieben langen Tag. Ich spielte Gitarre, ritt spazieren, jagte hin und wieder für unser Abendessen und langweilte mich, eben all das, was ein Nachfahre spanischer Aristokraten zu tun pflegte.
„Hast du schon einmal an deine Zukunft gedacht?“
Wenn ich meinen Vater nicht so gefürchtet hätte, wäre ich nun garantiert in ein brüllendes Gelächter ausgebrochen. Natürlich hatte ich an meine Zukunft gedacht und war zu dem schlichten Ergebnis gekommen, dass ich keine hatte. Wie und wo denn auf einer abgelegenen heruntergekommenen Hazienda irgendwo in Mexiko, meilenweit vom nächsten Dorf entfernt, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Und diese anderen Menschen hegten zu uns blonden bleichen eingewanderten Spaniern ein abergläubisches Misstrauen. Meine Verwunderung wurde von einem mitleidigen Grinsen seitens Don Rodrigos quittiert.
„Mein Sohn, hast du eigentlich schon einmal in den Schrank dort drüben geschaut?“
Hatte ich nicht, zumindest nicht bewusst.
„Gut, dann geh rüber und hole das jetzt nach.“
Ich spielte sein Spielchen mit und tat wie geheißen. Was erwartete er von mir? Ehrlich gesagt außer Büchern konnte ich nichts anderes entdecken. Ich zog es vor, lieber nichts zu sagen.
„Hol dir irgendein Buch heraus, egal welches“, befahl Don Rodrigo weiter. Ich zog einen in Leder eingefassten Band aus dem Regal.
„Nun komm wieder zurück.“
Dieses Mal setzte ich mich ganz auf den Stuhl, denn ich fand das Spiel langsam irgendwie spannend. Don Rodrigo beugte sich plötzlich zu mir vor und schaute mich eine Zeitlang durchdringend an, bis er ganz sanft fragte:
„Sag einmal, mein jüngster Sohn. Kannst du überhaupt lesen?“
Also wieder der alte Spott. Ich sollte nicht vergessen, er spielte mit mir, nicht ich mit ihm. Ich erinnerte ihn zaghaft daran, dass ich vor etlichen Jahren ein Klosterinternat besucht hatte, in dem Lesen und Schreiben auf dem Stundenplan stand.
„Ich verstehe dich nicht“, seufzte mein Vater und ließ sich mit dem Ausdruck gespielter Verzweiflung in den Sessel zurückfallen. „Hier steht ein unerschöpflicher Reichtum an Wissen herum und was macht mein jüngster Sohn? Er langweilt sich. Weißt du, was ich getan habe, als das Haus brannte? (Es brannte nicht das Haus – es brannte vor dem Haus – sinnlos zu widersprechen.) Rate mal! Ich habe alle diese Bücher gerettet, mein Kind. Weil ich wusste, was sie für mich und auch einmal für euch bedeuten würden. Aber ich habe sie gewiss nicht gerettet, damit sie nun im Schrank verrotten, sondern gelesen und vor allem begriffen werden. Wenn möglich von euch allen. Wobei ich bei deinen Schwestern die Hoffnung schon begraben habe. Juana kann ja gerade mal ihren Namen schreiben. Der einzige, der sich allein und ohne meine Anregung mit den Büchern beschäftigt hat, war Enrique. Er hat alle gelesen …“
„… bis er blind geworden ist“, erlaubte ich mir, seinen Monolog zu unterbrechen und erschrak über meine Unverfrorenheit. Aber zugleich kehrte eine ungeheuer tiefe Befriedigung in mir ein, denn er war so verblüfft, dass er eine ganze Weile für eine Antwort brauchte, die wider Erwarten nicht in einer kräftigen Ohrfeige bestand.
„Mein jüngster Sohn, du bist ja regelrecht schlagfertig und gar nicht so tumb und verträumt wie ich erst glaubte. Ganz richtig. Es existieren Bücher, bei deren Durchblättern man schon blind werden kann.“
„Ist das hier so ein Buch?“, fragte ich sofort übermütig, weil er mir offensichtlich zu verstehen gab, dass ich ihm ebenbürtig war und deutete auf den Band, der noch immer schwer auf meinen Knien lag. Jetzt kam die Retourkutsche – ich hätte es wissen sollen:
„Nein, blind wirst du davon nicht. Mit Sicherheit bekommst du Kopfschmerzen, weil dein verkümmerter Geist den Text nicht zu erfassen vermag. Es ist das Werk eines sehr berühmten großen deutschen Dichters, den ihr in eurer Klosterschule bestimmt nicht gelesen habt.“
Immer dieser ekelhafte Dünkel. Ich beschloss, heute Nacht meinen verkümmerten Geist zu Höhenflügen zu verhelfen und diesen Lederschinken bis zur letzten Zeile zu lesen! Sollte ich so kühn sein und ihm auch eine Frage stellen? Ich sollte!
„Ich möchte noch wissen, was solche Bücher mit meiner Zukunft zu tun haben?“
Auch wenn ich seine Arroganz verabscheute, hatte er meine ganze Aufmerksamkeit geweckt. Don Rodrigo erhob sich und ging zum Fenster, schaute eine Weile hinaus, bevor er bedeutungsvoll fortfuhr: „Wir sprechen uns in einem halben Jahr. Du musst erst die nötige geistige Grundlage haben, bevor du begreifst, was ich mit dir vorhabe. Also mein jüngster Sohn, streng dein Gehirn, das du dem Himmel sei Dank ja zu haben scheinst, endlich einmal an und beschäftige dich mit wichtigeren Dingen, als den Schauermärchen deiner Schwester. Wie du siehst, dir steht alles zur Verfügung. So, und jetzt lass mich allein, ich habe noch zu tun.“
Ich klemmte das Buch unter den Arm und schlich vollkommen durcheinander nach oben auf mein Zimmer. Was war mit einem Mal in ihn gefahren? Einerseits war ich über sein ungewöhnliches Verhalten glücklich, andererseits wurde mir trotzdem irgendwie allmählich unheimlich. Am besten, ich würde ganz unbefangen an die Sache herangehen. Zuerst musste ich dieses Buch durchbringen und selbstverständlich auch die vielen anderen und wenn ich die nötige geistige Grundlage hatte ... ich kam nicht weiter, den Gedanken auszuspinnen.
„Efrén.“
Ich schaute mich erschrocken um und erkannte in der Dunkelheit Enriques Umrisse.
„Ich habe euer Gespräch mit angehört“, flüsterte er hastig und zog mich an sich .„Jetzt macht er es mit dir genauso, wie er mit mir angefangen hat. Lass dich bloß nicht von ihm einwickeln. Bitte sei vorsichtig, er ist ein ...“ Enrique kam nicht weiter.
„Er glaubt, ich sei ein Schwarzmagier“, ertönte Don Rodrigos Stimme plötzlich unten an der Treppe. „Er hat zu viele Schauergeschichten gelesen (doch nicht etwa die im Schrank?). Nun ist sein armer Geist so verwirrt, dass er nicht mehr Phantasie und Realität auseinander halten kann.“
„Ich weiß sehr genau, was ich sage“, brüllte Enrique zurück und zitterte dabei vor Wut am ganzen Leib. „Warum willst du deinen jüngsten Sohn wieder verderben? Kannst du nicht deine schmutzigen Finger von ihm lassen. Misch dich dieses Mal nicht in sein Leben ein.“
„Und du, misch dich gefälligst nicht in meine Entscheidungen ein“, entgegnete Don Rodrigo verärgert, als er oben angekommen war. „Ich will auf keinen Fall, dass er total verblödet. Es ist an der Zeit, dass er zu lernen beginnt.“
„Ich kann es nicht fassen. Nun, immerhin wird er hoffentlich schnell lernen, was für ein hinterhältiger Schuft sein eigener Vater ist“, fuhr Enrique unbeirrbar fort. „Es ist wahrscheinlich besser, ein verblödeter Geist zu bleiben, als eine Ewigkeit kreuzunglücklich zu werden.“
Nun verlor auch unser Vater die Geduld.
„Du solltest nicht immer von dir auf andere schließen. Im Übrigen bist du zwar kreuzunglücklich geworden, aber trotzdem noch verblödet geblieben. Das zum Ersten. Zum Zweiten – und das meine ich jetzt verdammt ernst – ich verbiete dir, Efrén in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Du weißt, was ich meine, nicht wahr? Hoffentlich begreift das dein kreuzunglücklicher verblödeter Geist. Gute Nacht zusammen.“
Dem hatte Enrique nichts mehr entgegen zu setzen. Mit einem lauten Aufschluchzen verschwand er in seinem Zimmer. Ich fragte mich einen Augenblick, ob er mich wirklich vor einer drohenden Gefahr warnen wollte oder ob er ganz einfach eifersüchtig war. Ich fürchte, dass der erste Gedanke wohl am ehesten zutraf. Ich konnte mich also noch auf einiges gefasst machen, bevor ich die nötige geistige Grundlage hatte. Nur mich sollte mein Vater niemals heulen sehen!
In meinem Zimmer angelangt, warf ich mich auf das Bett um nachzudenken. Und ich kam zu dem Ergebnis, dass mein Leben nun doch einen Sinn haben sollte, denn ich wurde gefordert und ich wurde gebraucht. Mein Vater, Don Rodrigo de Alpojar beschäftigte sich mit seinem jüngsten Sohn! Ich glaubte, das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich zu sein – nur das zählte im Augenblick. Was er mit mir vorhatte, war mir im Moment gleichgültig, genauso ob er ein Schwarzmagier war. Enrique phantasierte bestimmt. Zugegeben, Don Rodrigo war oftmals mehr als eigenartig, aber mein Bruder tat ja gerade so, als ob er der Teufel persönlich wäre, idiotisch.
Ich beschloss nun endlich mit dem Buch anzufangen, das ich mit nach oben geschleppt hatte. Den Titel fand ich ehrlich gesagt nicht sehr aufschlussreich „Faust – eine Tragödie von Johann Wolfgang von Goethe“. Also gut. Ich schüttelte mein Kopfkissen zurecht und begann forsch zu lesen. Eine halbe Stunde später stellten sich tatsächlich die Kopfschmerzen ein, die mein Vater mir prophezeit hatte. Ich hätte nie gedacht, dass Lesen dermaßen anstrengend sein konnte. Die Zeilen verschwammen vor meinen Augen und schließlich wusste ich am Ende der Seite nicht mehr, was ich am Anfang gelesen hatte. Aber ich wollte durchhalten – unerbittlich. Ich musste dieses verdammte Buch durchstehen und verstehen, damit mich Don Rodrigo nicht für einen Schwachkopf hielt und mich womöglich wieder in die triste Langeweile zurückschickte. Außerdem brauchte ich so schnell wie möglich die nötige geistige Grundlage. Ein unvorstellbares Grauen erfasste mich, als ich mir vorstellte, dass die gesamte Bibliothek meines Vaters aus dieser Gattung Literatur bestand. Ich würde Jahre brauchen, bis ich das ganze Zeug durchgeackert hatte. Ein schwaches Aufflackern meines erschöpften Geistes glaubte ich zu spüren, als ich an die Stelle kam, wo sich Faust und Mephisto in der Hexenküche befanden, dann fiel ich in tiefen Schlaf.
Irgendwann mitten in der Nacht erwachte ich. Die Kerze war schon längst herunter gebrannt. Wie ein erdrückender Albtraum lag der „Faust“ in meinem Magen beziehungsweise auf dem selben. Bevor ich weiter las, begann ich erst einmal die Seiten zu zählen die mir noch bevorstanden und gleichzeitig wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich das gewünschte Pensum diese Nacht niemals schaffen würde. Warum sollte ich mich eigentlich mit einem Buch herumplagen, das mich zu Tode langweilte. Don Rodrigos Bibliothek war so umfangreich, dass ich die nötige geistige Grundlage bestimmt mit einem spannenderen Werk erreichen konnte.
Diese Erkenntnis befriedigte mich. Ich legte mich entspannt in meine Kissen zurück und versuchte zu schlafen. Aber ich hatte dermaßen grässliche Träume, animiert von Goethes Faust und Enriques finsteren Andeutungen, dass ich nach kurzer Zeit schweißüberströmt am ganzen Leib zitternd erwachte. So etwas war mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert und einen kleinen Moment sehnte ich mich doch nach meinem ruhigen und langweiligen Leben zurück –- aber wirklich nur einen ganz kleinen Moment. Nach weiteren vergeblichen Versuchen wieder zur Ruhe zu kommen, gab ich auf, erhob mich und ging ins Nebenzimmer zu Juana. Wie erwartet, war sie noch wach. Ich setzte mich zu ihr an den Bettrand und ließ mir von ihr die üblichen harmlosen Schauermärchen erzählen, die ich weitaus unterhaltsamer fand, als Don Rodrigos hochgestochene Bücher, die sowieso in einer Sprache geschrieben waren, in der sich kein normaler Mensch zu unterhalten pflegte.
Am nächsten Morgen – in aller Herrgottsfrühe – schlich ich verstohlen in den Aufenthaltsraum hinunter, um den verhassten Goethe so schnell wie möglich in den Schrank zurückzustellen. Kaum hatte ich ihn mit einem hörbar erleichterten Aufseufzen ins Regal geschoben, da bemerkte ich zu meinem Entsetzen, dass mein Vater hinter mir stand.
„Hat es dir gefallen?“
Ich glaubte, einen dicken Kloß in der Kehle stecken zu haben. Nachdem ich mehrere Male versuchte hatte, ihn hinunterzuwürgen, gab ich ihm auf seine Frage die typische Antwort, die einem immer einfällt, wenn man etwas absolut nicht verstanden hat.
„Nun, es war ganz interessant.“
„Was bist du für ein ergötzliches Kerlchen, Efrén. Das Buch war offenbar so interessant, dass du darüber eingeschlafen bist“, höhnte mein Vater.
„Das nächste Buch verstehe ich bestimmt“, erwiderte ich gereizt, was Don Rodrigo veranlasste schallend zu lachen. Ich fühlte mich nicht nur bis auf die Knochen blamiert, sondern auch erbärmlich gedemütigt.
„Du bist gemein“, flüsterte ich kaum hörbar und versuchte verzweifelt, meine Tränen zurückzuhalten. Und er hörte sofort auf zu lachen.
„Es tut mir leid Efrén. Aber du wirst doch jetzt nicht aufgeben wollen.“ Ich spürte, wie er auf einmal seinen Arm um meine Schulter legte und seine Stimme wurde ganz freundlich, als er fortfuhr: „Natürlich kannst du das noch nicht verstehen. Du hast dich am Anfang einfach übernommen. Komm mit, ich suche etwas für dich aus, was du ohne Schwierigkeiten lesen kannst. Keine Angst, mein jüngster Sohn, du wirst es schaffen. Das weiß ich.“
Sofort war ich wieder mit mir und mit ihm versöhnt und musste sogar an mich halten, dass ich ihm nicht vor lauter Freude um den Hals gefallen wäre.
War Don Rodrigo in vielen Dingen noch immer ein Scheusal geblieben sein, so häuften sich doch die Momente, in denen ich ihn zu mögen begann und mich nicht über seine mangelnde Aufmerksamkeit beklagen konnte. Von jenem Tag an beschäftigte er sich mit mir mit einer immensen Geduld und bereits nach einem halben Jahr war ich so weit, dass ich mich fast ohne seine Hilfe mit der komplizierten Materie befasste. Er hatte sich wirklich Mühe gegeben und mich in Literatur, Philosophie, Theologie sowie Astrologie und auch Mathematik unterrichtet. Oft waren die Tage so anstrengend, dass ich abends todmüde ins Bett fiel und in traumlosen Schlaf sank. Ich lernte erstaunlich schnell, so als ob ich in kürzester Zeit das Wissen, das mir all die Jahre vor meinem siebzehnten Lebensjahr vorenthalten wurde, einverleiben müsste. Kurz gesagt, ich wollte einfach so schnell wie möglich die nötige geistige Grundlage erreichen. Ich war doch so gespannt, was Don Rodrigo dann mit mir vorhatte (ich blödes naives Kalb).
Ein Wermutstropfen blieb, denn während der ganzen Zeit folgte mir Enrique wie ein drohender Schatten, und immer wenn er unseren Vater nicht in der Nähe glaubte, zischte er mir dieselbe Warnung zu. Er tat mir leid, schließlich hatte ich jetzt seine Stelle eingenommen. Ihn hatte man fortgestoßen wie einen lästigen alten Hofhund und wer weiß, was unser Vater sonst noch mit ihm vor hatte. Ich versuchte mein Mitleid in Grenzen zu halten, indem ich mir immer wieder einredete, dass er meine Fortschritte nur neidete. Trotz des Unbehagens, das mein Bruder nach jedem seiner Auftritte hinterließ, behielt meine Neugierde die Oberhand. Ich versprach ihm, mich in acht zu nehmen, somit hatte er und vor allem ich Ruhe.
Nach diesem halben Jahr intensiver Arbeit, glaubte ich, dass nun endlich der Augenblick gekommen sei, wo mein Vater mir seine wirklichen Absichten mitteilen würde. Ich war aufs Äußerste enttäuscht, als mich Don Rodrigo auf ein weiteres Jahr vertröstete. Er behauptete, ich müsse noch viel mehr Geduld aufbringen, das Gelernte sinnvoll verarbeiten und nichts überstürzen, weil ich mir sonst alles verderben würde. Ich hegte kurz den Verdacht, dass er mich doch an der Nase herumführte, aber ich verwarf diesen Gedanken sofort wieder. Er hätte sich ja wohl kaum die anstrengende Arbeit gemacht, mir sein Wissen, das er sonst hütete wie einen verborgenen Schatz, zu vermitteln. Ich musste eben weiter warten, warten, warten!
Übrigens, Goethes Faust habe ich allerdings seit jenem bewussten Abend nie wieder angerührt.
Mexiko | Finis Terra 1917 – 1923
2.
Diner mit weißen Bohnen, schwarzem Kater und toter Maus
Wenn ich mich an Don Rodrigos eigenartigste Gepflogenheit zu erinnern versuche, so fällt mir sofort der abendliche Vollzug unseres Diners ein. Jetzt, im Nachhinein, kann ich mich darüber amüsieren. Aber noch vor wenigen Wochen war es mir so unbegreiflich wie entsetzlich, dass von unserem vergoldeten Tafelservice, das sicher einst herrliche Festtafeln erlebt hatte, zur Unkenntlichkeit zerkochte Maiskolben und weiße zermanschte Bohnen und noch andere undefinierbare Schrecklichkeiten einverleibt wurden. Don Rodrigo bestand auf dieser Tradition, die er bereits als Kind pflegte und die Armut und der Zerfall dieses Hauses hinderte ihn keineswegs daran, diese Tradition aufrecht zu erhalten. Im Grunde war das Ganze nichts anderes als eine Farce, auf deren Höhepunkt selbst diniert wurde, wenn gar nichts zu Essen da war. So kam es hin und wieder vor, dass wir sogar mit knurrenden Mägen vor den kostbaren leeren Tellern saßen und so tun mussten, als ob wir fürstlich speisten. Ob unser Vater in dieser Beziehung wirklich verrückt war oder ob das nur eine weitere Variante seiner Gemeinheiten darstellte, ist mir bis heute noch nicht klar. Während seiner Abwesenheit ließen wir das Diner selbstverständlich ausfallen. Leider hatte er anscheinend beschlossen, sich endgültig hier im Haus zur Ruhe zu setzen, denn er beglückte uns schon seit mehr als einem Jahr mit seiner Gegenwart und verschonte uns keinen Abend mit diesem blödsinnigen Ritual.
Felipe, unser Diener, kochte, sofern es etwas zu kochen gab, bereitete die Gänge sorgfältig zu und trug schließlich über alle Maßen zufrieden und stolz einen nach dem anderen auf. Ja, wir hatten sogar einen Diener, der die Funktion eines Kochs und vor allem die des Hofnarrs inne hatte. Don Rodrigo hatte die arme kleine Missgeburt auf der Straße aufgelesen. Felipe war ein winziges dünnes Kerlchen mit einem zu großen aufgequollenen Bauch, mageren steifen Beinen und der riesige Kopf, der so rund war wie seine grauen wässrigen Augen, gaben ihm das Aussehen einer wandelnden Wassermelone. Geistig auf der Stufe eines zehnjährigen Kindes zurückgeblieben, war er die ständige Belustigung unseres Vaters, der an ihm immer wieder seinen schlechten Humor austobte.
Felipe hatte eben den Tisch gedeckt. Er brauchte eine Ewigkeit dazu, tat es aber mit einer ganz besonderen Hingabe, als Don Rodrigo mit wohlgefälligem Lächeln auf der Bildfläche erschien. Noch einen Augenblick schweiften seine Blicke über die Pracht des vergoldeten Tafelgeschirrs, dann forderte er mit einer wahrhaft königlichen Geste auch uns auf zu sitzen.
„Felipe!“
Der Genannte erschien am Eingang.
„Du kannst auftragen.“
Felipe nickte, verbeugte sich und verschwand, um seinen Höhepunkt des Abends zu zelebrieren. Inzwischen hatte Don Rodrigo die Kerzenstummel auf den versilberten Leuchtern angezündet. Dann kam Felipe zurück. Auf dem Arm trug er eine große Schüssel.
„Herr, der erste Gang“, verkündete er dabei einfältig lächelnd. Die einzelnen Gänge waren haarsträubend phantasielos. Sie variierten hauptsächlich zwischen weißen Bohnen und Mais. Manchmal gab es aber auch hintereinander das Gleiche. Nun begann Felipe auszuteilen und ich fragte mich jedes Mal, ob dieses dampfende Etwas essbar war oder ob es zum Verkitten der Risse an den Wänden diente. Es roch nicht nur seltsam, es bot in dem feinen Geschirr einen derart widerlichen Anblick, dass mir der Hunger erst einmal gründlich verging. Aber mein Magen knurrte und ich hatte keine andere Wahl, als ihn wieder mit dieser abscheulichen Pampe aufzufüllen. Also spielte ich meine Rolle wie jeden Abend in dieser unsäglichen Farce, grinste Felipe gequält an und ließ ihn in aller Ruhe meinen Teller vollhäufen. Als er endlich seine Runde gemacht hatte, wünschte uns seine blöde Fratze „Guten Appetit“, den wir allerdings nötig brauchten. Das Tischgebet ließen wir ausfallen, zumal Don Rodrigo seit dem Tod unserer Mutter keinen gesteigerten Wert mehr darauf legte.
Noch unerträglicher als dieser Fraß, war unser Vater, der es nicht lassen konnte, uns während der abgeschmackten Mahlzeiten mit seinen abgeschmackten Bemerkungen auf die Nerven zu gehen. Er rief Felipe an den Tisch und erkundigte sich mit interessierter Stimme:
„Felipe, du gibst mir ein Rätsel auf, was ist das für ein eigenartiges Gericht?“
„Es sind Bohnen, Herr – eine Bohnensuppe.“ (Sehr eigenartig.). Don Rodrigo schüttelte daraufhin fassungslos den Kopf, nahm die Gabel und stocherte eine Weile im Teller herum. Schließlich spießte er ein verschrumpftes Gebilde auf und fixierte es.
„Wahrhaftig eine Bohne.“
Diese umwerfende Erkenntnis versetzte Felipe in einen wahren Freudentaumel.
„Es freut mich, wenn es Ihnen schmeckt, Herr.“
„Aber natürlich. Äußerst süperb diese Bohne“, entgegnete Don Rodrigo zufrieden und wandte sich an uns: „Mir scheint, ihr seid nicht hungrig. Aber ihr solltet trotzdem unbedingt Felipes ausgezeichnete Bohnensuppe versuchen.“
Enrique hatte die versteckte Drohung zuerst begriffen. Er nahm den Löffel und begann mühsam zu essen. Juana und Gracía folgten seinem Beispiel. Ich konnte mich dazu absolut nicht aufraffen, bis mein Vater auch mich ermahnte:
„Du willst doch nicht verhungern, mein jüngster Sohn. Iss, das ist kein Gift!“
Ich hatte weder die Absicht, an Hunger noch an Gift zu sterben. Ich beschloss, gleich am nächsten Morgen auf die Jagd zu gehen. Ich hatte schon lange keinen Kaninchenbraten mehr gegessen. Offensichtlich besaß Don Rodrigo die unheimliche Gabe des Gedankenlesens.
„Efrén, bitte lass das Gewehr im Schrank. Wir brauchen die Munition für das Gesindel, das sich hier in der Gegend herumtreibt und nicht für die armen Häschen, die du so leidenschaftlich gern abschießt.“
Er wusste ganz genau, seit dem Aufstand hatte sich keine Menschenseele mehr hier blicken lassen und ich hätte meinen Kopf dafür gewettet, dass das alte Ekel die armen Häschen hinter unserem Rücken haufenweise abknallte, um sie heimlich zu verspeisen. Aber ich spürte, dass er sehr gereizt war und ich mich lieber nicht mehr mit ihm anlegen sollte. Ich ergriff schließlich auch den Löffel, zitterte aber dabei so vor Wut, dass er mir aus der Hand in den Teller glitt. Das Aufklatschen in der grauen Brühe war dermaßen ekelhaft und ich musste mich fast übergeben, wenn es etwas zu übergeben gegeben hätte. Meine Geschwister aßen mit gequälten verängstigten Gesichtern. War es wirklich die Angst vor unserem Vater, die sie dazu trieb oder einfach nur der nackte Hunger. Was ihn betraf, er musste wirklich komplett übergeschnappt sein. Er löffelte das grässliche Zeug wie eine erlesene Köstlichkeit in sich hinein. Dann klatschte er gleich einem satten zufriedenen Sultan in die Hände. Prompt erschien Felipe am Eingang.
„Du kannst den nächsten Gang auftragen.“
Felipe verneigte sich wieder und sammelte lärmend die Teller ein. Als er bei mir vorbeikam, konnte ich seine Enttäuschung deutlich spüren.
„Ach, Don Efrén, hat es Ihnen nicht geschmeckt?“
Um die Heuchelei auf die Spitze zu treiben (ich bin immerhin der Sohn meines Vaters) bedauerte ich schmerzlich:
„Es war ausgezeichnet wie immer, aber ein wenig zu scharf, du weißt, mein Magen.“
„Wie konnte ich das vergessen, Don Efrén. Ich verspreche Ihnen, in Zukunft nicht mehr so verschwenderisch mit den Gewürzen umzugehen.“
Felipe hatte bestimmt noch nie in seinem Dasein ein Gewürz gesehen geschweige benutzt – seine Speisen waren grundsätzlich gewürzarm – aber er war beruhigt. Der zweite Gang entpuppte sich als Bohnengemüse. Nachdem Don Rodrigo noch eine Weile den unerschöpflichen Einfalls(oder eher Einfalts-) reichtum unseres Meisterkochs gelobt hatte, entschied ich, doch nicht am Hungertod zugrunde zu gehen und würgte den weißgrauen Brei herunter. Als Felipe zum dritten Mal auftauchte, in der Hand eine Schale mit der gleichen weißen Masse, ahnten wir, dass es sich bereits um den dritten Gang handeln musste und wir bald erlöst waren. Don Rodrigo, wie immer an den neuesten Rezepten interessiert, fragte natürlich sofort:
„Entzückend, was ist das Delikates?“
„Das ist pikanter Bohnensalat, Herr.“
„Meine Güte, deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.“
Felipe lächelte verlegen und eine eifrige Röte stieg in sein teigiges blasses Gesicht. Dann stelzte er nach draußen, um in der Küche die Reste dieses Festmahles zu verzehren. Nun wurden sogar meine Geschwister ungeduldig. Gracía war ohnehin schon fast eingeschlafen, Juana lauerte offensichtlich darauf, endlich in ihr Zimmer verschwinden zu können und Enrique stocherte lustlos in seinem Teller herum, bis er ihn schließlich angeekelt beiseite schob und etwas von „verdorben und muffig“ murmelte. Mit finsteren Blicken hatte Don Rodrigo ihn beobachtet, bis er gleichfalls die Gabel sinken ließ.
„Was ist mit dir, mein Erstgeborener?“
Enrique erhob sich.
„Ich bin satt und wünsche nach oben zu gehen,“ brachte er mühsam heraus.
„Wünschen kannst du. Nur, ob deine Wünsche sich erfüllen, ist eine andere Sache“, zischte Don Rodrigo „Hier wird noch immer getan, was ich wünsche. Du setzt dich wieder und bleibst hier, bis wir alle fertig sind. Wo bleibt dein Familiensinn.“
Mit wutverzerrtem Gesicht ließ sich Enrique nieder. Ich hatte noch nicht erwähnt, dass der absolute Höhepunkt unseres abendlichen Festessens immer in einem handfesten Krach zwischen meinem Bruder und Don Rodrigo endete. Heute waren die beiden sogar früher dran, denn normalerweise begann Don Rodrigo mit seinen Sticheleien erst zum Dessert (Bohnenmus?!).
„Sag nur, dir schmeckt es nicht.“
„Nein verehrter Don Rodrigo de Alpojar. Es schmeckt mir nicht. Der Fraß ist genauso abgeschmackt wie deine niederträchtigen Bemerkungen. Du und dein Spott ekeln mich an.“
„Habe ich dich verspottet, Erstgeborener? Aber nein. Ich habe dich nur gebeten noch zu bleiben.“
„Vergiss nicht, ich verabscheue schlicht und einfach deine Gegenwart“, murmelte Enrique und versuchte, sich wieder vom Stuhl zu erheben.
„Hast du schlecht geschlafen?“
„Keineswegs. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Aber es ödet mich einfach an, wenn ich jeden Abend erleben muss, wie dir das Gift aus allen Löchern herauskommt.“
„Bei dir sind es wenigstens nur die Bohnen“, feixte Don Rodrigo zurück.
„Lass mich endlich mit deinen verdammten Scheißbohnen in Frieden.“
Unser Vater ließ sich keineswegs aus der Ruhe bringen. Er genoss den widerlichen Streit wie er die widerlichen Bohnen genoss.
„Ich weiß, wovon du dich normalerweise ernährst, du ekelhafte Kreatur. Sei also froh, dass du hier bei mir überhaupt deinen Magen mit etwas Anständigem füllen darfst. Diese Bohnen enthalten alle wichtigen Nährstoffe für deine überreizten Nerven. Fleisch täte dir sowieso gewiss nicht gut. Es würde nur unnötig deine Sinne anregen, wenn du weißt was ich meine, mein Erstgeborener.“
Nun kam auch Enrique in Fahrt – er hatte keine Chance - aber er musste es immer wieder versuchen. Und er war wütend, und so wütend hatte ich ihn noch nie erlebt.
„Ich weiß sehr wohl was du meinst, spar dir deine vulgären Andeutungen. Wir wollen in der Tat etwas Anständiges zu essen. Wenn du mit diesem vergammelten Dreckzeug zufrieden bist, ist das deine Angelegenheit.“
Scheinbar fassungslos schüttelte Don Rodrigo den Kopf.
„Lass deine Geschwister gefälligst da raus. Und das ist der Dank dafür, dass ich dir mein ganzes Wissen vermacht habe? Du streitest dich mit mir um ein blödsinniges Stück Fleisch. Vor einigen Jahren fandest du andere Dinge noch wesentlich erstrebenswerter als nur deinen Bauch voll zuschlagen. Deine Weisheit beschränkt sich jetzt nur noch auf primitivste Bedürfnisse. Du bist so armselig, Enrique.“
„Lass mich endlich in Ruhe!“, brüllte Enrique.
„Hör du endlich auf, dich zu benehmen wie ein keifendes Fischweib!“, schrie nun auch mein Vater. Er war wohl gerade im Begriff aufzustehen, um vielleicht Enrique eine Ohrfeige zu verpassen, als er plötzlich innehielt und grinste. Der Grund war unser Kater, der mit einer erbeuteten Maus auf den Tisch gesprungen war. Obwohl, oder gerade weil Enrique dieses schwarze Vieh hasste wie die Pest, hatte es nichts anderes zu tun, als ausgerechnet die tote Maus auf seinem Teller abzulegen.
„Schau Onyx hat sich deiner erbarmt und dir eine kleine Leckerei mitgebracht.“
Don Rodrigo konnte kaum an sich halten vor Lachen. Wenn die Situation in ihrer Grausamkeit nicht so real gewesen wäre, hätte ich einen Augenblick geglaubt, Akteur in einem miserablen Theaterstück zu sein. Natürlich tastete Enriques Hand nach dem Teller und befühlte zitternd die tote Maus. Bevor unser Vater noch ein weiteres geschmackloses Bonmot von sich geben konnte, war Enrique mit einem Aufschrei größter Verzweiflung aufgesprungen und stolperte weinend nach oben in sein Zimmer.
Ich bezweifelte, dass dieser Zwischenfall zufällig war. Enriques Flucht hatten auch meine Schwestern als Gelegenheit genutzt, unauffällig zu verschwinden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte – meinem Bruder folgen und ihn trösten – ich hatte keine Worte, um ihn zu trösten. Also blieb ich, ohne es zu wollen, wie erstarrt sitzen und beobachtete, wie Felipe geschäftig das Geschirr abräumte. Eine Spur von Mitleid kam in dem Augenblick in mir auf, als mich seine blöden runden Augen traurig anschauten und er schließlich in seiner demütig gebückten Haltung wieder in der Küche verschwand.
Ich wollte ebenso nach oben gehen, aber ein unerklärlicher Zwang hielt mich plötzlich in diesem Raum gefangen. Ich atmete ein paarmal tief auf und schaute verängstigt zu der anderen Seite des Tisches, wo mein Vater saß und mit starren Blicken das fahle Licht der Kerzen fixierte. Er schien mich nicht mehr wahrzunehmen und völlig entrückt zu sein. Seine Augen waren wie verschleiert und ab und zu huschte ein eigenartiges Lächeln über seine Lippen. Merkwürdig – jetzt konnte ich erkennen, dass er überhaupt nicht in die Kerzen sah. Ohne mich von der Stelle zu rühren, folgte ich vorsichtig seinen Blicken. Er schaute unbeweglich auf den großen Schrank in der Ecke des Raumes. Aber sein blasses Gesicht mit den harten Zügen war mit einem Mal nicht mehr beunruhigend und bösartig, sondern unglaublich anziehend. Seine starren Augen, die unaufhaltsam etwas suchten oder vielmehr betrachteten, die durch die Dunkelheit hindurch zu sehen vermochten, die Dinge erfassten, die mir trotz größter Anstrengungen nicht gegenwärtig wurden, hatten meine Sinne gefangen genommen.
An diesem Abend, als das Verhängnis unaufhaltsam seinen Lauf nahm, als in mir der Wunsch aufkam, wie auch er diese Dinge sehen zu wollen, ihren Sinn zu begreifen, ertappte ich mich dabei, wie auch ich den Schrank anzustarren versuchte. Natürlich sah ich nichts. Ich probierte es ein zweites Mal, nichts. Dieses Etwas wollte sich nicht vor meinen Augen materialisieren, die undurchdringliche Dunkelheit gab mir ihr Geheimnis nicht preis, noch nicht. Und ich war mir der Gefahr, in die ich mich begab, nicht im geringsten bewusst. Die Tatsache, dass mein armer verzweifelter Bruder für diese Dinge womöglich mit seinem Augenlicht und seinem Verstand bezahlt hatte, ignorierte ich.
Auf eimal spürte ich, wie sich eine schwere Hand auf meine Schulter legte und als ich mich umdrehte, sah ich entsetzt in Don Rodrigos Gesicht. Ich hatte Zeit und Raum vergessen und nicht gemerkt, wie er aufgestanden war. Wie immer lag ein herablassender Ton in seiner Stimme, als er sagte:
„Ich begreife dich nicht, Efrén. Im Garten ist es herrlich, der Mond scheint und die Nacht ist so mild. Stattdessen sitzt du hier herum und starrst förmlich Löcher in die Luft. Oder wartest du auf eine Erleuchtung?“
Er betrachtete mich noch kurz mit leutseligen schadenfrohen Blicken, dann verließ er wortlos den Raum. Er wusste genau, was in mir vorging – von meinem Wunsch so zu sein wie er – er wusste, dass ich unwiderstehlich von ihm gefangen war.‚
Mexiko | Finis Terra 1917 – 1923
3.
Im Brunnenschacht
Letzte Nacht habe ich wieder sehr schlecht geschlafen. Ich muss etwas Scheußliches geträumt haben. An den Traum selbst kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiß nur noch, dass ich schreiend aufgewacht bin. Eigentlich wäre es gescheiter, wenn ich mich nicht allzu sehr mit meiner Vergangenheit beschäftigen würde. Sie belastet mich mehr als ich dachte. Wenn wenigstens jemand bei mir wäre. Die Stille im Haus beginnt mich zu beunruhigen. Aber ich habe weder die Kraft noch den Mut, dieses Haus zu verlassen. Als einzige Gesellschaft, außer unserem Stallknecht, ist mir der schwarze Kater geblieben, der gegenüber auf dem Sessel liegt und friedlich schläft.
Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach, bei unserem Diner. Inzwischen war ein weiteres Jahr vergangen und mein Vater hatte mir noch immer nicht gesagt, was er mit mir vorhatte. Langsam begann ich die Geduld zu verlieren. Doch er brachte es fertig, mich bei der Stange zu halten. Ich hoffte also unermüdlich weiter auf den großen Augenblick.