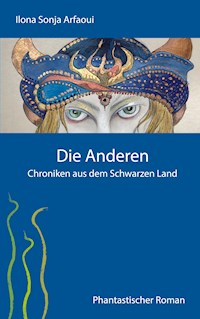Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Großstadt in Süddeutschland, eine einsame Hütte in den Tiroler Alpen, ein erfolgloser Schriftsteller, der eine schwere Schuld auf sich geladen hat, wie er dagegen anzuschreiben versucht, sich ihr letztendlich stellen muss. Und jene Kinder der Nacht, deren Schicksale unwiederbringlich mit dem seinen verbunden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Großstadt in Süddeutschland, eine einsame Hütte in den Tiroler Alpen, ein erfolgloser Schriftsteller, der eine schwere Schuld auf sich geladen hat, wie er dagegen anzuschreiben versucht – sich ihr letztendlich stellen muss. Und jene Kinder der Nacht, deren Schicksale unwiederbringlich mit dem seinen verbunden sind:
Rémy: Sang, dass die Engel im Himmel jubelten. Sein Vater verkaufte ihn für Ruhm und Reichtum an einen Mörder. Megan: Sprach mit Elfen. Ihre Eltern waren davon überzeugt, sie sei ein Wechselbalg. Marie: Das niedliche eitle Frätzchen musste sterben, weil sie zu Bescheidenheit und Demut gezwungen wurde. Alexios: Der kleine Held erntete wegen des Appetits auf kandierte Früchte nur Spott. Miriam: Das hochbegabte Kind kam zur falschen Zeit im falschen Land zur Welt. Menschen wie ihresgleichen schickte man als unwertes Leben in den Tod. Mascha: Sie wollte Gerechtigkeit für ihr hungerndes Volk. Der Vater, ein hochmütiger Aristokrat, trieb ihr zuerst die Flausen aus dem Kopf und sie anschließend in die Arme eines falschen Mannes. Phoebe: Ihre kindliche Phantasie und die zerstörerische Phantasie des Vaters wurden ihr zum Verhängnis.
Ilona Sonja Arfaoui: Jahrgang 1950, lebt mit ihren Katzen in Stuttgart. Vor ihrem Ruhestand arbeitete sie als Werbeberaterin und Grafik-Designerin in der Werbeabteilung eines Verlages. Von ihr sind bereits drei phantastische Romane: Der Hexenmeister, die Macht und die Finsternis (2016) | Der König der Schatten (2019)|Die Anderen – Chroniken aus dem Schwarzen Land (2022) sowie eine Katzengeschichte (Die Katze, der Traum und der Pharao 2016) erschienen. (www.ilonaarfaoui.com)
Für Rémy, Megan, Marie, Alexios,
Miriam, Mascha, Phoebe
und zum Gedenken an alle Kinder,
denen auf dieser Welt ein gleiches
Schicksal beschieden war.
Wir verlangen nach Wahrheit, und finden nur Ungewissheit. Wir suchen Glück, und finden nur Unglück und Tod. Wir sind unfähig, Wahrheit und Glück nicht zu wünschen, und sind doch weder der Gewissheit und des Glücks fähig. Dieses Verlangen ist uns gelassen, sowohl um uns zu strafen, wie uns fühlen zu lassen, aus welcher Höhe wir gefallen sind. | Blaise Pascal
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Über den Autor
Widmung
Motto
Vendée, Frankreich 1439 – Rémy
März 2018
April 2018
Mayo, Irland 1845 – Megan
Mai 2018
Juni 2018
Paris, Frankreich 1789 – Marie
Juli 2018
Heutige Türkei, Troja um 1182 v. Chr. – Alexios
August 2018
Eine Großstadt in Deutschland 1939 bis 1942 – Miriam
September 2018
Jekatherinenburg, Russland 1918 – Mascha
Oktober 2018
Eine Hütte in den Tiroler Alpen, Österreich 2017 – Phoebe
November 2018
Dezember 2018
Epilog
Nachwort
eitere Informatione
Die Fortsetzung
Das Finale
Vendée, Frankreich 1439 – Rémy
„Schön wie ein Engel!“, Worte, scheinbar gleichgültig dahin gesprochen, sollten in Bälde Pierre D.s beschaulich genügsames Leben aus den Fugen geraten lassen. Schön wie die Engel waren sie allesamt, diese weizenblonden, goldblonden, rotblonden blau-grün-grau-äugigen elfengleichen Knaben im Alter von acht bis vierzehn Jahren. Rémys Augen waren blauviolett! Er hatte nicht nur das Aussehen eines Engels, er hatte die Stimme eines Engels. Sein betörender Gesang erklang bei jeder passenden und manchmal unpassenden Gelegenheit zur Freude der stets gut gelaunten Mutter, zum Verdruss des ehrgeizig strengen Vaters bis hin zu den wohlgesinnt schlichten Bewohnern seines Dorfes. Er erreichte auch die empfindlichen Raubtierohren jenes lasterhaften Ungeheuers, das sich, zurückgekehrt von einer Reise in die umliegenden Provinzen, wieder hinter den wuchtigen Mauern seiner monströsen Festung verschanzt hatte. Jene Engelsstimme verhalf dem unscheinbaren Schneider Pierre D. zu Einfluss und Reichtum, währenddessen sie seinem Sohn zum Verhängnis wurde.
Rémy war das einzige Kind des Schneiders und dessen Gemahlin. Dementsprechend wurde das Chouchou von der Mutter über die Maßen verhätschelt. Mit stoischer Geduld ließ Pierre die unverhältnismäßigen Liebkosungen, die seine Gemahlin dem verzärtelten Jungen zuteil werden ließ, über sich ergehen, bis er nach neun Jahren, anfangs behutsam, kundtat, dass es an der Zeit wäre, den bezauberten kleinen Fresser zum nützlichen Familienmitglied auszubilden.
Einwände, dass der begabte Sohn in der benachbarten Klosterschule als aufmerksam und gelehrig gelte, erstickte Pierre, inzwischen sichtlich gereizt, im Keim. Das Chouchou könne bereits ausreichend lesen und schreiben, das bisschen Rechnen lerne es so nebenbei während es den Vater bei der Arbeit unterstütze. Falls so nebenbei die Engelsstimme zum Einsatz käme – warum nicht! Hauptsache, der Müßiggang (schließlich hatte er nur diesen einen Sohn), nehme ein Ende. Er, Pierre D., ein einfacher Schneider, brauche vor allem einen tüchtigen Nachfolger, der imstande sei, ordentlich mit Nadel und Faden umzugehen und nicht die kostbare Lebenszeit mit Flausen, wie sich die lateinische Sprache einverleiben zu wollen, verschwendete. Das hätte ihm noch gefehlt: sein Chouchou als Pfaffe! Neben salbungsvoller Predigten brauchten die Menschen für den Kirchgang unter anderem angemessene Gewänder – konnten nicht zerlumpt oder nackt dem hochwürdigen Herrn Pfarrer unter die hochwürdigen Augen treten. Soweit Pierre D.: am Ende hatte selbst die widerspenstige Gemahlin ein Einsehen. Doch es kam anders, ganz anders!
Rémy liebte seine Eltern abgöttisch. Er liebte Lisette, die Mutter, wollte bis in alle Ewigkeit nie mehr von ihrer Seite weichen, hing buchstäblich zu jeder Tages- und Nachtzeit an deren Rockzipfeln. Er liebte Pierre, den Vater, gab sich jede erdenkliche Mühe, ihn zufrieden zu stellen. Er schleppte die schweren Ballen grobgewebter Stoffe, die die Auftraggeber vor dem Haus des Schneiders ablieferten, in die schmale Werkstube, hielt tapfer die Tränen zurück, wenn ihm die Nadel mit peinigender Regelmäßigkeit in die ungeschickten Finger stach. Um es abzukürzen: Das Chouchou mit dem Aussehen und der Stimme eines Engels erwies sich als ein williges, aber keineswegs nützliches Familienmitglied. Seine Gesänge, die ihn von der harten Realität in wundersame Traumwelten geleiteten, bescherten dem Meister D. nichts weiter als krumme nachlässig verarbeitete Nähte. Krumm und nachlässig verarbeitet war jenes Dingsda, das sich Rémy mit Inbrunst aus Stoffresten zusammengeflickt gestichelt hatte. Eine Lumpenpuppe – so scheußlich wie mitleidserregend. Messire Sorcier, zum Begleiter und Beschützer seines kleinen Schöpfers bestimmt, versagte kläglich in dem Augenblick, als dieser dessen Zauberkünste dringend gebraucht hätte.
An einem milden Frühlingsmorgen, wie es sich gleich herausstellte, einem bedeutsamen milden Frühlingsmorgen, stattete der Hohe Herr, begleitet von seiner Entourage, der unscheinbaren Behausung des Schneiders einen überraschenden Besuch ab. Der Baron, der Hohe Herr, von den Bewohnern unterhalb seiner Festung heimlich tuschelnd Blaubart – Das Ungeheuer genannt, hatte sich offensichtlich dazu entschlossen, den Urheber jener unwiderstehlichen Engelsstimme ausfindig zu machen. Frisches Blut, frische Stimmen brauchte er dringend für seinen Knabenchor, nachdem einige verbrauchte Stimmen auf unerklärliche Weise verstummt waren. Schon seit einigen Jahren machten Gerüchte in der Vendée die Runde, Gerüchte über eine ausgemergelt bucklige Alte, die angeblich bettelnde Kinder mit der Grosszügigkeit des Hohen Herrn hinter das Portal seiner Festung lockte; Kinder, die niemand mehr zu Gesicht bekam. Aber wen interessierten bettelnde Kinder? Und aus dem schier unübersichtlichen Hofstaat des Barons, warben, gleich schreiend bunt herausgeputzten Fasanen, dessen Diener vorzugsweise blond gelockte Knaben und Jünglinge entweder als Sänger oder als Pagen an, wovon einige ebenso auf mysteriöse Weise verschwanden. Im Gegensatz zu den heimatlosen Bettlern nahm man deren Verlust sehr wohl zur Kenntnis. Keiner von der inzwischen misstrauischen Bevölkerung, wagte den folgenschweren Verdacht laut auszusprechen.
Der Hohe Herr war noch immer eine geachtete Persönlichkeit, wenngleich sich sein glorreich strahlender Stern bereits am Verglühen befand. Er, aus einem der reichsten und ältesten Geschlechter Frankreichs stammender Sproß, Ritter, der an der Seite der Jeanne d’Arc erfolgreich gegen die Engländer gekämpft hatte, galt als unantastbar.
„Schön wie ein Engel!“. Die überraschend wohltönend weiche Stimme, als auch das vermeintlich verführerische Lächeln, täuschten nicht über seine wahren Absichten hinweg. Schräge grüne Katzenaugen begutachteten mit beängstigender Sorgfalt die erwählte Beute. Wie lange beabsichtigte dieses Ungeheuer sich noch an dessen Engelsstimme zu ergötzen, bis es sie endgültig zum verstummen brachte? Rémys Engelsstimme verstummte in jenem Augenblick, als er in das schmale wachsbleiche Antlitz des Hohen Herrn starrte und bitterlich bereute, sie jemals zum Erklingen gebracht zu haben. Er weigerte sich, dem Dialog des Barons mit dem Vater zu folgen, obwohl es ihm längst klar sein sollte: dieses Gespräch drehte sich ausschließlich um seine Person, um seine Zukunft, um die Zukunft seiner Familie.
Warum sollte Pierre D. das verlockende Angebot des Hohen Herrn nicht annehmen? Er, der einfache Schneider, der einfache Bekleidung für einfache Menschen anfertigte oder die bereits getragene zum gefühlten tausendsten Male ausbesserte, während seine Lisette den schmalen Lebensunterhalt als Wäscherin aufstockte. Einen Lehrling konnte (oder wollte) er nicht verköstigen, geschweige bezahlen. Sein Sohn, in den er ursprünglich alle Hoffnung gesetzt hatte, bekam, wie es ausschaute, nur eine schiefe Lumpenpuppe zustande. Andererseits das vermeintlich unbrauchbare Chouchou besaß diese Stimme, diese unwiderstehliche Engelsstimme, die es dem Hohen Herrn wert schien, Pierre D. in die Riege seiner hoch geschätzten Hofschneider zu erheben. Lisettes Einwände bezüglich der vermehrt üblen Gerüchte um den finsteren Baron schob der vom zu erwartenden Ruhm geblendete Vater bedenkenlos beiseite.
Das blanke Entsetzen im erblaßten Gesichtchen seines einzigen Kindes übersah er, wie er die plötzliche Schwermut in den einst fröhlichen Gesängen überhörte. Immerhin hatte der bezaubernde kleine Fresser seine Bestimmung gefunden – als einer der Solisten im namhaften Knabenchor des Hohen Herrn. Und er, Pierre D. konnte endlich seine wahre Begabung zum Einsatz bringen. Statt wie bisher grobe gleichförmige Bekleidung für unscheinbare Dorfbewohner und Bedienstete der Festung anzufertigen oder auszubessern, durfte er von nun an den prunkvollen Hofstaat des Barons mit Seide, Samt und Brokat ausstatten. Seine Lisette musste sich nicht mehr den Buckel krumm machen, ihre schmalen Hände in Lauge und kaltem Flusswasser ruinieren. Ihr sollte, neben den ihm versprochenen Lehrlingen, eine Hilfsmagd zur Seite gestellt werden. Weiterhin wurde ein Umzug in ein geräumigeres Haus direkt unterhalb der Festung in Aussicht gestellt.
Lisette stimmte ergeben zu, hielt die Tränen um den Verlust ihres Chouchou für einsame Nächte an der Seite ihres friedlich schnarchenden Gemahls zurück. So kam es, dass Rémy, frisch eingekleidet in ein anständiges Gewändelchen an der Hand des Vaters hinauf zu der übermächtigen Festung geleitet wurde. Er durfte vor Furcht nicht zittern, vor Verzweiflung nicht weinen. Er musste tapfer sein, sehr tapfer – tapfer für seine kleine Familie. Er musste um sein Leben singen! Er bemühte sich um ein heiteres Lächeln, umklammerte wie besessen seine geliebte Lumpenpuppe, als er durch das Tor schritt. Niemand, wirklich niemand, vor allem nicht dieser schwarzhaarige, wachsbleiche Dämon durfte ihm ansehen, wie elend er sich in Wirklichkeit fühlte.
Entgegen aller Bedenken hielt der Baron Wort. Pierre D. wurde dessen persönlicher Hofschneider, indes hielt er, wie es der Respekt gegenüber eines Hohen Herrn gebührte, den vertraulich engen Kontakt in Grenzen. Andererseits umschmeichelte er die hochnäsige Dienerschaft des Barons mit scheinheiligen Komplimenten, während er sich im Stillen über die dummen putzsüchtigen Lackaffen amüsierte. Seine Lisette blieb, der in der Zwischenzeit eine Hilfsmagd zugeteilt worden war, immer noch ängstlich und misstrauisch – nicht geheuer war ihr der plötzliche Wohlstand ihrer Familie. Der Preis, mein Gemahl, alles hat irgendwann seinen Preis! Am Anfang zeigte Pierre für ihre gleichbleibend gedrückte Stimmung Verständnis, bis er eines Tages mit seiner Geduld am Ende war. Was wolle sie denn noch? Nie ging es ihr und ihm so gut wie in jenen Tagen. Er bekam endlich die berechtigte Anerkennung, sie brauchte ihre schwere Arbeit im Haus lediglich an die liebenswerte brave Magd abzugeben. Ja, das Chouchou konnte sogar die Eltern regelmäßig im neuen geräumigen Haus besuchen. Ob sie als Mutter nicht stolz darauf sei, der Engelsstimme ihres geliebten Kindes, den geliebten Solisten des Barons in dessen Knabenchor, lauschen zu dürfen? Ja, er war etwas schmaler und blasser geworden. Er brauche halt Zeit, um sich an die gegebenen Verhältnisse zu gewöhnen. Ja, der Hohe Herr machte einen finster bedrohlichen Eindruck! Aber wer wusste, welche der Gerüchte über seine fadenscheinigen Machenschaften der Wahrheit entsprachen.
Rémys Besuche im Elternhaus fanden von Mal zu Mal seltener statt. Der Hohe Herr bestand, während er regelmäßig auf den Besitztümern entlang der Loire verweilte, auf der Anwesenheit seiner allerliebsten Engelchen. Lisette stand in dieser Zeit um ihr Couchou im wahrsten Sinne des Wortes Todesängste aus. Pierre machte sich dagegen keine weiteren Sorgen, im Gegenteil, er befürwortete die Reisen seines Sohnes. Womöglich hoffte er, dass dessen betörende Engelsstimme irgendwann in ganz Frankreich Ruhm erlangte.
Im darauf folgenden Sommer blieben jedoch Rémys Besuche plötzlich aus. Zuerst schien Pierre D. ihn nicht zu vermissen, er war mit den Gedanken ausschließlich bei der kräftezehrenden Arbeit, wie bei einem der säumigen Stofflieferanten, mit dem er sich herumärgerte. Es war abermals Lisette, die hartnäckig bei der Dienerschaft des Barons, der zwar mit seinem Chor, aber ohne seinen geliebten Solisten zurückgekehrt war, eine Erklärung für dessen Ausbleiben verlangte. Kurz hinter dem Tor, weiter hinein in die Festung ließ man sie nicht – tat ihr einer der aufgeputzten Fasane kund, dass Rémy nicht in der Lage sei, die beschwerliche Rückreise in die Vendée anzutreten, weil er sich eine fiebrige Erkältung zugezogen habe, und auf einer der Burgen des Herrn gesund gepflegt werde. Warum gab sich Lisette mit dieser Aussage nicht zufrieden? Warum weigerte sich der Baron, ihr diesen Umstand mitzuteilen? Schickte stattdessen einen seiner überheblichen Diener vor? Warum musste sie erst den Mut aufbringen, um nach ihrem Sohn zu fragen? Warum hatte man den Eltern nicht gleich Auskunft über die Krankheit ihres Kindes gegeben? Wilde Mutmaßungen, die der ergebene Hofschneider des verehrten Hohen Herrn vergeblich seiner aufgewühlten Gattin auszureden versuchte.
Wochen später begann auch er sich Sorgen um Rémy zu machen. Während einer Anprobe erlaubte er sich, sich bei dem Herrn persönlich nach dem Gesundheitszustand des geliebten Solisten zu erkundigen. Ja, es ginge dem kleinen Engel etwas besser, er sei auf dem Weg zur Genesung. Doch erachte man es für sinnvoll, ihn noch eine kleine Weile der sorgfältigen Pflege der Gemahlin des Barons zu überlassen – lautete die Antwort. Eine kleine Weile? Wochen gingen ins Land, auf weitere Fragen erfolgten keine Antworten. Lisette fühlte, sie wusste es längst, ihr Chouchou würde nicht mehr zurückkommen, nie mehr!
Messire Sorcier, Rémys Lumpenpuppe kehrte zurück. Das aus einem Auge blöde glotzende Dingsda, verdreckt, nach dem Moder der verborgenen Verliese stinkend, in denen die traurigen Überreste der ermordeten Kinder entdeckt worden waren. Den Anlass für die Festnahme des Hohen Herrn, gewiss nicht, wegen der seit Jahren vermissten Knaben und Jünglinge – sowie dessen Überführung ins Gefängnis der naheliegenden Stadt, interessierte die bis ins Mark erschütterten Eltern nicht. Immerhin hatte die bislang zögerliche Justiz daraufhin die Gelegenheit wahrgenommen, den wilden Gerüchten aus dem aufgebrachten Volk nachzugehen, bis sie schließlich die abscheulich ekelhafte Wahrheit unter den Mauern der Festungen des Barons bestätigt fand. Schwarze Magie, Teufelsanbetung, Hexerei, Ketzerei, Mord an über einhundert unschuldigen Kindern – so lautete die Anklage, die kurze Zeit darauf die Vollstreckung eines Todesurteils zur Folge hatte.
Nein, Pierre D. betete keineswegs für die verirrte Seele des reumütigen Hohen Herrn, wie es die Geistlichen von der gläubig gehorsamen Bevölkerung erwarteten. Seinetwegen konnte der adlige Bastard zur Hölle fahren. Stattdessen betete er inbrünstig für seine Seele, seine hochmütige Seele, die gierig nach fragwürdiger Ehre und schnödem Mammon das einzige Kind schändlich verraten, es dem blutrünstigen Monster ausgeliefert hatte. Wiederum betete er für Lisette. Sie verstummte von jenem Moment an, als ihr die zerfledderte Lumpenpuppe ihres Chouchou überreicht wurde. Nicht ein einziges Wort kam mehr über ihre ausgedörrten Lippen. Was war Pierre von seinem einstmals drall frohgemuten Weib geblieben? Nur noch ein schmales, im Haus umher irrendes Gespenst mit anklagendem Blick aus den verweint farblosen Augen. Ihm blieb keine andere Wahl, als die Arbeit in der Festung fortzusetzen. Er wagte nicht daran zu denken, wer von dem verbliebenen Hofstaat an den Gräueltaten des Hohen Herrn womöglich mit beteiligt oder zumindest eingeweiht gewesen war. Überraschenderweise begegnete man ihm, dem vom Verlust seines Sohnes getroffenen Schneider, mit wohlwollend verhaltenem Mitleid. Geheucheltes Mitleid, das Pierre im Grunde seines zutiefst verletzten Herzens hasste.
Im darauf folgenden Winter starb seine Lisette. Ausgezehrt vom Kummer, hatte sie ihm in den letzten Stunden als Geste der Vergebung die zerbrechliche Hand gereicht. Er weigerte sich, der Beisetzung beizuwohnen, ließ den besorgten Priester vor der Tür seiner Behausung von einem der Lehrlinge abwimmeln. Die schlaflosen Nächte verbrachte er in Gesellschaft von Messire Corcier, machte der schweigenden Lumpenpuppe Vorwürfe, nicht auf deren Schöpfer achtgegeben zu haben. Wiederum war er derjenige gewesen, der Rémys mehr als deutliche Zeichen nicht sehen wollte: die zögerliche Bestätigung, wie gut es ihm bei dem Hohen Herrn erginge, widersprach den tief umschatteten, unnatürlich großen Augen im blutleeren Antlitz, den bleichen Lippen, den panisch an die armselige Puppe festgekrallten Händen. Nur noch seine Stimme, seine überirdische Engelsstimme, war ihm geblieben, verzweifelt, nicht angemessen für ein neunjähriges Kind.
Schuldig! So lautete der Richterspruch. Ob der Angeklagte noch etwas zu seiner Verteidigung hervorbringen wolle? Nein, das wolle er nicht! Er bekannte sich schuldig am Tod des eigenen Kindes. Darin waren er und das Tribunal sich soeben einig geworden. Das Tribunal, sieben gesichtslose Skulpturen, gekleidet in blutbefleckte Gewänder. Jene prunkvollen Gewänder, die der Schneider Pierre D. für den Hohen Herrn angefertigt hatte. Als er erleichtert aus einem der schlimmsten Albträume erwachte, erinnerte er sich zwar daran, dass er das Tribunal nach der Begleichung seiner Schuld gefragt hatte, die Antwort nicht abzuwarten brauchte – er wusste sie längst.
Nur wenige Minuten dauerte es, bis sie lichterloh in Flammen aufgingen, die edlen Stoffe aus knisternder Seide, geschmeidig schmeichelnden Samt, glänzendem Brokat, die angefangenen und die vollendeten Gewänder der feinen Damen und Herren. Pierre D. hatte sie in der selben Nacht vor seiner Wohnstatt aufeinander gestapelt und angezündet. Zum Glück gelang es den vom Brandgeruch geweckten Lehrlingen, das Feuer rechtzeitig zu löschen, bevor es sich auf die umliegenden Gebäude ausbreitete.
Vom ehemaligen Hofschneider des mörderischen Barons fehlte jede Spur. Man begab sich halbherzig auf die Suche nach ihm, unterließ es bald darauf. Was hatten die einfachen Dorfbewohner mit einem wie ihm, der inzwischen zur Bande der vornehmen Verbrecher gehörte, zu schaffen. In der Festung vermisste man den selbstverliebten Emporkömmling ohnehin nicht, (wenngleich er eine außergewöhnlich gute Arbeit geleistet hatte). Ein Ersatz war in Windeseile herbeigeschafft.
Monate später wollte ihm ein Mönch während seiner Pilgerreise begegnet sein. Ein umherziehender Händler verbreitete das Gerücht, er hätte eine Anstellung als Hofschneider des türkischen Sultans angetreten. Zuverlässigere Zeugen behaupteten, er sei nach einer Schlägerei verwundet aus einem berüchtigt heruntergekommenen Wirtshaus weggelaufen. Nein, ihn habe man nicht gesehen, aber da lag die grausige Puppe in der Abflussrinne, die er bei seiner übereilten Flucht verloren haben musste. Am darauf folgenden Morgen war auch sie verschwunden, wie Pierre D. verschwunden blieb.
*********
März 2018
I
„Mein Schwarzes Logbuch! Mein Füller! Meine Handschrift! Mein Text?“ Bisher hatte er die Schwierigkeiten mit der Wortfindung und seine sporadisch auftretenden Gedächtnislücken nicht ernst genommen. Dass er sich nicht mehr daran erinnerte, die tragische Geschichte eines ermordeten Chorknaben verfasst zu haben, sollte allerdings ein triftiger Grund zur Besorgnis sein. Er blätterte das Notizbuch durch. Die darauf folgenden Seiten waren leer, so leer wie das Buch, nachdem er es aus dem braunen umweltfreundlichen Kuvert eines Online-Versand-Riesen herausgezerrt hatte. Das Schwarze Logbuch, Format DIN A4 mit fast einhundert fein karierten Seiten, die das gradlinige Schreiben erleichterten, vorgesehen tiefschürfende Gedankengänge, Ideen, Notizen, Entwürfe und kurze Tagebucheinträge. Die Ur-Manuskripte der Kurzgeschichten sowie der geplante große Roman gehörten grundsätzlich in die Roten Logbücher, bevor sie nach nervenaufreibender Überarbeitung den Weg ins MacBook fanden. Er ärgerte sich maßlos darüber, dass er offenbar im Laufe der vergangenen Nacht die Geschichte (ja, es war nun mal seine Geschichte) in das falsche Logbuch geschrieben hatte. Er beabsichtigte sie am nächsten Tag, ausgeruht und einigermaßen nüchtern, wieder zu lesen und zu entscheiden, ob es sich lohnte, sie in das richtige Logbuch zu übertragen.
In der spanischen Kneipe um die Ecke mit dem japanischen Namen und dem griechischen Wirt war er einer der letzten Gäste gewesen. Ouzo, Cognac, Wodka, Whisky und Calvados wechselten in unterschiedlicher Reihenfolge, dazwischen ein halber Liter Rotwein. Als stabile Grundlage für den Magen servierte der diensteifrige Kellner mindestens zwei Portionen Wilde Kartoffeln mit Aioli, die rülpsend den zum Frühstück hastig verschlungenen Toast mit Erdbeermarmelade ergänzten. Er klappte das vor kurzem noch jungfräuliche Schwarze Logbuch zu, warf es seufzend auf die Schreibtischplatte und ging ins nebenliegende Wohnzimmer. Eine breite Liege, aufgepeppt zum orientalisch anmutenden Diwan, lud zum Verweilen ein, er bettete seinen lädierten Kopf auf eines der zahlreichen bestickten Samtkissen, dachte einen Augenblick darüber nach, die Toilette aufzusuchen, um mit Hilfe der Finger die unverdauten Wilden Kartoffeln samt Frühstück wieder loszuwerden.
Schließlich zog er eine Wolldecke über sich. Sie roch nach Parfüm, nach einem der aufdringlich süßen Essenzen, die man in diversen Discountern unter dem Label Designer-Düfte günstig erwarb. Ein Parfüm, das die Lady des Hauses niemals an sich herangelassen hätte. Es passte zu dem unbekannten Mädchen, das er in der vorigen Nacht beim Betreten der Wohnung auf dem Diwan sitzend vorfand. Ein spilleriges Elfchen in ihrem billigen knöchellangen Streublümchen-Fummel mit zu dünnen Zöpfen geflochtenen mittelblonden Haaren.
Obwohl er sich, bedingt durch reichlichen Alkoholkonsum, nicht sicher war, einer Halluzination gegenüber zu stehen, erlaubte er sich trotzdem zu fragen, wie er zu der Ehre ihres Besuches kam und vor allem, auf welche Weise sie hier hereingelangt war. Ihre überraschend tiefe Stimme klärte ihn darüber auf, dass die Besitzerin der geräumigen Altbauwohnung ihr regelmäßig das sogenannte Arbeitszimmer als Atelier zur Verfügung stelle, wann immer sie es benötige, und hereingelangt sei sie nicht mit einem Zauberspruch, sondern mit einem handelsüblichen Schlüssel. An weitere tiefsinnigere Gespräche konnte er sich beim besten Willen nicht erinnern, auch nicht daran, womöglich mit ihr geschlafen zu haben, geschweige wann dieses zerzauste Elfchen sich buchstäblich in Luft aufgelöst hatte. Sie musste ihm allerdings noch vor dem abrupten Abgang ihren Namen genannt haben. Ihm brummte der Schädel. Shakespeare, er hatte irgendwas mit Shakespeare zu tun!
II
„Kilian, Kilian … ich buchstabiere: D_v_o_ř_á_k“. Er ließ jeden einzelnen Buchstaben sorgfältig auf der Zunge zergehen, während die Angestellte des Bürgerbüros seinen Nachnamen mit unbeteiligter Miene in den Computer eintippte. Somit verzichtete er auf die obligatorische Anmerkung, dass er – zumindest seines Wissens nach – nicht mit dem besagten berühmten Komponisten verwandt sei. Er musste Sophia versprechen, sich gleich nach der Ankunft in der Stadt anzumelden. Es brauchte mehrere ermahnende WhatsApp-Nachrichten, bis er sich dazu aufraffte. Chaotisch-anarchistisch wie sie ansonsten war, so sehr legte sie auf die strenge Einhaltung derartiger Formalitäten Wert.
An einem unerträglich dämpfig schwülen Juli-Tag kam er am Bahnhof der süddeutschen Großstadt an. Nachdem er sich verzweifelt durch das Labyrinth einer schier unendlichen Baustelle bis in die lärmende Verkaufsmeile durchgeschlagen hatte, gönnte er sich einen Coffee-to-go, und obwohl er keinen Hunger hatte, kam er zum ersten Mal in den Genuss einer landesüblichen Butterbrezel. Weitere Eindrücke von der auf zwei Jahre begrenzten neuen Heimstatt gedachte er sich vorerst nicht anzutun. Die verschwitzte, rempelnde Eis schleckende Menschenmenge ging ihm auf die angeschlagenen Nerven. Er fummelte das iPhone aus den Tiefen seines Rucksacks, stellte in Windeseile fest, dass ihm der Weg zur angegebenen Straße zu Fuß zu weit, als auch zu mühsam war. Genauso wenig hatte er Lust, sich mit dem Fahrplan der Stadtbahnen zu beschäftigen. Also, leistete er sich von seinem letzten Kleingeld ein Taxi.
Das scheinbar heruntergekommene Viertel gefiel ihm auf Anhieb. Eine bürgerlich spießige Umgebung hätte gar nicht zu ihr gepasst, zu Sophia, der verflossenen Seelenfreundin, Reisebegleiterin und Geliebten. Eine gefühlte Ewigkeit hatte zwischen ihr und ihm Funkstille geherrscht, und wenn er sich nicht von seiner Frau hätte trennen müssen, wäre es höchstwahrscheinlich bei einer weiteren gefühlten Ewigkeit geblieben. Über seinen Kumpel, momentanen Arbeitgeber, Lektor und Verleger in einer Person, der nur wenige Straßen entfernt wohnte, wagte er erneut, den Kontakt zu ihr aufzunehmen. E-Mails gingen noch eine ganze Weile hin und her, in denen sich beide auf den neuesten Stand ihrer gegenwärtigen Aktivitäten brachten, bis sie ihm, nachdem er aus dem ehelich schmucken Nest verbannt worden war, für die nächsten zwei Jahre kostenfrei Unterschlupf gewährte. Sie selbst hatte sich einen lang ersehnten Kindheitstraum erfüllt, war mit einem Archäologen mitsamt dessen Team zu einer Expedition nach Lateinamerika aufgebrochen und zufrieden, ihr Domizil in ihrer Abwesenheit in guten Händen zu wissen. Er klingelte bei der befreundeten Nachbarin, betrat nach dem Summen des Öffners den überdachten Innenhof, fand sich kurz darauf in einem renovierungsbedürftigen Treppenhaus wieder, wo er in der zweiten Etage die Schlüssel von besagter Nachbarin ausgehändigt bekam. Sie hieß ihn vertraulich duzend willkommen, bot unverblümt ihre Hilfe an, welche er immer benötige. Bevor er sich ihre Lebensgeschichte anhören durfte, verabschiedete er sich so höflich, wie er dazu in der Lage war. Er sei erschöpft, hätte eine weite anstrengende Reise hinter sich gebracht – und ja, sehr gern würde er bei Bedarf auf ihr zuvorkommendes Angebot zurückkommen, und ja, er sei mit Sophia A. eng befreundet, und ja, sie sei wirklich sehr, sehr nett!
Er kannte jeden winzigen Leberfleck auf ihrer nackten Haut. Plötzlich verspürte er eine unerklärliche Scheu in die Intimität ihrer Wohnung einzudringen. Ein Refugium, in das sie sich regelmäßig zurückzog, um allein zu sein, soweit er sich erinnerte, dort niemals Gäste empfing. Ihre wenigen Bekannten traf sie ausschließlich in den umliegenden Cafés, Restaurants oder Kneipen. Er hatte sie im Schlepptau von Konrads Clique während eines Frankreich-Aufenthaltes kennengelernt. Seitdem verbrachten sie mindestens zweimal im Jahr dort ihre gemeinsamen Urlaube, bis sie nach seiner Hochzeit mit der vermögenden Tochter eines Reeders die Beziehung beendete. Er zögerte einen Augenblick, ließ den Rucksack von der Schulter gleiten, streifte auf der bunteinladenden Matte den nicht vorhandenen Schmutz von den Schuhsohlen, steckte nervös zuerst den falschen Schlüssel zum Hoftor, dann noch nervöser den falschen Schlüssel zur Haustür und schließlich ganz ruhig den richtigen Schlüssel ins Schloss und betrat ehrfürchtig gleich einem heidnischen Priester das Allerheiligste der launischen Göttin.
III
Funktionierende Glühbirnen besorgen, notierte er auf die potentielle Einkaufsliste. Die verschnörkelte Lampe an der über drei Meter hohen Decke gab nach mehreren Knips-Versuchen kein Licht. Wenigstens war die Funzel auf dem wackeligen Tischchen hell genug, um sich während der Nacht im fensterlosen Flur zurechtzufinden. Um sich auch in der gesamten, fast neunzig Quadratmeter großen Altbauwohnung zurechtzufinden, würde er eine Woche brauchen. Eindeutig zu einem weiblichen Wesen gehörend, glich sie einem privaten Museum, vollgestopft mit antiken Möbeln und Krimskrams von Flohmärkten, Reiseandenken, Bildern an den Wänden, gehängt und angelehnt, zahllosen Büchern – Büchern auf dem Boden, Büchern auf den Tischen, Büchern auf den Kommoden, Büchern in zwei Reihen übereinander gestapelt in den Regalen. Das sogenannte Arbeitszimmer, neben dessen Eingang ein imposanter Schreibtisch auf dem ein nagelneuer iMac stand (er hatte die Erlaubnis, ihn benutzen zu dürfen), würde mit Sicherheit sein bevorzugter Aufenthaltsort werden.
Im Wohnzimmer, weitaus übersichtlicher eingerichtet, gedachte er die Fernsehabende als auch die Nächte zu verbringen. Die breite Liege verführte zum ausgedehnten Chillen. Er ließ sich der Länge nach darauf fallen, warf mit einem genüsslichen Hier halte ich es aus!, seine Sneaker von sich und schloss die Augen Zoffie, so bald wirst du mich nicht los! Er schaltete den ein Meter Durchmesser großen Fernseher auf dem holzgemaserten Kunststoffregal ein, ließ die nächste Stunde eine Reportage über das Wilde Patagonien über sich ergehen, (ob es Sophia auch dorthin verschlug?). Anschließend setzte er seine Erkundungstour fort. Miez, Miez, Miez! Der gigantische Kratzbaum in der Mitte des Wohnzimmers deutete auf einen oder mehrere pelzige Mitbewohner hin. Sophia liebte Katzen, eine Liebe, die er uneingeschränkt mit ihr teilte. Er hatte Zeit und Geduld, irgendwann würde die Neugierde über das Misstrauen siegen, heißt, er ging davon aus, demnächst einem gutgenährten schwarzen Kater zu begegnen.
Durch die schmale Küche, ausgestattet mit vorsintflutlichen Schränken eines schwedischen Möbelhauses, gelangte er in das dritte und letzte Zimmer: Das Schlafzimmer! Viele Hotel-Herbergs-Ferienwohnungs-Betten, Schlafsäcke hatte er mit ihr geteilt, aber kein einziges Mal hatte sie ihn bisher dazu eingeladen, sich an ihrer Seite unter der schwülstigen Blumenbettwäsche und dem mit den üppigen Ornamenten verzierten Plaid hinzulegen. Nachtschwarze Gewänder und farbenfrohe Kimonos hingen an den Türen der Kleiderschränke, an der Decke über dem Bett war ein kristallener Kronleuchter (mit funktionierenden Glühbirnen) notdürftig befestigt, künstliche Rosen teilten sich mit zahlreichen Seifen die Oberfläche eines zierlichen Tischchens und gegenüber auf dem schiefen Regal saß eine Schar Puppen, von denen einige den Wert eines gebrauchten Kleinwagens haben mussten. Neben dem hölzernen Schaukelpferd am Fenster versammelten sich in einem Korbwagen mehrere Teddy-Bären. Dieser Raum, von rotorangenen Vorhängen in ein warmes Licht getaucht, angereichert mit Erinnerungen der scheinbar sorglosen Kindheit in einem wohlhabenden Elternhaus, gehörte ihr allein. Er würde respektvoll Abstand halten, ihn nur betreten, um das einsame Usambaraveilchen auf dem Fensterbrett mit Wasser zu versorgen. Ausgenommen sein Flämmchen, ihm würde er nicht nur den Zutritt zu diesem Paradies erlauben, sondern es in der Blumen-Bettwäsche schlafen lassen. Sophia, die sich absolut nichts aus Kindern machte, würde sie mögen – seine kleine Tochter – ganz bestimmt! Sobald er sich eingelebt hatte, musste er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen, dass sie ihn besuchen durfte.
Zurück in der Küche fand er an einem der Hängeschränke den mit Tesafilm angehefteten Zettel, ihre letzte Anweisung zum Aufenthalt in ihrem Allerheiligsten:
Willkommen Dworschak! Fühl dich wie Zuhause, aber benimm dich nicht so! Im Kühlschrank hast du noch etwas Nahrung und vor allem ausreichend Getränke (zum Beispiel Bier). Ansonsten, falls du keinen Appetit darauf hast, bekommst du gegenüber im Kiosk deine Basic-Lebensmittel: Chips, Kräcker, Cola, Zigaretten (rauchen ist nur in der Küche bei offenem Fenster gestattet). Ist zwar bequem, aber auf Dauer kostspielig. Die beiden Supermärkte auf dem Scheußlichsten Platz der Stadt ein paar Häuser weiter sind bestens sortiert. Damit du nicht zusätzlich mit unnötiger Arbeit überlastest wirst (ich gehe davon aus, dass das okkulte Machwerk deine gesamte Energie beansprucht), habe ich meine drei Kinder (Katzen) bis zur Rückkehr bei einer guten Bekannten untergebracht. Ich würde mir allerdings wünschen, dass du es schaffst, dich um meine grünen Mitbewohner zu kümmern. Ansonsten lass es dir wohl ergehen. Ich werde mich ab und zu über WhatsApp melden, vorausgesetzt, ich bekomme eine Verbindung. Ich gehe davon aus, dass ich dich in ungefähr zwei Jahren wieder analog sehe, und natürlich muss ich unbedingt deine Tochter kennenlernen. Außerdem darfst du mir noch einmal – so ausschweifend wie du willst – die Tragödie deiner gescheiterten Ehe vorwinseln. Habe dich immer noch lieb, alte Quasselstrippe. Deine Zoffi.
Erst jetzt merkte er, wie durstig er die ganze Zeit über war. Sie hatte an ihn gedacht, hatte seine beinahe exzessive Leidenschaft für eiskaltes Bier nicht vergessen. Als er jedoch die Tür des bulligen Designer-Kühlschranks öffnete, erhielt seine Vorfreude einen unbarmherzigen Dämpfer. Fünf Flaschen vollgefüllt mit dem Bier der rechts gegenüberliegenden Brauerei – auf jeder von ihnen stand die unmissverständliche Ansage Alkoholfrei. Der Weg zum Kiosk war unumgänglich. Bei Thor, Odin und sonstigen Göttern, wehe, Gnade dir, wo immer du, Sophia, dich gerade herumtreibst, der verfügte über kein Kühlfach!
IV
Er hatte ausgeschlafen. Traumlos, konnte sich nicht daran erinnern, von einem seiner übelsten Albträume heimgesucht worden zu sein. Er schaute zum Fenster in die Dunkelheit, ein Blick auf die Uhr zeigte 19.57 an. Er bereitete sich in der Küche ein leichtes Abendessen zu, machte sich, bevor seine britische Lieblings-Krimi-Serie anfing, nochmals an die Durchsicht des mysteriösen Manuskripts. Zugleich fiel ihm im wahrsten Sinne des Wortes heiß siedend ein, dass er Konrad versprochen hatte, ihm beim nächsten Besuch in drei Tagen, ihm persönlich eine ausgedruckte vollständige Kurzgeschichte auszuhändigen. In regelmäßigen Abständen brachte dessen exquisiter Kleinverlag schaurige Anthologien unter der Bezeichnung Banshees Kitchen heraus. Schaurig war die Geschichte um den kleinen Sänger und dessen Mörder tatsächlich, aber schaurig wie eine düstere Legende, die vielleicht empfindsamen Halbwüchsigen schlaflose Nächte bereitete. Exquisit bedeutete für Konrad: Blutrünstig, blutrünstig und blutrünstig – auf höchstem Niveau, aufgewertet durch die sensationellen Illustrationen eines in einschlägigen Kreisen bekannten Künstlers. Aus verständlichen Gründen unterließ es Kilian, in Gegenwart seines Geld- und Arbeitgebers besagtes Höchstes Niveau anzuzweifeln. Er verwarf den irrwitzigen Gedanken, noch bevor er ausreichend Gestalt annahm, wenngleich Rémys Schicksal einen realen Hintergrund hatte. Das Monster hatte existiert (wobei seine Augenfarbe keine tragende Rolle spielte). Gilles de Rais, Herr über Ländereien an der Loire und der Vendée, Kampfgefährte der Johanna von Orléans, Schwarzmagier, Mörder an über hundert Kindern, am 26.10.1440 nach einem kurzen Prozess zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt, könnte, sofern ein Autor es darauf anlegte, ausreichend Stoff für eine unappetitlich blutrünstige Novelle bieten. Weitaus drastischer als Kilians rührselige Episode, die den Verbrecher zu einem Märchen-Blaubart romantisierte. Er kannte einige literarische Publikationen um den mittelalterlichen Knabenschlächter, hatte auch zusammen mit Sophia dessen Festung (heute eine Touristenattraktion) besucht, wo beide in einem Gasthaus unterhalb der Ruine sich mit einem Fünf-Gänge-Menu den Bauch vollgeschlagen hatten. Nein, besser er drückte Konrad keine Geschichte aufs Auge als diese, die ihn zu ausgelassenem Gelächter reizte: Welches Mädle hat dir, alten Wolf, die letzten Zähne gezogen? Wen willst du mit diesem Kitsch beeindrucken! Er beschloss, noch diese Nacht, bei klarem Verstand, Moby Dick mit einer wirklich blutrünstig niveauvollen Story zufrieden zu stellen.
Er öffnete das Fenster, legte die parfümgetränkte Decke über das Brett. Er befürchtete, dass selbst die frische Luft außerstande war, den Schwindel erregenden Gestank zu beseitigen. In irgendeinem der Schränke musste sich ein Ersatz finden lassen. Die kleine Reinigung unten an der Ecke war jedenfalls keine echte Alternative. Sophia, die angeblich nicht eine einzige menschliche Seele in ihre Wohnung ließ, stellte diesem überspannten unterernährten Dingsda eines ihrer Zimmer als Atelier zur Verfügung? Demnach mussten die Bilder an den Wänden des Arbeits- und Wohnzimmers von ihr stammen. Sie waren gut, richtig gut! Hauptsächlich Porträts finsterer Personen, von denen Kilian nicht wissen wollte, was diese hinter ihren abgründig dunklen Augen verbargen. Ophelia! Jetzt fiel ihm der Name wieder ein. Sie hieß Ophelia. Er wusste es, ihr Name hatte irgendwas mit Shakespeare zu tun!
April 2018
I
Nachdem er sich dazu durchgerungen hatte, sein Elternhaus zu verkaufen, beschloss er, von einem Teil des Erlöses für längere Zeit auf Reisen zu gehen. Sein erstes Ziel: Frankreich! Anfangs begleitete ihn ein Kumpel aus der ehemals betreuten Wohngemeinschaft, bis der kurz hinter Perpignan Richtung Spanien weiterfahren wollte, um sich dort in einer Art Kommune selbst zu finden. Kilian verspürte weder Lust noch Interesse, sich selbst zu finden. Kommunen und WGs waren ihm zuwider. Er beabsichtigte ganz simpel die Tragödie, die ihn bisher in tiefste Schwermut gestürzt hatte, zumindest für eine Weile hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Er wünschte dem Kumpel eine gute Reise, alles Glück der Welt bei der Selbstsuche, ließ ihn mitsamt fahrbarem Untersatz ziehen, um ihn nie wieder zu sehen. Er suchte sich für ein paar Tage eine Unterkunft, bis er per Anhalter über die Pyrenäen an die Atlantikküste gelangte.
In der Altstadt eines Vorortes von Biarritz quartierte er sich in einer behaglichen Auberge ein, verbrachte die Tage mit ausgedehnten Spaziergängen an einsamen Stränden, fand oberhalb der Klippen auf einem Felsen seinen Lieblingsplatz, wo er seine Mahlzeiten, bestehend aus Baguette, Käse und einer Flasche Rotwein einnahm, bis ihn das gleichförmige Auf und Ab der Wellen in ein wohliges Nickerchen geleitete.
Natürlich hatte er ihn nicht vergessen: seinen Geburtstag! Ihn jedoch nach dem schmerzlichen Verlust seiner Familie mit peinigender Regelmäßigkeit übergangen, das Datum tunlichst verschwiegen, damit keiner auf den Gedanken kam, ihm zu gratulieren, mit überflüssigen Präsenten einzudecken oder womöglich eine rauschende Party zu erwarten. War es nur eine spontan euphorische Stimmung oder lag es vielmehr daran, dass er an der rauen stürmischen Atlantikküste sein seelisches Gleichgewicht gefunden zu haben glaubte? Er würde seinen zweiundzwanzigsten Geburtstag feiern – aber allein! In einem kleinen feinen Restaurant beabsichtigte er ihn regelrecht mit einem landestypischen Festmahl zu zelebrieren. Das Restaurant hielt, was dessen familiär anheimelnde Außenfassade verhieß. Er setzte sich im Innenraum an einen der mit rot-weiß-karierten Tüchern bedeckten Zweiertische, sog den Duft der in Einmachgläsern dekorierten Kräuter ein. Der aufmerksame Kellner klärte ihn freundlich über die drei ausgeschriebenen Menüs auf. Das überschaubare Restaurant war gut besucht, alle Außenplätze waren besetzt, wenngleich die Temperaturen des Vorfrühlings noch frösteln ließen.
An den Zweiertischen saßen zwischen vorwiegend einheimischen Händchen haltenden Pärchen einzelne Touristen. Ihm gegenüber, am größten Tisch hatte sich eine fünfköpfige fröhlich munter plaudernde Runde eingefunden. Zwei Männer und drei Frauen, die abwechselnd auf englisch, französisch und deutsch untereinander geistreiche Frotzeleien austauschten. So schmal ätherisch einer der beiden Männer war, so zeichnete sich sein Tischnachbar durch eine barocke Leibesfülle aus. Beide waren in exklusiv teure, Lässigkeit demonstrierende, cremefarbene Leinenanzüge gekleidet.
Der Barock-Mensch führte das Gespräch an, wenn er sich nicht gerade den Mund mit Fisch, Meeresfrüchten und Brot vollstopfte, sie anschließend wohlig ächzend mit einem Glas Wein hinunterspülte. Rechts von ihm saß sein weibliches Pendant, klein, wohl proportioniert mollig, mit einem exakt bis über die Ohren reichenden hellbraunen Pagenkopf. Links neben ihm hatte die zweite durchtrainierte schlanke weibliche Person Platz genommen, die sich nach jedem Bissen ihre blonde widerspenstige Lockenpracht aus der Stirn strich. Das von den dreien gegenüber sitzende, an einen Elb aus dem Herrn der Ringe erinnernde Wesen, traktierte angespannt den spärlich gefüllten Teller mit der Gabel, weil es sichtlich Mühe hatte, dem englisch-französichdeutschen Kauderwelsch seines Gegenübers zu folgen. Am Kopfende des Tisches saß ein Hut, ein monströser Strohhut. Bis auf die großen dunklen Augen war von der Person darunter nichts mehr zu erkennen. Für den Bruchteil einer Sekunde streifte ihr Blick den einsamen Gast am Nebentisch, bevor sie die geschätzte Aufmerksamkeit wieder den Bonmots des wohlbeleibten Entertainers zuwandte.
Aliens! Sie sahen aus wie Aliens! Die acht bis zehn Zentimeter kleinen orangeroten Dingsda, deren stiere Augen an pechschwarze Punkte erinnerten. Deren fadendünne Fühler ragten über den Tellerrand hinaus, währenddessen die krakeligen Beine den Anschein erweckten, sich jeden Augenblick in Bewegung zu setzen, um die Flucht vor ihren Fressfeinden anzutreten. Sprachlos, wie ein Etymologe, der soeben ein einzigartiges Insekt entdeckt hatte, betrachtete Kilian die Geburtstagsüberraschung auf seinem Teller. Er wagte einen Moment an Oma Agathes Povidelknödel zu denken, die sie ihm zu diesem Anlass regelmäßig serviert hatte. Er hatte sich dazu entschieden, seinen kulinarischen Horizont zu erweitern und bei dem beflissen eifrigen Kellner heldenmütig eine Portion Crevettes á l’ail bestellt. Insgeheim hoffte er, sie würden mit ihren Spinnenbeinchen davonkrabbeln, aber sie harrten geduldig ergeben in ihrem in Knoblauch getränkten Öl aus. So unauffällig wie möglich, schaute er im Restaurant um sich. Die Gäste waren allesamt mit Plaudern und Essen zugange, niemand beobachtete ihn. Er hätte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Aliens unauffällig entsorgen können.
Er verwarf den kleinbürgerlichen Gedanken, fischte mit spitzen Fingern eines der orange-roten Dingsda heraus, Vermute, der Kopf ist nicht essbar!, schloss die Augen und biss hinein, zuckte zusammen, als seine Zähne den angeblich essbaren Körper knirschend zermalmten. Ein kräftiger Schluck vom trockenen Weißwein verschaffte ihm die Möglichkeit, das zweite Exemplar anzugehen. Vor Alien drei genehmigte er sich vorsichtshalber ein in Knoblauch-Öl getunktes Stück Brot. Beinahe die Hälfte des gewöhnungsbedürftigen Festmahls hatte er immerhin hinter sich gebracht. Sich Gedanken darüber zu machen, weshalb diese splitternden grusligen Viecher eine Delikatesse darstellten, ersparte er sich. Runter damit – in der Hoffnung, dass sie nicht seine Magenwände perforierten.
Bei Nummer Vier angelangt registrierte er, dass die knackenden Geräusche seiner Zähne sich nicht ausschließlich auf sein Gehör beschränkten. Am Nebentisch herrschte nämlich buchstäblich Totenstille, während fünf Augenpaare andächtig fasziniert jede seiner Kaubewegungen aufmerksam verfolgten. Bevor er dazu kam, sich die Nummer Fünf anzutun, tauchte plötzlich die Lady mit dem Hut an seinem Tisch auf, nahm ihm besagte Garnele aus der Hand, entfernte mit geschickten Fingern fachgerecht die harte Schale und schob ihm kurzerhand das zarte weiche Fleisch in den Mund. Soweit er unter dem von der Sonne gebleichten einstmals pinkfarbenen Strohhut erkannte, hatte sie ein apartes ovales Gesicht. Aber wenngleich ihre grellrot angemalten Lippen ein äußerst liebreizendes Lächeln hervorzauberten, verbargen die schwarzbraunen Augen keineswegs den unverhohlenen Spott. Sie tauchte die öligen Finger in das bereitgestellte Schälchen mit Wasser, trocknete sie mit zwangloser Eleganz an einer der Stoffservietten ab. (Jetzt kapierte er, dass das Wasser in der kleinen Schale nicht zum Trinken gedacht war).
„Ich heiße Sophia! Du kommst aus Deutschland, nehme ich an?“ Sie ging selbstverständlich davon aus, dass kein Einheimischer, sondern nur ein unbedarfter Tourist imstande war, Crevettes á l’ail samt der Schale zu verzehren. Er nannte seinen Namen, erwähnte beiläufig, dass er heute Geburtstag hätte. Willkommen in unserem Club! Du bist ein weiterer Aprilscherz, geboren im Tierkreiszeichen des Widders.
Und bevor er sich versah, saß er am Tisch der Schweigenden Lämmer. Alle fünf hatten zwischen dem 1. und 17. April das Licht der Welt erblickt: Konrad, Sylvie, Olga, Amadée und – Sophia!
II
Konrads feudales Domizil lag nur wenige Straßen weiter von Kilians beziehungsweise Sophias Behausung entfernt – allerdings wenige Straßen weiter oben! Sie schienen die gesamte Stadt zu dominieren, die Stufen, Treppen, Staffeln, von den Einheimischen hingebungsvoll Stäffele genannt. Eine Himmelsleiter zwischen den Sträuchern verwilderter Gärten führte von seiner Sackgasse aus steil hinauf zu einer gepflegten Parkanlage, von der aus man einen atemberaubenden Blick über das Panorama bis hin zum Wahrzeichen der Stadt hatte. Kilian mochte jene Treppen, die in den umliegenden Waldgebieten oder in den Weinbergen endeten. Als durchtrainierter Gebirgswanderer bereiteten ihm derartige Steigungen keinerlei Probleme. Er verzichtete an diesem sonnig milden Vormittag auf die gemächlich zockelnde Zahnradbahn. Die vergangene schlaflose Nacht hatte er mit einem von Sophias Klassikern lesend verbracht, sich anschließend, noch vor Tagesanbruch, seiner weniger anspruchsvollen Vampir-Novelle zugewandt. Für Konrads dritten Band der exklusiven Horror-Anthologie dürften ungefähr zwölf Seiten ausgereicht haben. Dessen Leserschaft interessierte Kilian nur am Rande. Ihn interessierte, dass er in Euro-Scheinchen ausreichend entlohnt wurde, dass er für den blutrünstigen Blödsinn nicht seinen Namen hergeben musste. Oleander D., Sirius F., Eliot G., Dorian A. und Cosmo Z. waren die Pseudonyme, hinter denen sich er und Konrad im Wechsel verbargen und die geneigte Leserschaft mit abgefahrenen Schilderungen aus dem Zombie-Vampir-Werwolf-Universum ergötzten, wobei die fiktiven Kurzbiographien der fiktiven Autoren weitaus phantasievoller verfasst waren als die Kurzgeschichten selbst. Wen juckte es am Ende? Dieses dankbare Publikum war bereit, für ein blutrotes Büchlein mit samtschwarzem Lesebändchen und zum Genre passenden Illustrationen einen unverschämten Preis zu bezahlen.
Auf der Höhe des Restaurants angelangt, in dem Konrad zu ganz besonderen Anlässen (davon gab es genügend) zu speisen pflegte, schlängelte sich noch eine Reihe schmaler Stufen hinauf zu der im Jugendstil erbauten Villa. Kilian erlaubte sich, für die Damen des Hauses von den Nachbargrundstücken drei Zweige voll erblühter Forsythien mit dem Taschenmesser abzuknipsen. Er schob das angelehnte schmiedeeiserne Tor auf, zuckte beim Geräusch, das seine Schuhe auf dem von bizarren Steinfiguren flankierten Kiesweg verursachten, zusammen. Hinter einer Thujahecke, den neugierigen Blicken Aussenstehender verborgen, setzte Olga, hingegossen auf einer mintfarbenen Liege, die überaus ansehliche Bikinifigur den Strahlen der Aprilsonne aus, während Sylvie damit beschäftigt war, eines der Beete mit den soeben aus der Gärtnerei erworbenen Frühlingsblumen zu verschönern.