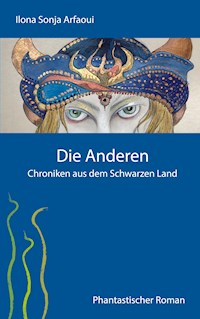Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Dunklen Herrscher gehören einem uralten mysteriösen Volk an, das regelmäßig magisch begabte Schüler aus einem der letzten heidnischen Clans in Irland erwählt, um ihnen mit Brutalität und Grausamkeit ihre einzigartigen Fähigkeiten zu vermitteln. Cahal, einer ihrer Schüler und Sohn des Königs, will sich ihnen nicht mehr unterwerfen und zettelt eine Meuterei an, wobei es ihm und seinen acht Gefährten gelingt, die verhassten Dunklen Herrscher in das Schwarze Land zu verbannen. Er ahnt zu dieser Zeit allerdings nicht, welche Tragödie er damit auslösen wird. Nicht nur der Zusammenhalt der neun Gefährten, auch die Freundschaft zwischen dem Königssohn und einem jungen Normannen wird durch Missgunst, Lügen und Verrat auf eine harte Probe gestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 861
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Dunklen Herrscher …
… gehören einem uralten mysteriösen Volk an, das regelmäßig magisch begabte Schüler aus einen der letzten heidnischen Clans in Irland erwählt, um ihnen mit Brutalität und Grausamkeit ihre einzigartigen Fähigkeiten zu vermitteln.
Cahal, einer ihrer Schüler und Sohn des Königs, will sich ihnen nicht mehr unterwerfen und zettelt deshalb eine Meuterei an, wobei es ihm zusammen mit seinen acht Gefährten gelingt, die verhassten Dunklen Herrscher in das Schwarze Land zu verbannen. Er ahnt allerdings nicht, welche Tragödie er damit auslösen wird.
Nicht nur der Zusammenhalt der neun Gefährten, auch die innige Freundschaft zwischen dem Königssohn und einem jungen Normannen, wird am Ende durch Missgunst, Lügen und Verrat auf eine harte Probe gestellt.
Ilona Sonja Arfaoui, Jahrgang 1950, lebt mit ihrem Mann und drei Katzen in Stuttgart. Noch während sie mit dem Schreiben ihres Romans Der Hexenmeister, die Macht und die Finsternis (2016) und einer Katzengeschichte Die Katze, der Traum und der Pharao 2016) begann, arbeitete sie als Werbeberaterin und Grafik-Designerin in der Werbeabteilung eines Verlages. (www.ilonaarfaoui.com)
Selbst die absolute Dunkelheit kann keine Kerze am Scheinen hindern
Irisches Sprichwort
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil | Die Erwählten
Das Jahr des künftigen Königs und seiner Gefährten
Magische Spiele
Waschtag der Könige
Bluttaufe für einen verhinderten Jäger
Tribut an die Götter
Die Halle des Schweigens
Ein Jäger wird gejagt
Das Schwarze Land I
Magische Hochzeit
Weiße und schwarze Steine
Zweiter Teil | Die Dunklen Herrscher
Fürst Gunnars Festung
Cahals Gabel
Muireall
Die unsichtbaren Türen
Der Flug des Raben
Das Schwarze Land II
Die Anderen
Der Schwur
Die Brautschau
Erik
König Brians letzte Schlacht
Dritter Teil | Der König
König Brians letzte Reise
Calypso
Die Stunde des Königs
Das verschlossene Tor
Lady Morgane
Geheimnisse
Das Labyrinth der ungewissen Wiederkehr
Branan
Die Schlucht der Verdammten
Abgründe
Blutige Sonne
Gnade und Fluch
Abschied
Personen
Glossar
Er wolle die nächsten Wochen auf keinen Fall gestört werden und sei für niemanden, wirklich niemanden, zu sprechen. Nicht einmal für den einen seiner Söhne, den einzigen, der sich wahrscheinlich ernsthaft Sorgen um ihn zu machen schien.
Der alte, zerstreute Butler von Sir Lawrence Duncan hatte mitbekommen, dass sich Vater und Sohn nach langer Zeit vor einigen Tagen wieder angenähert hatten und mochte den besorgten Anrufer nicht brüskieren. Er erfand nach kurzem Zögern eine Notlüge und behauptete, der gnädige Herr sei auf einer Expedition irgendwo in der Wildnis und daher momentan nicht erreichbar. Mit einem unguten Gefühl – ihm war klar, dass man ihm nicht glaubte – legte er seufzend auf, um dem gnädigen Herrn auszurichten, dass dessen Sohn Edward angerufen hatte.
Sir Lawrence Duncan, versunken in seinem abgeschabten Ohrensessel, scheinbar in ein Buch vertieft, blickte einen Augenblick auf, legte die Brille beiseite, kniff die Augen zusammen, nickte schwach und gab mit einer fahrigen Handbewegung zu verstehen, dass er zwar verstanden habe, aber weiterhin in Ruhe gelassen zu werden wünsche. Sein Butler, seit Jahren mit den Launen seines Arbeitgebers vertraut, zuckte resigniert die Achseln, schlurfte hinunter in die Küche, um den Nachmittagstee zuzubereiten.
Lawrence Duncan hatte gehofft, dass das Buch, das seit Stunden aufgeschlagen auf seinem Schoß lag, ihn ablenken würde. Ablenken von Erinnerungen, Gedanken, die ihn immer wieder quälten und ihm schlaflose Nächte bereiteten. Er klappte das Buch unwillig zu, erhob sich, beherrschte sich gerade noch, es auf den Tisch zu werfen, ließ es stattdessen auf den Sessel fallen und ging zum Fenster.
Frühling, es war wieder Frühling geworden. Wie oft hatte er schon den Beginn des Frühlings erlebt, und heute war ein herrlicher Tag. Seit mehr als einer Woche herrschte diese wunderbare Aufbruchstimmung, die dieser Jahreszeit zu eigen war, mit dem unermüdlichen Gezwitscher der Vögel, die eifrig ihre Nester in den Bäumen und Sträuchern des heimelig gepflegten Gartens vor seinem Haus in London bauten, und die Strahlen der Sonne, die an diesem Nachmittag in das düstere Wohnzimmer drangen, gaben erbarmungslos preis, dass sein Diener vor der Staubpartikel-Invasion endgültig kapituliert hatte. Nur, das war das geringste Problem. Er duldete den alten mageren Mann, der schon seit Generationen in diesem Haus verkehrte, zerstreut und verstaubt, wie die alten Möbel, die ebenso seit Generationen, nicht einen Zentimeter von der Stelle bewegt, als stumme Zeugen an eine glanzvolle lebendige Vergangenheit erinnerten.
Lawrence blinzelte noch einen Moment in die späte Nachmittagssonne und zuckte zusammen. Bevor die Erscheinung einer aufgehenden Sonne in einem grünen Land von ihm Besitz ergreifen konnte, zog er mit einem Ruck panisch die Vorhänge zu, schlich zurück zu seinem Sessel und ließ sich seufzend mit geschlossenen Augen in die weichen, ausgeleierten Polster fallen.
Nachmittagstee, ein spartanisches Abendessen, das er allein und lustlos einnahm und schließlich der Beginn einer endlos langen, quälenden Nacht. Die Geister der Vergangenheit. Sie kehrten zurück, tauchten zwischen den Zeilen seiner Bücher auf, mit denen er sich abzulenken versuchte, verfolgten ihn unerbittlich bei den nächtlichen Spaziergängen, von denen er hoffte, die nötige Bettschwere zu erlangen. Er war alt und einsam. Alt, obwohl er mit seinen fast siebzig Jahren ein ansehnlicher, sehr schlanker Mann war. Der durchtrainierte Körper und die blonden Haare, die nur einige graue Strähnen aufwiesen, halfen nicht darüber hinweg – er war alt, sehr alt und sehr müde. Einsam, obwohl er vier Söhne (… und waren da nicht noch Töchter gewesen? Vor langer Zeit?) hatte. Sie mieden ihn, hassten ihn, und als sie ihn einmal vor einer Katastrophe bewahrten, geschah das nur aus reiner Bosheit. Davon war er überzeugt. Schlechte Kinder, und ein schlechter Vater wie er, hatte diese schlechten Kinder verdient. Er war einsam, weil er einsam sein wollte, weil er es verdient hatte, einsam zu sein und die Tatsache, dass sein Lieblingssohn ihn besucht hatte, machte ihn nicht im Geringsten glücklich.
Er schob den noch fast vollen Teller beiseite, ignorierte den vorwurfsvollen Blick seines Butlers („Sie müssen mehr essen, Sir Lawrence!“) und schickte ihn auf sein Zimmer. Es war an der Zeit, die ihm einzig verbliebene Freundschaft zu pflegen. Ein prachtvolles Kristallglas (von seinem Butler hingebungsvoll gepflegt), gefüllt mit der goldenen Flüssigkeit eines uralten Whiskys, tröstete ihn in den einsamen Stunden und ließ ihn für diese Zeit vergessen. Seit dem Besuch von Ned hatte er den Alkohol nicht mehr angerührt, doch heute Nacht sollte ihn sein goldener Freund nicht nur trösten, sondern ihm Mut machen. Mut für einen Schritt, den er zu lange hinausgezögert hatte. Umso mehr genoss er den ersten Schluck, nahm sich allerdings vor, es bei dem einen Glas zu belassen, und stellte die prachtvolle Glaskaraffe (von seinem Butler hingebungsvoll gepflegt) außer Reichweite. Er wollte sich konzentrieren, denn die Nacht war noch lang.
Bevor er die Schublade seines Sekretärs öffnete, hielt er einen Augenblick inne, denn er musste an den seltsamen Besucher denken, der vor einigen Monaten an der Tür geklingelt hatte. Als er öffnete (sein Butler, eigentlich Mädchen für Alles, machte gerade in der Stadt Besorgungen für ihn), stand vor ihm ein junger Bursche. Rotbraune, widerspenstige Locken fielen in sein rundes mit unzähligen Sommersprossen übersätes Gesicht und die graugrünen Augen musterten Lawrence abschätzend als er sich mit unverkennbar irischem Akzent erkundigte, ob hier der „Prof hauste“. Lawrence, völlig überwältig von so geballter Forschheit, nickte, und bevor er sich mit einem „Ja, der bin ich“ ausweisen konnte, war das Bürschlein (er schätzte ihn auf nicht älter als achtzehn Jahre) flink wie ein Wiesel an ihm vorbei gehuscht und schaute sich nun neugierig im Flur um. Lawrence glaubte so etwas wie toller alter Schuppen zu hören, bis sich sein Besucher offenbar an seine guten Manieren erinnerte und sich höflich als Ian Mac-Sowieso vorstellte.
Bis auf den heutigen Tag wusste Sir Lawrence nicht, weshalb er diesen Jungen spontan in sein Wohnzimmer bat, ihn aufforderte doch bitte schön Platz zu nehmen und als der Butler vollbeladen mit Lebensmitteln vom Einkauf zurückkam, ihm sogar noch anbot, zum Essen zu bleiben, was sein Gegenüber mit einem breiten zustimmenden Grinsen quittierte.
Bis jetzt hatte ihm Ian noch immer nicht den Grund seines Besuches mitgeteilt und Lawrence würde diesen sowieso erst erfahren, wenn Ian seinen knurrenden Bauch gefüllt hatte. Die Sandwiches waren zwar matschig (weiß der Henker, was der tattrige Butler in seiner Einkaufstasche alles drauf gehäuft hatte), gefüllt mit zu viel Mayonnaise und zu wenig Schinken. Doch der Überraschungsgast schien nicht wählerisch zu sein. Er verdrückte in Windeseile vier Stück davon („Mann, habe ich einen Kohldampf. Danke Sir, nett von Ihnen“), und als er den letzten Bissen mit lauwarmem Kaffee heruntergespült und sich den klebrigen Mund mit der Serviette (selbstverständlich aus Damast) abgewischt hatte, fixierten seine gerade eben noch so schalkhaften Augen plötzlich den Professor mit beängstigen Ernst. Ob der Prof denn nicht endlich wissen wolle, von wo er herkam?! Natürlich wollte Lawrence das wissen.
Oben, von der Nordwestküste Irlands. Zwei Tage sei er unterwegs gewesen. Von Sligo bis Dublin und von dort direkt nach London vor dieses beschauliche Haus. Er selbst komme aus einem winzigen Dorf mit gerade mal fünfzig Seelen, noch ein Stück weiter westlich von Sligo, das am Rande der Welt lag, denn nach den steilen Klippen gab es nur noch den Atlantischen Ozean. Ian machte eine bedeutungsvolle Pause, als ob er auf eine Reaktion von Lawrence wartete. Als keine Reaktion kam, bat er, eine Zigarette rauchen zu dürfen, und nachdem der Prof nichts dagegen hatte (Lawrence erkannte sich selbst nicht wieder), begann er nach zwei tiefen Zügen mit der ausführlichen Beschreibung: Von den Mauerresten der Festung, die einst am Rande auf den Klippen zum Ozean stand, von den undurchdringlichen Wäldern, die nicht mehr existierten, den Sümpfen südlich der Ruine, dem steinernen Altar auf dem Hügel, zwischen dessen massiven Menolithen die Sonne im Osten aufging, sowie von dem Volk, das hier einst lebte und grausam vernichtet wurde.
Lawrence reagierte noch immer nicht, aber er ahnte inzwischen, weshalb Ian zu ihm gekommen war.
„Meine Familie sind direkte Nachkommen jenes Stammes, der mit diesem untergegangen Volk befreundet war“, erläuterte Ian, während er seine Zigarette in einer der Untertassen zornig ausdrückte und dabei Lawrence mit lauerndem Blick nicht aus den Augen ließ. Er hatte sich ganz plötzlich von dem forsch-fröhlichen sommersprossigen Iren in einen unheimlichen Gast verwandelt.
„Warum, junger Mann, erzählen Sie mir das?“, entgegnete Lawrence noch immer gefasst und höflich während er überlegte, wie er das lästige Gegenüber so schnell wie möglich loswerden konnte
„Sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie hätten zu tun, um mich rauszuschmeißen, Sir.“ Ian hatte ihn längst durchschaut. „Keine Angst, Sir (er betonte das Sir). Ich mache gleich die Fliege. Doch ich habe den Auftrag, Ihnen noch vorher etwas zu überreichen.“
Blätter, uralte Blätter aus Pergament. Lawrence hielt sie in der zitternden Hand, als er sie aus der Schublade seines Sekretärs herausgeholt hatte. Sauber beschrieben, an einigen Stellen verwischt, aber noch immer gut lesbar. Geschrieben in einer seltsamen Sprache. Als Professor der Archäologie war Sir Lawrence bewandert im Entziffern seltsamer Sprachen. Diese Sprache brauchte er nicht mühsam zu entziffern, er kannte sie, auch wenn er manche Wörter und Redewendungen vergessen hatte – es war so lange her, so lange. Ian, der forsche irische Besucher, der ihm am Ende so einen Schrecken eingejagt hatte, behauptete, dass sein Vater diese Chronik angeblich unter dem Altar auf dem Hügel gefunden und ihn vor seinem Tod gebeten habe, sie einem gewissen Sir Lawrence Duncan, Professor der Archäologie, auszuhändigen. Was Ian als gehorsamer Sohn auch tat. Allerdings war er nicht ganz sicher, ob der Prof in der Lage war, dieses Manuskript zu lesen – und lesen musste er es. Genau aus diesem Grund setzte sich Ian, ohne das Wissen seines Vaters (er hätte es nie erlaubt) an den Computer und übersetzte es Satz für Satz ins Englische.
Lawrence legte die Originalblätter behutsam wie einen wertvollen, zerbrechlichen Gegenstand zurück in die Schublade und holte stattdessen Ians Neufassung, gedruckt auf schneeweißen DIN-A-4-Bögen, heraus. Nach kurzem Durchblättern stellte er fest, dass dieses Manuskript zwar korrekt übersetzt war (ja, Ian beherrschte den alten mittelirischen Dialekt perfekt), und musste fast lächeln, als er feststellte, dass der forsche Ian allerdings eine äußerst moderne Version zustande gebracht hatte.
Als er endlich wieder in seinem Sessel saß, er bis auf die kleine Lampe neben ihm alle Lichter ausgemacht hatte, kamen ihm Zweifel. Wozu sollte er sich mit diesem Schriftstück beschäftigen? Wozu alte Wunden aufreißen? Noch mehr schlaflose Nächte. Oder sollte es ihm gerade damit gelingen, die Geister der Vergangenheit zu verbannen indem er sich ihnen stellte?
Für diese Entscheidung brauchte er dringend noch ein Glas von seinem goldenen Freund. Nachdem er absichtlich langsam seinen Whisky ausgetrunken hatte, war er endlich bereit. Bereit für seine Reise in die Vergangenheit.
Erster Teil | Die Erwählten
Irland 870
1.
Das Jahr des künftigen Königs und seiner Gefährten
Verfluchte Sonne. Diese verfluchte Sonne. Ich durfte so etwas nicht sagen, ja nicht einmal denken, denn damit hätte ich ein furchtbares, unverzeihliches Sakrileg begangen. Sie hätten mich nicht nur aus den Häusern gejagt, was sie bereits getan haben, sondern getötet. Erschlagen wie einen tollwütigen Hund und meinen Leichnam in der Schlucht der Verfluchten den wilden Bestien zum Fraß vorgeworfen. Verfluchte Sonne! Wie lange hatten wir alle so sehnsüchtig, so verzweifelt auf ihr Erscheinen gehofft. Die schrecklichen Monate des grau verhangenen, düsteren Himmels, die vom kalten, peitschenden Regen verdorbene Ernte, der nagende Hunger, die Krankheiten, die Mensch und Vieh dahinrafften. Nun war sie endlich zurückgekehrt, diese verfluchte Sonne. Sie schien auf die verfaulten, durchnässten Felder, sie schien in die finsteren Hütten und Häuser, sie schien durch die schmalen Fenster der gewaltigen Festung in den Thronsaal, in dem Erleichterung, gepaart mit tiefer Trauer, herrschte. Und – sie schien auf den großen Altar des Lichts. Sie trocknete das Blut auf der Treppe vor dem Altar, an dem sich bereits Scharen von Fliegen gütlich taten. Sie, die gnädige und die erbarmungslose Sonne, nahm ihren Preis entgegen. Den Preis, den sie bezahlten, damit sie mit ihrem Erscheinen unser Volk vor weiterem Elend bewahrte. Ihr Götter der Dunklen Herrscher – wo immer ihr euch jetzt befindet – vergebt mir, denn ich habe gewagt daran zu denken, dass der Regen wieder fallen möge,. nur ein einziges Mal für einen ganz kleinen Augenblick, den kleinen Augenblick, um die Treppe vor dem Altar von dem Blut zu reinigen. Vergebt mir! Und vergebt auch meinem Volk, das ihr so grausam bestraft habt!
Ich habe mich nach dem Untergang unseres Königreiches endgültig in den schützenden, dichten Wald zurückgezogen. Dort werde ich bleiben bis ich meine letzte Reise in das Schwarze Land antreten muss. Doch vorher werde ich die Geschichte meines Volkes aufschreiben. Mein Volk – ermordet und ausgelöscht. Wie sollen sie nicht vergessen werden? Diese fünftausend Seelen, die hier ihre Felder bestellten, ihr Vieh hüteten, regen Handel trieben, ihre Häuser bauten, liebten, hassten, lachten und weinten, wenn von deren Existenz nicht einmal ein Grab an sie erinnerte? Nur mich ließen sie am Leben. Ich, der Einzige, der um mein Volk trauern darf. Diese Chronik wird mein Vermächtnis werden: für die tapferen Männer und Frauen, deren Kinder und für meinen geliebten König.
Ich erblickte diese Welt in der Nacht der großen Sommersonnenwende. („Ein gutes Omen“, murmelten die Priester). Diese schöne, große und unheimliche Welt. Nun ja, eigentlich war diese Welt für mich im Augenblick meiner Geburt noch sehr überschaubar, doch die Hebamme jagte mir erst einmal gehörig Angst ein, als sie mich mit ihren breiten, rauen Pratzen an den Beinen beherzt in die Höhe hob, um festzustellen, dass alles dran war, was dran sein sollte. Ich schrie mir buchstäblich die winzige Seele aus dem Leib, bis ich endlich, auf dem warmen, nackten Bauch meiner erschöpften Mutter liegend, zufrieden an deren Brustwarzen nuckeln durfte.
„Es ist ein Junge, Mylady! Ihr habt soeben einem Jungen das Leben geschenkt. Dank den Göttern. Er ist so zart, so unglaublich zart,“ soll die Hebamme bei meinem Anblick gerufen haben. „Und er ist so wunderschön, und Mylady, er hat die Gabe. Dank den Göttern.“
Unglaublich zart, wunderschön, die Gabe, ach, was noch alles! Meine Mutter hörte nur mit halbem Ohr auf das Geplapper der eifrigen Hebamme. Für sie existierten in diesem Augenblick nur wir beide.
„Finian, mein geliebter Finian“, flüsterte sie und gab mir einen zärtlichen Kuss auf die Stirn, bevor sie mit dem seligen Lächeln, das den Frauen eigen ist, wenn sie nach den unendlichen Qualen der Geburt ihr Kind auf die Welt gebracht haben, einschlief.
Am nächsten Morgen kamen sie, die Besucher. Rufe des Entzückens, der Freude wurden, wie es in unserem Stamm bei jeder geglückten Geburt üblich war, entgegengenommen. Und als auch unsere Priester – die Dunklen Herrscher – ihr Wohlwollen zum Ausdruck gebracht hatten, kehrte wieder Ruhe ein.
Bis heute ist mir meine zauberhafte Mutter, die der elenden Seuche während der Hungersnot erlag, in schönster Erinnerung. Eine große, schlanke Persönlichkeit mit rabenschwarzen Haaren und tiefschwarzen Augen (beides habe ich von ihr geerbt), die mich unermüdlich mit ihren weißen, schmalen Händen liebkoste („Verzärteltes, verwöhntes, verweichlichtest Muttersöhnchen …“, schlimmere Bezeichnungen, mit denen mich später meine Gefährten verspotteten, werde ich aus Gründen des Anstands hier lieber nicht erwähnen). Sie stammte – wie auch ihre große Schwester, die Königin – in direkter Linie von dem Alten Volk ab, das vor langer Zeit im Land lebte und, vertrieben von den Eroberern der Insel, sich in die Anderswelt zurückgezogen hatte. Unsere Priester, die Dunklen Herrscher, gehörten zu den wenigen, die noch mit den Nachfahren der Eroberer verkehrten. Unantastbar bewahrten sie das Wissen des Alten Volkes und gaben es nur denen weiter, die in ihren Augen würdig waren, eingeweiht zu werden.
Würdig war meine Mutter, von einem der Dunklen Herrscher ein Kind zu empfangen. War also dieses Wesen, das kurz nach meiner Geburt an Muirgens Wochenbett trat mein Erzeuger? Ich weiß es nicht. Obwohl ich immer wieder versuchte, in den bleichen, gefühllosen Gesichtern der Dunklen auch das meine zu erkennen, gelang es mir nicht, ihn ausfindig zu machen. Ich habe nie erfahren, wer von den neun Dunklen mein Vater war, und die Dunklen nahmen ihr Geheimnis mit, als sie endgültig in das Schwarze Land verbannt wurden.
Jedoch ist meine Geschichte zweitrangig. Es geht hier vor allem um eine Person, die noch nicht geboren war, als ich bereits in den Armen meiner Mutter lag. An ihrem Bett saß ihre Schwester, die Königin, und seufzte leise, während sie mit besorgter Miene ihren Bauch streichelte.
„Ich möchte die Götter nicht beleidigen, indem ich ihnen vorwerfe, dass ich womöglich wieder ein Mädchen auf die Welt bringen werde“, murmelte sie mehr zu sich selbst. „Ich will dich auch nicht um deinen Sohn beneiden, liebe Schwester. Ach, ich bin so müde und so erschöpft. Und dieses Kind hier wird nach den sechs Kindern mein letztes sein. Ach, wenn es wieder ein Mädchen ist, danke ich trotzdem den Göttern. Und du weißt, liebe Schwester, dass dann dein Finian nach dem König den Thron besteigen wird.“
Muirgen holte tief Luft und versuchte, sich ein leises „Ja, ich weiß“ abzuringen. Sie wünschte sich alles für mich, aber niemals, dass ich den Thron bestieg. Sie wünschte, dass ich von den Dunklen Herrschern die Heilkunst erlernte und in deren Geheimnisse eingeweiht wurde und auf keinen Fall das für einen König unumgängliche Handwerk eines Kriegers ausführte.
„Elaine, warum machst du dir schon jetzt unnötig Sorgen?“ Muirgen richtete sich auf, während sie ihren schlafenden Sohn vorsichtig beiseite legte. „Vielleicht wird es dieses Mal doch ein Junge“, sie runzelte die Stirn. „Oder fürchtest du womöglich den Zorn des Königs?“
Elaine schüttelte energisch den Kopf. König Brian, ein alter Haudegen mit unberechenbarem Temperament, machte, nachdem das letzte Kind wieder ein Mädchen war, seiner Gemahlin keinen Vorwurf, sondern freute sich sogar unbändig über seine sechste Tochter. Elaine sehnte sich endlich selbst einen Sohn herbei, aber sie kannte ihren Gemahl zu gut, um zu wissen, dass es ihm im Grunde seines Herzens genauso ging. Während ich also friedlich schlummernd neben meiner Mutter lag, erörterten die zwei unermüdlich das Für und Wider, wer, wann, warum überhaupt einmal der Nachfolger von König Brian werden solle. Vollkommen sinnlos, zumal das strampelnde Etwas in Elaines Bauch noch immer nicht sein Geschlecht preisgegeben hatte. Doch das gleichförmige Geplauder, von dem ich ohnehin kein Wort verstand, bescherte mir immerhin angenehme Träume.
Cahal, der heiß ersehnte Thronfolger, hatte seinen spektakulären Auftritt an einem kühlen, verregneten Novembermorgen, nachdem sich die Königin fast die ganze Nacht damit herumgequält hatte, ihn aus ihrem Leib zu pressen. Und während sie sich vollkommen erschöpft von den aufgeregten Helferinnen versorgen ließ, hatte König Brian das zerknautschte Dingsda mit den rabenschwarzen Haaren der Hebamme sprichwörtlich aus den Händen gerissen und hielt nun triumphierend seinen zappelnden Sohn aus dem Fenster, um ihn, vor Stolz platzend, dem Volk zu präsentieren. Cahal erwiderte den Jubel seiner künftigen Untertanen mit lautem Gebrüll, und aus Protest, dass man ihn so schamlos nackt den neugierigen Blicken und der beißenden Kälte ausgesetzt hatte, pinkelte er den Kriegern, die in der ersten Reihe standen, auf den Kopf.
In jenem glücklichen Jahr, das unsere Götter als ein ganz besonderes Jahr bezeichneten, kamen wir alle zur Welt – wir, die Erwählten. Die Söhne zweier Krieger, eines Kaufmanns, eines Bauern, eines Goldschmieds, eines Waffenschmieds, eines Hirten, einer Magd, eines Dunklen Herrschers und eines Königs. Erwählt, um in die Geheimnisse der Dunklen Herrscher eingeweiht zu werden.
Diese Wesen, von denen einige munkelten, dass sie zwar menschliche Gesichter hatten, aber sich im Laufe der Jahrhunderte in etwas verwandelten, das nicht mehr menschlich war, während andere das Gerücht verbreiteten, sie seien niemals menschlich gewesen, sondern uralte Kreaturen aus längst vergangenen Zeiten, die aus der Anderswelt oder womöglich aus dem Schwarzen Land zu uns gekommen waren. Sie waren auch das Bindeglied zwischen uns und ihren Göttern, gefürchtet und verehrt. Doch es gab noch andere Stimmen in unserem Volk. Allen voran der König selbst. Er gehörte zu denen, die die Dunklen fürchteten. Ihre bleichen, übernatürlichen, regungslosen Gesichter waren ihm nicht geheuer und ganz tief in seinem Inneren hoffte er, dass sie so klammheimlich verschwanden, wie sie aus den Tiefen ihrer Vergangenheit aufgetaucht waren. Nur – war er mit einer der ihren vermählt. Elaine hatte die gleiche hohe Statur, das blasse, schmale Gesicht, diese undurchdringlichen wissenden Augen, und als er seinen neugeborenen Sohn näher betrachtete, wurde ihm schmerzlich bewusst, dass dieser nicht nur äußerlich den mysteriösen Priestern ähnelte, sondern ebenso deren beängstigend magische Fähigkeiten in sich trug.
Noch lag diese Zukunft für uns Erwählte in weiter Ferne und unsere Kindheit verlief die ersten acht Jahre wie die der unzähligen anderen Töchter und Söhne unseres Stammes. Meine Mutter und ich lebten zusammen mit dem Königspaar, dessen Kindern und wenigen Vertrauten, wie dem weisen, alten Connor, dem engsten Berater des Königs, im Haupttrakt der Festung. Wir hatten sogar das Privileg, für uns beide allein ein eigenes Gemach, wenn auch klein, unser Eigen zu nennen. Somit konnten wir uns, wann immer wir wollten, von dem Trubel, der in der Festung herrschte, zurückziehen und genossen die Stille in unserer heimeligen Kammer – meine geliebte Mutter Muirgen und ich.
Anders erging es Cahal. Er war von dem Augenblick an, als er das Licht der Welt erblickte, Gegenstand unermüdlicher Bewunderung seitens seiner weiblichen Geschwister. Sie hörten nicht auf, ihn permanent zu liebkosen und stritten sich sogar am Ende darüber, wer den kleinen Prinzen mit sich herumschleppen durfte. Cahal schien die stürmische Zuneigung zu genießen, denn er gluckste zufrieden vor sich hin, wenn eine seiner Schwestern ihn zärtlich streichelte und ihn in inniglicher Umarmung in den Schlaf wiegte. Elaine ließ ihre Mädchen mit einem nachsichtigen Lächeln gewähren, während König Brian brummelnd klarmachte, dass dieses Weibergefummel an seinem Sohn mit dem fünften Lebensjahr beendet sei. Spätestens dann sollte das Schoßhündchen zum Mann und Krieger ausgebildet werden. Einfacher gesagt als getan, denn wie alle Untertanen längst vermuteten: Hier in der Festung hatte die Königin das Sagen. Sie gab in allen Gemächern (ob auch im Schlafgemach, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis) und im Thronsaal den Ton an, während sie ihrem Gemahl großzügig die Befehlsgewalt nur in der Räumen der Krieger überließ.
Bride, die älteste Tochter, hatte das Vorrecht, sich um den kleinen Bruder kümmern zu dürfen. Sie war es, die dem ewig hungrigen Schreihals die Brust gab, weil die Milchquelle der Mutter nach den sieben strapaziösen Geburten versiegt war. Sie war eine kräftige, junge Frau mit blaugrauen, schwermütigen Augen und dem breiten, offenherzigen Gesicht ihres Vaters. Mit gerade mal fünfzehn Jahren mit einem der Krieger des Königs verheiratet, wurde sie an dem Morgen, während ihr Sohn geboren wurde, Witwe als ihr ebenso junger Gemahl sein Leben auf dem Schlachtfeld ließ. Die Götter meinten es nicht gut mit dieser sanften Frau, denn zwei Monate später starb auch ihr Sohn an einer fiebrigen Krankheit. Auch wenn der Bruder, den sie so gut wie ihr eigenes Kind in den Armen halten durfte, ein Trost war, so erholte sie sich nie wieder von dem Verlust ihrer zwei geliebten Menschen und erduldete ergeben und stumm das Schicksal, das unsere Götter ihr auferlegt hatten.
Ganz anders Ginessa, die zweite Tochter des Königspaares. Aufgeweckt unterhielt sie mit ihrem ständigem Geplapper den ganzen Hofstaat, überhäufte ihn mit alten Geschichten, neuen Geschichten sowie dem üblichen Tratsch und wenn es nichts mehr zu tratschen gab, war sie davon überzeugt, dass eine Wiederholung von allem nicht schadete, bis ihr Vater, an seine Autorität als König erinnernd, lautstark Einhalt gebot („Halt endlich deine Klappe, Tochter! Du bist eine Prinzessin und kein Fischweib!). Sie stritt am häufigsten mit Bride um das Schoßhündchen, und wenn es ihr endlich gelang, das Objekt ihrer Begierde an sich zu reißen, drückte, kitzelte und knetete sie den schmächtigen Körper so lang und grob, bis Cahal brüllend zu verstehen gab, dass er zu seiner sanften Ziehmutter zurück wollte.
Die zarte, elfenhafte Kiarra näherte sich dem Neuzugang vorsichtig wie einem scheuen, wilden Tierchen und es dauerte einige Tage, bis sie endlich wagte, als ob dieses schlafende Wesen in seinem Bettchen zerbrechlich wäre, behutsam die federleichten, weichen Haare zu berühren.
Róisin und Sabia, der doppelte, rothaarige, personifizierte Albtraum des Hofstaates. Unzertrennlich, wild und unberechenbar begrüßten sie Cahal auf ihre unvergleichlich temperamentvolle Art und Weise, indem sie lauthals eine Willkommensballade zum Besten gaben (zumindest sollten die Geräusche, die die achtjährigen rothaarigen Zwillinge kreischten, so etwas wie ein musikalisches Ständchen darstellen). Mit nervenaufreibender Regelmäßigkeit sahen sie es als ihre Geschwisterpflicht an, dem Brüderchen vor dem Einschlafen eine Geschichte zu erzählen, deren Inhalt allerdings selbst die härtesten Krieger erröten ließ. Als die dezenten Hinweise ihres Vaters, doch bitte schön diese Sauereien, die nun wirklich nicht für die Ohren eines Säuglings bestimmt waren, (die dieser zu seinem Glück und Seelenheil ohnehin nicht verstand), zu unterlassen, nicht fruchteten, beendete die Königin den verbalen Saustall kurzerhand – entgegen ihrer sonstigen Erziehungsmethoden – mit vier Ohrfeigen, gerecht verteilt auf jede Wange ihrer frühreifen Töchter.
Guinevere war des Königs Liebling. Eine überirdisch bildschöne fünfjährige Elfe – das schwarze Gegenstück zu der weißen Kiarra – mit blauschwarzen Haaren, die ihr bis zur Hüfte reichten, schmalen, grünen Augen, tief und unergründlich wie der Ozean, dessen Farbe je nach Stimmung von strahlend hell bis tiefdunkel wechselte. Brian war in dieses kapriziöse Geschöpf, dem es gelang, ihn immer wieder aufs Neue zu faszinieren, so vernarrt, dass die Königin ihn regelmäßig tadelte, weil er den Liebling, unter dessen Launen der ganze Hofstaat zu leiden hatte, nach Strich und Faden verwöhnte. Guinevere war der Kontrast zu ihren blonden und rothaarigen Schwestern. Anders als die Zwillinge, die mit ihren derben Streichen ihre nähere Umgebung tyrannisierten, gelang es ihr dagegen, die Untertanen allein durch ihre Anwesenheit, wenn sie mit ihrer samtenen Stimme Befehle austeilte, für sich zu gewinnen, wobei es niemand schaffte, ihr die absurdesten Wünsche zu verweigern. Sie, nur sie allein war die unumstrittene Prinzessin. Nun – und jetzt kündigte sich, nachdem es ihr gelungen war, die plumpen Schwestern in den Hintergrund zu drängen, erneut Konkurrenz an. Prinz oder Prinzessin – Guinevere beschloss, ihre bevorzugte Position mit allen lauteren und unlauteren Mitteln zu verteidigen. Sie nahm es dem strampelnden Wesen im Bauch der Königin bereits übel, dass es ihrer geliebten Mutter solche Qualen zu bereiten schien. Als schließlich bei der Königin die Wehen einsetzten, schwor sie, während Elaine sich vor Schmerzen die Seele aus dem Leib schrie, es diesem grässlichen Dingsda heimzuzahlen noch bevor es den ersten Atemzug von sich gab.
Ermahnungen, aufmunternde Worte sowie Augenzeugen, die nicht aufhörten zu berichten, wie entzückend, wie hinreißend, wie bezaubernd, wie goldig, wie niedlich, wie liebreizend dieses grässliche Dingsda doch war, brachten Guinevere nicht dazu, auch nur einen Blick auf das entzückende, hinreißende, bezaubernde, goldige, niedliche, liebreizende Wunder zu werfen. Sie schmollte, zog sich in das Gemach der Mädchen zurück und nicht einmal Brian brachte sie dazu, wenigstens zu den Mahlzeiten im Großen Saal zu erscheinen. Nun ja, irgendwann merkte die Prinzessin, dass ihren demonstrativen Rückzug niemand außer ihrem Vater zur Kenntnis nahm. In einem unbeobachteten Augenblick schlich sie in das Gemach ihrer Mutter, um sich davon zu überzeugen, wie entzückend, hinreißend, bezaubernd, goldig, niedlich, liebreizend der neugeborene Prinz wirklich war. Als sie die Decke anhob und auf das vollkommen entspannt atmende Würmchen schaute, war es um sie geschehen. Sie lächelte ihr geheimnisvolles Elfenlächeln, und dabei schien es ihr, als ob Cahal ihr Lächeln erwiderte. Und als ihre kühle Hand die entblößte Brust des Säuglings berührte, umfassten die zarten Händchen so fest einen ihrer Finger, dass sie Mühe hatte, sich aus der Umklammerung zu lösen.
„Willkommen Cahal, mein kleiner Bruder!“, flüsterte sie, während sie sich tiefer zu ihm hinabbeugte. „Nicht wahr, auch du weißt es längst, dass wir beide zusammengehören.“ Ihre meergrünen Augen verdunkelten sich, als sie fortfuhr: „Mein kleiner Bruder, du gehörst jetzt mir, nur mir allein.“
Irland um 874
2.
Magische Spiele
Regelmäßig vor Sonnenuntergang verließen Muirgen und ich unser Gemach, um unten im großen Thronsaal zusammen mit dem Königspaar und dem gesamten Hofstaat die abendlichen Mahlzeiten einzunehmen. Unser geliebtes Gemach: mit dem breiten, schlichten Bett, das den meisten Platz beanspruchte, mit den zwei hohen, harten Stühlen, mit dem schmalen Brett, das auf zwei Holzböcke gelegt, als Tisch diente, mit dem einzigen wertvollen Möbelstück, der mit Eisenbeschlägen verzierten Truhe, in der meine Mutter ihre Kleider aufbewahrte und dem Kamin, in dem ein schwaches Feuer oftmals vergeblich versuchte, für die nötige Wärme zu sorgen. Es war der stetige Wind, der unaufhaltsam vom Ozean her die klamme Kälte hereinblies. Trotzdem: Dieses Gemach, hoch oben im Turm mit der atemberaubenden Aussicht hinaus auf das Ende der Welt, war nach vier Jahren noch immer unser bevorzugter Aufenthaltsort. Und in diesem Gemach sollte sich am Ende auch das grausame Schicksal der Königsfamilie erfüllen, in das sie verzweifelt vor den Angriffen der fremden Bestien geflohen war.
Unten im Thronsaal, in dem auch die täglichen Mahlzeiten eingenommen wurden, herrschte lautes, munteres Treiben. In der Mitte der T-förmig aufgestellten Tische und Bänke (Bretter auf Holzböcken, die nach Beendigung der Mahlzeiten wieder beiseitegeräumt wurden), saß König Brian, zu seiner Rechten Elaine und Cahal, zu seiner Linken sein engster Berater, der weise, alte Connor, sowie sein Lieblingskrieger, der Unbesiegbare Trahern, der heute das erste Mal seinen kleinen Sohn Amalach dabeihatte. Die sechs Prinzessinnen bildeten den Anfang der Längsseite des großen T’s. Ihnen gegenüber nahmen meine Mutter und ich Platz. Der Rest des Hofstaates, bestehend aus Verwandten, Kriegern, Beratern und Gästen, bildete das Schlusslicht der langen Tafel.
Für einen Augenblick wurde der Lärm von dem weisen, alten Connor energisch unterbrochen. Es herrschte respektvolle Stille, als König Brian seinen Becher hob, sich mit funkelnden Augen seiner uneingeschränkten Aufmerksamkeit vergewisserte, mit dröhnender Stimme einen Trinkspruch zum Besten gab, auf murmelnde Zustimmung sowie eifriges Nicken wartete und schließlich, nachdem er den Inhalt in einem einzigen Schluck geleert hatte, den Becher mit einem lauten Rülpser begleitend mit den Worten „Verzeiht, liebe Untertanen. Es hätte ein Lied werden sollen!“ auf den Tisch knallte, was seine jubelnden Krieger veranlasste, es ihm gleichzutun. Und nachdem das unbändige Lachen und Rülpsen verstummt waren, wurde das Signal zum ungehemmten Zugreifen gegeben. Man aß gemächlich mit den Fingern, ignorierte die mit Wasser gefüllten Schüsseln, die zum Reinigen derselben dienten, aber immerhin von den Ladys benutzt wurden, zerteilte die Fülle der Fleischstücke, tunkte sie in diverse schmackhafte Soßen und wischte sich, sehr zum Missfallen der anwesenden Ladys, das Fett mit den Ärmeln der Gewänder aus dem Gesicht. Man prahlte mit vollem Mund, wie erfolgreich und wie gefährlich die letzten Jagdausflüge gewesen waren und mit jedem Schluck Bier nahmen die drei Wildschweine, die auf den Tischen verteilt waren, überdimensionale Größe an.
Muirgen und Elaine warfen sich Blicke zu. Sie hatten es längst aufgegeben, den Männern bessere Tischmanieren beizubringen. Sie zuckten resigniert mit den Achseln, bemühten sich jedoch, wenigstens bei ihren Söhnen auf etwas mehr Anstand zu achten, was zur Folge hatte, dass meine Mutter mir eine Kopfnuss verpasste, als ich versuchte, ebenfalls einen kläglichen Rülpser von mir zu geben.
Ich mochte diese rauen, tätowierten Krieger mit den abenteuerlich frisierten schwarzen, blonden oder roten Haaren. Ich mochte es, ihnen zuzuschauen, wie sie die Fleischstücke mit ihren kräftigen Händen auseinanderrissen, wie ihnen das Bier, das sie gluckernd in sich hinein schütteten, die Kehle hinabrann, denn das war der Auftakt zu ihren spannenden Geschichten von Kämpfen mit erbarmungslosen Feinden, riesigen Wildschweinen, wilden Wölfen und unglaublich gefährlichen Monstern, die in den undurchdringlichen Wäldern ihr Unwesen trieben. Da saß ich also in ihrer Mitte, ich zarter vierjähriger Winzling und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, mein Bauch satt vom reichlichen Essen und mein Kopf gefüllt mit Abenteuern, die mich bis in meine Träume verfolgten und mich dort zum unbesiegbaren Helden über alle Monster machten.
„Schaut doch, was für ein feines, zauberhaftes Gewand unser Finian heute trägt!“ Guineveres samtene Stimme machte mir schmerzhaft klar: Unbesiegbare Helden trugen niemals feine, zauberhafte Gewänder, und als meine Mutter auch noch das Kompliment, das wohl eher boshaft gemeint war, mit einem zustimmenden Lächeln erwiderte, wurde mir bewusst, dass meine Abenteuer in Zukunft nur in meinen Träumen stattfinden würden. Zu allem Überfluss hatte auch König Brian diese Bemerkung mitbekommen (was Guinevere bestimmt beabsichtigte). Er grinste und kommentierte lautstark:
„Ja, ja, dieses neumodische Zeug. Diese Stöfflein, die unsere eitlen Händler hierhergeschleppt haben und die jetzt jeder Dummkopf trägt, taugen wenig für unseren Alltag. Sie sind viel zu dünn für unser Klima. Dein verzärtelter Sohn zittert ständig wie Espenlaub, liebe Schwägerin. Und wenn du ihn schon abhärten willst, wie es sich für einen künftigen Mann gehört, dann lass ihn gefälligst, wie die meisten unserer kleinen Söhne, halbnackt oder ganz nackt herumlaufen, statt ihn in ein Gewand zu stecken, in dem er aussieht wie ein feines, zauberhaftes Mädchen!“
Das Lächeln meiner Mutter erstarb, sie fixierte Brian, bevor sie, nach einem kurzen Blick auf seine edlen Jagdhunde, deren Schnauzen gar nicht edel den Boden nach Knochen und Fleischresten absuchten, mit ungewohnt scharfer Stimme entgegnete:
„Mein König, jawohl, dieses Gewand ist in der Tat aus einem sehr kostbaren Stoff, so kostbar, wie auch mein Sohn ist. Er ist einem eurer edlen Hunde ähnlich, die tapfer gegen die wilden Wölfe kämpfen, um unser kostbares Vieh zu schützen. Bitte, mein König, schließt niemals nur nach dem Äußeren auf die Tapferkeit eines Menschen!“
Ich hatte kein Interesse, den Dialog der beiden weiter zu verfolgen. Ich nutzte die Gabe, vollkommen abschalten zu können. Die Stimmen um mich herum verschwanden, während ich mich stattdessen über den Anblick der stummen Münder, die japsten wie aus dem Wasser gezogene Fische, amüsierte.
Dann fiel mein Blick auf Cahal. Er schien merkwürdig still zu sein, was nicht seinem wilden Temperament entsprach. Er saß, ein angebissenes Stück Brot noch in der Hand haltend, wie erstarrt neben der Königin. Offenbar fühlte auch er sich, genau wie ich, in seiner weißen Leinentunika mit den bestickten Besätzen nicht wohl – so vermutete ich, (und mit seinen schulterlangen Haaren sah auch er aus wie ein feines, zauberhaftes Mädchen). Er war, wie die vielen anderen Knaben in seinem Alter gewöhnt, mit nichts weiter als einem goldenen Halsring bekleidet zwischen den Hunden seines Vaters auf dem strohbedeckten Boden herumzutoben (was den Mädchen natürlich der Schicklichkeit halber nicht gestattet war). Die nackte Haut war also in den Augen des Königs bei unserem Klima angemessen. Sie diente, wie er bereits drastisch verkündet hatte, der nötigen Abhärtung künftiger Krieger, wogegen die feinen Hemden aus Seide den Träger unnötig verweichlichten. König Brians Logik sollte mir noch des öfteren im Laufe meines Lebens Kopfzerbrechen bereiten.
Doch ich lag mit meiner Vermutung bezüglich Cahals Tunika nicht richtig, denn jetzt bemerkte ich, dass er die ganze Zeit seinen Blick auf den Becher des Königs gerichtet hatte, der ein Stück von seinem Besitzer entfernt, am Rand der Tischplatte, stand. Ich war mir ganz sicher, dass Brian diesen Becher, bis obenhin gefüllt mit Bier, niemals an diesem gefährlichen Platz abgestellt hatte. Ich wusste zuerst nicht weshalb, aber als auch ich den Becher konzentriert fixierte, geschah etwas, was mich bis ins Mark entsetzte: Der Becher bewegte sich, er bewegte sich von allein in Richtung des Königs. Und noch bevor ich registrieren konnte, dass es meine Gedanken waren, die ihn kontrollierten, rutschte der Becher wieder zum Rand des Tisches. Ich atmete zweimal tief durch, und der Becher kam zurück zu seinem Besitzer. Zum Glück, denn der König packte ihn, nahm einen kräftigen Schluck, und kaum hatte er ihn abgestellt, glitt er abermals zum gefährlichen Platz, wo er hin- und herzukippen begann und jeden Augenblick hinunterzufallen drohte, allerdings rechtzeitig zum Stehen kam. Cahal und ich schauten uns kurz an, und nachdem wir innerlich vor Lachen fast geplatzt waren, brachten wir dieses Spiel zum Höhepunkt, indem wir den Vorgang nicht nur beschleunigten, sondern das Risiko, dass der Becher wirklich vom Rand fiel, erhöhten. Die Anwesenden schienen so sehr in ihre lärmenden Gespräche vertieft zu sein, dass keiner von ihnen unser heimliches Duell bemerkte – dachten wir.
Hocherfreut, diese unfassbare Fähigkeit für uns beide gerade entdeckt zu haben, hätten wir dieses faszinierende Spiel bestimmt noch eine Weile fortgesetzt, wenn nicht doch eine Person, die offensichtlich ebenso diese unfassbare Fähigkeit besaß, dazwischengegangen wäre.
„Hört auf der Stelle mit diesem Unsinn auf!“ So weich Guineveres Stimme war, so traf mich ihr Befehl in meinem Kopf hart und grell wie ein Blitzstrahl. Auch Cahal zuckte zusammen und griff sich zitternd an die Stirn.
„Macht so etwas nie wieder! Habt ihr zwei Rotznasen mich verstanden? Macht diese magischen Spielchen nie wieder!“
Wir machten sie allerdings wieder, diese magischen Spielchen. Sogar fast an der gleichen Stelle des Thronsaales. Nur waren es nicht mehr die magischen Spielchen kleiner übermütiger Knaben, sondern der blutige Ernst junger verzweifelter Schüler.
Wenn man das große Tor der Festung passiert hat, befindet man sich auf der breiten Straße, die, auf beiden Seiten von den niedrigen mit Torf bedeckten Steinhäusern flankiert, in den Wald der Götter hineinführt und dort mittendrin abbricht. Von da an gibt es lediglich noch den einen Pfad in die Schlucht der Verfluchten, in die die Leichen der Verbrecher, Verräter und der Abtrünnigen den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden und nur die Schwarzen Henker, als einzige Lebende, diesen Teil des Waldes betreten dürfen, während der zweite Pfad direkt vor der Lichtung endet, auf der regelmäßig der Herr des Waldes erscheinen soll. Nur ganz wenige hatten ihn bis jetzt von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, allerdings waren ihre Beschreibungen so unterschiedlich, dass die meisten von uns an ihrem Wahrheitsgehalt erheblich zweifelten. Bei den einen war er ein riesiger, hellbrauner Wolf, bei den anderen wiederum ein schwarzer Keiler mit mächtigen Hauern oder ein schneeweißer Hirsch mit rotglühenden Augen. Nun ja, sollte er wirklich existieren – davon waren wir Kinder überzeugt – so war er in der Lage, jedes Aussehen nach seinem Gutdünken anzunehmen.
Jedenfalls sollten diese unheimlichen Erscheinungen unserer Phantasie genügend Nahrung geben, den geheimnisvollen Wald zu meiden, was sicher auch der Sinn der Sache war, als der weise, alte Connor an einem der langen dunklen Winterabende, an dem wir zusammengekuschelt vor dem warmen Kamin saßen, eine Geschichte nach der anderen zum Besten gab. Während ich vor Ehrfurcht erstarrte, machten Cahal und Amalach, der Sohn des Unbesiegbaren Trahern, bereits Pläne, wie sie unbemerkt den grausigen Wald erforschen könnten. Da Amalach, wie auch Cahal und meine
Wenigkeit, zu den Erwählten gehörten, waren wir bereits in der Lage, uns per Gedankenübertragung zu verständigen. Wir schafften es sogar, nach einiger Übung die naseweise Guinevere auszuschließen, die allerdings an diesem Abend nicht anwesend war. Trotzdem blieb den anderen Zuhörern, ganz besonders den rothaarigen Zwillingen, unser Austausch nicht ganz verborgen. Ihre erstaunten Blicke wechselten ständig zwischen uns hin und her, und als sie schließlich Grimassen schneidend endgültig kapitulierten, brachen wir drei in ein schallendes Gelächter aus. Auch der weise, alte Connor musste lachen:
„Ihr drei kleinen Monster! Denkt ja nicht, dass ich nicht gemerkt habe, was ihr vorhabt?“ Er machte eine kurze Pause und schaute uns mit seinen listigen grauen Augen durchdringend an. „Ja, ihr werdet es nicht glauben, ich weiß sehr wohl, was in euren Köpfen gerade vorgegangen ist, auch wenn ich selbst keine Gedanken lesen kann. Es sind eure Blicke, die euch verraten, ganz einfach. Nun, ihr müsst noch viel lernen, denn jeder Idiot kann eure Gedanken lesen. Ihr könnt also eure Unterhaltung in aller Ruhe laut fortführen. Ich bin sicher, in ein paar Jahren seid ihr drei bestimmt soweit, dass ihr euch verständigen könnt, ohne dass irgendjemand etwas mitbekommt. Und bis dahin solltet ihr mit euren Talenten vorsichtig umgehen.“
Er machte abermals eine Pause, senkte den Kopf und verharrte eine Weile in dieser Stellung, bis er fortfuhr:
„Manchmal sind mir die Götter gnädig und lassen mich in die Zukunft schauen, aber heute vermag es mir bei keinem von euch so recht gelingen. Ich versuche es trotzdem. Du, Finian, bei dir sehe ich große Weisheit, doch auch großen Schmerz – dann nichts mehr.“
Ich versuchte zu lächeln, was mir allerdings angesichts des vorher bestimmten Schmerzes nicht so recht gelingen wollte. Mehr würde der weise, alte Connor mir ohnehin nicht sagen können oder wollen, deshalb beschloss ich, seine verstörende Bemerkung in die tiefsten Tiefen meines Gedächtnisses zu verbannen und sie in alle Ewigkeit dort zu lassen.
„Du, Amalach, du wirst ein großer Krieger wie dein Vater, und du …“, er zögerte einen Augenblick, „… wirst eine zeitlang auf dem Thron sitzen.“ Connor seufzte tief auf, und als er Amalachs erschrockenen Blick sah, packte er ihn an den Schultern, umarmte ihn und versuchte, ihn zu trösten. „Hab keine Furcht, junger Krieger, nicht alles, was ich zu sehen glaube, muss eintreffen oder Böses bedeuten.
Mach dir also keine Sorgen, denn auch der alte, verwirrte Connor kann sich irren.“
Amalach schien nicht allzu beruhigt zu sein. Der alte, verwirrte Connor vermochte sich zu irren, doch niemals die Götter, die ihm nach seiner Aussage die Gabe der Prophezeiung gegeben hatten. Er gab jedoch mit einem eifrigen Nicken zu verstehen, dass er versuchte, dem alten, verwirrten Connor tapfer Glauben zu schenken. Der hatte sich inzwischen dem Königssohn zugewandt:
„Cahal, mein künftiger Herr und Meister, du hast die größte Gabe von allen Erwählten erhalten. Nutze sie klug und besonnen, denn sie ist nicht nur eine große Freude, sondern auch eine große Last!“ Und als ob er sich auf einmal scheute, weiter in die Zukunft seines künftigen Herrn und Meisters zu schauen, fuhr er ihm zerstreut durch die langen, pechschwarzen Haare, betrachtete versonnen die schneeweiße Strähne, bis er seine Prophezeiung beendete: „Die Götter haben dich gezeichnet, Cahal. Ich kann nicht erkennen, ob zu deinem Segen oder zu deinem Fluch. Ich sage dir, du selbst wirst es einst in der Hand haben, ob dein Volk dich lieben oder hassen wird.“
Er wartete einen Augenblick auf Cahals Reaktion, und als der jedoch mit versteinertem Gesicht beiseiteschaute, räusperte sich der weise, alte Connor und fuhr verlegen fort: „Machen wir an dieser Stelle Schluss. Was wollt ihr noch hören?“
„Die Geschichte von dem nackten Mädchen, das angeblich in einem verwunschenen Schloß lebt und wie sie sich zu Beginn des Frühlings mit dem Herrn des Waldes trifft, um sich mit ihm zu vereinigen …“, riefen Róisin und Sabia aus einem Mund. Die zwei hatten bis jetzt still und gelangweilt unseren Zukunftsplänen gelauscht. Connor hatte die Geschichte von der Zauberin mit den spitzen Zähnen, die von ihrem Wächter, einem Wiesel, ständig begleitet wurde, schon gefühlte tausend Mal erzählt, doch die Mädchen liebten diese Romanze, mit der wir drei Jungen vorerst gar nichts anfangen konnten. Vorerst – ich betone ausdrücklich – vorerst!
Ich war davon überzeugt, dass, wie ich selbst, ebenso Cahal und Amalach dem weisen, alten Connor ohnehin nicht mehr zuhörten. Jeder von uns dreien schien mit einem Mal, in seine eigenen Gedanken versunken, über sein eigenes Schicksal nachzugrübeln. Eigentlich wollte ich von meiner Zukunft, die offenbar nur Schmerz versprach, nichts mehr wissen, trotzdem fürchtete ich mich in diesem Augenblick so sehr, dass ich Mühe hatte, die Tränen zurückzuhalten, während Amalach, seinem besinnlichen Grinsen nach zu schließen, sich mit der Vorstellung, eines Tages den Thron zu besteigen, langsam vertraut zu machen begann. Nur Cahal ließ noch immer nicht erkennen, was er mit der Aussage, dass die Götter ihn gezeichnet hatten – zu seinem Fluch oder zu seinem Segen – anfangen sollte. Ob er sich überhaupt schon jetzt darüber im Klaren war, welche Verantwortung er eines Tages für sein Volk tragen würde? Ich wusste es nicht, denn er hatte seine Gedanken, die mir bis jetzt immer zugänglich gewesen waren, blockiert.
Das zweideutige Gekicher der Mädchen holte uns zurück in die Gegenwart, denn der weise, alte Connor pflegte seine Erzählung von der wilden Zauberin – bestimmt auch zu seinem eigenen Ergötzen – jedes Mal mit neuen, schlüpfrigen Details zu würzen. Sie stutzten einen Moment, sahen uns stirnrunzelnd an, murmelten etwas von miesepetrigen Spielverderbern, um gleich wieder ihr munteres Geplauder fortzusetzen, nachdem sie ihrem kleinen Bruder freudig verkündet hatten, dass er in zwei Tagen ein Bad nehmen musste. Diese Vorstellung brachte Cahal mehr aus der Fassung, als Connors Prophezeiung, beziehungsweise schien es für ihn bereits die Erfüllung und der Beginn einer Reihe endloser Flüche zu sein, die ihm die Götter auferlegt hatten, denn er sprang entsetzt auf, knurrte, fletschte die Zähne wie ein in die Enge getriebenes Raubtier, um sich schleunigst für die nächsten Tage im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar zu machen.
Irland um 874
3.
Waschtag der Könige
Badetag! Das bedeutete erst einmal, eine königliche Familie in fröhlicher Aufruhr, dampfende Kessel, in denen Unmengen Wasser, herbeigeschleppt von emsigem Gesinde, brodelten, hölzerne Zuber, die in der Küche, unterhalb des Thronsaales, die Gänge versperrten und damit die Arbeit der fluchenden und ständig übel gelaunten Köchinnen behinderten. Es herrschte das Gebrüll der hektischen Mägde, denn sie kamen kaum noch nach, die Bottiche aufzufüllen, und dazwischen das schrille Geschnatter der Prinzessinnen hinter den weißen Laken, die man der Diskretion halber an Seilen zwischen den abgehangenen Fleischstücken gespannt hatte.
Für mich war der Waschtag der Könige immer ein ganz großes Fest. An diesem Tag hatte ich sogar das Vorrecht, noch vor dem Kronprinzen, der weiterhin mit Abwesenheit glänzte, meinen vor Kälte bibbernden bleichen Körper in das noch unberührte heiße Wasser einzutauchen und mich anschließend dampfend vor Hitze, rot wie ein frisch gekochter Krebs, von Muirgen abschrubben zu lassen. Aber die Behaglichkeit fand schnell ein Ende. Ich konnte den Rest meines Bades nicht mehr richtig genießen, da man inzwischen ein fauchendes, spuckendes Etwas zu mir in den Zuber gesetzt hatte. Natürlich hatte Elaine mit dem routinierten Spürsinn einer Mutter ihren vermissten Schmutzfink in Windeseile aufgespürt, ihn am Schlafittchen gepackt, seine verdreckte Hose der nächsten Magd zum Reinigen vor die Füße geworfen, während sie mit der anderen freien Hand geschickt ihren vergeblich protestierenden Sprössling ins bereits lauwarme Wasser beförderte. Dem Geruch nach zu schließen, den Cahal verströmte, hatte er sich im Pferdestall versteckt, bis ihn der Stallmeister bei der Königin, deren Launen er mehr fürchtete als sämtliche Dämonen des Waldes, verriet. Cahal hatte sich mittlerweile in sein Schicksal ergeben und ließ sich nun stumm und geduldig von seiner Mutter mit Ginessas Hilfe Kopf und Körper waschen.
Er hasste das Wasser. Ob es daran lag, dass er vor ungefähr zwei Jahren im See, unterhalb der Festung, beinah ertrunken wäre? Es waren die Zwillinge, die den kleinen Bruder verbotenerweise zu einem Ausflug dorthin mitnahmen, um nach ihren Aussagen herauszufinden, wie Cahals Zauberkräfte im Wasser wirkten. Sie fanden es auf der Stelle heraus – nämlich gar nicht! Er verwandelte sich weder in eine Ente noch in einen Fisch. Er blieb ein nacktes, panisch nach Luft schnappendes Menschlein, bevor er wie ein Stein unterging. Nur Bride hatte instinktiv geahnt, dass wieder grober Unsinn in den Köpfen der Zwillinge herumspukte und war ihnen gefolgt und konnte das blau angelaufene zitternde Kleinkind wieder rechtzeitig ins Leben zurückholen. Danach fiel alle Sanftmut von ihr ab, und Róisin und Sabia mussten, nach Aussagen verlässlicher Zeugen, schleunigst die Beine unter die Arme nehmen, um nicht von ihrer großen Schwester jämmerlich ersäuft zu werden. Bei den Göttern, Bride hätte es wirklich getan!
An einem Nachmittag gegen Ende eines warmen und sonnigen Sommers saßen Cahal und ich in der kleinen Nische vor dem Fenster oben in unserem Turmzimmer. Er hielt sich immer bei mir auf, wenn ihm der Trubel im Thronsaal zu heftig zusetzte. Und heute war er in der Tat sehr heftig. Seit mehr als einer Woche belagerte, um König Brian zu zitieren, ein Fürst aus den nördlichen Regionen der Insel mitsamt seinem Gefolge unsere Festung. Mengen von Nahrung wurden eigens für ihn und seine lärmende, trinkfreudige Entourage aufgefahren und ebenso mussten Unterhaltungskünstler wie Tänzer, Akrobaten, Sänger, Musikanten, Geschichtenerzähler und mittelmäßige Zauberer den missmutigen, grobschlächtigen Fürsten, der in einem seiner zahlreichen Kämpfe ein Auge eingebüßt hatte, bei Laune halten. Keine Ahnung, warum der König diesen Fürsten zu sich eingeladen hatte. Und weil es mich nicht sonderlich interessierte, hörte ich auch nur mit halbem Ohr hin, als mir Cahal – der Klugscheißer – mit beflissener Miene den Begriff Diplomatie zu erklären versuchte. Jener Fürst des Nordens verfügte über Beziehungen zu einem Volk, das mit seinen Schiffen Waren herbeischaffen konnte, die auch uns angeblich einen noch viel größeren Wohlstand versprachen. Deshalb war es für den König unumgänglich, ihn von morgens bis abends zu bespaßen, ermüdende, langweilige Gespräche zu ertragen, die gesamten Lebensmittelvorräte zu plündern und diesem Grobklotz auch noch zu allem Überfluss einer seiner liebreizenden Töchter zur Gemahlin zu versprechen, damit sie ihm zahlreiche männliche Nachfolger bescherte.
„Sag mal, hättest du nicht auch Lust, einmal auf einem der Schiffe auf das Meer hinauszufahren?“, fragte Cahal mit seiner ungewöhnlich rauen Stimme, die so gar nicht zu seiner mageren, zarten Erscheinung passte, nachdem er bemerkt hatte, dass mich seine Ausführungen bezüglich der diplomatischen Verhandlungen des Königs zu langweilen begannen. Ich fuhr aus meinen Träumen hoch. Seltsam, nein, eigentlich nicht seltsam, denn genau die gleiche Frage wollte auch ich ihm gerade stellen, während ich mich weiter aus dem Fenster beugte. Ein Himmel von einem unnatürlich gleißenden Blau, das in den Augen schmerzte und tief darunter der endlose Ozean, der heute tückisch ruhig wie ein unberechenbares, mächtiges Tier einen dummen Knaben zu dem Gedanken ermunterte, ein Schiff zu betreten, um bis ans Ende der Welt zu fahren. Ich warf noch einen Blick hinunter in die schwindelerregende Tiefe und setzte mich schließlich Cahal gegenüber in die Nische zurück. Ich nickte.
„Ja, das würde ich sehr gern. Und wie sieht es bei dir aus? Ich dachte du magst kein Wasser“, erinnerte ich ihn an seinen Auftritt letzte Woche in der zur Badestube umfunktionierten Küche.
„Finian, du Dummkopf! Ich will mich doch nicht nass machen und das Meer durchschwimmen, sondern es auf den Blanken eines riesigen Schiffs erforschen“, entgegnete er mit unerschütterlicher Besserwisserei, während er plötzlich aus den Falten seines Gewandes einen Hühnerschlegel hervorzog und ihn mir angeekelt hinhielt. „Willst du? Ich verabscheue Geflügel. Ich habe dieses widerliche Ding in meinem Gewand verschwinden lassen, als niemand hingesehen hat, denn wenn mein Gebieter (so nannte er seinen Vater, den König) unserer fetten Köchin erzählt, dass ich ihre vorzüglichen Hühner nicht leiden kann, wird sie mich dazu verfluchen, bis in alle Ewigkeit nur noch Hühner zu essen.“
Da ich gegen den Fluch, in alle Ewigkeit die vorzüglichen Hühner der fetten Köchin zu essen, nichts einzuwenden hatte, nahm ich den schon etwas zerfledderten Schlegel gern entgegen und biss kräftig hinein, bevor ich mit vollem Mund unser Gespräch fortsetzte:
„Aber da müssen wir ja zu diesem Volk, das mit den Schiffen bis ans Ende der Welt gekommen sein soll, auch Kontakt aufnehmen. Doch davor fürchte ich mich …“, und als Cahal ungläubig die Stirn runzelte, „… denn sie sollen sich schon eine ganze Weile nördlich von unserem Reich niedergelassen und dort eine riesige uneinnehmbare Festung erbaut haben. Krieger, die unsere Grenzen bewachen, haben davon berichtet: Von großen Männern mit wilden, hellblauen Augen und grausamen Waffen, die noch nie jemand vorher gesehen hat.“ Ich hielt inne, als ich merkte, dass Cahal sein Grinsen aufgesetzt hatte, mit dem er sich gern über alles lustig machte, was er als die Ammenmärchen der fetten Köchin bezeichnete. „Und unsere Priester haben schlimme Dinge prophezeit …“, fuhr ich unbeirrbar fort.
„Die Priester, bei denen wir uns vor drei Tagen vorstellen mussten?“, flüsterte Cahal erschrocken und wurde mit einem Mal blasser als er es ohnehin schon war. Ja, wir waren vor drei Tagen bei jenen Priestern gewesen, die unser Volk als die Dunklen Herrscher bezeichnete und wir hatten allerdings bis jetzt kein Wort über unseren Besuch verloren. Ungewöhnlich, denn eigentlich pflegten wir beide uns alle Erlebnisse eifrig zu erzählen und hatten uns sogar versprochen, alle Geheimnisse miteinander zu teilen. Der Ozean, das Ende der Welt, die Schiffe, das fremde Volk aus dem Norden rückten in den Hintergrund unserer Gespräche und alle Abenteuer, die wir zu erleben hofften, waren wie ausgemerzt angesichts der Zukunft, die uns in einigen Jahren erwartete.
Wir waren noch vor Sonnenaufgang aufgebrochen, der König, die Königin, Cahal, Muirgen und ich. Obwohl der Ritt gen Süden nur eine Stunde dauerte, kam mir unsere Reise ins Ungewisse wie eine gefühlte Ewigkeit vor. Wir verließen auf der rechten Seite den breiten Hauptweg, bogen auf einen schmalen Pfad ein, vorbei an den Grasebenen, auf denen das Vieh allmählich aus seinem Dämmerschlaf erwachte, vorbei an den Ställen unserer Heiligen Pferde, die uns mit einem verhaltenen Wiehern begrüßten, vorbei an dem Hügel, auf dem der Altar des Lichtes die Sonne erwartete, bis hinunter zu der großen Wiese, auf der unser Volk sich regelmäßig um den Opferstein versammelte um den Göttern zu huldigen. Die von einem Diener der Dunklen bewachte schmale Brücke führte über den Fluss, der zwei Seen miteinander verband, direkt zu der Halle des Schweigens und der Behausung der Priester, einem unscheinbaren, steinernen mit Torf bedecktem Gebäude, wie es alle unsere Hütten und Häuser waren.
Zuerst wurde die königliche Familie hereingebeten, während meine Mutter und ich vor der Tür warten mussten. Inzwischen war es hell geworden und ich versuchte die zermürbende Zeit des Wartens zu überbrücken, indem ich die Umgebung erforschte. Die Halle des Schweigens, eine ungewöhnliche Konstruktion, erinnerte auf den ersten Blick an eine mächtige, grüne Laube, umgeben von einem Dickicht aus knorrigen, uralten Bäumen und verkrüppelten Sträuchern, von dem ich lieber nicht wissen wollte, wer oder was sich dahinter aufhielt sowie zwei Seen, von denen ich erst recht nicht wissen wollte, was sie unter ihrer schwärzlich-blauen Oberfläche verbargen. Ich schrak hoch, als sich die Tür öffnete und Elaine und Brian samt Cahal wieder aus dem Haus der Priester heraustraten. Die Königin seufzte erleichtert und ich glaubte zu hören, wie sie ihrem Gemahl beschwichtigend zuflüsterte:
„Mein König, es war doch nur die Aufregung.“
Worauf er sie besorgt anschaute und entgegnete: „Meine Königin, du weißt es genau, es war nicht die Aufregung – es war die nackte Angst.“
Er trug Cahal, der zitternd das Gesicht an seiner Brust verborgen hatte, zu den Pferden, um, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, den Heimweg anzutreten.
„Ihr könnt jetzt hineingehen“, ermunterte uns Elaine mit einem schwachen Lächeln, bevor sie ihrem Gemahl und ihrem verstörten Sohn folgte.
„Ich habe ihnen vor die Füße gekotzt!“, nahm Cahal unser Gespräch wieder auf und sah mich etwas kleinlaut an. „Ich habe ihren prächtigen Boden mit meiner gesamten Morgenmahlzeit besudelt.“ Und als ich nicht sofort reagierte: „Das Gewand des Meisters hat auch was abgekriegt.“
Glaubte ich wirklich auf einmal ein triumphierendes Aufblitzen in seinen Augen zu sehen? Nun ja, und was sollte ich zu dieser ungeheuren Eröffnung sagen? Ich brauchte nicht allzu viel Phantasie, um in meinem Kopf ablaufen zu lassen, wie der Sohn des Königs sich vor dem Hohepriester der Dunklen erbrach, und als ich mir noch vorstellte, wie dem Meister beim Anblick seines künftigen Schülers, der ihn gerade vollkotzte, die steinernen Gesichtszüge entglitten, konnte ich nicht mehr an mich halten und brach in ein solch ungehemmtes Gelächter aus, dass mir fast der Atem versagte.
„Und sie haben dich Ferkel trotzdem erwählt?“, keuchte ich, nachdem ich meinen heftigen Schluckauf wieder im Griff hatte.
„Ja, das haben sie Finian. Sie haben mich erwählt. Ich vertraue dir ein Geheimnis an, und du musst schwören, nicht einer Seele davon zu erzählen.“ Er meinte es ernst und der durchdringende Blick aus seinen nachtschwarzen Augen bedeutete auch das Ende alberner Scherze.
„Ich schwöre es.“
„Sie sind böse, sie sind allesamt böse.“
„Sie sind wunderschön und so würdevoll.“
„Sie sind böse!“, beharrte mein Gegenüber.
„Nun ja, ein wenig unheimlich sind sie schon“, kam ich ihm ein Stück entgegen.
„Ich fürchte mich vor ihnen, vor ihren grausamen Blicken, ihren eiskalten Händen, die mir auf unerklärliche Weise plötzlich die Haut zu verbrennen schienen, als sie mich berührten. Sie haben mir alle Kleider ausgezogen und jede Stelle meines Körpers angefasst. Jede Stelle – wenn du weißt, was ich meine.“
Ich schwieg, auch mit mir hatten sie das Gleiche getan.
„Sie behaupteten, sie müssten prüfen, ob ich nicht einen Makel an mir hätte. Sie fanden keinen, außer, dass ich ihnen zu dünn war. Ich wünschte, ich hätte einen Makel, nur einen ganz, ganz kleinen Makel, Finian“, fuhr er mit leiser Stimme fort, als ob er fürchtete belauscht zu werden, und bemühte sich tapfer, die Tränen zurückzuhalten. „Was soll ich nur machen? Ich will doch gar nicht erwählt sein.“
„Aber du bist der Sohn des Königs, du hast von uns allen die größte Gabe, das hat doch der weise, alte Connor gesagt. Hast du vergessen, dass es eine große Ehre ist, von den Dunklen erwählt zu werden?“, ermahnte ich ihn so behutsam wie möglich. Endlich hatte er ein Einsehen. Er seufzte resigniert:
„Du hast ja recht. Ich werde nicht mehr jammern, das schickt sich nicht für einen Königssohn. Und ich habe keine andere Wahl. Ja, Mylady war so stolz, als sie erfuhr, dass ich in den Kreis der Priester aufgenommen war, sie hatte so schlimme Angst, dass man mich ablehnen würde. Sogar mein Gebieter hat mir erst gestern versichert, wie großartig er es auf einmal findet, dass sein einziger Sohn jetzt nicht nur zum Krieger, sondern auch zum Priester ausgebildet wird.
Dabei hatte ich so gehofft, dass gerade er, der die Dunklen ebenso fürchtet wie ich, mich nicht zu ihnen schickt, aber er ist mein Vater und mein König und ich werde mich seinem Willen beugen.“
Ich war erschüttert, denn in diesem Zustand hatte ich meinen so verwegenen und vorlauten Cousin noch nie erlebt – ein mageres, vor Furcht bebendes Kind, das noch weit entfernt von dem wagemutigen Krieger, dem mächtigen Meister und dem gefürchteten König war. Und was sollte ich ihm erwidern? Ja, auch ich war von den Dunklen entkleidet und bis auf jede Pore meines Körpers abgetastet worden. Ja, ihre Hände waren anfangs kühl, jedoch fühlte ich eine angenehme Wärme, als sie mir über den Nacken bis hinunter zu den Füßen strichen, und als sie mich für würdig befanden, in ihren Kreis aufgenommen zu werden, war es nicht nur meine Mutter, die vor Glück kaum an sich halten konnte.
Es war nicht der richtige Zeitpunkt, Cahal von meinen Erfahrungen mit den Dunklen Herrschern zu berichten. Ich nahm seine Hände in die meinen und prophezeite ihm, dass am Ende alles gut werden würde. Es wurde nichts, gar nichts gut – es wurde sogar noch viel schlimmer. Doch ich will nicht vorgreifen.
Ich, für meine Person, zehrte sogar noch eine Weile davon, den Dunklen begegnet zu sein. Ich durfte, wie auch Cahal, einen kurzen Augenblick in ihrer Anderswelt verweilen, denn hinter dem Saal, von dem aus eine breite Treppe ins Nirgendwo hinaufführte, befanden sich auf beiden Seiten des Saals jeweils drei gläserne Türen, aus denen ein grünlich-gelbes Licht schimmerte und der Boden war so glatt geschliffen, dass sich unsere Abbilder darin spiegelten.