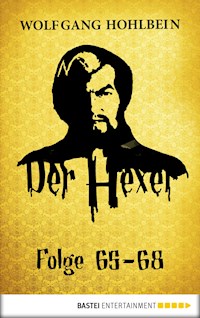
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Das Labyrinth von London" - Folge 65 - enthält ebenso wie "Fluch aus der Vergangenheit" - Folge 66 -, "Das Haus der bösen Träume Teil I" - Folge 67 - und "Schattenwerkstatt Teil II" - Folge 68 - die letzten beiden HEXER-Romanhefte.
Für ein finales Ende überarbeitete Wolfgang Hohlbein die vier Teile, die schließlich als Taschenbuchausgabe und später innerhalb der HEXER-Sammelbände als Tachenbücher erschienen.
London, 1892. Das geschäftige Treiben der Metropole wird gestört, als eine Insel vor der Küste aus dem Meer auftaucht. Sie besteht zum größten Teil aus einem geheimnisvollen Labyrinth, das sich bis weit unter die Stadt verzweigt. In diesem Labyrinth lauert einer der gefürchteten Großen Alten, und als eine Expedition dorthin aufbricht, ergreift er von einem der Teilnehmer Besitz. Fortan treibt das Böse sein Unwesen in der Stadt, und Robert Craven, der Hexer, sieht sich einmal mehr seinen alten Feinden gegenüber. Um sie zu besiegen, muß er sich selbst in das bizarre Labyrinth begeben ...
"Fluch aus der Vergangenheit" - Folge 66
Kevin Collins arbeitete bereits seit fast dreißig seiner insgesamt neunundvierzig Jahre auf der Harper-Werft. Die harte Arbeit hatte ihre Spuren hinterlassen. Er war ein bulliger Mann mit breiten Schultern und Händen, die an die Pranken eines Bären erinnerten. Wo er hinschlug, da wuchs so schnell kein Gras mehr, das konnten zahlreiche Zecher bezeugen, die im Laufe der Zeit den Fehler begannen hatten, sich in einer der vielen Kneipen des Hafenviertels, in denen er verkehrte, mit ihm anzulegen. Er war kein streitsüchtiger Mann, ganz gewiss nicht, aber er ging auch keiner Schlägerei aus dem Weg, wenn er genügend provoziert wurde.
"Das Haus der bösen Träume Teil I" - Folge 67
John Baldwin war nicht abergläubisch, was der Hauptgrund war, weshalb er nach rund einem Jahr noch immer auf der Baustelle am Ashton Place 9 arbeitete - und weshalb er jetzt in diesem Schlamassel steckte. Die Geschichten, dass es dort angeblich spukte, dass irgendwelche übernatürlichen Kräfte einen nennenswertes Fortschritt beim Wiederaufbau des Hauses verhinderten, waren für ihn nie mehr als alberne Märchen gewesen ...
"Schattenwerkstatt Teil II" - Folge 68
Das Haus war eine Falle.
Roderick Andara vermochte nicht zu sagen, woher er diese Überzeugung nahm. Nichts an dem schäbigen kleinen Häusschen inmitten des kaum größeren, von der schon seit Wochen anhaltenden Hitze ausgedörrten Gartens am Ortsrand von Innsmout war irgendwie auffällig, nichts deutete auf eine wie auch immer geartete Bedrohung hin. Hinter einem der Fenster im Erdgeschoss brannte Licht, doch die Vorhänge waren zugezogen und der Stoff zu dicht, um etwas dahinter zu erkennen. Auch zu hören war nichts. Und doch fühlte Andara die Gefahr so deutlich, als ob die Warnung mit Leuchtfarbe auf die Wände gepinselt wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 891
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Das Labyrinth von London
Der Hexer – Fluch aus der Vergangenheit
Der Hexer – Erster Teil: Das Haus der bösen Träume
Der Hexer – Zweiter Teil: Die Schattenwerkstatt
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 65-68:
Der Hexer – Das Labyrinth von London
Der Hexer – Fluch aus der Vergangenheit
Der Hexer – Erster Teil: Das Haus der bösen Träume
Der Hexer – Zweiter Teil: Die Schattenwerkstatt
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 65–68
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1584-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 65-68
Dieser Band »Das Labyrinth von London« – Folge 65 – enthält ebenso wie »Fluch aus der Vergangenheit« – Folge 66 –, »Das Haus der bösen Träume Teil I« – Folge 67 – und »Schattenwerkstatt Teil II« – Folge 68 – die letzten beiden HEXER-Romanhefte.
Für ein finales Ende überarbeitete Wolfgang Hohlbein die vier Teile, die schließlich als Taschenbuchausgabe und später innerhalb der HEXER-Sammelbände erschienen.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 65Das Labyrinth von London
28. September 1892
Irgendetwas stimmte nicht.
Kapitän Joffrey Blossom von der königlich-englischen Kriegsmarine blickte so gebannt zu der kleinen Felseninsel hinüber, dass er nicht einmal den scharfen Ostwind registrierte, der über das Oberdeck der HMS THUNDERCHILD pfiff, an seinem grauen Haar zerrte und wie mit winzigen Nadeln in seine Haut stach. Es war sehr kalt; ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit und selbst für die wahrlich nicht an tropische Temperaturen gewöhnten Gewässer dicht vor der englischen Küste, aber auch das bemerkte er kaum, ebenso wenig wie die Feuchtigkeit, die sich wie ein schmieriger grauer Film über das Schiff und alles an Deck gelegt und selbst seine Uniform bis auf die Haut durchnässt hatte. Er hatte seine Hände so fest um das Metall der Reling geklammert, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten und alles Blut aus dem Fleisch unter seinen Nägeln gewichen war, bis sie wie kleine weiße Narben wirkten. Seine Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengepresst, und er hatte seit mehr als einer Minute nicht einmal mehr geblinzelt, sondern stand reglos wie eine aus Stein gemeißelte Statue da. Aus eng zusammengekniffenen Augen starrte er zu der kleinen Felseninsel hinüber.
Irgendetwas stimmte nicht.
Es war das zweite Mal, dass er diesen Gedanken ganz klar formuliert dachte, und ebenfalls zum zweiten Mal schien es ihm, als hallten die Worte düster und lange in seinem Schädel nach, fast als wäre es gar kein Gedanke, sondern der Klang einer lautlosen Stimme, die ihm eine Warnung zuflüsterte: Geh nicht dorthin. Flieh! Meide diesen Ort. Geh weg, so lange du es noch kannst … Sie war nicht sehr laut, aber sie flüsterte ununterbrochen und wurde eindringlicher, je näher sie der Insel kamen.
Normalerweise gestattete sich Blossom nicht, solcherlei albernen Gedanken nachzugeben. Aber an diesem Tag – und diesem Ort – war nichts normal. Seit die HMS THUNDERCHILD die kleine Insel erreicht hatte, hatte er immer mehr das Gefühl, gleichsam eine Grenze überschritten zu haben, die nicht materiell, trotzdem aber höchst real war. Und die er besser nicht überschritten hätte. Er wusste nicht, was dahinter lag, aber was immer es war – es machte ihm Angst.
Vor vier Tagen erst war die Insel urplötzlich aus dem Meer aufgetaucht, ohne dass irgendjemand bislang eine plausible Erklärung dafür gefunden hatte. Zwar war zu diesem Zeitpunkt ein leichtes Seebeben registriert worden, das auch an Land noch zu spüren gewesen war, doch selbst wenn man bedachte, dass das Meer hier, eine Meile von der Themsemündung entfernt, noch ziemlich flach war, hätte das Beben allein niemals ausgereicht, ein solches Eiland entstehen zu lassen. Blossom war alles andere als ein Fachmann für Geologie, aber selbst er wusste, dass Inseln nicht einfach so aus dem Meer auftauchten. Irgendetwas höchst Eigentümliches war hier vorgefallen. Und waren schon die Umstände, unter denen die Insel aufgetaucht war, seltsam genug, so war es das nicht allein, das Blossom irritierte. Nicht einmal annähernd. Tief in sich wusste er längst, was es war. Er war nur noch nicht so weit, es zuzugeben:
Es war die Insel selbst.
Das Eiland durchmaß etwa zwei Dutzend Yards. Seine Oberfläche bestand aus zerklüftetem Fels von einer Farbe, für die Blossom einfach keine Bezeichnung fand: irgendetwas zwischen Schwarz, Dunkelblau und einem Ton von Indigo, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Es war die Farbe der Nacht. Die Dunkelheit einer sternklaren Polarnacht, die von einer Kälte erzählte, die man regelrecht zu spüren glaubte, wenn man diesen Stein nur lange genug ansah. Die Schwärze des Felsens war so intensiv, als wäre die Insel nicht wirklich materiell; nichts, was war, sondern vielmehr ein gewaltiger Riss, der in der Wirklichkeit klaffte. Und hinter dem Etwas lauerte etwas, das beobachtete. Das wartete.
Hinaus wollte?
Dieser Eindruck wurde noch durch die Stille und die völlige Leblosigkeit unterstrichen, die diesem Ort innewohnte. Nichts rührte sich. Nichts bewegte sich. Hier, so nahe bei der Küste, wäre es eigentlich ganz normal gewesen, wenn Möwen und andere Vögel das Eiland sofort in Besitz genommen hätten. Stattdessen jedoch schien das Leben die Insel in weitem Umkreis zu meiden. Selbst das regelmäßige Dröhnen der gegen den Fels brandenden Wellen klang gedämpft, und wenn er genau hinhörte, konnte er so einen weiteren, vielleicht noch unheimlicheren Effekt wahrnehmen: Das monotone Geräusch der Wellen schien nur aus drei Richtungen zu kommen. Vor ihnen, dort, wo die Insel lag, herrschte absolute Stille.
Vielleicht, dachte Blossom, war das die Erklärung: Diese Insel lag jenseits der unsichtbaren Grenze, der sie sich genähert hatten. Der Gedanke war vollkommen lächerlich, aber er fügte sich so nahtlos an das an, was seit einer Weile hinter Blossoms Stirn vorging, dass ihm das nicht einmal zu Bewusstsein kam.
»Sir?«
Die Stimme Cliff Hasseltimes riss Blossom aus seinen Grübeleien; Gedanken überdies, die eines aufgeklärten, modern denkenden Mannes wie Blossom nicht würdig waren – und des Kapitäns eines Kriegsschiffes ihrer Majestät schon gar nicht. Unsichtbare Grenzen? Die Farbe der Nacht? Was für ein Unsinn!
Verärgert über sich selbst wandte er sich zu seinem Ersten Offizier um, der unbemerkt neben ihn getreten war und ihn abwartend musterte. Erst jetzt wurden ihm die Kälte und Schärfe des Windes richtig bewusst. Er fröstelte, löste die Hände von der Reling und rieb sie aneinander, während er ein paarmal hineinhauchte. Seine Haut prickelte, als hätte er in eine Schale mit gemahlenem Glas gegriffen, und er wurde sich des unangenehmen Gefühles bewusst, dass seine Uniform durchnässt war und in unansehnlichen Falten an seinem Körper klebte. Es war ihm nicht recht, so vor seinem Ersten Offizier zu stehen. Blossom war ein Mensch, der großen Wert auf Disziplin und ein tadelloses Äußeres legte; bei seinen Offizieren, und erst recht bei sich selbst.
»Eine verdammt seltsame Geschichte«, brummte er. »Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding lieber von hier aus dahin zurück bombardieren, woher es gekommen ist, statt auch nur einen Fuß darauf zu setzen. Möchte nur wissen, was wir da groß untersuchen sollen.«
Er straffte sich und zog seine Uniformjacke glatt; und mit dieser einfachen Geste schien ein völlig anderer Mensch aus ihm zu werden. Gerade noch ein gebeugter, von Kälte gebeutelter Mann, der von Sorgen und Zweifeln geplagt war, war Blossom eine Sekunde später wieder ganz Offizier.
Und die Veränderung war nicht nur äußerlich. Von einem Moment zum nächsten war auch sein Denken wieder von jener Logik und Präzision, die ihn zu dem gemacht hatten, was er war: vielleicht nicht einer der erfolgreichsten, aber mit Sicherheit doch einer der verlässlichsten Offiziere der Royal Navy.
»Aber Befehl ist nun einmal Befehl, nicht wahr? Sind die Männer so weit?«
»Alles bereit, Sir«, antwortete Hasseltime.
Wenn er die gleiche Nervosität empfand wie Blossom, so verbarg er es perfekt. Sein Gesicht war vollkommen ausdruckslos, und Blossom suchte selbst in seinen Augen vergeblich nach einem verräterischen Funken, einer Spur von Unsicherheit oder gar derselben substanzlosen Furcht, die ihn quälte. Blossom war nicht sicher, ob er Hasseltime wirklich mochte. Er war ein guter Mann, aber manchmal schon beinahe zu beherrscht. Die meisten Menschen glaubten, dass es einen guten Soldaten ausmachte, keine Gefühle zu haben, aber das stimmte nicht. Ein guter Offizier hatte Gefühle – er wusste nur besser damit umzugehen als ein schlechter.
Hasseltime räusperte sich. »Wir warten nur noch auf Sie, Sir.« Er zögerte einen Moment und fügte dann hinzu: »Wenn Sie mir eine Bemerkung gestatten: Es ist durchaus nicht unbedingt nötig, dass Sie uns begleiten. Ich glaube nicht, dass uns auf der Insel irgendwelche Schwierigkeiten erwarten, aber falls doch, wäre es auf jeden Fall besser, wenn Sie sich hier an Bord befänden.«
Kapitän Blossom lächelte flüchtig. Hasseltime handelte natürlich ganz und gar nach Vorschrift, indem er diesen Vorschlag machte. Was sich wie reine Freundlichkeit anhörte, entsprach der durchaus richtigen Überlegung, niemals alle höheren Offiziere eines Schiffes zugleich einer Gefahr auszusetzen.
Ein weiterer Grund, aus dem er Hasseltime nicht mochte. Er hatte einfach ein bisschen zu oft Recht. Der junge Mann hatte bereits eine glänzende Karriere hinter sich und mit großer Sicherheit einen noch steileren Aufstieg vor sich. Er stammte aus einer angesehenen und sehr wohlhabenden Familie, hatte eine hervorragende Schule besucht und die Militärakademie mit Auszeichnung absolviert. Blossom war sicher, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis Hasseltime selbst das Kommando über ein Schiff bekam; vielleicht sogar das über die THUNDERCHILD.
»Vielleicht haben Sie Recht«, entgegnete Blossom. »Trotzdem möchte ich mir die Insel selbst ansehen. Die Berichte über diese unterirdischen Stollen haben mich neugierig gemacht.«
Hasseltime sah ihn eine Sekunde lang durchdringend an, aber er war klug genug, nichts von dem auszusprechen, was ihm sichtlich durch den Kopf ging. Blossom fragte sich, ob man ihm tatsächlich so deutlich ansah, wie unheimlich ihm diese Insel war. Er hoffte, nicht. Gerade Hasseltime gegenüber wäre es ihm sehr unangenehm gewesen, Schwäche zu zeigen.
Gefolgt von Hasseltime verließ er das Oberdeck. Zwei Beiboote waren bereits zu Wasser gebracht worden, bemannt mit jeweils fünf Matrosen und fünf Marinesoldaten, einer regelrechten kleinen Armee, die angesichts dessen, was vor ihnen lag – nämlich nichts als eine menschenleere, von allem Leben verlassene Insel – geradezu lächerlich erschien. Trotzdem hatte Blossom das Gefühl, in den Krieg zu ziehen. Mit jeder Sekunde mehr.
Blossom und der Erste Offizier nahmen jeder in einem der Boote Platz. Die Matrosen begannen zu rudern, ohne dass es eines besonderen Befehles bedurft hätte. Sie näherten sich der Insel aus westlicher Richtung, obwohl sie dadurch gegen den Wind und die Strömung ankämpfen mussten und die Anstrengung den Soldaten den Schweiß auf die Gesichter trieb. Blossom gehörte normalerweise nicht zu den Offizieren, die ihre Männer grundlos schunden, aber anders wäre die Gefahr zu groß gewesen, dass sie von der Brandung gegen die Felsen geschleudert würden. Das neu entstandene Eiland war zwar nicht besonders groß, aber die Felsen ragten glatt und nahezu senkrecht aus dem Meer, an manchen Stellen mehr als fünf Fuß hoch. In der unruhigen See dort anzulegen würde zu einem lebensgefährlichen Unterfangen werden. Auf dieser Seite hingegen gab es eine flache Geröllfläche, an der sie anlegen konnten, beinahe wie ein kleiner natürlicher Hafen. Dem Soldaten in Blossom gefiel dieser Anblick nicht annähernd so gut wie dem Seemann. Ihm erschien diese Einladung vielmehr wie eine Falle, das aufgerissene Maul eines Ungeheuers, in das sie mit offenen Augen hineinmarschierten. Er spürte die Gefahr, aber er konnte sie einfach nicht sehen.
Mit jedem Yard, den sie sich dem kleinen Eiland näherten, kehrte Blossoms Unbehagen zurück, ungleich stärker noch als zuvor, und der Ausdruck auf den Gesichtern der anderen zeigte ihm, dass es ihnen kaum anders erging. Die Männer fühlten sich nicht wohl. Blossom entgingen weder ihre kleinen nervösen Gesten noch die Blicke, die sie sich insgeheim zuwarfen. Die Haltung der Männer an den Rudern wirkte angespannt, die Marinesoldaten hielten ihre Gewehre ein wenig zu fest, und Hasseltime saß so aufrecht im Heck des anderen Bootes, als hätte er einen Besenstiel verschluckt. Der Anblick hätte Blossom unter allen anderen denkbaren Umständen große Befriedigung verschafft, war es doch einer der seltenen Momente, in denen selbst Hasseltime Gefühle zeigte. Hier und jetzt aber verstärkte er seine Nervosität nur noch.
Was war das? Wie allen wirklich guten Soldaten war auch Blossom die Furcht nicht fremd, weder seine eigene noch die seiner Untergebenen. Aber das hier war etwas anderes; ein Gefühl, wie er es noch nie zuvor kennen gelernt hatte und das ihn schon allein dadurch beunruhigte. Es war, als schrien ihm die schwarzen Felsen allein durch ihre bloße Anwesenheit eine Warnung entgegen, umzudrehen, an Bord der THUNDERCHILD zurückzukehren und davonzufahren, so schnell und so weit sie nur konnten: Geht weg! Geht weg! Geht weg! GEHT WEG!
Aber natürlich tat er es nicht, und wenig später erreichten sie die kleine Felsenbucht. Der Bootsrumpf scharrte über Geröll und schwarzen Kies. Blossom stand auf und sprang als Erster an Land.
Er hatte sich verschätzt. Eisiges Wasser schwappte in seine Schuhe und ließ ihn frösteln, und das Gefühl von Unbehagen und Furcht verstärkte sich schlagartig, nun, als auch noch die körperliche Unbill hinzukam. Er unterdrückte es und hoffte zumindest, dass man ihm seine Unsicherheit nicht zu deutlich ansah, ahnte aber selbst, dass es ihm nicht gelang. Das Wasser in seinen Schuhen war so kalt, dass es wehtat.
Während die Männer die Boote ein Stück weiter den Strand hinaufzogen und damit begannen, die mitgebrachten Kisten mit Sprengstoff auszuladen, trat Blossom gemessenen Schrittes ganz aus dem Wasser heraus und sah sich dabei aufmerksam um.
Viel gab es allerdings nicht zu entdecken. Die Insel war völlig kahl und vor allem leer; und das betraf nicht nur die normalerweise unvermeidlichen Vögel, sondern jegliche Form von Leben. Nicht der winzigste Sprenkel von Moos war zu sehen, nicht eine einzige Flechte auf dem schwarzen, wie lackiert schimmernden Vulkangestein zu entdecken, nicht einmal Algen oder angeschwemmter Seetang, keine Muschelschalen, keine Krebse, Würmer oder anderes Getier – was nahezu unmöglich war, wenn diese Felseninsel tatsächlich aus dem Meer aufgestiegen sein sollte. Es geschah zwar nicht alle Tage, aber doch öfter, als allgemein angenommen wurde, dass der Ozean ein Stück des eroberten Landes wieder freigab, das er verschlungen hatte, und Blossom wusste, wie schnell das Leben normalerweise wieder Fuß fasste.
Hier nicht.
Dieser Felsen war tot.
Und vielleicht war es gerade die völlige Lebensverneinung dieses auf den ersten Blick so harmlos anmutenden Eilandes, die sein Unbehagen hervorrief. Zugleich spürte Kapitän Blossom aber auch, dass dies nicht der einzige Grund war.
Diese Insel war nicht normal. Schon die Tatsache, dass sie quasi vor den Toren Londons aus dem Meer aufgestiegen war, hätte zu einem weltweiten Aufruhr unter den Geologen und Meeresforschern geführt, hätte die englische Regierung nicht aus Gründen, die Blossom nicht verstand, beschlossen, ihre Existenz geheim zu halten.
Diese Insel barg ein Geheimnis: Die Fischer, die das Eiland vor wenigen Tagen entdeckt und als Erste betreten hatten, hatten von unterirdischen Schächten und Stollen erzählt, die erstaunlich weit in die Tiefe reichen sollten, und es war Blossoms Auftrag, zumindest einen Blick in dieses Stollensystem zu werfen, ehe sie ihren zweiten Befehl ausführten, das so jäh aufgetauchte Schifffahrtshindernis mittels einer halben Tonne Dynamit wieder vom Antlitz der Erde zu entfernen.
Ganz plötzlich hatte Kapitän Blossom einen höchst sonderbaren Gedanken, der so gar nicht zu ihm, wohl aber zu seiner momentanen Stimmung passte: Er fragte sich, ob diese Insel spürte, dass sie gekommen waren, um sie zu vernichten, und das Gefühl von Unbehagen und Furcht vielleicht tatsächlich so etwas wie eine Warnung war. Möglicherweise war jene erdachte Grenze in Wahrheit mehr als nur ein abstrakter Begriff, sondern etwas höchst Reales; die letzte Grenze, vor der sie noch Halt machen und umkehren konnten, wollten sie nicht Gefahr laufen, Mächte auf den Plan zu rufen, deren sie nicht mehr Herr wurden.
Es kostete ihn erstaunliche Mühe, den Gedanken abzuschütteln und wenigstens äußerlich wieder zu seiner gewohnten Ruhe und Selbstsicherheit zurückzufinden. Oder wenigstens äußerlich so zu tun.
Die Matrosen hatten ihre Arbeit beendet. Einer von ihnen blieb auf Blossoms Anweisung hin bei den Booten zurück, die anderen machten sich zusammen mit ihm an die Erforschung der Insel.
Blossom brauchte den Marinesoldaten nicht einmal zu befehlen, ihre Gewehre schussbereit zu halten. Sie taten das von selbst, und auch wenn sie viel zu gut gedrillt waren, um sich ihre Angst anmerken zu lassen, so wurde doch die nervöse Anspannung immer deutlicher, unter der sie standen – obwohl es nicht das geringste sichtbare Zeichen irgendeiner Gefahr gab. Aber es war wohl – zumindest im übertragenen Sinne – tatsächlich so: Sie hatten etwas wie eine Grenze überschritten, und das schwarze Vulkangestein unter ihren Stiefeln gehörte zu einem Teil der Welt, der sich ihren gewohnten Empfindungen und Maßstäben entzog. Auf dem sie nicht sein sollten.
Der Tunnel, von dem die Fischer gesprochen hatten, existierte tatsächlich. Sie brauchten nicht lange zu suchen, bis sie den Einstieg fanden: Präzise in der Mitte der kleinen Insel gähnte ein kreisrundes Loch im Boden. Nicht einmal die starken Strahlen der Karbidscheinwerfer, die Blossom hatte austeilen lassen, vermochten den Grund des Schachtes zu erreichen. Das Licht verlor sich irgendwo in nicht zu bestimmender Entfernung in einer diffusen Farbe, die eine Mischung aus grau und schwarz war und auf ihre Weise etwas ebenso Beunruhigendes hatte wie diese ganze Insel. Doch trotzdem offenbarte ihr Schein etwas, das Blossoms Besorgnis schlagartig neue Nahrung gab:
Eine Anzahl eiserner Trittstufen war in die Wand des Schachtes eingelassen. Blossom versuchte sie zu zählen, um auf diese Weise wenigstens abzuschätzen, wie weit der Lichtstrahl in die Tiefe reichte, aber seltsamerweise gelang es ihm nicht. Hätte ihm jemand erzählt, dass ihm solcherlei widerfahren sei, hätte er die Behauptung ins Reich der Fabeln und Legenden verwiesen, aber nun erlebte er es selbst: Es waren nur eine Hand voll Stufen, aber immer, wenn er bei der letzten angelangt war, hatte er vergessen, wie weit er schon gezählt hatte.
Einen Moment lang erwog er ernsthaft, Hasseltime zu fragen, ob es ihm vielleicht ebenso erging, entschied sich aber dann dagegen; nicht einmal so sehr, weil er Angst gehabt hätte, sich lächerlich zu machen. Er hatte viel mehr Angst, dass es Hasseltime ebenso erging wie ihm.
Kapitän Blossom war wirklich sehr beunruhigt. Zumindest in diesem Punkt hatte er die Schilderungen der Fischer bezweifelt oder wenigstens für übertrieben gehalten. Was sie als Trittstufen bezeichnet hatten, mochte nichts weiter als von der Hand der Natur geschaffene Risse und Unebenheiten im Gestein sein, die nur zufällig das Aussehen einer Leiter hatten. Doch jetzt sah er, dass das nicht stimmte, und diese Entdeckung erschreckte ihn fast mehr als alles andere, was ihm im Zusammenhang mit dieser Insel bereits aufgefallen war. Ihre Bedeutung war so klar, wie sie nur sein konnte: Diese Insel war vielleicht durch eine Laune der Natur entstanden, dieser Schacht jedoch nicht. Hier waren vernunftbegabte Wesen am Werk gewesen.
Seltsam nur, dass er in diesem Zusammenhang nicht unbedingt an Menschen denken musste …
»Das … das ist verrückt«, murmelte Hasseltime neben ihm. Es war eine der ganz seltenen Gelegenheiten, an die sich Blossom erinnern konnte, bei der seine Stimme nicht ruhig und überlegen klang, sondern fast einen Unterton von Hysterie hatte. Und das war auch der Grund, aus dem Blossom den Blick von dem unheimlichen Schacht löste und seinen Ersten Offizier ansah. Hasseltimes Gesicht war unbewegt, aber das nervöse Flackern in seinen Augen verriet ihn.
»Das haben Menschen gemacht«, sagte Hasseltime. »Hier muss früher schon einmal jemand gewesen sein.«
Blossom nickte. Schon diese winzige Bewegung fiel ihm schwer. Wie gebannt starrte er wieder in den Schacht hinein. Hasseltime hatte Recht. Die eisernen Stufen waren zweifellos künstlich geschaffen und mit großer Kunstfertigkeit in das Gestein getrieben worden. Das aber wiederum bedeutete, dass diese Insel mehr war als eine Ansammlung von Felsbrocken, die durch ein Seebeben (das es überdies nachweislich nie gegeben hatte!) wahllos in die Höhe gepresst worden war. Mehr noch: Diese Insel konnte unmöglich ein Teil des Meeresbodens gewesen sein; sie musste früher schon einmal an der Oberfläche gelegen haben.
Hier waren Menschen gewesen. Und das musste lange zurückliegen; Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, denn dieses Eiland war auf keiner bekannten Seekarte verzeichnet – und das, obwohl es genau vor der Themsemündung und somit auf einer der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt lag. Das war verrückt. Verrückt und eigentlich unmöglich.
Blossoms mit Furcht gemischtes Unbehagen wich allmählich einer prickelnden Erregung. Möglicherweise harrten im Inneren dieser Insel große Funde ihrer Entdeckung – bedeutende archäologische oder auch materielle Schätze, auf jeden Fall aber ein uraltes Geheimnis.
Wie in fast jedem Seemann schlummerte auch in Blossom ein Entdecker. Auf dem Weg hierher hatte er insgeheim (wenn auch beinahe, ohne es sich selbst einzugestehen) darüber nachgedacht, wie er den ersten Teil seines Befehles ignorieren und diese Insel möglichst schnell sprengen konnte, ohne auch nur einen Fuß in diese ominösen Gänge zu setzen, von denen die Fischer erzählten. Aber nun war davon keine Rede mehr. Im Gegenteil: Mit einem Mal konnte er es kaum noch erwarten, das Geheimnis dieses Eilands zu ergründen. Schlagartig war jede Furcht vergessen, ebenso wie all die düsteren und absurden Gedanken, die ihn noch vor Augenblicken so gequält hatten. Ohne es selbst zu merken, hatte er eine zweite, unsichtbare Grenze überschritten. Nun war alle Furcht vergessen. Ebenso sehr, wie ihm die Insel gerade noch Angst gemacht hatte, schlug ihn ihr Geheimnis nun in ihren Bann.
Er deutete auf zwei der Soldaten. »Ihr beide geht als Erste!«, befahl er. »Gebt uns Bescheid, sobald ihr am Grund des Schachtes angekommen seid.« Er zögerte einen winzigen Moment, ehe er in möglichst beiläufigem Ton hinzufügte: »Und zählt die Stufen. Ich will wissen, wie tief dieser Schacht ist.«
Ohne Widerspruch oder auch nur ein Zögern – allerdings auch sichtlich nicht besonders glücklich über diesen Befehl – gehorchten die beiden Soldaten. Hintereinander kletterten sie in den Schacht hinab. Blossom fiel allerdings auch auf, dass sie beide einen winzigen Moment lang zögerten, ja, regelrecht zurückschraken, als ihre Hände das rostige Metall der Trittstufen berührten. Er maß dieser Beobachtung zwar keinerlei größere Bedeutung zu, merkte sie sich jedoch aufmerksam.
Schon nach kurzer Zeit war nur noch der immer kleiner werdende Lichtpunkt der Lampe zu erkennen, die sie mitgenommen hatten. Das Licht wurde nicht sichtbar kleiner, verlor jedoch sehr schnell an Leuchtkraft und begann zu verschwimmen, wie ein gefallener Stern, der in den Tiefen des Meeres versinkt. Gerade als Blossom schon fürchtete, auch ihn aus dem Auge zu verlieren, hörte er auf zusammenzuschrumpfen und wurde stattdessen von rechts nach links und wieder zurück geschwenkt.
»Wir sind unten!« Die Stimme des Soldaten klang dumpf, vielfach gebrochen und von den Wänden des Schachtes zu einem unheimlichen Echo verzerrt, und Blossom war, als wäre dies nicht alles, was er hörte. Vielmehr schien sich im Klang dieser harmlosen Worte noch etwas zu verbergen, etwas Düsteres und Böses, das im Schatten jener täuschend harmlosen Botschaft heranschlich.
Blossom wusste, was es war.
Die Furcht war wieder da. Sie war nie wirklich fort gewesen. Seine Neugier und der Entdeckerdrang hatten sie für einen kurzen Moment überlagert, sodass er sie nicht mehr spürte, aber sie war trotzdem die ganze Zeit über da gewesen. Blossom dachte diesen Gedanken ohne Erschrecken, aber mit dem furchtbaren Gefühl, dass es nun zu spät war, noch auf die Warnung zu hören, die ihm so überdeutlich zuteil geworden war. Es war zu spät. Sie hatten die Grenze überschritten – und es war eine Grenze, die sich nur in eine Richtung passieren ließ.
»Hier rührt sich nichts. Es gibt einen Stollen, der nach Norden führt.«
»Bleibt, wo ihr seid!«, rief Blossom in den Schacht hinab. »Wir kommen nach.« Er wandte sich an Hasseltime. »Ich gehe als Nächster. Sie übernehmen das Kommando über die Gruppe, bis alle unten sind. Sollte mir etwas zustoßen oder wir in einer Stunde nicht zurück sein, entscheiden Sie nach eigenem Ermessen.«
»Aye, aye, Sir«, erwiderte der Erste Offizier. Er salutierte, aber für Blossoms Geschmack etwas zu schnell und selbst für ihn etwas zu zackig. Blossoms Befehl gefiel ihm nicht, das sah man ihm deutlich an. Aber er war natürlich viel zu diszipliniert, um ihm zu widersprechen.
Vorsichtig ließ sich Blossom über die Kante des Schachtes gleiten, bis er mit den Füßen eine der eisernen Stufen erreichte, und begann mit dem Abstieg. Als seine Hand die erste Trittstufe berührte, zuckte er zurück, ebenso wie die beiden Soldaten zuvor, und nun wusste er auch, warum. Es war ein unheimliches, nicht in Worte zu fassendes Gefühl: Es war, als berühre er etwas Düsteres, Verbotenes, etwas, das ihm Geschichten aus uralten vergessenen Zeiten erzählte, Geschichten aus unaussprechlichen Zeiten und von unbeschreibbaren Dingen; schwarzen Scheußlichkeiten, die sich am Rande eines dunklen Ozeanes suhlten, während am Himmel über ihnen ein gestaltloses Chaos wimmelte. Der Eindruck war so heftig, dass er für einen winzigen Moment all diese Grauen erregenden Dinge tatsächlich zu sehen glaubte, obwohl ihm ihr Anblick, hätte er ihn tatsächlich erlebt, zweifellos auf der Stelle den Verstand geraubt, wenn ihn nicht gleich getötet hätte. Doch allein die bloße Ahnung dessen, was diese Bilder wirklich bedeuten konnten, war schon beinahe mehr, als Blossom verkraften konnte. Zitternd verhielt er mit der Hand auf der obersten Trittstufe, presste die Kiefer aufeinander und versuchte gleichzeitig ein Stöhnen zu unterdrücken und des Chaos Herr zu werden, das hinter seiner Stirn tobte. Keines von beidem gelang ihm wirklich.
Diesmal war es Hasseltime, der ihn rettete. Er beugte sich vor, sah mit gerunzelter Stirn auf Blossom herab und fragte: »Alles in Ordnung, Sir?«
Blossom nickte. Wenigstens versuchte er es, war aber nicht sicher, ob die Bewegung auch zu sehen war. Trotzdem war er fast sicher, dass Hasseltimes Stimme ihm in diesem Moment das Leben rettete, denn sie war ein Teil seiner Welt, etwas Vertrautes und Gewohntes, dessen Dasein die apokalyptischen Bilder zerbrach, die in seinem Kopf waren, und mit ihnen den schwarzen Strudel, in dem Blossoms Bewusstsein zu versinken gedroht hatte.
»Ja«, antwortete er gepresst. »Es ist … alles in Ordnung.«
Hasseltimes Gesichtsausdruck verriet überdeutlich, was er von dieser Antwort hielt. Aber er beherrschte sich auch jetzt meisterhaft. Mit einem nur angedeuteten Nicken trat er vom Rand des Schachtes zurück, und Blossom löste seine Hand von der eisernen Sprosse und setzte seinen Weg in die Tiefe fort.
Die Karbidlampe hatte er sich ebenso wie das Gewehr umgehängt, um die Hände frei zu haben. Während er kletterte, vermied er es fast krampfhaft, in die Tiefe zu blicken, obwohl unter ihm nichts weiter als Schwärze war. Die Sprossen hatten aufgehört, ihm düstere Geschichten aus gottlosen Zeiten zu erzählen, aber nun quälte ihn eine andere, fast ebenso schlimme Furcht – der Schacht musste gute hundertfünfzig, vielleicht sogar zweihundert oder mehr Fuß tief sein, und obwohl Blossom nicht an Höhenangst litt, machte ihn allein die Vorstellung des gähnenden Abgrundes, der unter ihm klaffte, nervös.
Und als sei dies allein nicht genug, begann ihm seine Fantasie einen weiteren bösen Streich zu spielen – er war plötzlich fest davon überzeugt, dass die Jahrhunderte, die diese Insel unter Wasser gelegen haben musste, ausgereicht hatten, um die eisernen Trittstufen zu zermürben. Zweifellos würde schon die nächste unter seinem Gewicht zerbrechen, sodass sein Abenteuer mit einem Sturz auf den tödlichen Lavaboden tief unter ihm enden würde. Falls dieser Schacht überhaupt einen Grund besaß und nicht endlos weiter und weiter in die Tiefe führte, hinab bis ins Herz der Erde und noch tiefer.
Das genaue Gegenteil war der Fall. Die eisernen Krampen waren sogar erstaunlich gut erhalten. Obwohl sie älter sein mussten als seine gesamte Mannschaft zusammengerechnet, zeigten sie nicht die winzigsten Abnutzungserscheinungen. Das Metall war ebenso schwarz wie das Gestein, und es glänzte wie am ersten Tag. Nicht der leiseste Hauch von Rost hatte sich darauf festgesetzt, und auch im Inneren der Insel hatten weder Algen noch Muscheln oder irgendwelches andere Leben Einzug gehalten. Die Luft roch muffig, aber in keiner Weise feucht. Nichts von alledem war irgendwie logisch oder auch nur möglich, aber Blossom war mittlerweile ohnehin davon überzeugt, dass sie die wirkliche Welt längst verlassen und einen Bereich des Universums betreten hatten, in dem menschliche Begriffe ebenso wenig galten wie ein menschliches Leben. Mehr noch: in dem es nicht nur vollkommen bedeutungslos, sondern falsch war. Sie sollten nicht nur nicht hier sein, sie durften es nicht.
Um seiner steigenden Nervosität Herr zu werden, konzentrierte sich Blossom ganz auf dieses eine, neuerliche Rätsel, während er Hand über Hand in die Tiefe stieg. Es gab nur eine einzige logische Erklärung: Hier drinnen war kein Wasser gewesen. Der Schacht musste verschlossen gewesen sein, möglicherweise durch eine Felsplatte oder einen großen Stein über seinem Eingang, der erst nach dem Auftauchen der Insel seinen Halt verloren hatte. Das würde auch erklären, warum dieser Schacht samt des sich daran anschließenden Stollensystems nicht voll Wasser gelaufen war, obwohl sich beides tief unter dem Meeresspiegel befunden hatte. Obwohl Blossom tief in sich wusste, dass diese Erklärung falsch war, klammerte er sich mit all seiner Kraft daran. Es musste so gewesen sein: Vermutlich gab es nur diesen einen Einstieg, der irgendwann einmal, als dieser Felsen vielleicht Teil einer größeren Insel gewesen war, den höchsten Punkt dargestellt hatte, den Gipfel eines Berges, der zu dieser Insel geworden war, als er im Meer versank. Die Erklärung klang logisch. Sie hätte Blossom beruhigen müssen, aber sie tat es nicht. Irgendetwas sagte ihm, dass die Lösung dieses Rätsels ganz und gar nicht so einfach war. Hand über Hand kletterte er weiter, der Tiefe und der Dunkelheit entgegen, und dem, was darin verborgen auf ihn wartete.
12. Oktober 1892
Also war ich endlich zurück. Zurück von den Toten, zurück aus der Zeit jenseits der Unendlichkeit und zurück aus meiner ganz privaten kleinen Hölle, in der mich ein Vorgeschmack dessen erwartet hatte, was die Theologen unter dem Begriff ewige Verdammnis verstehen mochten. Die Psychologen hatten vermutlich ein anderes Wort dafür und die Philosophen wieder ein anderes, das zweifellos noch freundlicher klang.
Ich hatte zu keiner der drei Fraktionen ein besonders inniges Verhältnis, und trotzdem hatte ich mich in den vergangenen Tagen mehr als einmal mit dem Gedanken getragen, den Vertreter einer dieser Zünfte aufzusuchen; je nach Stimmung und momentanem Befinden mal den einen, mal den anderen.
Vielleicht, weil ich ihnen allen etwas voraushatte: Ich war dort gewesen, an jenem Ort, von dem die Priester behaupteten, er wäre die Strafe für ein sündiges Leben, die Gehirnklempner glaubten, er wäre nichts als ein Teil von uns, die Gerümpelkammer des Ich sozusagen, in der alle unguten Erinnerungen, alle Schrecken und Ängste in einem wirren Haufen übereinandergeworfen dalagen und darauf warteten, in einem unbedachten Moment die Tür zu sprengen und über das Hier und Jetzt herzufallen, und die Philosophen, dass es sich nur um einen abstrakten Begriff handelte. Ein Symbol in einer Welt von Symbolen, die immer genau das bedeuteten, was man in ihnen sehen wollte, und letztendlich also keine Gefahr darstellte, man also auch jenen imaginären Ort namens Hölle auch nicht zu fürchten brauchte.
Wie gesagt, vom Standpunkt der Philosophen aus, die von all diesen drei zuvor bezeichneten Berufsgruppen vielleicht die Schlimmsten waren – obwohl sie zweifellos die waren, die aus den uneigennützigsten Motiven heraus handelten, waren sie doch weder hinter unserer Seele noch hinter unserem Geld her, sondern glaubten den Unsinn tatsächlich, den sie ihren Zuhörern auftischten; übrigens zumeist unter vollkommener Missachtung des Umstandes, ob sie es nun hören wollten oder nicht.
Ich jedoch war dort gewesen, an jenem schlimmsten aller Orte, und obwohl ich ihn durch eine Verkettung schier unglaublicher Umstände, Zufälle und schierer Wunder lebend und sogar bei halbwegs klarem Verstand wieder verlassen hatte, spürte ich nichts von der Erleichterung, die sich bei diesem Gedanken eigentlich einstellen sollte.
Im Gegenteil. Wenn die seelischen Wunden, die ich davongetragen hatte, überhaupt jemals verheilen würden, dann würde es Zeit brauchen, viel Zeit. Mehr Zeit jedenfalls als die nur knapp vier Tage, in denen ich erst wieder versuchte, mir erneut so etwas wie ein geordnetes Leben aufzubauen.
Die Stimme des Kutschers riss mich aus meinen Gedanken. Ich schrak hoch und blickte ihn verwirrt an. »Wie bitte?«
»Da wären wir … Sir«, wiederholte der Fahrer der Mietdroschke und warf mir einen schrägen Blick zu, an dem auch das fulminante Trinkgeld nichts änderte, das ich ihm zusätzlich zu dem vereinbarten Fahrpreis ausgehändigt hatte; in weiser Voraussicht und eingedenk meiner Kenntnis der Psyche von Mietdroschkenfahrern – die übrigens zu allen Zeiten und an allen Punkten der Welt gleich ist – im Voraus.
»Und Sie sind sicher, dass es sich wirklich um die richtige Adresse handelt?«
»Vollkommen«, versicherte ich ihm, während ich aus dem Wagen stieg und mich suchend in beiden Richtungen des Trottoirs umsah. Ich spürte die bohrenden Blicke des Fahrers mit fast körperlicher Intensität, bemühte mich aber nach Kräften, sie zu ignorieren. H. P. war noch nicht da und das war einigermaßen seltsam. Neben einigen anderen hervorstechenden Eigenschaften war mein Freund und Mentor Howard Phillips Lovecraft nämlich einer der pünktlichsten Menschen, denen ich jemals begegnet war. Seine fast manische Besessenheit, immer und überall und unter allen nur vorstellbaren Umständen pünktlich zu sein, hatte in der Vergangenheit oft Anlass zu gutmütigen Frotzeleien gegeben. Nun war er nicht da. Und das war wirklich sehr ungewöhnlich.
»Soll ich auf Sie warten, Sir?«, erkundigte sich der Kutscher, mit einer Stimme, die lautlos, aber auch unüberhörbar hinzufügte: Wenn du noch ein kräftiges Trinkgeld drauflegst, du eitler Geck.
»Danke, nicht nötig.« Ich wartete ab, bis der Mann die Peitsche knallen ließ und die Kutsche anruckte, dann wandte ich mich endgültig dem Haus zu.
Genauer gesagt dem, was einmal ein Haus gewesen war.
Seit Andara-House in einer Februarnacht des Jahres achtzehnhundertsiebenundachtzig bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, war Ashton Place Nummer 9 nicht viel mehr als ein gewaltiger, von einem Zaun umgebener Schutthaufen gewesen; nach einhelliger Meinung der Nachbarn überdies ein Schandfleck in dieser Wohngegend, die immerhin zu den vornehmsten und teuersten Londons zählte. So war es kein Wunder, dass man dem Beginn der Aufräum- und Bauarbeiten mit allgemeiner Erleichterung und Freude entgegensah, aber auch einer gehörigen Portion Misstrauen gegen den vermeintlich neuen Besitzer, die zugegebenermaßen aus schlechter Erfahrung geboren war. Schlechter Erfahrung mit dem Vorbesitzer des Anwesens.
Nun, dieser neue Besitzer war ich, und ich hatte mir fest vorgenommen, meine neuen (und übrigens auch alten, aber davon würden sie ganz bestimmt nichts erfahren) Nachbarn zumindest in ihrem Misstrauen allem gegenüber, was den Namen Craven trug, gründlich zu enttäuschen.
Schon um mich von meinen Grübeleien abzulenken, hatte ich in den vergangenen Tagen mit einer Goodwill-Tour rings um den Ashton Place begonnen und war bei jeder einzelnen Familie vorstellig geworden, um mich sozusagen prophylaktisch für die Aufregungen und den unvermeidlichen Lärm zu entschuldigen, die beim Wiederaufbau von Andara-House entstehen mussten, und natürlich waren alle viel zu höflich gewesen, ihre Bedenken laut auszusprechen; immerhin waren wir nicht nur in England, sondern noch dazu in London, der Stadt, in der die feine englische Art erfunden worden war und in der selbst die Verbrecher Gentlemen waren. Wenigstens einige.
Trotzdem hatte ich natürlich gespürt, was man tatsächlich von meinen Versprechungen hielt. Ich konnte es den guten Leuten nicht einmal wirklich verübeln. Sie hatten zu viele schlechte Erfahrungen mit dem Mann gemacht, als dessen verschollen geglaubter Zwillingsbruder gleichen Namens ich mich ausgab. Meine ursprüngliche Idee, mich nach meinem Vater Roderick zu nennen, hatte ich wieder verworfen. Der Name Robert war mir einfach zu vertraut; wahrscheinlich würde ich noch über Jahre hinweg unbewusst reagieren, wenn mich jemand so rief, und meine Tarnung damit riskieren.
Ich erinnerte mich gut der diversen Gespräche, die ich mit den guten Leuten geführt hatte. Natürlich waren sie viel zu höflich und viel zu reserviert gewesen, um mir ins Gesicht zu sagen, welche Gefühle allein der Klang des Namens Craven bei ihnen hervorrief, aber ich hätte schon blind und taub sein müssen, um ihre Reaktion nicht zu bemerken: den hörbar kühler werdenden Ton, das Hochziehen der Augenbraue, die plötzlich etwas zu reservierte Höflichkeit, die verstohlenen Blicke, mit denen man mich musterte und in denen man ganz deutlich die Besorgnis las, ob meine unübersehbare Ähnlichkeit mit meinem verstorbenen Zwillingsbruder sich vielleicht nicht nur auf Äußerlichkeiten beschränkte.
Natürlich will ich keinem der guten Leute unterstellen, dass sie tatsächlich froh über meinen Tod gewesen waren. Aber ich hatte doch in all diesen Gesprächen eine gewisse Erleichterung nicht überhören können, die der bloßen Tatsache galt, dass Robert Craven, der Hexer, nicht mehr da war. Und die bange Sorge, ob mit seinem Zwillingsbruder vielleicht noch mehr an den Ashton Place zurückkehren mochte als nur der Name Craven.
Während ich langsam die Treppe zu der aus den Angeln gerissenen Tür von Andara-House hinaufging, fragte ich mich, wie viele Anwohner des Ashton Place mir die Geschichte des angeblichen Zwillingsbruders Robert Craven II. aus Amerika wohl geglaubt hatten. Wahrscheinlich nicht alle. Vielleicht nicht einmal besonders viele, und möglicherweise gar keiner. Sicher, mein Gesicht hatte sich ein wenig verändert in den Jahren, in denen ich in jenem zeitlosen Land zwischen der Welt der Toten und der der Lebenden geweilt hatte, und auch die zahlreichen Operationen, die Viktor Frankenstein hatte vornehmen müssen, um die Wunden zu heilen, die das Feuer meinem Körper zugefügt hatte, hatten ihre Spuren darin hinterlassen. Aber ich hatte immerhin jahrelang in der unmittelbaren Nachbarschaft dieser Menschen gelebt. Zumindest würde der eine oder andere seine Zweifel haben, ob ich tatsächlich der war, für den ich mich ausgab, und nicht doch der, der ich war …
Ehe ich meine Gehirnwindungen vollends verknotete, schob ich den Gedanken von mir und konzentrierte mich lieber darauf, mir meine Umgebung genauer anzusehen.
Fast bedauerte ich, es getan zu haben.
Es war nicht das erste Mal in den letzten Tagen, dass ich die Ruine von Andara-House betrat, aber der Anblick erfüllte mich jedes Mal mit der gleichen Mischung aus Trauer, Schrecken und einer schwelenden Wut.
Trauer beim Anblick der Zerstörung, denn das, was hier in Trümmern lag, war weit mehr als ein Haus. Es war mein Heim gewesen, über viele Jahre hinweg, der sichere Hafen, in den ich nach allen Abenteuern und Fährnissen immer wieder zurückkehren und neue Kräfte schöpfen konnte. Es war beinahe so etwas wie ein Freund geworden; viel mehr als eine bloße Anhäufung von Steinen, Holz und anderen Baumaterialien; und wenn ich es jetzt betrachtete, hatte ich eher das Gefühl, den Leichnam eines lieben alten Freundes zu sehen, als die Ruine eines ausgebrannten Hauses.
Aber das Bild beinhaltete auch Schrecken, denn dies war der Ort, an dem ich gestorben war. Nicht nur beinahe. Nicht nur – wie schon so oft – in eine lebensgefährliche Situation geraten, sondern ganz konkret und real gestorben, und wie hätte ich dieses fürchterliche Erlebnis jemals vergessen können?
Und schließlich Wut, einen unstillbaren, tief in meine Seele hineingebrannten Zorn, den ich niemals ganz würde vergessen können.
Zorn auf die Wesen, die mir all dies angetan hatten, die mein Leben zerstört hatten, das meiner Freunde, die die getötet hatten, die ich auf der ganzen Welt am meisten liebte, und die mich letzten Endes dazu gezwungen hatten, meinen eigenen Sohn zu töten.
Aber all das war Vergangenheit. Die GROSSEN ALTEN waren besiegt. Vielleicht nicht für immer geschlagen, denn ich bezweifelte, dass Wesen von solch unvorstellbarer Macht überhaupt vollkommen zerstört werden konnten, aber sie hatten doch eine empfindliche Niederlage erlitten, und selbst ein Koloss wie Cthulhu würde eine Weile brauchen, um seine Wunden zu lecken. Irgendwann, dessen war ich mir schmerzlich bewusst, würde er wieder auferstehen und der Schrecken, den er und all die anderen namenlosen Scheußlichkeiten in seinem Gefolge verbreiteten, vielleicht von neuem beginnen. Die Gefahr war gebannt, aber keineswegs besiegt.
Doch bis dahin würde Zeit vergehen, vielleicht Jahrtausende, möglicherweise noch viel, viel mehr. Das letzte Mal, dass die finsteren Gottheiten von den Sternen in den Abgrund des Vergessens hinabgestoßen worden waren, vergingen zweihundert Millionen Jahre, ehe es ihnen gelang, ihre hässlichen Häupter wieder über seinen Rand zu erheben. Natürlich maßte ich mir nicht an, die GROSSEN ALTEN mit der gleichen Macht getroffen zu haben, wie es damals die ÄLTEREN GÖTTER getan hatten, in einer Zeit, lange bevor es Menschen auf der Erde gab. Doch auch die Hiebe, die wir den GROSSEN ALTEN versetzt hatten, waren sehr schmerzhaft gewesen; sie würden Zeit brauchen, um sich davon zu erholen, und sie waren Geschöpfe, die in anderen Dimensionen dachten als wir. Möglicherweise waren die Spuren der menschlichen Rasse längst im Sand der Zeit verweht, wenn dieser Moment gekommen war, möglicherweise, mit nur einem ganz kleinen bisschen Glück, war die Menschheit aber das nächste Mal auch einfach nur besser auf ihr Kommen vorbereitet; ja, vielleicht sogar in der Lage, der Bedrohung Herr zu werden.
Für mich jedenfalls spielte nichts von alledem mehr eine Rolle. Meine Lebenszeit war begrenzt, wie die aller Menschen, und auch wenn ich gerade ein zweites Leben geschenkt bekommen hatte, so würde es doch irgendwann auf natürliche Weise enden, nach einer Spanne, die für die schlafenden Dämonen in ihren Kerkern wenig mehr als ein Atemzug war. Das Thema GROSSE ALTE war für mich erledigt, so oder so. Viktor Frankenstein hatte mich von den Toten zurückgeholt und mir nicht nur ein neues Gesicht, sondern ein neues Leben und damit auch eine zweite Chance geschenkt. Und was Andara-House anging: Ich würde es wieder aufbauen; größer, schöner und prachtvoller, als es jemals gewesen war.
Jedenfalls war es das, was ich damals dachte. Aber da kannte ich Storm noch nicht …
»Robert!«
Der Klang einer wohl bekannten Stimme riss mich aus meinen Grübeleien. Ich sah hoch und erblickte Howard, der mit ausgebreiteten Armen und einem strahlenden Lächeln im Gesicht auf mich zugeeilt kam, als hätten wir uns seit Jahren nicht mehr gesehen, statt gerade einmal vierundzwanzig Stunden. In seiner Begleitung befanden sich drei höchst sonderbar anmutende Gestalten: Die erste war klein, untersetzt, ohne dabei dick oder gar fett zu wirken, und hätte in ihrem maßgeschneiderten Anzug, dem grauen Haar und mit den perfekt manikürten Fingernägeln durchaus wie ein Bankier oder ein Vertrauen einflößender Kaufmann gewirkt, wären nicht der verschlagene Gesichtsausdruck und der Blick kleiner gieriger Augen gewesen, die in ununterbrochener Bewegung zu sein schienen und jede Kleinigkeit begutachteten, abschätzten, taxierten und in Gedanken mit einem Preisschild versahen.
Der zweite Mann war größer, um etliche Jahre jünger, hätte aber ansonsten eine – wenn auch billigere – Kopie des Älteren sein können. Der Dritte im Bunde schließlich war ein dunkelhaariger Mann Anfang der vierzig, der zwar ebenso elegant gekleidet war wie seine beiden Begleiter, trotzdem aber irgendwie nicht zu ihnen passen wollte.
Howard begrüßte mich stürmisch, und obwohl ich die übertriebene Zurschaustellung von Gefühlen in aller Öffentlichkeit normalerweise verabscheue, ließ ich es klaglos über mich ergehen, wenngleich ich mir insgeheim vornahm, bei passender Gelegenheit mit ihm darüber zu reden. Ich hätte ja durchaus Verständnis dafür gehabt, dass er mich wie einen totgeglaubten lieben Verwandten begrüßte – aber musste er es denn jedes Mal tun, wenn wir uns begegneten?
»Robert!«, sagte er erneut, nachdem er endlich aufgehört hatte, mich abwechselnd an sich zu pressen und mir auf Schultern und Rücken zu schlagen, dass ich glaubte, meine Rippen knacken zu hören. Zu allem Überfluss schwelte in seinem Mundwinkel natürlich die unvermeidliche Zigarre, deren Qualm mir die Tränen in die Augen trieb. Ich hoffte nur, Howard hielt dies nicht für ein Zeichen meiner Rührung, was ihn zweifellos zu einer Fortsetzung seiner stürmischen Zuneigungsbekundungen veranlasst hätte.
Gottlob tat er das nicht, sondern trat im Gegenteil einen Schritt zurück und deutete auf seine drei Begleiter. »Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass wir schon einmal mit der … äh … Besichtigung angefangen haben. Das sind die Herren Storm, Lickus und –« Er zögerte einen Moment und sah den Dritten im Bunde an. »- wie war noch gleich …?«
»William«, antwortete der Mann. »Aber Will reicht. Jeder nennt mich Will.«
»Will, okay.« Es war Howard sichtlich peinlich, den Namen seines Gesprächspartners vergessen zu haben. Er versuchte die Situation zu retten, indem er einen gewaltigen Zug aus seiner Zigarre nahm und mit beiden Händen hektisch in der Luft herumzufuchteln begann, um die Qualmwolke auseinanderzutreiben, die ihm aus Nase, Mund und Ohren zugleich zu quellen schienen. Sein Anblick erinnerte mich an einen gutmütigen alten Drachen, der im Laufe der Jahrhunderte vergessen hatte, wie er mit seinem eigenen Feuer umgehen musste. Einen überdies ziemlich nervösen alten Drachen. Ich trat instinktiv einen Schritt zur Seite, um nicht versengt zu werden, sollte er versehentlich eine Stichflamme ausspucken.
»Die Herren haben sich bereits einen ersten Überblick verschafft, und ich denke, was sie dir zu sagen haben, wird dich ein wenig aufheitern«, erklärte er fröhlich. »Es gibt gute Neuigkeiten.«
Das Trio Infernal nickte wie ein Mann. »Das kriegen wir schon hin«, sagte Storm und rieb sich die Hände. Daumen und Zeigefinger beider Hände bewegten sich dabei, als zähle er Geld.
»Zu einem Preis, bei dem Sie Augen machen werden«, fügte Lickus grinsend hinzu, und Will schloss: »Das geht ganz schnell. Und macht kaum Dreck.«
Eine dieser drei Aussagen kam mir nicht sehr überzeugend vor, aber ich kam nicht dazu, darüber nachzudenken, welche, denn nunmehr ergriff Storm wieder das Wort.
»Ich kann Sie nur dazu beglückwünschen, sich für die Firma STORM DEVASTATIONS entschieden zu haben, Mister Craven. Ich versichere Ihnen, dass Sie nicht enttäuscht sein werden. Wir werden Ihr Heim binnen kurzem in einen Zustand versetzen, in dem Sie es selbst kaum wiedererkennen werden.«
»Zu einem Preis, bei dem Sie Augen machen werden«, versprach Lickus erneut, und Will fügte hinzu: »Und es geht ganz schnell. Und macht kaum Dreck.«
»Einen Moment«, wandte ich ein. »Ich habe mich ja noch gar nicht –«
»Aber die Details können wir doch später noch besprechen«, unterbrach mich Storm. Er kam näher, ergriff mich beim Arm und senkte die Stimme zu einem jovialen Flüstern. »Lassen Sie uns nur machen, mein Junge. Sie sind bei uns in den besten Händen. Glauben Sie mir, wir wollen nur Ihr Bestes.«
»Mein Geld?«, fragte ich.
Storm starrte mich eine Sekunde mit einem Blick an, als hätte ich ihn auf frischer Tat mit der Hand in der Portokasse erwischt, dann rang er sich zu einem – allerdings reichlich verkrampften – Lächeln durch. »Sicher, auch das«, sagte er.
»Sie werden Augen machen«, fügte Lickus hinzu, und Will beeilte sich zu versichern: »Das geht ganz schnell. Und macht kaum Dreck.«
Ich verdrehte – zumindest innerlich – die Augen und sah mich Beistand heischend nach Howard um, konnte aber außer einer gewaltigen Qualmwolke, die sich allmählich über das gesamte Gelände zu verteilen begann, keine Spur mehr von ihm entdecken. Offensichtlich war er schlauer als ich gewesen und hatte sich aus dem Staub gemacht, ehe das Trio Infernal zur Höchstleistung auflaufen konnte. Allmählich begann sich in mir das ungute Gefühl breitzumachen, dass Howard mir vielleicht das eine oder andere über die drei verschwiegen hatte.
»Was die Einzelheiten angeht, meine Herren –«, begann ich, wurde aber sofort von Storm unterbrochen:
»Machen Sie sich da mal keine Sorgen, Mister Craven. Wir werden alles in Ruhe durchrechnen und Ihnen ein Angebot machen, dem Sie nicht widerstehen können.«
»Sie werden Augen machen«, fügte Lickus hinzu.
Ich wartete eine Sekunde vergebens, dann drehte ich mich zu Will herum und sah ihn an. Er fuhr sichtbar zusammen und beeilte sich hinzuzufügen: »Das geht ganz schnell. Und macht kaum Dreck.«
»Sie werden diese Ruine nicht wiedererkennen, Mister Craven«, versicherte Storm.
»Aber ich will sie wiedererkennen«, belehrte ich ihn. »Sehen Sie, Mister Storm, bis auf ein paar gezielte Änderungen geht es mir ja gerade darum, das Haus möglichst in seinem Urzustand wiederherzustellen.«
»Ja, wissen Sie denn überhaupt, wie es ausgesehen hat?«, erkundigte sich Lickus. Er klang ein bisschen alarmiert.
Und ob ich das wusste. Immerhin hatte ich jahrelang in diesem Haus gelebt. Leider konnte ich das nicht laut sagen, und so suchte ich Zuflucht in einer Notlüge. »Mein Bruder hat regelrecht von diesem Haus geschwärmt«, antwortete ich. »Ich kenne es aus seinen Briefen. Fast so gut, als wäre es mein Haus gewesen.«
»Gibt es irgendwelche … äh … Bilder?«, erkundigte sich Lickus. »Zeichnungen oder gar Blaupausen?« Das letzte Wort sprach er aus, als wäre es etwas Obszönes.
»Ich fürchte nein«, antwortete ich. »Das ist wohl alles dem Brand zum Opfer gefallen.«
Lickus atmete sichtbar auf, und Storm erklärte mit einem fettigen Grinsen: »In diesem Fall erweist es sich ja als doppelt glücklicher Umstand, dass Sie sich an die Firma STORM DEVASTATIONS gewandt haben, Mister Craven.«
»So?«, fragte ich. Irgendwo hinter Storm und den beiden anderen bewegte sich etwas. Nicht zwischen den Trümmern. Zwischen den Schatten.
»Wie es der Zufall will«, erklärte Storm und begann so heftig zu nicken, dass ich es fast mit der Angst zu tun bekam, sein Kopf könnte abbrechen, »war ich mit Ihrem verblichenen Herrn Bruder gut bekannt.«
»So?«, fragte ich noch einmal. »Das ist seltsam. Er hat Sie in seinen Briefen nie erwähnt.« Es fiel mir schwer, mich auf Storm zu konzentrieren. Das Wogen und Beben hinter ihm wurde deutlicher. Ich konnte nicht wirklich Einzelheiten erkennen, aber da war etwas. Oder nein, das stimmte nicht … irgendetwas wollte werden.
»Nun, wir waren nicht eng befreundet, wenn Sie das meinen«, sagte Storm, hastig und mit einem leisen, nervösen Lachen. »Aber ich kann doch behaupten, dass ich oft genug in diesem prachtvollen Haus zu Gast war, um es zu kennen.«
Ich fragte mich, welches Gesicht der Bursche wohl gemacht hätte, hätte ich ihm gesagt, dass mein »verstorbener Herr Bruder« niemand anderer als ich selbst war und dass ich ihn vor dem heutigen Tage noch nie gesehen hatte. Leider konnte ich das nicht. Und ich war auch nicht in der Stimmung dazu. Diese unheimliche Nicht-Bewegung hinter Storm und den beiden anderen wurde immer deutlicher. Ich war jetzt vollkommen sicher, dass dort irgendetwas war.
»Ich will nicht behaupten, das Haus in allen Einzelheiten zu kennen«, fuhr Storm fort und begann anzüglich zu kichern. »Es gibt immer den einen oder anderen verschwiegenen Ort, den man selbst guten Freunden nicht so ohne weiteres zeigt, Sie verstehen?«
»Sicher«, murmelte ich und starrte die Schatten an. Ich spürte selbst, wie mir der Schweiß ausbrach. Es war vorbei. Die GROSSEN ALTEN und ihre diversen Apologeten waren besiegt, vielleicht nicht für alle, aber doch für sehr, sehr lange Zeit. Ich hatte meinen eigenen Sohn geopfert, um Cthulhu und die anderen schwarzen Götter daran zu hindern, die Erde zu übernehmen und ihre Bewohner zu versklaven! Was ich sah, konnte einfach nicht sein! Es durfte einfach nicht sein!
»Jedenfalls versichere ich Ihnen, dass wir Ihren Wünschen nach einer möglichst originalgetreuen Restauration nachkommen können«, fuhr Storm fort. »Technische Änderungen natürlich vorbehalten.«
Die Schatten verdichteten sich, bekamen Substanz und Materie, und plötzlich starrten mich schmale geschlitzte Augen an. Nadelspitze Fänge blitzten, und ich hörte ein tiefes, drohendes Knurren. Ich spürte selbst, wie alle Farbe aus meinem Gesicht wich.
»Selbstverständlich nur, wenn es sich als unumgänglich erweisen sollte«, sagte Storm hastig. Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hörten auf, imaginäres Geld zu zählen.
Das Knurren wurde lauter, und dann schoss eine beigebraune, langhaarige Katze zwischen Storm und Lickus hindurch und verschwand auf der anderen Seite des Platzes. Eine Katze. Nichts als eine ganz normale Katze. Ich atmete hörbar erleichtert auf. Vielleicht wurde es wirklich Zeit, dass ich ein wenig zur Ruhe kam. Und vor allem auf andere Gedanken.
»Sehen Sie, Mister Craven, ich wusste doch, dass wir uns einig werden«, sagte Storm. »Ich sehe schon, dies wird der Beginn einer langen, intensiven Geschäftsfreundschaft.«
Gottlob kam in diesem Moment Howard zurück.
Ich eilte ihm mit weit ausgreifenden Schritten entgegen und unterbrach Storms Redefluss, ohne mich auch nur zu ihm herumzudrehen: »Ich erwarte dann Ihr schriftliches Angebot, meine Herren. Meine momentane Adresse ist Ihnen ja bekannt.«
»Schriftlich?«, murmelte Lickus. Er klang ein bisschen erschrocken.
»Etwa auch … verbindlich?«, fügte Will hinzu. Er hörte sich an, als stünde er am Rande der Panik.
»Schriftlich und verbindlich«, bestätigte ich, noch immer, ohne mich zu den dreien herumzudrehen. Und weil es mir gerade passend erschien, fügte ich noch hinzu: »Das geht doch bestimmt ganz schnell, oder? Und macht überhaupt keinen Dreck.«
»Ihr Vertrauen wird nicht enttäuscht werden, Mister Craven«, versicherte mir Storm. Sogar seine Stimme klang ölig. »Das Angebot geht noch heute raus.«
»Sie werden Augen machen«, fügte Lickus hinzu.
Howard blickte zuerst die drei Berufschaoten und dann mich verstört an, aber er war diplomatisch genug, wenigstens zu warten, bis sie gegangen waren, ehe er fragte: »Was hast du denn mit denen gemacht?« Bei jeder einzelnen Silbe blies er mir eine übel riechende Qualmwolke ins Gesicht.
Ich hustete demonstrativ, ehe ich antwortete: »Erzähl mir lieber, wo du diese Gestalten aufgetrieben hast«, seufzte ich. »Nebenbei – hast du hier irgendwo eine Katze gesehen?«
»Sie wurden mir empfohlen«, antwortete Howard.
»So? Von wem? Nero?«
Howard verzog die Lippen zu einem flüchtigen Lächeln und zündete sich eine neue Zigarre an, obwohl er die alte noch gar nicht ganz aufgeraucht hatte. »Meine Zeit ist leider ein wenig knapp bemessen«, sagte er paffend. »Wenn du willst, nehme ich dich mit zurück ins Hotel.« Meine eigentliche Frage überging er diskret.
Ich nahm das Angebot dankend an. In einer Gegend wie dieser eine Mietdroschke zu bekommen war gar nicht so einfach – wer hier lebte, verfügte in der Regel über ein eigenes Fuhrwerk samt Kutscher. Und mir stand der Sinn im Augenblick nicht nach einem längeren Fußmarsch.
»Da ist sie«, sagte Howard, als wir das Haus verließen.
Ich sah ihn verwirrt an.
»Du hast mich gerade gefragt, ob ich irgendwo eine Katze gesehen habe«, erklärte Howard. »Da ist sie.«
Tatsächlich saß auf der untersten Stufe eine Katze. Es war zweifellos die gleiche, die zuvor schon an mir vorbeigeschossen war, doch jetzt fand ich zum ersten Mal Gelegenheit, sie genauer zu betrachten. Ich habe Katzen immer gemocht, zu meinem großen Bedauern jedoch niemals ein Leben geführt, das es mir ermöglicht hätte, ein solches Tier zu halten, denn auch eine Katze mit ihrem sprichwörtlichen Sinn für Selbstständigkeit reklamiert doch ein Mindestmaß an Zuwendung und Zeit, die jemand, der ein so unstetes Leben wie ich führt, einfach nicht aufbringen kann, sodass mir allein mein Verantwortungsgefühl stets verbot, einen solchen vierbeinigen Hausgenossen aufzunehmen.
Bei diesem Tier hätte ich schwach werden können. Es war ein wahres Prachtstück, groß, mit langem, beinahe goldfarbenem Fell und riesigen, klugen Augen, die Howard und mich abwechselnd und sehr aufmerksam musterten. Kein Streuner, dazu war das Tier viel zu gepflegt. Vermutlich gehörte sie in irgendeines der benachbarten Häuser. Mit Sicherheit sogar; wenn ich jemals eine Katze gesehen hatte, auf die Attribute wie edel und unnahbar zutrafen, dann diese.
»Du solltest dir auch eine Katze anschaffen«, sagte Howard. »Es wimmelt hier von Ratten.«
Ich antwortete mit einem Nicken, ohne die Worte indes wirklich verstanden zu haben. Irgendetwas an dieser Katze irritierte mich. Der Blick ihrer Augen war eindeutig zu klug für den eines bloßen Tieres. Sie musterten mich ebenso aufmerksam und – dessen war ich mir plötzlich sicher – nachdenklich, wie umgekehrt ich sie.
Ich machte einen Schritt auf sie zu. Die Katze blickte mir aufmerksam entgegen und straffte ihre Gestalt. Als ich einen weiteren Schritt in ihre Richtung machte, sprang sie mit weiten Sprüngen davon und war im nächsten Moment hinter einem der Schuttberge verschwunden.
Ich zuckte mit den Achseln und wandte mich nach einem letzten langen Blick auf das, was einmal Andara-House gewesen war und es bald wieder sein würde, wieder der Kutsche zu.
17. Februar 1893
Es war noch nicht vorbei.
Ich hatte gehofft, meine schlechten Stimmungen, die ständig kommenden und gehenden Anwandlungen von Depressionen, Melancholie oder auch grundloser Besorgnis, die mich quälten, würden sich legen, wenn erst einmal genug Zeit verstrichen wäre, aber dem war auch rund fünf Monate nach meiner Rückkehr von den Toten noch nicht so. Ganz im Gegenteil hatte ich manchmal das Gefühl, dass es eher schlimmer wurde. Vielleicht war es wirklich so, dass die seelischen Wunden, die ich damals davongetragen hatte, niemals richtig verheilen würden.
Ein Psychologe hätte den Zustand, in dem ich mich seit fast einem halben Jahr befand, vermutlich als anhaltende Depression bezeichnet. Rowlf, mein alter Freund und seit meiner offiziellen Rückkehr in die Welt der Lebenden auch mein Leibwächter, fasste es in sehr viel treffendere Worte: »Wieda mies drauf, wa?«, nuschelte er. »Echt mies. Macht keen Spaß nich heute.«
Ich ersparte mir die Frage, was ihm heute keinen Spaß machte, und lächelte nur flüchtig über seine Aussprache, die jeden des Englischen halbwegs Mächtigen an den Rand des Schlaganfalles führen würde und von der ich nicht erst seit heute argwöhnte, dass er sie sorgsam kultivierte. Ich mochte Rowlf, sehr sogar. Meine Gefühle dem rothaarigen Hünen gegenüber waren die für einen Bruder und sehr, sehr lieben Freund – aber im Moment ging er mir gehörig auf die Nerven. Wie immer, wenn er mich in meine Suite im Hilton-Hotel begleitete, in der ich bis zur endgültigen Wiederherstellung von Andara-House mein vorläufiges Domizil aufgeschlagen hatte, lümmelte er in einem der kostbaren Sessel herum und vertrieb sich die Zeit damit, die Whiskyvorräte meines Barschranks leer zu trinken. Ach ja, und dann und wann eine spitze Bemerkung fallen zu lassen, versteht sich.
»Bitte, Rowlf«, sagte ich. »Warum gehst du nicht zu deiner Bande zurück, und ihr stehlt ein paar Fuhrwerke?«
»Sowas tuma nich«, antwortete Rowlf beleidigt. »Außerdem kann ich nich weg. Du weißt doch, dass H. P. mir gesacht hat, ich soll dich keine Sekunde nich aussn Augn lassn tun.«
Ich verdrehte mit einem neuerlichen Seufzen die Augen. Völlig hatte ich mich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnt, dass der Rowlf, der mir gegenübersaß, nicht mehr derselbe war, den ich vor fünf Jahren gekannt hatte. Rowlf war schon lange nicht mehr nur Howards Leibdiener, Kutschfahrer, Koch und Mädchen für alles in Personalunion. Stattdessen war er in den letzten Jahren zum Anführer einer der größten und ehedem gefürchtetsten Straßenbanden Londons avanciert.
Aber Rowlf wäre nicht Rowlf gewesen, hätte er die Bande nicht vollkommen umgekrempelt, kaum dass er das Kommando über ihre Mitglieder übernommen hatte. Ein paar dieser besagten Mitglieder hatte er dabei vermutlich ebenfalls umgekrempelt, aber die, die den Wechsel überlebt hatten, hatten sich buchstäblich vom Saulus zum Paulus gewandelt. Sie klauten noch immer wie die Raben, jetzt vielleicht sogar mehr denn je, aber sie bestahlen nur noch Diebe. Am liebsten die, die mit gestärkten weißen Kragen hinter ihren Schreibtischen saßen und von sich behaupteten, ehrbare Geschäftsleute zu sein. Es gab deren eine ganze Menge in London.
»Deine Sorge rührt mich noch zu Tränen«, antwortete ich säuerlich, dabei galt mein Ärger weniger Rowlf als vielmehr Howard, der offensichtlich der unumstößlichen Ansicht war, dass ich unbedingt einen Aufpasser brauchte, seit sich meine Depressionen vor einigen Wochen wieder verstärkt hatten. Ich würde ihm morgen – nicht zum ersten Mal und garantiert ebenso erfolglos wie bislang – ein paar wenig freundliche Worte dazu sagen, aber im Augenblick war er nicht greifbar, sodass sich mein Ärger auf Rowlf entlud, und es war mir dabei völlig egal, ob ich mich ihm gegenüber fair verhielt oder nicht. Schließlich war er es, der seit Wochen auf meinen Nerven Klavier spielte, nicht umgekehrt.
»Warum trinkst du nicht noch ein paar Flaschen?«, fügte ich boshaft hinzu. »Dann siehst du mich vielleicht doppelt und kannst deine Aufgabe doppelt gut erfüllen.«
»Würd ich ja gern«, antwortete Rowlf und schwenkte eine leere Bourbonflasche. »Aber der Inhalt deiner Bar lässt zu wünschn übrich, echt. Is was fürn hohlen Zahn. Was tut ihr fein Pinkel eigentlich, wenner mal richtig durstich sein tut?«
Überrascht zog ich die Augenbrauen hoch. Ich hatte die Bar am Nachmittag extra auffüllen lassen. Jetzt war es noch nicht einmal ganz Mitternacht. Rowlf hatte im Laufe des Abends nicht weniger als drei Flaschen Whisky in sich hineingekippt. Und er sprach nicht einmal mit schwerer Zunge! Jedenfalls nicht mehr als gewohnt.





























