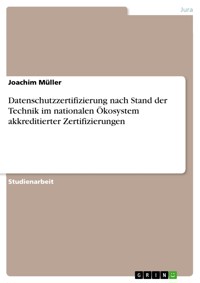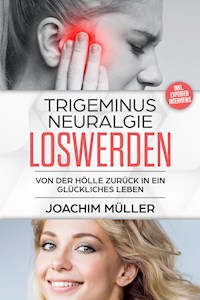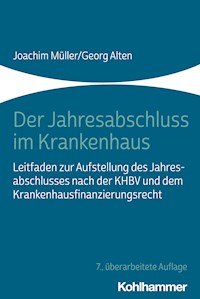
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die 7. Auflage des Praxisleitfadens "Der Jahresabschluss im Krankenhaus" aktualisiert die Grundlagen für eine zutreffenden Aufstellung, Dokumentation und Prüfung des Jahresabschlusses eines Krankenhauses. Der Schwerpunkt liegt auf den Besonderheiten, die sich aus den vielen Krankenhaus-Finanzierungsvorschriften ergeben. Zudem gilt zu beachten, dass für Krankenhäuser auch die Regeln des Handelsrechts, Zivilrechts und des Steuerrechts gelten. Die 7. Auflage berücksichtigt den Rechtsstand bis 30. Juni 2021; ein Exkurs zur COVID-19-Finanzierung und die Ausgliederung des Pflegebudgets sind im Buch eingearbeitet. Das Werk vermittelt Basiswissen für den Einsteiger und ist zugleich ein unverzichtbares Nachschlagewerk für den Praktiker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autoren
Joachim Müller, 1950 in Bonn geboren, verbrachte seine Ausbildungszeit einschließlich des Studiums (Mathematik, Informatik und Volkswirtschaftslehre) in Bonn. Die Berufswahl führte nach Köln in die Wirtschaftsprüfung und so war die erforderliche Ausbildung zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer unvermeidlich. Nach 5 Berufsjahren erfolgte einerseits eine Fokussierung der Tätigkeit auf gemeinnützige Unternehmen, insbesondere Krankenhäuser und andererseits eine Ausweitung der Tätigkeit auf Themen der Unternehmens- und Transaktionsberatung von gemeinnützigen Unternehmen, speziell Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Die berufliche Arbeit wurde ergänzt um: Facharbeit für das Institut der Wirtschaftsprüfer im Krankenhaus-Fachausschuss, Fachvorträge und seit 1997 die Autorenschaft für das Buch »Jahresabschluss im Krankenhaus« nunmehr in 7. Auflage. Am 01.08.2017 hat der Autor seine Berufstätigkeit bei BDO AG, Köln, beendet und ist nunmehr als Unternehmensberater tätig.
Georg Alten, Jahrgang 1964, ist Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und verfügt über eine mittlerweile 20-jährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen unterschiedlichster Rechtsformen.
Bei BDO verantwortet Georg Alten die Betreuung des Marktsegmentes Health Care übergreifend für alle Unternehmensbereiche (Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, Rechtsberatung).
Er ist Mitglied im Krankenhausfachausschuss des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf) und bringt in dieser Funktion die Belange des Marktes und der Prüfungskolleginnen und -kollegen in die Facharbeit des Berufsstandes ein. Intern koordiniert Herr Alten die fachliche Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen im Health-Care Bereich, ist Vortragender bei unseren internen und externen Fachveranstaltungen und Referent in zahlreichen fachlichen Webinaren.
Joachim MüllerGeorg Alten
Der Jahresabschluss im Krankenhaus
Leitfaden zur Aufstellung des Jahresabschlusses nach der KHBV und dem Krankenhausfinanzierungsrecht
7., überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
7., überarbeitete Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-040858-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-040859-3
epub: ISBN 978-3-17-040860-9
Inhalt
Übersicht über das elektronische Zusatzmaterial
Vorwort
1 Einführung
1.1 Rechnungswesen ist mehr als Buchhaltung und Jahresabschluss
1.2 Anwendungsbereich der KHBV
1.3 Gemischte Einrichtungen
1.4 Betriebsaufspaltung
1.5 Krankenhausabschluss als Trägerabschluss
1.6 Krankenhausabschluss als Konzernabschluss
1.7 Randbemerkung zu rein handelsrechtlichen Jahresabschlüssen
2 Organisation einer sach- und termingerechten Jahresabschlussaufstellung, -dokumentation und -prüfung
2.1 Abschlussarbeit als Teamarbeit
2.2 Gesetzliche Fristen für die Aufstellung des Jahresabschlusses
2.3 Aufstellungszeitpunkt
2.4 Ziel des Maßnahmenplans
2.5 Zeitliche Einteilung der Abschlussarbeiten
2.6 Abschlussprüfung
2.7 Offenlegung
3 Wichtige Gesetze für Buchführung und Krankenhausfinanzierung
3.1 Das deutsche Fallpauschalensystem (G-DRG)
3.2 Die Vergütung stationärer psychiatrischer, psychosomatischer und psychotherapeutischer Krankenhausleistungen (PEPPs)
3.3 Krankenhauspolitik über die Veränderungsrate gesteuert
3.4 Finanzierung der Ausbildungsstätten
3.5 Selbstbeteiligung bzw. Beitreibung der Eigenanteile
4 Buchführung und Jahresabschluss
4.1 Vorbemerkungen
4.2 Das große Prüfschema der Aktivierung in der Krankenhausbilanz
4.3 Das große Prüfschema der Passivierung in der Krankenhausbilanz
4.4 Die Fördermittelbilanz
4.5 Der Fördermittelbereich in der Gewinn- und Verlustrechnung
4.6 Spezielle krankenhausspezifische Bilanzierungsvorschriften
5 Wichtige Einzelthemen
5.1 Die Bereitstellung der Kapazitäten und deren Finanzierung
5.2 Die Instandhaltung und ihre Finanzierung
5.3 Der Umsatzprozess
5.3.1 Die Umsatzerlöse
5.3.2 Die Erlöse aus Krankenhausleistungen
5.3.3 Erlöse aus Wahlleistungen
5.3.4 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses
5.3.5 Nutzungsentgelte der Ärzte
5.4 Realisation und Bewertung bei Forderungen und Umsatzerlösen
5.4.1 Realisation und Bewertung bei stationären Krankenhausleistungen
5.4.2 Prüfungen durch den Medizinischen Dienst (MD)
5.4.3 Entgelte abzurechnen für stationäre Leistungen der integrierten Versorgung
5.4.4 Realisation und Bewertung bei Wahlleistungen
5.4.5 Realisation und Bewertung bei ambulanten Leistungen
5.4.6 Realisation und Bewertung der Nutzungsentgelte der Ärzte
5.4.7 Übersicht über die wesentlichen GKV-Leistungen des Krankenhauses
5.5 Verjährungsfristen für Leistungsforderungen
5.6 Die Erlösverprobung
5.6.1 Grundsatz
5.6.2 Erlösverprobung für die Entgelte nach der BPflV
5.6.3 Erlösverprobung für die Entgelte nach dem KHEntgG
5.7 Erlöskonten in der Kontenklasse 4
5.7.1 Der Kontenrahmen der KHBV bildet die DRG- und PEPP-Erlöse nicht ab
5.7.2 Welche Konten werden zusätzlich benötigt?
5.7.3 Abbildung der DRG-Fallpauschalen in wie vielen Konten?
5.8 Die Ausgleichsposten und Berichtigungen
5.8.1 Belegungsausgleiche
5.9 Buchhaltung und Steuern
5.9.1 Buchhaltung und Umsatzsteuer
5.9.2 Buchhaltung und Ertragsteuern
5.10 Abgrenzung »Unfertige Leistungen« und »Bestandsveränderung«
5.11 Die Personalkosten und ihre Abgrenzung
5.12 Die Zusatzaltersversorgung
5.13 Die Sachkosten und die Kreditoren
6 Der Anhang
7 Der Lagebericht
7.1 Der Lagebericht nach HGB
7.2 Wer stellt den Lagebericht auf?
7.3 Was ist der Inhalt des Lageberichts eines Krankenhauses?
7.4 Pflichtangaben zu den Geschäfts- und Rahmenbedingungen
7.5 Pflichtangaben zur (wirtschaftlichen) Lage
7.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
7.7 Beurteilung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
7.8 Weitere Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB
7.9 Der Prognosebericht
7.10 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren
7.11 Spezialgesetzliche Angabepflichten
8 Exkurs: Corona-Finanzierung
8.1 Ausgleichszahlungen für freigehaltene Krankenhaus-Betten für potenzielle COVID-19-Erkrankte
8.2 Ausgleichszahlungen für Corona-Schutzkleidung und Hygiene
8.3 Zahlungen für zusätzliche intensivmedizinische Behandlungskapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit
8.4 Sonstige Erleichterung wegen der Corona-Pandemie
8.5 Der Corona Jahresgesamtausgleich 2021
Anlage 1: Wichtige Begriffe des Entgeltsystems
Anlage 2: Checkliste zur Dokumentation
Anlage 3: Inhaltsverzeichnis Dauerakte
Anlage 4: Übersicht über die wichtigsten Gesetze für den KH-Jahresabschluss (Stand 31.03.2021)
Anlage 5: Gesetzliche Bescheinigungen
Anlage 6: Verlautbarungen des IDW
Anlage 7: Prüfungspflicht der Krankenhausabschlüsse nach Landesrecht
Anlage 8: Checkliste Pflichtangaben im Anhang des Krankenhausabschlusses
Anlage 9: Abgestimmte Bilanz nach Finanzierungsarten
Anlage 10: Verprobungsformular E1
Anlage 11: Übersicht über die abrechnungsrelevanten Landesbasisfallwerte
Anlage 12: Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Nützliche Links
Stichwortverzeichnis
Übersicht über das elektronische Zusatzmaterial1
Den Weblink, unter dem die Zusatzmaterialien zum Download verfügbar sind, finden Sie zu Beginn der jeweiligen Kapitel.
• Checkliste zur Dokumentation der Jahresabschlussaufstellung ( Anlage 2)
• Inhaltsverzeichnis Dauerakte ( Anlage 3)
1 Wichtiger urheberrechtlicher Hinweis: Alle zusätzlichen Materialien, die im Download-Bereich zur Verfügung gestellt werden, sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist nur zum persönlichen und nichtgewerblichen Gebrauch erlaubt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Vorwort
Seit der Veröffentlichung der 6. Auflage des Buchs »Der Jahresabschluss im Krankenhaus« im November 2016 hat sich im deutschen Krankenhauswesen und seiner Rechnungslegung schon wieder so viel geändert, dass eine neue überarbeitete Auflage erforderlich ist.
Die bereits im Vorwort früherer Auflagen angesprochene notwendige Überarbeitung des KHBV-Kontenrahmens steht bisher immer noch aus. Der Gesetzgeber hatte mit der Schaffung der KHBV auch die Aufgabe übernommen, regelmäßig die Regeln und Konten an die sich ständig ändernden Vorschriften der Krankenhausfinanzierung anzupassen. Das hat er seit Jahren unterlassen und deshalb muss sich jedes Krankenhaus seine fehlenden Konten – insbesondere die Umsatzerlöskonten für die Entgeltsystematik in der Somatik, Psychiatrie, für die Vergütung der Pflegepersonalkosten, die Vielzahl der Zu- und Abschläge auf den Rechnungen sowie und für die Vergütungen der Ausbildungsbetriebe – selbst einrichten. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich jetzt bei den Personalkosten – speziell bei den Kosten des Pflegedienstes – ab.
Die nachstehenden Ausführungen geben Hinweise zur zutreffenden Aufstellung, Dokumentation und Prüfung eines Jahresabschlusses eines Krankenhauses. Der Schwerpunkt liegt einerseits auf den Aspekten, die sich aus den besonderen Krankenhausfinanzierungsvorschriften ergeben, andererseits sollte nicht vergessen werden, dass für Krankenhäuserträger grundsätzlich auch die Regeln des Handelsrechts gelten. Hier sind umfangreichen Rechtsänderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zum 01.01.2016 planmäßig in Kraft getreten.
In der Krankenhausfinanzierung auf Bundesebene sind seit 2017 insbesondere die Vorschriften des
• PpSG – Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes vom 14.12.2017,
• MDK-Reformgesetzes vom 14.12.2019,
• COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz vom 24.03.2020 und
• KHZG – Krankenhaus-Zukunftsgesetzes vom 23.10.2020
parlamentarisch verabschiedet worden. Wegen der Corona-Pandemie wurden zahllose Gesetze und Verordnungen verabschiedet bzw. geändert. Diese Änderungen wegen der COVID-19-Pandemie haben wir in einem Exkurs zusammengefasst. Die vorliegende 7. Auflage berücksichtigt grundsätzlich den Rechtsstand bis Ende Dezember 2021.
Georg AltenJoachim Müller
Köln, im März 2022
1 Einführung
Das deutsche Gesundheitswesen ist aufgrund der politischen Vergütungsvorgaben für die eingerichteten Kapazitäten unterfinanziert. Statt nun die Kapazitäten – und hier liegt der Fokus zuallererst auf den Krankenhauskapazitäten – an den Bedarf anzupassen, werden die verfügbaren Finanzmittel politisch für alle Krankenhäuser begrenzt bzw. gekürzt, um Krankenhausträger »freiwillig« – ohne Handlungen, die direkt der Politik zugerechnet werden können, – aus dem Markt zu drängen.
Dass in der stationären Versorgung im europäischen Vergleich bezogen auf Deutschland Überkapazitäten bestehen, war lange Zeit ein Dogma der deutschen Gesundheitspolitik. Diese Grundthese kam angesichts der auftretenden Kapazitätsengpässe in der Corona-Krise – insbesondere bei den Intensiv- und Beatmungskapazitäten – deutlich ins Wanken ( Abb. 1.1).
Abb. 1.1: Betten je 10.000 Einwohner (Quelle: Statista 2021, Daten 2019 basierend auf OECD-Health at a Glance)
Bei der Intensivversorgung von Corona-Patienten kam es in einigen europäischen Nachbarstaaten, z. B. England, Frankreich, Italien, Portugal, zu Überlastungssituationen und Deutschland leistete humanitäre Unterstützung, wenn die dortigen regionalen Behandlungskapazitäten erschöpft waren.
In Deutschland wurde seit Anfang April bis Ende September 2020 die Aufstellung von neuen Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit einmalig mit EUR 50.000 je Bett bezuschusst. Leider mangelte es auch in Deutschland an examiniertem Pflegepersonal, das diese schwerstkranken Patienten pflegen konnte. Die Vorhaltung von Intensivpflegepersonal wurde vor dem 01.01.2020 nicht bezahlt und dementsprechend wurde auch nicht in ausreichender Menge in den Kliniken Intensivpflegepersonal ausgebildet und vorgehalten. Wenn diese Spezialisten nicht auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind, nützen auch Gehaltsverbesserungen wenig ( Tab. 1.1).
Tab. 1.1: Wie viele Krankenhausbetten stehen 10.000 Einwohnern in welchem Bundesland zur Verfügung? (Quelle: Fläche: Wikipedia, Betten und Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt)
Es wäre an der Zeit, eine ernsthafte politische Diskussion über die Frage zu führen, wie viel medizinische Angebote gewollt und welche Kapazitäten grenzwertig bzw. überflüssig sind. Die Kommunal- und Landespolitik kämpft besonders in zeitlicher Nähe zu Wahlen für jedes kleine ortsnahe Krankenhaus. Dabei gilt aber auch: Wenn ein Patient ernsthaft erkrankt, geht er doch lieber in das größere Krankenhaus im weiter entfernten Oberzentrum – in der Hoffnung, je größer das Krankenhaus, desto größer ist dessen medizinische Kompetenz.
Das somatische deutsche Fallpauschalensystem impliziert darüber hinaus eine betriebswirtschaftliche Gesetzmäßigkeit, die immer stärker ihre ökonomischen Wirkungen entfaltet: Die Gewinnschwellenanalyse, also die Antwort auf die Frage, wie viele Fälle muss eine medizinische Behandlungseinheit behandeln, damit sie ihre Kosten deckt. Sie benötigt eine Fallschwere x, eine Fallzahl y bei einen Einheitspreis z, um überhaupt dauerhaft bestehen zu können (Beak-Even-Menge). Praktische Beispiele zeigen, dass Entbindungsabteilungen mit weniger als 700 Geburten pro Jahr zumindest in Westdeutschland grundsätzlich verlustträchtig arbeiten.
Beispielsweise chirurgische, herzchirugische, urologische oder gynäkologische Abteilungen sind aufgrund der im laufenden Betrieb teuren Operationssäle und der aufwendigen Nachsorge ebenfalls auf Mindestfallzahlen angewiesen, weil anderenfalls die Vorhaltekosten (Fixkosten) dieser Behandlungseinheiten nicht durch die aus der Arbeit dieser Abteilung resultierenden Fallpauschal-Erlöse gedeckt werden können. Die Behandlungseinheit arbeitet dann mit negativem Deckungsbeitrag.
Es verwundert immer wieder, warum für bestimmte große Behandlungspfade keine Break-Even-Mengen in der Fachliteratur diskutiert werden, denn eine Krankenhaus-Fachabteilung, die ihre Break-Even-Mengen nicht erreicht, kann nur mit Dauersubventionen am Netz gehalten werden.
Um in diesem Umfeld verknappter ökonomischer Ressourcen dauerhaft bestehen zu können, benötigen die deutschen Krankenhäuser gute Fachleute im Rechnungswesen und Controlling.
Nachdem das deutsche Fallpauschalen-Entgeltsystem (G-DRGs) zum 01.01.2003 optional und zum 01.01.2004 verpflichtend eingeführt worden war, ist dieses zum 01.01.2009 in seinen Regelbetrieb eingetreten. Alle somatischen Krankenhäuser bzw. Fachabteilungen waren nach 10 Jahren Regelbetrieb Ende 2019 mit dem sehr komplexen System – etwa 1.275 DRG-Fallpauschalen – mehr oder weniger gut vertraut. Die Umsatzerlöse waren gemäß den Vorgaben der Krankenhausplanung optimiert, die Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) wurden mit dem Ziel hinreichender Deckungsbeiträge gesteuert und die Investitionsfinanzierung der Länder war in hohem Maße unzureichend. In dieses vertraute Umfeld platzte das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) wie eine Revolution:
• Statt der Regel »Geld folgt der Leistung« gilt ab 2020 »Selbstkostendeckung« für alle Kosten der Pflegekräfte am Patientenbett (Vorhaltung).
• Galten bis 31.12.2019 feste Fallpauschalen, so werden ab 01.01.2020 gewichtete, tagesbezogene Entgelte zusätzlich zur aDRG abgerechnet und bezahlt.
• Das Leistungsentgelt für die Pflege wird buchhalterisch als durchlaufender Posten durch die Gewinn- und Verlustrechnung ausgestaltet. Es gibt keine Möglichkeit, aus der Pflegevergütung ein Teilergebnis bzw. einen Deckungsbeitrag zu generieren.
• Diese anteiligen Umsatzerlöse aus dem Pflegebudget sind der Dispositionshoheit der Geschäftsführung insoweit entzogen, als ausschließlich die tatsächlich angefallenen Pflegepersonalkosten am Patientenbett vergütet werden. Höhere abgerechnete Abschlagszahlungen auf diese Personalkosten sind den Kostenträgern zu erstatten; sind dagegen die tatsächlichen Pflegepersonalkosten höher als die Abschlagszahlungen, wird dem Krankenhaus der fehlende Betrag erstattet.
Der vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) jährlich kalkulierte DRG-Entgeltkatalog musste für das Kalkulationsjahr 2020 um die »Personalkosten der Pflege am Patientenbett« bereinigt werden. Diese neuen Fallpauschalen ohne Pflegekosten heißen jetzt aDRGs. Dabei steht das »a« für ausgegliedert ( Tab. 1.2).
Tab. 1.2: Kennzahlen im G-DRG-System (Quelle: Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn)
Der Leitsatz in der DRG-Vergütung lautete bis Ende 2019: » Das Geld folgt der Leistung«. Für jeden stationären DRG-Fall gibt es ein festes Entgelt. Entsprechend diesem Anreizsystem vermehrte sich die Fallzahl in deutschen Krankenhäusern bis 2016 stetig. 2017 bis 2019 stagnierte die Fallzahl oder entwickelte sich sogar rückläufig, bis 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie die Fallzahl in vielen Krankenhäusern um etwa 12–15 % einbrach.
Der Gesetzgeber reagiert auf diese Entwicklung mit finanziellen Zu- bzw. Abschlägen oder Ausgleichszahlungen zu den Entgelten. Auch diese Zu- und Abschläge bzw. Ausgleichszahlungen sind verursachungsgerecht im Entstehungsjahr zu erfassen.
Gemäß § 4 KHG (Bund) werden die Investitionskosten im Wege der öffentlichen Förderung (durch die Bundesländer) übernommen. Da die Bundesländer selbst unter einer Finanznot leiden, leidet dementsprechend auch die Krankenhausfinanzierung unter der Finanzknappheit. Aus dem Rückzug der Länder aus der Krankenhausfinanzierung sind buchhalterische und betriebswirtschaftliche Konsequenzen zu ziehen. Mit der Kennziffer prozentualer Anteil der jährlichen Fördermittel an den Gesamtkosten (eines Krankenhauses, eines Bundeslandes oder der Bundesrepublik Deutschland) soll der Rückgang der Fördermittel beschrieben werden. Die folgende grafische Darstellung verdeutlicht den Umfang des Problems.
Abb. 1.2: Anteil der Fördermittel an den Gesamtkosten in Deutschlands Krankenhäusern (Quelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistischen Bundesamtes – Fachserie 12 Reihe 6.3 und der DKG Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den Bundesländern 2021)
Im Jahr 1972 wurde die duale Finanzierung, also die Investitionsfinanzierung als Aufgabe der öffentlichen Hand, in den § 4 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) geschrieben. Knapp 50 Jahre später findet sich auf der Internetseite der Deutschen Krankenhausgesellschaft unter dem Stichwort Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser:
3,7 Mrd. Euro fehlen den Krankenhäusern jährlich für dringende Investitionen!
Die Krankenkassen ihrerseits haben den Erosionsprozess bei der KHG-Fördermittelfinanzierung ebenfalls fest im Blick und erklären, dass sie nicht bereit wären, durch höhere Landesbudgets den Fördermittelrückgang auszugleichen.
Die Gesundheitspolitik des Bundes versucht mit dem Instrument des Krankenhaus-Zukunftsfonds – angesiedelt beim Bundesamt für Soziale Sicherung in Bonn –, dotiert mit EUR 4,3 Mrd. (davon EUR 3,0 Mrd. Einzahlungen des Bundes und 1,3 Mrd. Einzahlungen der Länder) finanziellen Druck abzubauen. Diese Mittel sollen ab 01.01.2021 bis 31.12.2024 zur Verfügung gestellt werden und sie unterliegen einer gesetzlich bestimmten Verwendungsbeschränkung: Gefördert werden nur Maßnahmen zur Modernisierung der Notfallkapazitäten, Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Krankenhäuser in den Bereichen der internen und sektorübergreifenden Versorgung, Ablauforganisation, Kommunikation, Telemedizin, Robotik, Hightechmedizin und Dokumentation sowie IT- und Cybersicherheit.
Schließlich sei an dieser Stelle noch hervorgehoben, dass auch in der Wirtschaftsprüfung eine deutliche Schwerpunktverschiebung eingetreten ist. Nicht mehr das Zahlenwerk der Buchhaltung steht im Mittelpunkt des prüferischen Interesses, sondern die verbalen Ausführungen in Anhang und Lagebericht. Die Treiber dieser Entwicklung sind auf Seiten des Gesetzgebers (Bundesministerium der Justiz – BMJ), des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW), des Deutschen Rechnungslegungsstandardisierungsinstituts (DRSC) und der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) zu finden.
1.1 Rechnungswesen ist mehr als Buchhaltung und Jahresabschluss
Die Eingrenzung des Themas ausschließlich auf die Finanzbuchhaltung, ihre Nebenbuchhaltungen und den Jahresabschluss unter Außerachtlassen der sonstigen Teile des Rechnungswesens eines Krankenhauses ist erforderlich, um die Ausführungen in einem überschaubaren Rahmen und Umfang zu halten. Definiert man das Rechnungswesen eines Krankenhauses als die Summe aller Wert- und Mengendaten, die erforderlich sind, um prospektiv zu kalkulieren, eine pagatorische (zahlungsbezogene) Buchführung zeitnah zu führen und aus Gründen der Wirtschaftlichkeitsanalyse und der Pflegesatzverhandlungen Kostenstellenkosten oder Kostenträgerstückkosten nachzukalkulieren, dann bedeutet ein Abschluss des gesamten Rechnungswesens – sei es ein Monats-, Quartals- oder Jahresabschluss –, dass sämtliche Werte und Mengen abgegrenzt auf die betreffende Periode fristgerecht vorliegen müssen. Das zu beschreiben und zu organisieren, würde den Rahmen dieses Leitfadens sprengen.
Die Schwierigkeiten, im Krankenhaus zu aussagefähigen Monatsabschlüssen zu gelangen, wenn sich – wie in den letzten Jahren zu beobachten – die Pflegesatzverhandlungen bis in das 2. oder sogar 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres hinauszögern, und die dazukommenden Probleme der Mehrleistungsabschläge, der innerjährlichen Ausgleichsbe- und -verrechnung nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) und/oder nach der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) – Verrechnung der alten Ausgleiche und Erfassung der neuen Ausgleiche des laufenden Geschäftsjahres – sollen nicht Schwerpunkt dieser Abhandlung sein. Soweit die Jahresabschlussaufstellung betroffen ist, werden die Ausgleichsregeln im Folgenden auf dem Rechtsstand September 2021 behandelt.
Ein besonderes Problem besteht darin, dass die Preisbildungsmechanismen, die Entgeltverhandlungen und die nachträglichen Ausgleiche und Berichtigungen völlig verrechtlicht sind. »Schnell« geht nicht, wenn zuvor erst ein Gesetz verabschiedet oder geändert werden muss.
Die Finanzbuchhaltung mit ihren Nebenbuchhaltungen wird schwerpunktmäßig unter der Perspektive des Jahresabschlusses betrachtet. Welche Bereiche des Rechnungswesens sind von den Abschlussarbeiten vorrangig betroffen? Wie organisiert man einen ordnungsgemäßen und termingerechten Jahresabschluss?
1.2 Anwendungsbereich der KHBV
Der Jahresabschluss des Krankenhauses ist ein spezieller Betriebsstättenabschluss, dessen begriffliche Umschreibung umgangssprachlich weiter gefasst ist als sein rechtlich definierter Anwendungsbereich. Umgangssprachlich werden oftmals unter dem Begriff »Krankenhaus« zusammengefasst: Kliniken aller Art, z. B. Reha- und Kurkliniken, Diagnosekliniken, Nachsorgekliniken, orthopädische oder neurologische Fachkliniken, aber auch Akutkrankenhäuser, psychiatrische Landeskrankenhäuser, Bundeswehrkrankenhäuser, BG-Kliniken, Universitätskliniken etc. Bei der Abgrenzung des hier zugrunde liegenden Begriffs »Krankenhaus« im speziellen Sinne der » Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV)« hilft die Definition des § 2 KHG (»Krankenhäuser sind Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können«)nicht weiter. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist der Anwendungsbereich gem. § 1 Abs. 1 KHBV deckungsgleich mit der Bundespflegesatzverordnung (BPflV). Seit der Einführung des deutschen Fallpauschalensystems durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 wird man den Anwendungsbereich der KHBV um die Krankenhäuser erweitern müssen, die ihre Leistungen nach dem KHEntgG abrechnen. Ausdrücklich hat der Gesetzgeber Bundeswehrkrankenhäuser und Krankenhäuser in Trägerschaft der gesetzlichen Unfallversicherung vom Anwendungsbereich ausgeschlossen (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KHBV).
Das Krankenhaus, das Entgelte nach § 10 BPflV a.F. bzw. § 7 BPflV n.F. und/oder nach § 7 KHEntgG abrechnet, muss demnach die besonderen Buchführungspflichten der KHBV erfüllen. Im Umkehrschluss heißt dies aber auch, wer seine Entgelte nicht nach der BPflV oder dem KHEntgG verhandelt, ist nicht zur Anwendung der KHBV gezwungen.
Somit fallen alle Universitätskliniken, wenn sie in ein Hochschulverzeichnis eines Bundeslandes eingetragen sind, und alle Plankrankenhäuser, wenn sie in den Landeskrankenhausplan eingetragen sind, unter die BPflV oder das KHEntgG. Die Krankenhäuser, mit denen ein schriftlich abgeschlossener Versorgungsvertrag (§ 108 Nr. 3 SGB V) besteht, sind zu unterscheiden in solche, die wegen § 5 Abs. 1 Nr. 2 KHG keine Fördermittel erhalten, weil sie die Anforderungen des § 67 Abgabenordnung (AO) nicht erfüllen, und solche, die Fördermittel erhalten. Wenn das Versorgungsvertragskrankenhaus Fördermittel erhält, ist die KHBV verbindlich anzuwenden, im anderen Fall empfiehlt der Krankenhausfachausschuss (KHFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) die Anwendung (IDW RS KHFA 1 vom 03.02.2011, Tz. 3 letzter Satz).
Durch § 1 Abs. 2 Nr. 3 KHBV sind Bundeswehrkrankenhäuser und die Krankenhäuser der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (BG-Kliniken) vom Anwendungsbereich der KHBV ausgenommen, selbst wenn sie überwiegend GKV-Patienten behandeln. Etwas anders könnte der Sachverhalt zu beurteilen sein, wenn BG-Kliniken mit bestimmten Teilbereichen in den Landeskrankenhausplan eingetragen sind und sie Fördermittel nach KHG erhalten haben. Fraglich ist schließlich, ob auch Krankenhäuser, die auf Grund eines Modellvorhabens nur einen Belegungsvertrag mit einer Gruppe von gesetzlichen Krankenkassen abgeschlossen haben, z. B. mit dem VdAK oder der AOK, die KHBV anwenden sollten. Die Praxis zeigt jedoch, dass die gesetzlich ausgegrenzten Kliniken i. d. R. auch den Kontenrahmen der KHBV verwenden, einfach weil er auch deren Anforderungen genügt.
1.3 Gemischte Einrichtungen
Dass die KHBV grundsätzlich nur für Krankenhäuser – eingegrenzt auf solche im o. g. Sinne – anzuwenden ist, versteht sich bereits aus ihrer Bezeichnung. Wie ist aber zu verfahren, wenn der Einrichtungsträger, z. B. eine GmbH, neben dem Krankenhaus noch einen ambulanten Pflegedienst und ein Altenheim betreibt? Für den ambulanten Pflegedienst (ab 01.01.1998) und das Altenheim (ab 01.01.1997) gelten grundsätzlich gesonderte Rechnungs- und Buchführungspflichten nach der Pflegebuchführungsverordnung (PBV). Diese Verordnung legt zugelassenen Pflegeeinrichtungen ab 1997 eine branchenbezogene Buchführungs- und Abschlusspflicht auf. Dabei ist die Tatsache, dass die vorgegebenen Kontenpläne und Abschlussglie-derungsschemata der KHBV und der PBV nicht kompatibel sind, für Praktiker im Rechnungswesen ausgesprochen störend.2
§ 1 PBV sieht im Gegensatz zur KHBV Regelungen für sogenannte » gemischteEinrichtungen « vor. Als gemischte Einrichtungen werden dabei solche Pflegeeinrichtungen definiert, bei denen der Träger parallel andere Leistungen, die nach dem SGB finanziert werden, erbringt. Hierzu zählen auch die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem SGB V. Nach der Regelung der PBV kann der Träger in diesen Fällen von dem Wahlrecht Gebrauch machen, für die Pflegeeinrichtung, begrenzt auf die Leistungen nach dem SGB XI, lediglich eine separate Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen eigenen Anlagen- und Finanzierungsnachweis zu erstellen. Zusammenfassend gilt: Pflegeeinrichtungen, wenn sie zur Behandlung von gesetzlich pflegeversicherten Bedürftigen zugelassen sind, dürfen in einer Buchhaltung mit einem Krankenhaus gebucht werden, wenn für sie eine separate Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein eigener Anlagen- und Finanzierungsnachweis aufgestellt werden kann. Diese Anforderung ist oftmals mit Hilfe der Kostenrechnung und der Anlagenbuchhaltung zu erfüllen, ohne dass zwei getrennte Buchführungen eingerichtet werden müssen.
Die KHBV enthält keine derartige Regelung. Ihr Anwendungsbereich ist grundsätzlich auf Krankenhäuser beschränkt. Allerdings hält der Krankenhausfachausschuss des IDW gemäß seinem Rechnungslegungsstandard RS KHFA 1 auch die Einbeziehung von Nicht-Krankenhausbetrieben (z. B. Pflegeeinrichtungen) in den Jahresabschluss nach KHBV für zulässig, wenn es sich um untergeordnete Nebentätigkeiten handelt (IDW RS KHFA 1 vom 03.02.2011 Tz. 14).
Die Kombination großes Pflegeheim mit kleinem Krankenhaus in einer Buchhaltung wäre danach nicht möglich, obwohl die Praxis zeigt, dass es solche Komplexeinrichtungen mit nur einer Buchführung gibt und diese auch vernünftig steuerbar sind. Die unterschiedlichen Bilanzierungskonzepte der PBV und der KHBV können somit das Führen einer einheitlichen Buchhaltung für gemischte Einrichtungen verhindern.
1.4 Betriebsaufspaltung
In den vergangenen Jahren sind in zunehmender Zahl rechtliche Umstrukturierungen bei traditionellen Krankenhausträgern zu verzeichnen gewesen. Ein bevorzugtes Modell war und ist dabei die sog. Betriebsaufspaltung. In Anlehnung an die steuerliche Betriebsaufspaltung, die dann vorliegt, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen im Privatvermögen des Kaufmanns gehalten werden und dem steuerlichen Betriebsvermögen im Wege der Verpachtung oder Nutzungsüberlassung zur Verfügung gestellt werden, spricht man auch bei bestimmten Eigentumskonstruktionen im (gemeinnützigen) Krankenhaus von einer Betriebsaufspaltung.
Diese ist beispielsweise dann gegeben, wenn eine Ordenskongregation, weltlich verfasst in der privatrechtlichen Rechtsform eines eingetragenen Vereins, ein Grundstück nebst Krankenhausaufbauten einer dem Orden – genauer gesagt dem eingetragenen Verein – mehrheitlich gehörenden Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (GmbH) nicht überträgt, sondern der Betriebsgesellschaft nur zur Nutzung überlässt.
In der Praxis haben sich verschiedene Formen der Betriebsaufspaltungvon Krankenhäusern herausgebildet, deren Grundformen im Folgenden kurz skizziert werden sollen.
a) Die Krankenhausimmobilie ist Eigentum einer Gebietskörperschaft (z. B. Landkreis, Stadt oder Land) oder eines Trägervereins (z. B. Ordensvermögen); der Krankenhausbetrieb ist einem anderen Träger (z. B. Betriebs-GmbH) übertragen, der im Eigentum des o. g. Besitzunternehmens steht; die Gestellung der Immobilie erfolgt im Wege des Erbbaurechts. Die Krankenhausbetreibergesellschaft wird Eigentümerin der Krankenhausgebäude und muss diese in ihrem Jahresabschluss aktivieren. Das Erbbaurecht wird zum Erinnerungswert von EUR 1 oder mit dem Wert der Einmalzahlungen, wenn eine solche geleistet wird, aktiviert. Bei laufend zu entrichtender Erbpacht erfolgt die buchhalterische Erfassung derselben als Pachtaufwand.
b) Die Krankenhausimmobilie ist Eigentum einer Gebietskörperschaft (z. B. Landkreis, Stadt oder Land) oder eines Trägervereins (z. B. Ordensvermögen); der Krankenhausbetrieb ist einem anderen Träger (z. B. Betriebs-GmbH) übertragen, dessen Anteile (mehrheitlich) im Eigentum der Gebietskörperschaft oder des Ordensvermögens stehen; die Gestellung der Immobilie erfolgt im Wege der befristeten Nutzungsüberlassung (Fortbestand der wirtschaftlichen EinheitKrankenhaus entsprechend des IDW RS KHFA 1 vom 03.02.2011, Tz. 12).Bei einer schuldrechtlichen Nutzungsüberlassung wird grundsätzlich ein Miet- oder Pachtverhältnis anzunehmen sein, das keine Aktivierung von Gebäuden bei der zu nutzenden Krankenhausbetriebsgesellschaft zulässt. Ob ausnahmsweise durch die Nutzungsüberlassung wirtschaftliches Eigentum bei der Krankenhausbetriebsgesellschaft angenommen werden muss, was dann im Abschluss der Krankenhausbetriebsgesellschaft zur Aktivierung von Grundstücken mit Betriebs- oder Wohnbauten führt, wird von der vertraglichen Ausgestaltung des Einzelfalles abhängen. Zusätzlich ist in den Fällen der Nutzungsüberlassung zu prüfen, ob trotz der erfolgten Betriebsaufspaltung für Zwecke des KHBV-Abschlusses von einem Fortbestand der wirtschaftlichen Einheit Krankenhaus auszugehen ist, mit der Folge, dass im KHBV-Abschluss weiterhin das Grundvermögen auszuweisen wäre. Der KHFA geht von einem Fortbestand der wirtschaftlichen Einheit Krankenhaus aus, wenn das Besitzunternehmen weiterhin (Einzel-)Fördermittel erhält (IDW RS KHFA 1 vom 03.02.2011, Tz. 12–14).
c) Die Krankenhausimmobilie ist Eigentum einer Gebietskörperschaft (z. B. Landkreis, Stadt oder Land) oder eines Ordensvermögens; der Krankenhausbetrieb ist einem anderen Träger (z. B. GmbH) übertragen, der im Eigentum der Gebietskörperschaft oder des Ordensvermögens steht. Erstgenannter stellt die Immobilie im Wege der unbefristeten und nur aus wichtigem Grunde kündbaren Nutzungsüberlassung der Betriebs-GmbH zur Verfügung, sodass wirtschaftlichesEigentum bei der GmbH entsteht. Die letztgenannte Konstruktion ist förderrechtlich und grunderwerbssteuerlich nicht unumstritten.
Die Fälle b) und c) werfen auch die Frage nach dem Krankenhausträger auf. Ist Krankenhausträger, wer die Grundstücke bilanziert und ggf. die Fördermittel erhält und verwendet, oder ist es derjenige, der das Krankenhaus betreibt? Diese Frage ist im BayKrG in Art. 9 Absatz 4 Satz 2 abschließend geklärt: »Krankenhausträgerist, wer das Krankenhaus betreibt.«
Diese Eindeutigkeit fehlt in den meisten Landesgesetzen zur Umsetzung des Bundes-KHGs. Insbesondere ist aus NRW zu berichten, dass oft Jahre nach einer Betriebsaufspaltung immer noch der Rechtsträger des Krankenhausgrundstücks und nicht der Rechtsträger des Krankenhausbetriebs im Landeskrankenhausplan verzeichnet ist. In der Praxis behandelt dann ein nicht nach § 108 SGB V zugelassenes Krankenhaus GKV-Patienten. Spätestens bei gerichtlichen Auseinandersetzungen führt das zu sehr überraschenden Ergebnissen.
1.5 Krankenhausabschluss als Trägerabschluss
Probleme bereitet in der Praxis der Wunsch, den Krankenhaus-Betriebsstättenabschluss zugleich auch als handelsrechtlichen Abschluss des Krankenhausträgerunternehmens, z. B. einer GmbH, zu verwenden. Dann treffen die Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften der KHBV (Krankenhausabschluss) mit denen des Handelsgesetzbuchs (HGB; z. B. GmbH-Abschluss) zusammen. Der Gesetzgeber hat die sich daraus ergebenden Probleme erkannt und in § 1 Abs. 3 KHBV deshalb ein Wahlrecht eingeräumt, aufgrund dessen das Krankenhaus grundsätzlich
• zwei Jahresabschlüsse – einen Abschluss nach der KHBV und einen nach dem HGB – aufstellen darf oder
• nur einen Jahresabschluss – nach den Regeln des HGBs aufstellt, der jedoch nach den Anlagen zur KHBV gegliedert ist.
Was ist hier zu empfehlen? Grundsätzlich ist ein Jahresabschluss, der beiden gesetzlichen Anforderungen genügt, sinnvoll, weil er weniger Arbeit für das Rechnungswesen bedeutet. Warum dann also die Diskussion der Möglichkeit, zwei Jahresabschlüsse aufzustellen?
Die Kostenträger (Krankenkassen) interessieren sich durchaus für die Jahresabschlussdaten der Krankenhäuser. Hierzu stehen zwei legale Informationswege offen: Erstens die Offenlegung im elektronischen Bundesanzeiger bzw. den Gesellschaftsblättern, die die Satzung vorschreibt, des veröffentlichten Jahresabschlusses (z. B. § 325 HGB) und zweitens die Betriebskostenauswertung laut der Krankenhaus-Statistikverordnung. Die gesetzliche Veröffentlichungspflicht hat bis spätestens vor Ablauf des 12. Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahres bei den Betreibern des elektronischen Bundesanzeigers zu erfolgen.
Folgende Unterlagen sind im Internet (www.bundesanzeiger.de) für jeden zugänglich offenlegungspflichtig:
• Jahresabschluss einschließlich Bestätigungsvermerk oder Vermerk über dessen Versagung,
• Lagebericht,
• Bericht des Aufsichtsrates,
• die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung, die Regelungen des Dt. Corporate Governance Codex (nur bei börsennotierten Aktiengesellschaften).
Soweit sich die folgenden Angaben nicht aus dem eingereichten Jahresabschluss ergeben, sind zusätzlich offenzulegen:
• Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses,
• Beschluss über seine Verwendung unter Angabe des Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages.
Es kann vor dem Hintergrund der Offenlegung also grundsätzlich sinnvoll sein, zwei Jahresabschlüsse aufzustellen, wobei der offenlegungspflichtige HGB-Abschluss dem externen Leser grundsätzlich weniger Informationen bietet als der zusätzliche KHBV-Abschluss, welcher nicht von den Gesellschaftern festgestellt und offengelegt werden muss, der also in den Archiven verschwindet und nur auf Anforderung der Förderbehörde oder in strittigen Auseinandersetzungen mit den Kostenträgern vorgelegt werden muss.
1.6 Krankenhausabschluss als Konzernabschluss
Wiederholt wurde die Frage gestellt, ob es möglich ist, in einem Krankenhauskonzern die einzelnen KHBV-Abschlüsse zu konsolidieren. Um es sofort klar auszusprechen: Nein, das geht nicht. Die KHBV-Abschlüsse müssen einzeln mittels einer so genannten Handelsbilanz II in je einen HGB-Abschluss umgewandelt werden, damit dann eine Konzernkonsolidierung und ein Konzernjahresabschluss gesetzeskonform aufgestellt werden können.
1.7 Randbemerkung zu rein handelsrechtlichen Jahresabschlüssen
In der geübten Praxis findet man in rein handelsrechtlichen Jahresabschlüssen oder in Krankenhausabschlüssen nach IAS/IFRS die Sonderposten und die passiven Ausgleichsposten für Darlehensförderung zum 01.01. mit dem Anlagevermögen saldiert, die aktiven Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung und manchmal auch für Darlehensförderung werden zum 01.01. mit dem Eigenkapital saldiert.
Die Inhalte der noch immer gültigen HFA-Stellungnahme 1/1984, die für die Investitionszuschüsse weitgehend deckungsgleich mit den Anforderungen der KHBV sind, lassen sich – wie folgt – zusammenfassen:
»Der Zuwendungsertrag soll so lange abgegrenzt (passiviert) werden, bis dieser und der zugehörige Verwendungsaufwand in der gleichen Periode erfasst werden.«
Die Regeln für die handelsrechtliche Bilanzierung von Zuwendungen sind in Abbildung 4.2 ( Abb. 4.2) zusammengefasst.
Beispiel 1:
Der Investitionszuschuss wird als Sonderposten so lange abgegrenzt, wie die Nutzungsdauer des Anlagegutes währt.
Beispiel 2:
Das Krankenhaus sammelt Spenden für krebskranke Kinder aus der Ukraine. Die Spendenmittel werden als Passivposten abgegrenzt, bis die Kinder im Krankenhaus behandelt werden.
Von besonderer Problematik sind in einigen Bundesländern die Bilanzierung der Zahlungen im Zusammenhang mit geförderten Investitionsprojekten, die aber nach dem KHG i. d. R. nur anteilig gefördert werden, während der fehlende Restbetrag von der jeweiligen Gebietskörperschaft, die das Krankenhaus betreibt (Träger des Krankenhauses), zu tragen ist. Die Bilanzierung dieser anteiligen KHG-Zahlungen erfolgte in der Praxis unterschiedlich. So ist beispielsweise zu beobachten, dass einige Krankenhäuser diese Zuschüsse als Kapitalrücklagen passivieren, während andere Krankenhäuser den Ansatz eines Sonderpostens bevorzugten. Wenn dann in einer Gebietskörperschaft mehrere kommunale Krankenhäuser existieren und jedes bilanziert diese Zahlungen des Trägers anders, dann ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, diese offenbare Unklarheit zu hinterfragen. Nach den Grundsätzen der Bilanzierung unter der Herrschaft des dualen Finanzierungssystems sollen Investitionen und ihre Fördermittel-Finanzierung grundsätzlich keine Ergebnisauswirkung zeigen. Also kann nur eine Bilanzierung als Sonderposten richtig sein. Zweitens fehlt es i. d. R. an einem Einlagebeschluss in das haftende Eigenkapital des Krankenhauses. Dennoch bleiben Zuwendungen aus dem kommunalen Vermögenshaushalt ohne präzise Verwendungsbeschlüsse für das bilanzierende Krankenhaus immer interpretationsbedürftig für den bilanzierenden Buchhalter.
Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass die Baupauschalen inNRW diesen Grundsätzen nicht unbedingt genügen müssen. Es handelt sich nicht mehr um eine Projekt- oder Maßnahmenfinanzierung, sondern um jährlich neu bewilligte Pauschalen, die pro Jahr durch einen speziellen Verwendungsbeschluss der Krankenhausgeschäftsführung eingesetzt und somit verwendet werden. Es gibt keinen Grundsatz der Förderstetigkeit bei den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Aber man kann mit guten Argumenten die Auffassung vertreten, dass in Fällen einer stark bilanzpolitisch motivierten Mittelverwendung eine Berichtspflicht gemäß § 264 Abs. 2 HGB im Anhang besteht.
Ähnliche Probleme haben sich i. d. R. bei öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern in der Form des Eigen- bzw. Regiebetriebes ergeben, wenn Liquiditätshilfen gewährt wurden. Waren diese Zahlungen rückzahlbare Darlehen, eigenkapitalverstärkende Kapitalrücklagen oder handelte es sich um ertragswirksame Aufwandszuschüsse? Problematisch werden diese Zahlungen immer dann, wenn aus dem Ratsbeschluss der Verwendungszweck nicht eindeutig hervorging. In diesen Fällen kann eine Passivierung nur durch Auslegung und Ableitung des Gewollten erfolgen. Die gewählte Bilanzierung wird spätestens durch die Feststellung des Krankenhaus(träger)abschlusses von den Gesellschaftern nochmals überprüft.
Die Position »Rückstellungen « wurde in der Vergangenheit oftmals gleichgesetzt mit Bilanzpolitik. Dem ist jedoch energisch zu widersprechen, denn bevor Bilanzpolitik überhaupt Platz greifen kann, müssen zunächst alle Pflichtrückstellungen dotiert sein. Bilanzpolitik kann möglicherweise erst in einer späteren Phase der Bilanzaufstellung betrieben werden.
Die Position Rückstellungen kennt insoweit noch eine Besonderheit, als dass Rückstellungen sowohl für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste (Verbindlichkeitsrückstellungen), als auch nach § 249 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1. und 2. HGB für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten, oder für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden, und/oder für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden (Aufwandsrückstellungen), gebildet werden müssen.
Für andere als die vorstehend bezeichneten Zwecke dürfen Rückstellungen nicht gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist (§ 249 Abs. 2 HGB).
2 Durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 28.05.2008 (BGBl. I S. 874), in Kraft getreten zum 01.07.2008, wird § 75 Abs. 7 SGB XI dahingehend geändert, dass der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene gemeinsam und einheitlich Grundsätze ordnungsmäßiger Pflegebuchführung für die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen vereinbaren. Die Vereinbarung nach Satz 1 ist den zugelassenen Pflegeeinrichtungen durch die Landesverbände der Pflegekassen bekanntzugeben. Sie ist für alle Pflegekassen und deren Verbände sowie für die zugelassenen Pflegeeinrichtungen nach Aufhebung der gemäß § 83 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI erlassenen Rechtsverordnung unmittelbar verbindlich. Mit Bekanntgabe der einheitlichen Grundsätze tritt die Pflegebuchführungsverordnung außer Kraft.
2 Organisation einer sach- und termingerechten Jahresabschlussaufstellung, -dokumentation und -prüfung
2.1 Abschlussarbeit als Teamarbeit
Die Aufstellung (Dokumentation der Aufstellung) des Jahresabschlusses eines Krankenhauses ist Teamarbeit. Die Mitwirkenden im Team sind u. a.:
• Geschäftsführung
• Verwaltungsdirektion
• Finanzbuchhaltung
• Patientenverwaltung
• Betriebswirtschaftliches und Medizin-Controlling
• Kostenrechnung
• Personalabteilung
• Einkaufsabteilung
• IT
• Apotheke
• Technik
• Ärzteschaft
• Medikamentenverantwortliche Pflegekräfte
Auf den Punkt gebracht: Die genannten Abteilungen müssen zusammenwirken, damit die Aufstellung des Jahresabschlusses sach- und fristgerecht gelingt. Dabei empfiehlt es sich, eine Projektleitung oder ein Führungsteam Jahresabschluss zu definieren, damit die Verantwortung für die frist- und sachgerecht zu erledigenden Arbeiten klar geregelt ist. Diese Person oder dieses Team ist funktionsgemäß die Leitung Finanzen oder Leitung Rechnungswesen des Krankenhauses.
Die Zusammenarbeit einer solchen Anzahl von Personen erfordert ein planmäßiges Vorgehen; nur so ist sichergestellt, dass alle Prozessbeteiligten ausreichend im Voraus informiert werden, welche Arbeiten den einzelnen Beteiligten zugewiesen sind und zu welchem Zeitpunkt diese erledigt sein müssen. Der Einzelne kann sich seine Arbeit einteilen, kann sich im Vorfeld auf terminliche Engpässe einrichten und rechtzeitig Rücksprache nehmen oder Rat einholen, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen Maßnahmenplan zur Aufstellung des Jahresabschlusses, wie er in Anlage 2 beispielhaft beigefügt ist, aufzustellen und den Beteiligten bekannt zu machen ( Anlage 2). Die Ergebnisse dieser Maßnahmen zur Aufstellung des Jahresabschlusses bezeichnet man auch als Dokumentation.
2.2 Gesetzliche Fristen für die Aufstellung des Jahresabschlusses
Die KHBV schreibt vor, dass Krankenhäuser – gleich welcher Rechtsform – ihren Jahresabschluss binnen vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen haben (§ 4 Abs. 2 KHBV).
Für Kapitalgesellschaften im Sinne des 2. Abschnitts des 3. Buches des HGB (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Personengesellschaften, bei denen nicht mindestens ein persönlich haftender Gesellschafter vorhanden ist) gelten die Aufstellungsfristen drei bzw. sechs Monate (§ 264 HGB). Dabei haben große und mittlere Kapitalgesellschaften – wegen der Größenkriterien vgl. § 267 HGB – ihren Jahresabschluss binnen drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen und kleine sowie Kleinst-Kapitalgesellschaften haben für die Aufstellung sogar sechs Monate Zeit, sofern im Gesellschaftsvertrag keine kürzeren Fristen vereinbart sind. Vom 31. Dezember als Abschlussstichtage abweichende Abschlussstichtage können für Krankenhäuser nicht gewählt werden ( Tab. 2.1).
Tab. 2.1: Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses (Quelle: §§ 267, 267a HGB)
Die Rechtsfolgen bzgl. der Aufstellungsfristen, der Aufstellungs- und der Offenlegungserleichterungen treten nur ein, wenn mindestens zwei der vorstehenden Merkmale in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren über- bzw. unterschritten wurden. Im Falle der Umwandlung oder Neugründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Voraussetzungen am ersten Abschlussstichtag nach der Umwandlung oder Neugründung vorliegen.
Achtung: Gehören die (Kapital-)Gesellschaften zu einem Konzern im Sinne des § 290 Abs. 1 HGB, sind die Fristen für die Aufstellung des Konzernabschlusses bestimmend für die Fristen zur Aufstellung der Jahresabschlüsse. Die gesetzlichen Fristen für den Konzernabschluss betragen grundsätzlich fünf Monate; die kapitalmarktorientierten Konzernunternehmen – Unternehmen, die einen organisierten Markt im Sinn des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes durch von ihr ausgegebene Wertpapiere im Sinn des § 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch nehmen oder die Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt beantragt haben (§ 264d HGB) – müssen den (geprüften) Konzernabschluss binnen vier Monaten im Bundesanzeiger veröffentlichen (§ 325 Abs. 4 HGB). Hier bietet es sich an, einen sogenannten »fast close« zu organisieren. In der Praxis sind die Jahresabschlüsse i. d. R. bis Ende Januar, also vier Wochen nach dem Bilanzstichtag, aufzustellen und zu prüfen, um dann im Konzernabschluss weiter verarbeitet werden zu können.
Für Krankenhäuser in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft – bei Inanspruchnahme des Wahlrechts zum Einheitsabschluss § 1 Abs. 3 KHBV – sind jeweils die kürzeren Fristen verbindlich. Damit haben Krankenhäuser in Trägerschaft einer großen oder mittleren Kapitalgesellschaft eine Aufstellungsfrist von drei Monaten und kleine Kapitalgesellschaften gem. § 4 KHBV von vier Monaten nach dem Bilanzstichtag zu beachten.
Ähnliches gilt übrigens i. d. R. auch bei kommunalen Krankenhäusern, bei denen die Eigenbetriebsverordnung oder eine Gemeindekrankenhaus-Betriebsverordnung oder die Gemeindeordnung regelt, dass die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe oder der Regiebetriebe nach den Regeln für große Kapitalgesellschaften aufzustellen sind.