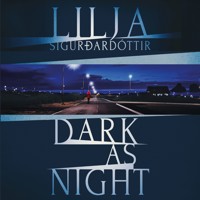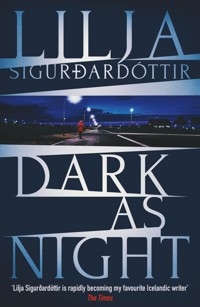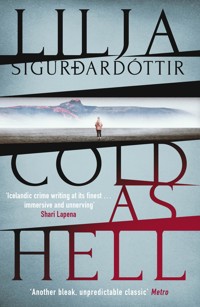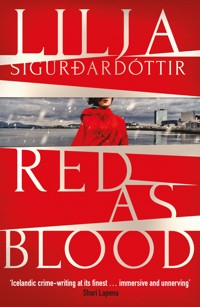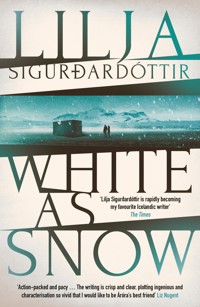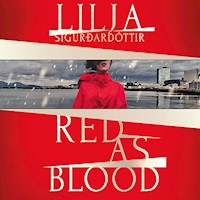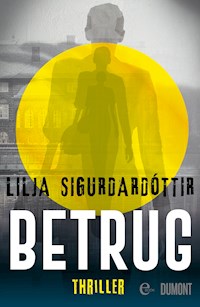8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Island-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Sonja wünscht sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Alle Brücken wollte sie hinter sich abbrechen und in London neu anfangen, weit weg von ihrer Vergangenheit und ihrer Heimat Reykjavík. Doch ihre Pläne werden zunichtegemacht: Sie muss mit ihrem Sohn Tómas zurück nach Island und mit langjährigen Gegnern abrechnen, wenn sie am Leben bleiben will. Für ihre Exfreundin Agla haben sich die Gefängnistore derweil wieder geöffnet, doch ist sie gefangen in ihrer Einsamkeit. Ihre Beziehung zu Sonja hat sie aufs Spiel gesetzt und verloren. Als sie von einem großen ausländischen Unternehmen gebeten wird, sich in ein Komplott in der Aluminiumbranche einzumischen, willigt sie resigniert ein und recherchiert mit Hilfe ihrer Erzfeindin, der investigativen Journalistin María. Bald schweben die beiden Frauen in höchster Gefahr, denn der skrupellose Geschäftsmann Ingimar schreckt vor nichts zurück, um sein Imperium zu schützen − doch er hat keine Ahnung, auf welchem Pulverfass er sitzt … Nach ›Die Schlinge‹ und ›Das Netz‹ folgt mit ›Der Käfig‹ das große Finale der mitreißenden Spannungstrilogie aus Island!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Ähnliche
Sonja wünscht sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Alle Brücken wollte sie hinter sich abbrechen und in London neu anfangen, weit weg von ihrer Vergangenheit und ihrer Heimat Reykjavík. Doch ihre Pläne werden zunichtegemacht: Sie muss mit ihrem Sohn Tómas zurück nach Island und mit langjährigen Gegnern abrechnen, wenn sie am Leben bleiben will.
Für ihre Exfreundin Agla haben sich die Gefängnistore derweil wieder geöffnet, doch ist sie gefangen in ihrer Einsamkeit. Ihre Beziehung zu Sonja hat sie aufs Spiel gesetzt und verloren. Als sie von einem großen ausländischen Unternehmen gebeten wird, sich in ein Komplott in der Aluminiumbranche einzumischen, willigt sie resigniert ein und recherchiert mit Hilfe ihrer Erzfeindin, der investigativen Journalistin María. Bald schweben die beiden Frauen in höchster Gefahr, denn der skrupellose Geschäftsmann Ingimar schreckt vor nichts zurück, um sein Imperium zu schützen – doch er hat keine Ahnung, auf welchem Pulverfass er sitzt …
Nach ›Die Schlinge‹ und ›Das Netz‹ folgt mit ›Der Käfig‹ das große Finale der mitreißenden Spannungstrilogie aus Island!
© Gunnlöð
Lilja Sigurðardóttir wurde 1972 in der isländischen Kleinstadt Akranes geboren und wuchs in Mexiko, Spanien und Island auf. Bereits mehrfach ausgezeichnet für ihre Theaterstücke, wurde sie mit ihrer Reykjavík-Trilogie, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde, auch einem internationalen Publikum bekannt.
LiljaSigurðardóttir
DERKÄFIG
EIN REYKJAVÍK-KRIMI
Aus dem Isländischenvon Anika Wolff
Die Übersetzung wurde finanziell unterstützt vom
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde außerdem vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
eBook 2021
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© Copyright Lilja Sigurðardóttir 2017
Die isländische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel ›Búrið‹ bei Forlagið, Reykjavík.
This translation published by arrangement with Forlagið, Reykjavik and Arrowsmith Agency, Hamburg.
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Anika Wolff
Redaktion: Friederike Arnold
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Straße: © Tabor Chichakly/Alamy Stock Foto, Adler: © dfikar/ Fotolia.com
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7022-6
www.dumont-buchverlag.de
APRIL 2017
1
Mit einem leisen Klacken fiel hinter Agla die Zellentür zu. Im neuen Gefängnis Hólmsheiði waren alle Türen mit Dämpfer ausgestattet, daher herrschte abends Stille im Frauentrakt. Kein Türenknallen war zu hören, und durch die schallisolierten Wände drangen auch keinerlei Fernsehgeräusche aus den Zellen der anderen Frauen, die hier ihre Strafen absaßen. Diese bedrückende Stille umgab Agla wie Wasser, in dem sie langsam auf den Grund sank. Sie hatte gewusst, dass es keine schöne Erfahrung sein würde, sich einsperren zu lassen. Vor einigen Jahren hatte sie ein paar Tage in U-Haft gesessen, während die Sache mit dem Marktmissbrauch untersucht worden war. Daher hatte sie geglaubt, zu wissen, wie sie sich fühlen würde. Doch das hier war anders als alles, was sie erwartet hatte. Zwei bis drei Tage konnte man in einer Zelle ausharren, wenn man wusste, dass jeden Moment der Anwalt wie ein rettender Engel herbeischweben und einen auf direktem Wege in ein schickes Restaurant bringen würde. Etwas völlig anderes war es, in dieses Gebäude geführt zu werden, das noch nach feuchtem Beton und Putz roch und in dem man ein ganzes Jahr zubringen musste.
Jetzt war es noch ein Monat bis zum Wechsel in den offenen Vollzug. Sie hatte sich die Haftzeit gedanklich in Etappen eingeteilt, auf die sie hinarbeiten konnte. Erst musste sie die Hälfte schaffen und dann bis zum offenen Vollzug durchhalten, aber jetzt, wo das Ziel in Sicht war, überkam sie Angst. Trotz der Eintönigkeit und der klaustrophobischen Enge boten diese Wände doch einen gewissen Schutz. Fast fühlte sie sich wie ein Zootier, das sich nicht traute, seinen Käfig zu verlassen und den Gefahren der Freiheit in die Augen zu blicken.
Mit der Zeit war ihr das Leben im Käfig erträglicher geworden, hatte sie sich mit dem stumpfen Dahinleben im Gefängnis arrangiert. Diese Ohnmacht hatte etwas seltsam Tröstendes. Je öfter sie sich über das lauwarme Duschwasser oder die harte Matratze beschwerte, desto bewusster wurde ihr, dass sie hier drinnen tun und sagen konnte, was sie wollte – es interessierte niemanden. Ihr Wille bewirkte nichts.
Es war, als strömte das Leben immer langsamer durch ihren Körper, und es fiel ihr zunehmend schwer, sich aufzuraffen. Die Wärter versuchten, sie zu Gesellschaftsspielen oder zu Handarbeiten zu motivieren, und brachten ihr Bücher aus der Bibliothek mit, doch selbst zum Lesen fehlte ihr die Lust. Genauso schien es auch den anderen Frauen zu ergehen. Diejenigen, die nach ihr kamen, traten genau wie sie hass- und schmerzerfüllt ihre Haft an, doch im dritten Monat wurden alle stumpf und sprachen kaum noch miteinander. Zwei der isländischen Frauen waren zur selben Zeit wie Agla ins Gefängnis gekommen, auch sie hatten lange auf den Haftbeginn gewartet. Eine dritte kam aus dem Gefängnis im Norden, und eine weitere Frau hatte lange nach ihnen ihre Haft angetreten. Die ausländischen Häftlinge waren im anderen Frauentrakt untergebracht, einige schon wieder entlassen worden und andere dafür gekommen, doch das interessierte Agla nicht weiter. Sie alle waren Kurierinnen, junge Mädchen aus Osteuropa in Jogginghosen, mit blondierten Haaren und schlechten Englischkenntnissen. Sie blieben unter sich, genau wie die Isländerinnen, nur dass es bei den Ausländerinnen irgendwie lebhafter zuging, auch wenn die Lachanfälle und der Gesang manchmal in Schreie und Schlägereien übergingen.
Anfangs war Agla noch täglich in den Fitnessraum gegangen, hatte die Sprechstunde des Seelsorgers wahrgenommen, einfach nur um mit jemandem zu reden, und hatte sich an ihren Koch-Tagen in der Küche verausgabt. Doch inzwischen hatte sie auch diese Aktivitäten satt, und ihre Mitgefangenen mussten mit Milchreis oder Fleischsuppe vorliebnehmen, für kompliziertere Gerichte hatte sie keinen Nerv mehr. Nicht, dass sie sich beschwert hätten, wahrscheinlich nahmen auch sie den Geschmack des Essens schon längst nicht mehr wahr.
Agla nahm den Nagelknipser aus dem Etui und begann, kleine Löcher in das Bettlaken zu schneiden, um es in Streifen zu reißen. Zwei Streifen brauchte sie sicher, damit der Strick hielt. Sie hatte dies schon vor einiger Zeit geplant. Im Grunde bereits in dem Moment, als ihr der nahende Wechsel in den offenen Vollzug angekündigt worden war, ohne dass sie einen konkreten Tag ins Auge gefasst hätte. Irgendwann an diesem Abend, es musste kurz nach den Fernsehnachrichten gewesen sein, hatte sie gespürt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war. Dieses Gefühl war weder von Traurigkeit noch von Furcht begleitet, sondern glich einer Art Erleuchtungszustand, als hätte sich der Nebel in ihrem Kopf gelichtet und sie sähe zum ersten Mal seit vielen Monaten ganz klar, dass es die richtige Entscheidung war. Das Laken zu zerreißen, dauerte länger als gedacht, und als sie die Streifen aneinandergeknotet und verzwirbelt hatte, kam ein nur halb so langes, mickriges Seil dabei heraus. Sie ließ den Blick schweifen und fand sofort die Lösung, als wäre ihr Geist jetzt, wo es so weit war, offen für andere Möglichkeiten, die ihr vorher nicht in den Sinn gekommen waren. Sie zog das Kabel aus dem Fernseher und zerrte es aus dem Kabelbündel hinter dem Gerät. Das würde gehen. Es wirkte stark genug.
Agla band das Lakenseil zu einer Schlinge, die sich um ihren Hals zuziehen würde, und befestigte sie am Kabel. Sie stand auf und ging zu der Wandheizung neben der Tür. Die Heizung war das Einzige in der Zelle, an dem man etwas festmachen konnte. Hoffentlich ist sie hoch genug, dachte Agla. Sie knotete das Kabel ganz oben an der Heizung fest und zog daran, zuerst vorsichtig, aus Sorge, dass sich die improvisierte Schlinge sofort lösen würde, dann fester und schließlich mit aller Kraft. Es wirkte solide, und sie hoffte, dass sich im letzten Moment nicht doch der Selbsterhaltungstrieb durchsetzen würde und ihre Beine gegen ihren Willen festen Boden unter den Füßen suchen würden.
Für einen kurzen Moment wurde die Stille von einer Amsel durchbrochen, die irgendwo in der Nähe mit dem Nestbau beschäftigt war. Die dicken Mauern vermochten nicht, den fröhlichen Gesang des Vogels gänzlich zu ersticken, und plötzlich überkam sie das Verlangen, an die frische Luft zu gehen und den Duft von knospenden Birken einzuatmen. Doch dieser Wunsch verschwand im selben Moment, in dem der Vogelgesang verstummte, und ihr schossen Bilder von ihrer Mutter und von Sonja durch den Kopf. Die Sehnsucht und der Schmerz, der diese Bilder begleitete, trafen sie so tief, dass der Gedanke, zum letzten Mal derart zu leiden, eine Erleichterung war. Sie würde nie wieder allein dastehen, jenseits dieser Wände, und sich den Kopf darüber zerbrechen, warum Sonja sie verlassen hatte. Sie musste sich nie wieder mit den endlosen Möglichkeiten der Freiheit auseinandersetzen, die sie so oft in die Irre geführt hatten. Es war eine Erleichterung, das Leben hinter sich zu lassen.
Sie stellte sich mit dem Rücken an die Heizung, stülpte sich eine Plastiktüte über den Kopf und legte sich die Schlinge um den Hals. Mit einem erleichterten Seufzen zog sie sie fest. Dann ließ sie sich fallen.
2
Anton fror im Abendwind. Er zog den Reißverschluss seiner Jacke zu und warf einen Blick auf seine Handyuhr. Es war acht Minuten her, dass Gunnar mit dem Moped zum vereinbarten Versteck gefahren war. Nur wegen des Mopeds hatte er Gunnar dabeihaben wollen. Anton hatte überlegt, ob er sich für die Fahrt hierher das Auto seines Vaters leihen sollte, fahren konnte er ja, obwohl er erst fünfzehn war und noch nicht einmal mit der Fahrschule angefangen hatte. Aber mit dem Auto wäre es zu riskant gewesen. Wenn er am Steuer erwischt würde, gäbe es Stress, und hier draußen war ein Mofa ohne Licht auch deutlich unauffälliger.
In der Dunkelheit näherten sich schnelle Schritte, und er drehte sich um. Es war Gunnar, der mit dem weißen Helm auf dem Kopf auf ihn zurannte wie ein riesiger Pilz. Sie hatten beschlossen, die Helme die ganze Zeit über aufzubehalten, um das Risiko zu verringern, dass die Polizei sie anhielt, und auch um unerkannt zu bleiben, falls es auf dem Gelände Überwachungskameras gab. Obwohl es nicht danach aussah. Er hatte die Gegend eine ganze Weile beobachtet und gesehen, dass die Straßenarbeiter über einen Dieselgenerator verfügten, der sie mit Strom und Wärme in den Containern versorgte, aber jetzt war alles dunkel. So dunkel, dass die matten Nordlichter, die am Osthimmel tanzten, beinahe grell wirkten.
Anton schwang sich den Rucksack mit dem Werkzeug auf den Rücken, und sie huschten schnell zum Zaun. Gunnar machte sich sofort daran, mit dem Seitenschneider ein Loch in den Drahtzaun zu schneiden.
»Da passt höchstens ’ne Katze durch«, sagte Anton. »Das Loch muss größer sein. Wir haben nachher volle Rucksäcke.«
»Okay«, sagte Gunnar und schnitt halbherzig ein etwas größeres Loch. Da ihm aber bereits die Kräfte schwanden, nahm Anton ihm die Zange aus der Hand und machte es selbst. Obwohl das Werkzeug für Draht geeignet und noch ganz neu und scharf war, kam er nur langsam voran. Zuerst hatten sie einfach über den Zaun klettern wollen, aber da er oben mit Stacheldraht bewehrt war, wären sie ums Schneiden so oder so nicht herumgekommen, also konnten sie genauso gut unten ein Loch in den Zaun schneiden und sich die Kletterei ersparen, zumal am Boden auch die Wahrscheinlichkeit geringer war, dass sie gesehen wurden.
»Los jetzt«, sagte Anton. Gunnar bog das aufgetrennte Stück Zaun zur Seite, sodass Anton und dann Gunnar durch das Loch kriechen konnte. Im Laufschritt ging es am Baucontainer vorbei zum Lagercontainer. Anton holte die Stirnlampen aus dem Rucksack, die sie sich über die Helme zogen. Er war froh, dass er auf diese Idee gekommen war, denn so sahen sie alles und mussten keine Taschenlampen in der Hand halten.
»Okay«, sagte er. »Legen wir los.« Das ließ Gunnar sich nicht zweimal sagen. Er schwang den Hammer in die Luft und schlug auf das erste Vorhängeschloss ein, während Anton mit einem Schraubenzieher die Beschläge löste. In diesem Punkt waren sie uneins gewesen. Sie hatten oberhalb des Geländes mit einem Fernglas zwischen Grashöckern gelegen, den Container inspiziert und hin und her diskutiert, wie sie die Tür am besten aufkriegten. Es war keine richtige Tür, sondern ein aus Sperrholz zusammengezimmertes Provisorium, das mit Ladenbändern außen an der Türöffnung befestigt war. Schließlich hatten sie sich darauf geeinigt, beide Methoden gleichzeitig anzuwenden und zu sehen, was schneller klappte. Wie sie dort hineinkamen, war Anton egal; die Hauptsache war, dass sie es schafften. Für Gunnar hingegen schien es eine Sache des Prinzips zu sein, die Vorhängeschlösser zu knacken, daher hatte sich Anton auf diesen Kompromiss eingelassen.
»Guck!«, rief Gunnar, als er das erste von drei Schlössern geknackt hatte.
»Super«, sagte Anton und schraubte unbeirrt weiter. Die Schrauben des ersten Ladenbands hatte er bereits gelöst und die des zweiten auch fast. Als er die letzte Schraube herauszog, verschnaufte Gunnar immer noch vom Kampf mit dem ersten Schloss. Anton nahm ihm den Zimmermannshammer aus der Hand, setzte die Klaue an und hebelte die Tür heraus. Es klappte beim ersten Versuch, jetzt hing sie nur noch an den beiden Vorhängeschlössern.
»Yes!«, rief Gunnar. »Du hast gewonnen. Das Eis nachher geht auf mich. Ich lad dich auf ein XL-Softeis ein, Meister!«, rief er aufgeregt und amüsierte sich offenbar prächtig. Anton war überrascht, wie ruhig er selbst war. Er hatte erwartet, dass er nervöser sein würde. Doch er spürte nur ein wohliges Kribbeln, als er den Container betrat und das Licht seiner Stirnlampe auf die Kisten fiel. Das war der erste Schritt in Richtung Ziel. Er kniete sich auf den Boden, öffnete den ersten Behälter und begann, die Dynamitstangen in seinen Rucksack zu stapeln.
3
»Ich stehe aber auf der Besucherliste«, sagte María mit zunehmendem Unmut zu dem Wärter an der Pforte. María hatte den Termin vor geraumer Zeit vereinbart, und sie konnte es nicht glauben, dass Agla sie von der Liste gestrichen hatte. Soweit sie wusste, war sie der einzige Besuch, den Agla bekam. Und obwohl diese Treffen für Agla nicht gerade angenehm waren, sondern Zank und Zwist bedeuteten, kostete sie die gesamte Besuchszeit immer voll aus. Die Besuche von María, die jedes Mal mit einer langen Liste an Fragen kam, auf die Agla größtenteils nicht einging, mussten die einzige Abwechslung in ihrem Haftalltag sein. Jedenfalls ging María davon aus, dass Agla sich deshalb auf die Treffen einließ. Und dass Agla auf einmal ihre Meinung geändert haben sollte, konnte sie nicht glauben.
»Rufen Sie morgen noch mal an, um einen neuen Termin zu vereinbaren«, sagte der Wärter und zupfte an seinem Hemd, um es unter der dicken Wampe zurück in den Hosenbund zu stopfen. »Heute kann Agla keinen Besuch empfangen.«
»Warum nicht?«, hakte María nach. Sie beugte sich vor und stützte sich auf die Ellbogen, um deutlich zu machen, dass er sie so schnell nicht loswürde.
»Sie ist beschäftigt«, antwortete der Wärter, der sich in die Besucherliste vertieft hatte und irgendetwas hineinkritzelte.
»Ich will wissen, warum«, sagte María, »oder sie anrufen und von ihr selbst erfahren, dass sie keinen Besuch möchte.«
Der Wärter seufzte. »Agla kann heute keinen Besuch empfangen. Rufen Sie morgen an.«
»Ich bin Enthüllungsjournalistin und verlange eine Erklärung dafür, warum Agla Margeirsdóttir nicht zu einem vorher vereinbarten Besuchstermin erscheint. Wenn ich keine Antwort kriege, muss ich mich wohl direkt an die Gefängnisaufsicht wenden.«
Der Wärter seufzte noch einmal, diesmal schwerer, und verdrehte die Augen. »Das hier ist nicht Guantanamo, gute Frau. Wir unterliegen der Schweigepflicht, was den Gesundheitszustand der Häftlinge angeht. Ich kann Ihnen lediglich sagen, dass es Agla heute nicht so gut geht. Sie können morgen anrufen und sich einen neuen Termin geben lassen.«
Jetzt seufzte María. Hier kam sie im Moment nicht weiter. Und es wäre unangebracht gewesen, ihren Frust an dem Wärter auszulassen. Wenn sie ehrlich war, gab es keinerlei Hinweis darauf, dass Aglas Absage in irgendeiner Weise verdächtig war. Sie konnte es einfach nur nicht abwarten. Denn sie brannte darauf, Agla ihre Fragen zu stellen. Diesmal ging es um Aglas Verbindungen zu Ingimar Magnússon und dem Pariser Spekulanten William Tedd. Auf beide Namen war sie damals während der Ermittlungen zu Agla gestoßen, als sie für den staatlichen Sonderermittler gearbeitet und Wirtschaftsverbrechen untersucht hatte. In ihrem alten Leben. Bevor die Sache mit Agla indirekt dafür gesorgt hatte, dass sie gefeuert wurde.
Sie ließ die Gedanken fließen, während sie zum Auto lief. Obwohl die Tage schon länger wurden, stand die Aprilsonne noch so tief am Himmel, dass sie blinzeln musste. Zum Glück würden die bläulich weißen, gleißenden Strahlen bald von der milderen Frühlingssonne abgelöst. In diesem Licht wirkte alles so grau und welk nach den Zerstörungen, die der Winter angerichtet hatte. Noch keine einzige Knospe war zu sehen, und die Sonne brannte gnadenlos auf das abgestorbene Gras an den Fleckchen Erde, die von den Bauarbeiten auf dem Gefängnisgelände verschont geblieben waren. Nicht, dass die Jahreszeit für María eine Rolle spielte. Sommerurlaub würde sie ohnehin nicht machen. Dafür fehlte ihr das Geld. Mit ihrem kleinen Online-Nachrichtendienst Íkorninn – Das Eichhörnchen – kam sie dank der paar Anzeigen, die sie verkauft hatte, gerade so über die Runden. Sie hatte noch kein Thema bei namhaften Medien unterbringen können, aber vielleicht war sie jetzt an etwas Großem dran. Zumindest deuteten die Namen William Tedd und Ingimar Magnússon darauf hin.
María setzte sich in ihren Wagen. Der Blick auf den kleinen Kristallengel, der am Rückspiegel baumelte – ein Geschenk von Magnús –, versetzte ihr einen Stich. Ein Jahr war es her, dass er sie verlassen hatte mit den Worten, sie sei nicht mehr der Mensch, den er geglaubt hatte, geheiratet zu haben. Wenn sie die Gründe dafür bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgte, war Agla eigentlich auch an der Trennung schuld. Ihre ganze Welt war zusammengebrochen, als sie beim Sonderermittler rausgeflogen war, und sie war monatelang in einer Art Wolke aus Hass und Unglaube gefangen gewesen. Bis Magnús es aufgegeben hatte. Er erkenne sie nicht wieder, hatte er gesagt. Noch nicht einmal sie selbst erkannte sich wieder. Doch es hatte keinen Zweck mehr, zu viele Gedanken an ihn zu verschwenden, das vermieste ihr nur den Tag. Wenn sie nicht aufpasste und sich in diesen Gedanken verlor, endete sie noch heulend auf den Treppenstufen vor seinem Haus. Was ihr nicht weiterhalf, denn obwohl sie jedes Mal insgeheim darauf hoffte, dass er sie hereinbat und in den Arm nahm, wusste sie, dass er sie mit einer Mischung aus Verachtung und Mitleid ansehen und ihr die Tür vor der Nase zuknallen würde. Sie startete den Motor und überlegte, ob sie den Engel einfach vom Spiegel reißen und in die bucklige Landschaft schmeißen sollte, doch sie brachte es nicht über sich. Vielleicht morgen. Morgen würde sie auch beim Gefängnis anrufen und einen neuen Besuchstermin vereinbaren. Und da sie Agla die Fragen von ihrer Liste jetzt nicht stellen konnte, musste sie eben mit Ingimar anfangen.
4
Sie war ungewohnt grob heute, das gefiel Ingimar. Er war so erschöpft von den Peitschenhieben, dass sie ihm ins Bett helfen musste. Was jetzt kam, war der schönste Teil, der eigentliche Grund, warum er herkam. Die Stunde, die er zwischen Schlafen und Wachen in ihrem Bett lag, überwältigt von seinen eigenen Hormonen, dem Adrenalin, das ihm ins Blut schoss, sobald die ersten Hiebe seinen Rücken trafen, und den Endorphinen, die bei jedem Schlag freigesetzt wurden und ihn irgendwann in eine Art Rausch versetzten. In jüngeren Jahren hatte er geglaubt, die Unterwerfung wäre das, was ihn so anmachte. Gefesselt, geknebelt, aufgehängt und gezüchtigt zu werden, ganz in ihrer Gewalt zu sein. Doch heute wusste er es besser. Es ging ihm um das völlige Ausgeliefertsein danach, wenn sie ihn wimmernd und blutig ins Bett brachte, seinen Rücken mit Heilsalbe einrieb, ihn in die Decke einpackte und ihm beruhigende, tröstende Worte ins Ohr raunte wie eine Mutter ihrem Kind. Dann fühlte er sich geliebt und genoss es, in diesem Bett zu liegen und nichts tun zu müssen, wirklich nichts, um das zu verdienen.
»Jetzt bist du ein braver Junge«, hauchte sie, küsste ihm den Nacken und stand auf, während er wegduselte. Dann lag er in einem traumlosen Halbschlaf, wie lange, wusste er nicht, bis seine Gedanken wieder klar und stringent wurden und er keinen Sinn darin sah, noch länger liegen zu bleiben. Die Entspannung war vorbei. Dann stand er auf und zog seine Hose an, das Hemd nahm er mit in die Küche, wo sie ihn mit einem Lächeln empfing. »Lass mich dich ansehen«, sagte sie und betrachtete seinen Rücken. »Sieht gut aus«, befand sie, reichte ihm das Unterhemd und half ihm hinein. Es brannte wie Hölle, aber das war gut. Er würde das Brennen die nächsten Tage noch unter der Dusche spüren, wenn er sich anzog, und jedes Mal, wenn er sich in einem Stuhl zurücklehnte. So sollte es sein. Er brauchte diese Ermahnung. Die Ermahnung an die Menschlichkeit. Wie die römischen Kaiser, denen ein Sklave hinterherlief, der immer wieder flüsterte: Du bist nur ein Mensch, du bist nur ein Mensch.
»Ich überweise es dir«, sagte er, als er sein Hemd zuknöpfte. Sie half ihm, den obersten Knopf zu schließen, und band ihm dann die Krawatte um.
»Aber nicht zu viel«, sagte sie. »Du gibst mir immer zu viel.«
»Weil ich dankbar bin«, sagte er.
»Du bist noch im Rausch, wenn du die Überweisung machst, deshalb überweist du mir immer viel zu viel.«
»Nicht mehr, als du verdient hast«, sagte er und küsste sie auf die Wange.
»Sei ein braves kleines Würmchen und tu, was ich dir sage.« Sie zwinkerte ihm zu und fügte lächelnd hinzu: »Ansonsten setzt’s was …«
Er verneigte sich übertrieben. »Ja, Madam!« Was das anging, waren sie ein eingespieltes Team. Sie spürte genau, wann sie über das Spiel zwischen ihnen scherzen konnte und wann Ernst vonnöten war, damit die Wirkung nicht verpuffte.
»Meld’ dich, wann immer du willst«, sagte sie und hielt ihm die Tür auf. Er warf ihr von der Treppe einen Luftkuss zu und wunderte sich mal wieder, wie anders er sich fühlte als noch vor gut zwei Stunden. Er war stressgeladen und gedanklich auf Hochtouren hier angekommen, und jetzt war er ruhig und klar im Kopf, als wäre seine Seele frisch gebadet.
Er startete den Motor und drehte die Heizung auf. Es war nicht besonders kalt draußen, aber der Schauder nach den Peitschenhieben hielt immer einige Stunden an. Sein Handy meldete einen Anruf in Abwesenheit und zwei Nachrichten. Alles von derselben Nummer. Er öffnete die erste Nachricht, ein langer Text von einer Journalistin namens María. Er stöhnte. Er wusste genau, wer diese María war. Eine ehemalige Mitarbeiterin des staatlichen Sonderermittlers, die in Ungnade gefallen war und jetzt als freie Journalistin eine investigative Internetseite betrieb, mehr aus Trotz denn aus Können. Eine von denen, die überall Verschwörungen witterten und die harmlosesten Zusammenhänge in ein verdächtiges Licht stellten. Die Nachricht enthielt eine Flut von Fragen zu ihm und Agla und ihren geschäftlichen Beziehungen. Diese Fragen könnte er schnell beantworten. Im Moment gab es keinerlei Beziehung. Diese hatten sie vor einigen Jahren beendet, und sie gingen sich seitdem tunlichst aus dem Weg.
In der zweiten Nachricht ging die Fragerei weiter. Wie blauäugig dieses Mädel war. Sie ging doch wohl nicht davon aus, dass er ihr per SMS antwortete? Normalerweise ignorierte er Journalisten und hätte auch diese Nachrichten sofort gelöscht. Doch die letzte Frage irritierte ihn: Was für Geschäfte treiben Sie und William Tedd mit isländischen Aluminiumwerken?
5
Sie hatte nicht geglaubt, dass es ihr noch schlechter gehen könnte als in den letzten Wochen, bevor sie sich an der Heizung mit der Schlinge um den Hals hatte fallen lassen. Doch das war wie ein Tanz auf Rosen gewesen im Vergleich dazu, nach einem gescheiterten Selbstmord wieder aufzuwachen. Der Schmerz, sich im Leben wiederzufinden, nachdem man sich endgültig von ihm verabschiedet hatte, war so unerträglich, dass sie noch nicht einmal sauer auf sich selbst sein konnte, weil sie es vermasselt hatte. Als sie die Augen öffnete und alles um sie herum weiß war, wusste sie, dass sie im Krankenhaus lag, daher schloss sie die Augen schnell wieder in der Hoffnung, zurück in die Bewusstlosigkeit des Schlafs abzutauchen. Doch vergeblich. Sie war aufgewacht, und neben ihr saß Wärterin Guðrún und las Zeitung.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Guðrún und klingelte nach der Schwester. Eine absurde Frage angesichts der Umstände, auf die es nur eine Antwort gab. Schlecht. Agla versuchte, sie laut auszusprechen, doch sie kriegte kein Wort heraus. Nur ein undeutliches Pfeifen, das wie der Laut eines Tieres klang. Eines wütenden, verletzten Tieres. Eine Frau in weißem Kittel kam herein und beugte sich über sie.
»Versuchen Sie, nicht zu reden«, sagte sie. »Ruhen Sie sich aus, und trinken Sie Eiswasser. Ihre Luftröhre ist noch sehr geschwollen, bis gerade eben hingen Sie am Beatmungsgerät, auch deshalb schmerzt Ihr Hals. Ich bringe Ihnen Wasser und ein Schmerzmittel. Später kommt dann noch der Arzt vorbei und spricht mit Ihnen.« Sie sah Agla in die Augen, und bevor sie ging, legte sie lächelnd ihre Hand auf Aglas Arm und drückte ihn kurz. Diese kleine freundliche Geste traf Agla wie ein Schlag in den Magen. Sie spürte, wie ihr Tränen aus den Augenwinkeln quollen und aufs Kissen liefen. Normalerweise war ihr Selbstmitleid fremd, aber eine schlimmere Niederlage konnte man nicht erleiden. Ein gescheiterter Tod war der endgültige und vollständige Beweis für ein gescheitertes Leben.
Die Krankenschwester kam mit einer Spritze zurück und injizierte ihr das Schmerzmittel über einen Zugang im Handrücken. Dann fischte sie mit einem Löffel einen Eiswürfel aus einem Wasserglas und hielt ihn Agla vor die Lippen. Wie ein braves Kind öffnete Agla den Mund, und als der Eiswürfel auf ihrer Zunge lag, merkte sie, wie das Morphium in ihren Körper strömte. Schlagartig war alles nur noch halb so schlimm. Sie hörte auf zu weinen und meinte, in der Nähe von Wärterin Guðrún, die sich wieder in ihre Zeitung vertieft hatte, ein Gefühl von Sicherheit zu empfinden.
Agla schrak auf, als sie die tiefe Stimme des Arztes hörte, die im Vakuum ihres Bewusstseins immer lauter wurde. Vielleicht stand er schon eine Weile neben ihrem Bett und redete.
»Sie haben wahnsinniges Glück gehabt«, sagte er. »Denn der Strick hat sich in die Länge gezogen, sodass in Ihrer sitzenden Position nicht das gesamte Gewicht auf dem Hals gelastet hat. Ansonsten hätten Sie sich das Genick gebrochen und das Rückenmark verletzt. Aber da sich der Strick in die Länge gezogen hat und Sie auch nicht lange dort hingen, sprechen wir lediglich von leichten Verletzungen an den Atemwegen, Schwellungen und Blutergüssen. Sogar Ihre Luftröhre ist in einem recht guten Zustand. Sie bleiben noch eine Nacht zur Beobachtung hier, und morgen können Sie dann nach Hause.« Sein Blick fiel auf Wärterin Guðrún, und er räusperte sich verlegen. »Also ich meinte, Sie werden dann morgen entlassen.«
Statt zu nicken, zwinkerte Agla ruhig mit den Augen, denn ihr Hals war steif. Auf dem Weg zur Tür drehte sich der Arzt noch einmal um. »Nachher kommt auch noch ein Psychologe vorbei, das ist in solchen Fällen vorgeschrieben.« In solchen Fällen, wiederholte Agla im Stillen. Warum sagte er nicht einfach: Wenn Leute versuchen, sich abzumurksen?
6
Júlía kam von hinten, als er auf der Schultreppe stand, und schob ihren kleinen Finger in seine Hand. Er antwortete, indem er seinen kleinen Finger mit ihrem verhakte. Das war ihr Zeichen. Ihre Art, auszudrücken, was zwischen ihnen war, und gleichzeitig das Höchstmaß an intimer Berührung. Alles Weitere hatte man ihnen verboten, was natürlich total peinlich gewesen war, aber grundlegend nichts änderte. Sie dürften sich weiterhin so viel sehen, wie sie wollten, hatte ihr Vater seinem Vater gesagt, als er bei ihm aufgekreuzt war, um über »diese Sache« zu reden. Sogar besuchen durften sie sich, solange ihre Zimmertüren offen blieben.
Antons Vater hatte nur mit großer Mühe seine Verwunderung verborgen und Júlías Vater hektisch mit Kaffee und Keksen den Mund gestopft. Doch schließlich hatte er ihm zugestimmt, zu Antons großem Erstaunen, der mit einer schroffen Abfuhr seitens seines Vaters gerechnet hatte. Stattdessen hatte er ihm beigepflichtet und Anton in strengem Ton erklärt, wenn ihm das Mädchen wichtig sei, dann könne er warten. Und das konnte Anton. In der Schule wussten alle, dass sie zusammen waren, daher würde es keiner der anderen Jungs wagen, ihr nahe zu kommen, und sie war ihm sicher. Das süßeste Mädchen der ganzen Schule. Das allersüßeste Mädchen, das er je gesehen hatte. Natürlich brachen sie die Regeln, sie küssten sich und schmusten, wenn niemand guckte, was aber selten vorkam, denn er merkte, dass sie sich unwohl fühlte, wenn sie sich ihrem Vater widersetzte, und er wollte keinen Druck auf sie ausüben. Das hatte sein Vater ihm eingeschärft: Wenn er ein Mädchen halten wollte, musste er dafür sorgen, dass es sich bei ihm sicher fühlte.
Und er wollte, dass sie sich bei ihm sicher fühlte. Er wollte alles dafür tun, dass sie bei ihm dieses Gefühl von Sicherheit hatte. Er drückte zart ihren kleinen Finger und sah sie an. Sie lächelte.
»Wollen wir morgen ins Kino gehen?«, fragte sie.
»Dinner and a movie«, sagte er und zwinkerte ihr zu. Das bedeutete Burger oder Kebab, und danach würden sie mit dem Bus zum Kino fahren. Bald hatte sie Geburtstag, da wollte er sie schick zum Essen ausführen, in Hemd und Krawatte, und seinen Vater um einen finanziellen Zuschuss fürs Essen und die Fahrt bitten. Dann hätte er ihr sein Geschenk bereits übergeben. Seit Wochen träumte er von diesem Abend, und er war sich sicher, dass es der schönste Moment in ihrer beider Leben sein würde.
»Wir hören uns heute Abend«, sagte sie, als Gunnar mit seinem Moped an die Treppe herangefahren kam, noch ganz dreckig von ihrem gestrigen Ausflug.
»Ja, bis heute Abend«, sagte Anton und drückte ein letztes Mal ganz fest ihren kleinen Finger. Das müssten sie eigentlich nicht sagen, denn sie hörten sich jeden Abend, schrieben sich ständig Nachrichten und chatteten miteinander. Sie war auch das witzigste Mädchen, dem er je begegnet war.
Er schwang sich hinter Gunnar aufs Moped und hielt sich an seiner Jacke fest, als Gunnar losbretterte. Sie hatten sich nach der Schule verabredet, um das Dynamit an einen sichereren Ort zu bringen. Und um die Sache mit den Sprengkapseln zu klären. Er hatte damit gerechnet, dass in dem Container auch Sprengkapseln lagern würden, aber Fehlanzeige. Sie hatten den Container bis in den letzten Winkel durchsucht. Also mussten sie eine andere Lösung finden, das Dynamit zu zünden.
7
»Falls dich eine isländische Journalistin namens María kontaktiert, lass dir von ihr keine Fragen stellen«, sagte Ingimar, nachdem er und William sich begrüßt hatten. Den Hintergrundgeräuschen nach zu urteilen, ging William mal wieder irgendwelchen Vergnügungen nach. Er war ein berüchtigter Lebemann, der sich kein Event entgehen ließ. Was das betraf, kam er Ingimar wie eine jüngere Ausgabe seiner selbst vor. Früher hatte er auch so viel Energie gehabt. Konnte bis in die Nacht Party machen und nach drei Stunden Schlaf putzmunter in einen stressigen Arbeitstag starten. Für ihn waren diese Zeiten endgültig vorbei, aber bei William sah es offenbar anders aus.
»Ich bin auf dem Geburtstag einer Bekannten«, sagte er mit seinem starken amerikanischen Akzent. »Du würdest hier auch auf deine Kosten kommen.« Ingimar wusste, was das bedeutete. Guter Wein und sexy Frauen. Er betrachtete im Rückspiegel sein grau meliertes Haar. Einen kurzen Moment befiel ihn Sehnsucht nach diesem Leben, das er eigentlich gar nicht vermisste. Heute konnte er zu jeder Tageszeit Wein schlürfen, ohne es groß zu spüren, und hinter Frauen war er nicht mehr wirklich her. Sie zählte nicht dazu. Und hinter ihr war er auch nicht her. Das war etwas anderes.
»Ansonsten läuft es blendend«, sagte Ingimar. »Diese María schnüffelt nur ziellos herum, aber ich wollte dich vor ihr warnen. Sie ist eine dieser nervigen Personen, die nicht merken, wann es genug ist. Sie versucht, Agla mit unserem Projekt in Verbindung zu bringen, aber die müssen wir da unbedingt raushalten.«
»Was hast du gegen Agla?«, fragte William lachend, und wie um zu unterstreichen, dass er sich gerade prächtig amüsierte, wurde die lässige Salsamusik im Hintergrund noch lauter.
»Ich habe überhaupt nichts gegen Agla«, erwiderte Ingimar. »Ganz im Gegenteil. Aber wenn sie von unserem Projekt Wind bekommt, verschwindet mehr als die Hälfte des Profits in ihrer Tasche, ehe wir überhaupt kapieren, was Sache ist.«
William prustete los. »Gut beschrieben!«, sagte er. »Und jetzt komm schnell nach Paris, mein Lieber. Ich bin gerade an einem heißen Mädel dran – und es gibt eine Zwillingsschwester. Das könnte ein unvergessliches Doppel-Date werden!«
Ingimar musste schmunzeln. Er beneidete William um seine Lebensfreude. Diese Amerikaner waren so herrlich dreist, wenn es um ihr persönliches Glück ging.
»Wir hören uns«, sagte Ingimar und legte auf. Es wäre natürlich nett, nach Paris zu jetten und sich von Williams Partylust anstecken zu lassen. Doch in den letzten Jahren war es, als hätte das Leben ihn eingeholt, und eine Verantwortung, wie er sie nie gekannte hatte, lastete auf seinen Schultern. Er musste für Anton da sein, angesichts des Zustands seiner Mutter. Er holte tief Luft und stieg aus dem Wagen. Die wenigen Schritte zum Haus fielen ihm ungeahnt schwer. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete leise die Tür. Drinnen war alles still, doch er spürte geradezu, wie ihm der üble Geruch des Unglücks in die Nase stieg, der dieses Haus erfüllte.
8
María schämte sich jedes Mal, wenn sie das Gebäude betrat, in dem sie sich ihr Íkorninn-Büro eingerichtet hatte, auf derselben Etage wie ihr Vermieter, der patriotische Radiosender Edda, der nur schlechte isländische Musik spielte und laut seiner Polit-Talkshows das Ziel verfolgte, diversen Minderheiten in Island die Menschenrechte abzusprechen. Am liebsten hätte sie sich irgendwo anders eingemietet, aber das konnte sie sich nicht leisten. Die Miete hier lag weit unter dem, was so zentral sonst üblich war, und es ersparte ihr viel Fahrerei, dass sie nicht irgendwo an den Stadtrand gurken musste. Aber sie verspürte immer den Drang, ihr Gesicht abzuschirmen, wenn sie das Gebäude betrat oder verließ, denn über dem Eingang prangte der Name des Radiosenders mit dem Slogan Island den Isländern.
Sie hatte ihr Büro kaum betreten, als Marteinn hinter ihr durch die Tür gepoltert kam. »Braune Umschläge, María, braune Umschläge voller Geld, die sich die Freimaurer bei ihren Versammlungen zuschieben. Bei den Freimaurerversammlungen, María!« Sie sah ihn prüfend an. Er hatte wieder diesen seltsamen Glanz in den Augen, der ihn wie ein scheues Pferd wirken ließ und ein sicheres Anzeichen dafür war, dass er auf einen psychotischen Anfall zusteuerte.
»Mein lieber Marteinn«, sagte sie. »Solltest du nicht so schnell wie möglich in die Klinik?«
»Nein«, sagte er und setzte sich an seinen Schreibtisch. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass er ihr Mitarbeiter war. Er war ein Sonderling, der kam und ging, wie er wollte. María ließ ihn unter dem Titel Stimme der Wahrheit täglich einen Artikel auf ihrer Internetseite veröffentlichen, außerdem half er ihr bei der Recherche. Wenn er gut drauf war, spürte er geschickt alle möglichen Informationen auf, und obwohl María den Verdacht hegte, dass er sich manchmal in verschlüsselte Netzwerke einhackte, um an Infos heranzukommen, hatte sie es längst aufgegeben, sich in seine Arbeitsmethoden einzumischen. Streng genommen war er ja auch gar nicht ihr Mitarbeiter, denn er wollte kein Honorar, und es war natürlich nützlich, dass sich jemand so reinhängte. Er schrieb unterhaltsam verschrobene Artikel, die oft eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit erfuhren, und es war ein schönes Gefühl, einen Mitstreiter zu haben. Wenn sie zusammen Kaffeepause machten und sich über seine neuesten Verschwörungstheorien unterhielten, fühlte es sich für María fast wie ein richtiger Job in einem richtigen Unternehmen an.
»Müssten deine Medikamente nicht noch mal neu eingestellt werden? Vielleicht machst du dich jetzt sofort auf den Weg, bevor die Klinik zumacht?«
»Nein«, antwortete er mit Nachdruck und beugte sich über seinen Computer, der wie ein Vogeljunges in einem Nest aus allem möglichen Kram auf seinem Schreibtisch thronte. »Zuerst muss ich diesen Artikel fertig schreiben.«
»Du hast mir schon Artikel für die ganze nächste Woche abgeliefert«, sagte María.
»Aber hier geht es um Bestechungsgeld, das gezahlt wird, um sicherzustellen, dass die Messungen der Umweltbelastung in der Nähe des Aluminiumwerks im Rahmen bleiben. Das spielt sich alles bei den Versammlungen der Freimaurer ab, María. Das müssen die Menschen erfahren!«
María seufzte. Ungefähr zweimal am Tag kam er mit einer neuen Verschwörungstheorie an, die meisten hatten mit den Freimaurern zu tun. Doch sie musste zugeben, dass sie oft sogar Freude daran hatte, und manchmal stieß er tatsächlich auf Themen, die nicht allzu abgefahren waren und so interessant wirkten, dass sie sich näher damit befasste. Allerdings waren seine Informationsquellen nicht immer die verlässlichsten.
»Woher hast du das?«, fragte sie.
»Was?« Er hob den Kopf und sah sie mit leerem Blick an. »Woher hab ich was?«
»Dass braune Umschläge mit Geld dafür sorgen, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden.«
»Ach das«, sagte er, wandte sich wieder seinem Computer zu und haute energisch in die Tasten. »Hab ich geträumt.«
María seufzte. Sie stand auf, eilte zur Toilette auf dem Flur und schwor sich, zu zählen, wie oft sie an diesem Tag musste. Es war nicht mehr normal, wie oft sie zur Toilette rannte und wie dringend es dann war. Jetzt zum Beispiel war es erst eine Minute her, dass sich ihre Blase überhaupt gemeldet hatte, und schon jetzt musste sie so nötig, dass sie befürchtete, sich in die Hosen zu machen, wenn diese verdammte verbeulte Metalltür nicht endlich zuging. Sie trat gegen die Tür, bis sie endlich schloss, und sank erleichtert auf die Toilette.
Sie machte sich ernsthaft Sorgen um Marteinn. Wenn er nicht von sich aus ging, musste sie ihn in die Psychiatrie bringen. Das wäre nicht das erste Mal. Sie hatte schon mehrmals ihren Tag damit zugebracht, ihn im Wartebereich irgendwie ruhig zu halten, bis er an der Reihe war. Es zahlte sich aus, ihn in Ärztehand zu übergeben, bevor er völlig durchdrehte, denn dann traute er nichts und niemandem mehr über den Weg. Sie selbst eingeschlossen.
9
»Agla, Mensch …«, sagte Ewa, die neue polnischstämmige Wärterin, als Agla am nächsten Morgen zum Wachbüro kam, in Begleitung von Guðrún, die Ewa eine Tüte mit Aglas Medikamenten in die Hand drückte, die in eine Pillenbox umgefüllt werden sollten. Agla hatte immer noch Schwierigkeiten mit dem Sprechen, daher nickte sie Ewa nur kurz zu und senkte den Blick. Sie war noch völlig durch den Wind und verspürte den Drang, sich bei Ewa zu entschuldigen, als wäre sie ihr als Dank für die Freundlichkeit, die sie Agla seit Dienstbeginn entgegengebracht hatte, eine Erklärung schuldig. Vorsichtig, als ob Agla zerbrechlich wäre, schob Ewa die Hand unter ihren Arm und führte sie zum Frauentrakt.
»Sagen Sie mir, wenn Sie irgendetwas brauchen«, raunte sie ihr zu. »Egal, was, ob klein oder groß. Das biegen wir schon hin.« Agla lächelte matt. Ewa konnte noch so motiviert sein, ihr Leben musste sie schon allein wieder zurechtbiegen. Ewa konnte nicht Aglas falsche Entscheidungen rückgängig machen, nicht die Dinge zu Ende bringen, die sie hatte laufen lassen, nicht die Zeit um einige Jahrzehnte zurückdrehen. Und sie konnte auch nicht ihren Liebeskummer wegen Sonja heilen, der höchstens mal für einen kurzen Moment in den Hintergrund rückte. Dabei war es inzwischen vier Jahre her, dass Sonja verschwunden war, sich mit einer einzigen kurzen Textnachricht aus Aglas Leben verabschiedet hatte. Sie könne das nicht. Agla hatte wie betäubt auf einem ungeöffneten Pappkarton in dem riesigen Haus gesessen, das sie für Sonja und sich gekauft hatte, und in Gedanken ihre gesamte Beziehung wie einen Film abgespielt, immer wieder, auf der Suche nach einer Erklärung. Selbst jetzt, nach mehreren Jahren, verstand sie nicht, warum Sonja sie verlassen hatte, und es schmerzte immer noch, wenn sie an diese Abfuhr dachte.
Am Eingang zum Frauentrakt drückte Ewa zum Abschied noch einmal leicht Aglas Arm. Agla ging zu ihrer Zelle. Die Tür stand offen, und als ihr gerade der verrückte Gedanke durch den Kopf schoss, dass vielleicht noch die Schlinge an der Heizung hing, blieb sie verdattert stehen. Jemand lag auf ihrem Bett.
»Hi!«, sagte das Mädchen und richtete sich auf. »Du bekommst jetzt Suizidüberwachung und musst in die Sicherheitszelle, daher habe ich jetzt deine Zelle gekriegt.« Agla starrte die junge Frau an, dann wanderte ihr Blick durch den Raum. Es schien, als wäre die Realität wie in einem Traum einfach beiseitegeschoben und verdreht worden. Überall auf dem Boden lagen Klamotten, eine offene Reisetasche stand auf dem Schreibtisch, und das Bett war mit leeren Verpackungen von allen möglichen Süßigkeiten zugemüllt. »Hast du versucht, dich abzumurksen?«, fragte sie und schob sich ein Stück Schokolade in den Mund. »Sorry, aber ich hab in Holland gesessen und ’ne Therapie gemacht, seitdem bin ich süchtig nach Süßkram.«
Agla öffnete den Mund und wollte fragen, wer sie war, aber dann ließ sie es bleiben. Sie kriegte immer noch keinen richtigen Ton heraus, und das Flüstern tat weh. Außerdem war es ihr egal, wer dieses verlotterte, abgemagerte Miststück war, das ihr das Zimmer geklaut hatte. Sie machte auf dem Absatz kehrt und lief zur letzten Zelle, direkt am Eingang zum Frauentrakt, und fand dort ihre Sachen. Eine der Wärterinnen hatte im Bad ihre Kosmetika aufs Regal gestellt und ihre Bücher auf den Tisch gestapelt. Ihre Kleidung lag noch immer ordentlich gefaltet in einem Pappkarton. Agla ließ sich aufs Bett fallen und starrte das allwissende Auge der Überwachungskamera an, das unter der Glaskuppel an der Decke blinkte. Dieser ganze Schlamassel wollte nicht aufhören. Jetzt würde ihr Leben die nächsten Tage oder Wochen live aufgezeichnet.
10
Ingimar saß eine Weile bei Rebekka auf der Bettkante und sah ihr beim Schlafen zu. Sie lag noch in derselben Position wie gestern Abend da, als er zuletzt nach ihr gesehen hatte, auf der linken Seite, den Kopf auf dem linken Arm und den rechten Arm ausgestreckt auf dem Nachttisch. Der Ehering an ihrem Finger hatte sich verdreht, und die Diamanten waren an der Innenseite ihrer Hand. Das hier hatte er nicht geahnt, als er ihr vor achtzehn Jahren diesen Ring an den Finger gesteckt hatte. Das war das Dumme an der Leidenschaft, sie raubte einem den Blick dafür, was das Beste für einen war. Er für seinen Teil wäre definitiv besser ledig geblieben.
Es würden noch Stunden vergehen, ehe sie aus ihrem Medikamentendusel erwachte, und bestimmt würde sie dann nach der Pillenschachtel auf dem Nachttisch greifen und weiterschlafen. Er strich ihr eine Strähne hinters Ohr. Sie murmelte nur leise irgendetwas, rührte sich aber ansonsten nicht. Aus ihrem Mund tropfte ein feiner Spuckefaden auf das Kopfkissen.
Ingimar stand auf und ging in sein Badezimmer, das ursprünglich mal das Gästebad gewesen war, als sie noch im selben Zimmer geschlafen hatten. Sie hatten nie vorgehabt, in getrennten Zimmern zu schlafen. Aber wenn sie so zugedröhnt war, konnte er einfach nicht neben ihr liegen. Dann wachte er ständig auf, weil sie sich nicht rührte, und wenn er dann sah, dass sie immer noch in derselben Position wie vor Stunden dalag, fühlte er sich beklommen. Er musste jedes Mal das Ohr an ihr Gesicht halten, um sicherzugehen, dass sie noch atmete, ehe er wieder einschlafen konnte.
Eines Nachts war er deshalb auf die Schlafcouch im Gästezimmer umgezogen, wo er wie ein Stein geschlafen hatte, als ginge ihn der schwache Atem seiner Frau im Nachbarzimmer nichts mehr an. Wenig später hatte er das Schlafsofa durch ein richtiges Bett ersetzt. Seitdem war das Gästezimmer sein Schlafzimmer und das Gästebad sein Badezimmer. Gäste bekamen sie ohnehin keine mehr.
Er ging nach unten, stellte die Kaffeemaschine an und machte Kakao für Anton, brachte ihn nach oben und saß dann an seinem Bett, während der Junge aufwachte. Seit er Teenager war, konnte er morgens ewig schlafen. So war es bei ihm nie gewesen. Er war morgens immer früh wach und voller Tatendrang gewesen, sein ganzes Leben lang. Aber das konnte man auch nicht vergleichen. In Antons Alter hatte er schon auf einem Fischerboot gearbeitet. Als Anton sich aufsetzte, ging Ingimar ins Bad, schmierte sich Rasierschaum ins Gesicht, während die Dusche heiß wurde, und rasierte sich wie immer unter dem Wasserstrahl die kurzen Stoppeln ab. Die Haut am Rücken brannte, daher duschte er sich so eiskalt ab, dass ihm der Atem wegblieb.
Nachdem er sich angezogen hatte, verabschiedete er sich von Anton und goss sich unten in der Küche Kaffee in einen Pappbecher, den er mitnahm. Er zog seinen Mantel an, legte sich den Schal locker um den Hals und schloss hinter sich die Tür. Es tat gut, die kühle Luft einzuatmen, und einen Moment lang hatte er das Gefühl, als würde er aus Wasser auftauchen, seine durstige Lunge gierte nach Sauerstoff, und auch sein Kopf fühlte sich leichter an unter freiem Himmel.
Es war schon merkwürdig, dass sein Leben gleichzeitig mit dem Kollaps kollabiert war. Nicht, dass ihm der Bankencrash finanziell zugesetzt hätte, ganz im Gegenteil, es gab mehr Gelegenheit für gute Geschäfte denn je, und die Gewinne fielen höher aus als gedacht, aber in anderer Hinsicht hatte er einen Kollaps erlitten. Einen innerlichen. Nachdem er den dummen Fehler gemacht hatte, mehrere Male mit derselben Frau zu schlafen, sich verliebt und den Entschluss gefasst hatte, sich scheiden zu lassen, war ihm aufgegangen, dass er das nicht konnte. Er konnte Rebekka in diesem Zustand nicht verlassen, in den er sie, wenn auch indirekt, gebracht hatte. Und auch Anton konnte er nicht zurücklassen. Denn obwohl der Junge seiner Mutter eindeutig zu verstehen gab, wie sehr ihn die Situation nervte, wusste Ingimar sehr wohl, dass er, wenn es hart auf hart kam, bei seiner Mutter bleiben würde. Für ihn war es genauso schwierig wie für Inigmar, er konnte sie einfach nicht verlassen.
Ingimar beschleunigte seinen Schritt, doch dann piepte das Handy in seiner Manteltasche, und er wurde wieder langsamer. Er warf einen Blick auf das Display. Diese verdammte Journalistin wollte einfach nicht aufgeben. Diesmal fragte sie, welche Summen unter der Hand geflossen seien, damit die Grenzwerte des Aluminiumwerks nicht überschritten wurden. Er grinste. Diese Frau betrieb einen merkwürdigen Journalismus. Sie produzierte eine Verschwörungstheorie nach der anderen in der Hoffnung, dass sie irgendwann zufällig ins Schwarze traf.
11
Anton bekam immer mit, wenn sein Vater morgens nach unten ging, aber es war so gemütlich, im warmen Bett liegen zu bleiben und ihn unten hantieren zu hören, dass er sich nicht rührte, sondern so tat, als schliefe er noch, bis der Kakao kam. Jeden Morgen dieselbe Routine. Zuerst hörte er den Briefschlitz klappern, wenn Papa die Zeitung herauszog, dann floss Wasser, und kurz darauf röchelte die Kaffeemaschine. Wenn die Mikrowelle piepte, folgten kurz darauf Schritte auf der Treppe. Dann öffnete sich Antons Zimmertür, Papa stellte den Kakaobecher auf den Nachttisch und setzte sich ans Fußende.
»Guten Morgen, mein Großer«, sagte er. Immer dieselbe Begrüßung, und dann schob er seine Hand unter die Bettdecke und streichelte Antons Bein. Nach einer Weile verkündete er, wie spät es war.
»Es ist Zeit, aufzustehen«, sagte er dann und streichelte in aller Ruhe weiter sein Bein. Manchmal sagte Anton »Hi« zu seinem Vater, aber wenn er einen faulen Tag hatte, was meist der Fall war, streckte er ihm einfach nur das andere Bein hin, damit er auch das streichelte. Irgendwann klopfte Papa kurz auf die Decke, verschwand in sein Zimmer, und kurz darauf stellte er die Dusche an. Dann griff Anton nach seiner Kakaotasse.
Morgens stand immer nur Papa mit ihm auf, jedenfalls war das so, seit er denken konnte. Ganz schwach erinnerte er sich daran, wie er mit Mama im Schlafanzug gespielt hatte, als er noch ganz klein gewesen war, aber je älter er wurde, desto kürzer wurden Mamas wache Momente. Gestern zum Beispiel hatte sie ihn schon vor dem Abendessen – natürlich kein richtiges Abendessen, sondern nur Pizza – genervt und ihm seinen falschen Dativgebrauch unter die Nase gerieben. Er würde es ja gern richtig machen, aber er kapierte es einfach nicht. Kurz darauf war sie schlafen gegangen, und vor Mittag würde sie nicht wieder aufwachen. Ihr Tag dauerte also immer nur wenige Stunden, aber die Nächte wurden immer länger, je düsterer es in ihr aussah.
Anton brauchte genauso lange für den Kakao wie Papa fürs Duschen, Rasieren und Anziehen. Ungefähr dann, wenn er die Zunge in den dicken Kakao-Bodensatz im Becher tunken wollte, steckte Papa den Kopf zur Tür herein und sagte, während er seine Krawatte knotete:
»Einen schönen Tag!«
»Ja, du auch«, antwortete Anton und stieg aus dem Bett. Er wusste schon, dass es eigentlich dir auch hieß, aber er sagte immer du auch, weil er es genoss, dass Papa ihn nie verbesserte.