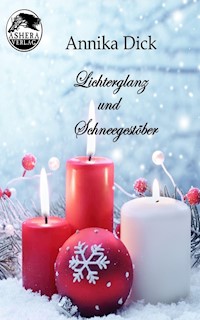4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ashera Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs, ein Straßenkater, der unter ein Auto kam. Zwei verletzte Seelen, die in der Vorweihnachtszeit in einem kleinen Cottage auf der Isle of Skye von einem Tierarzt mit dem Namen einer Disneyfigur zusammengebracht werden. Beide können ein Wunder gut gebrauchen. Wenn nicht in der Vorweihnachtszeit, wann dann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Table of Contents
Titelseite
Impressum
Widmung
Prolog
Teil 1
Kapitel 1 - Menschenmüde
Kapitel 2 - Ein Lichtblick in der Dunkelheit
Kapitel 3 - Willkommen auf Skye
Kapitel 4 - Ruhe und Stille
Kapitel 5 - Katzenhölle
Teil 2
Kapitel 6 - Ein neuer Mitbewohner
Kapitel 7 - Katzenparadies
Kapitel 8 - Der erste Schritt
Kapitel 9 - Panik
Teil 3
Kapitel 10 - Weihnachtsbäckerei
Kapitel 11 - Feenbrot und Schmetterlinge
Kapitel 12 - Weihnachtsbaum und Katzenjammer
Kapitel 13 - Bleib
Kapitel 14 - Fröhliche Weihnachten, Molly
Epilog
Zitat
Nachwort
Die Autorin
Annika Dick
er ater, er ein
eihnachtswunder bra(u)cht
Ashera Verlag
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Erste Auflage im Dezember 2022
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Ashera Verlag
Hauptstr. 9
55592 Desloch
www.ashera-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder andere Verwertungen – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlags.
Covergrafik: AdobeStock
Innengrafiken: Adobestock, pixabay
Coverlayout: Atelier Bonzai
Redaktion: Alisha Bionda
Lektorat & Satz: TTT
Printed by: Booksfactory
Vermittelt über die Agentur Ashera
(www.agentur-ashera.net)
Für Dich.
Auch wenn es sich so anfühlt, du bist nicht allein!
rolo
Das Knurren war eindeutig zu dicht hinter ihm. Er hatte gewusst, welches Risiko er einging, als er sich in Einohrs Revier vorgewagt hatte, doch sein kleiner Magen war einfach zu leer gewesen, um auf seine Furcht zu hören. Einohr war alt und fett und, so hatte er gehofft, träge genug, um ihm den mickrigen Fisch zu überlassen, den er sich aus einer der Mülltonnen geschnappt hatte.
Seine Hoffnung hatte ihn betrogen. Alt und fett mochte Einohr sein, doch träge keinesfalls. Das musste er jetzt lernen. Er konnte nur hoffen, dass es nicht seine letzte Lektion sein würde.
Er wagte nicht, sich umzusehen. Das würde Zeit kosten. Zeit, die er nicht hatte. Ein weiteres Fauchen, dicht hinter ihm. Er rannte, so schnell ihn seine kleinen Beinchen trugen. Sein Herz pochte laut in der Brust, beinahe lauter als das böse Knurren. Seine Lungen bebten vor Anstrengung. Sollte er es heil aus Einohrs Revier schaffen, würde er sich drei Tage lang nicht regen, versprach er sich. Aber erst einmal musste er es schaffen. Er musste viel schneller sein. Er musste sich einfach mehr anstrengen.
In seiner Verzweiflung wagte er sich sogar zwischen den Menschen hindurch, die er sonst mied. Zwischen ihren Beinen sprang er hindurch und versuchte so, Einohr zu entweichen. Einigen Menschen entfuhr ein Ausruf, als er an ihnen vorbeihastete. Er hatte keine Zeit, darauf zu reagieren. Die Menschen würden ihn nicht fangen. Nicht heute. Heute hatte er größere Probleme.
Ein schrilles Fauchen, ein ich hab dich gleich.
Er rannte zwischen zwei Menschenbeinen hindurch und schlug einen Haken. Hinaus auf den wasserlosen Fluss, den die Menschen in ihren Monstern überquerten. Heute war er waghalsig. Bitte, lass Einohr zu viel Angst vor dem grauen Fluss haben, sandte er ein Stoßgebet an die große Katze bei den Sternen.
Einohrs Fauchen wurde wütender, dringender. Sollte er es tatsächlich geschafft haben? Nun wagte er es doch, einen Blick über seine Schulter nach hinten zu werfen. Ja! Einohr stand am Rand des Flusses und trat unruhig hin und her. Sein Fell stand in alle Richtungen ab und sein Schwanz zuckte wild. Er wollte seine Beute nicht entkommen lassen, aber der Fluss ohne Wasser war selbst für ihn gefährlich.
Ich habe es geschafft, frohlockte er und drehte den Kopf wieder nach vorn. Er war entkommen, würde den nächsten Tag unbeschadet überstehen und es sich in Zukunft gründlicher überlegen, ob er es noch einmal wagen sollte, sein Schicksal mit Einohr herauszufordern. Den deutlich dünneren Schwanz als Einohrs stolz in die Luft gestreckt, setzte er seinen Weg über den Fluss fort. So bedrohlich wirkte er plötzlich gar nicht mehr.
Ein schrecklicher Laut zu seiner Linken. Noch grausiger als Einohrs Fauchen. Ein Brummen, ein Quietschen ein Schlag. Etwas traf ihn in der Seite, er wurde von den Beinen gerissen.
Mein Glück ist nicht von langer Dauer gewesen, dachte er noch und hörte sich selbst aufjaulen.
Schmerz.
Dunkelheit.
eil 1
Es gibt Hoffnung.
Auch wenn dein Gehirn dir etwas anderes sagt.
John Green
apitel 1enschenmüd
Sie sah die entsetzten Gesichter, noch ehe sie den Schrei hörte. Selbst, als sie ihn hörte, dauerte es einen Augenblick, bis Molly begriff, dass es ihre eigene Stimme war, die diesen Schrei verursachte. Einen weiteren Moment brauchte sie, um zu bemerken, dass sie auf dem Boden kauerte und sich die Ohren zuhielt.
»Um Himmels willen, Miss Cavandish, reißen Sie sich zusammen!«, zischte ein beleibter Mann mittleren Alters ihr zu und griff sie am Ellbogen. Sein Gesicht wurde puterrot, während er sie auf die Beine zog und von dem Paar wegzerrte, das sie eben noch so entsetzt beobachtet hatte.
»Was sollen denn die Leute denken?«, fuhr ihr Chef fort, während er sie an weiteren Kunden vorbei durch den Laden führte. Molly ließ ihn gewähren. Sie schrie nicht länger, das deutete sie als ein gutes Zeichen. Sie konnte nicht einmal genau sagen, weshalb sie geschrien hatte.
Sie hatte augenblicklich irrsinnige Kopfschmerzen bekommen. Das Licht war zu laut gewesen, die Menschen zu hell. Nein, dachte sie, das war falsch. Aber sie konnte sich auch nicht dazu bringen, die korrekte Form zu denken. Von Aussprechen ganz zu schweigen. Molly hätte ihrem Chef erklären sollen, was passiert war, das wusste sie. Sie war mitten in einem Kundengespräch schreiend auf den Boden gesunken. Aber wie sollte sie ihm erklären, das auf einmal alles um sie herum zu viel geworden war.
Das ist gelogen, flüsterte eine leise Stimme in ihr. Molly wischte sie beiseite, während ihr Chef die Tür zum Mitarbeiterbereich aufstieß.
»Also, Miss Cavandish, was sollte das gerade?«, fuhr er sie an, kaum dass sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte. Zwei ältere Frauen aus der Haushaltswarenabteilung, die Pause machten, sahen neugierig zu ihnen herüber. Molly wollte weglaufen. Sie wollte sich verstecken. Sie wollte sich wieder auf den Boden kauern und losschreien. Wieso starrten sie alle so an? Wieso stellte ihr Chef ihr Fragen, auf die sie keine Antworten hatte?
Ihr wurde flau im Magen.
»Mir ist schlecht«, brachte sie heraus und fühlte, wie sich ihr Magen noch mehr zusammenzog. Die Gesichtsfarbe ihres Chefs wurde indessen noch intensiver.
»Und deswegen schreien Sie unsere Kunden an?«, blaffte er sie an. »Haben Sie den Verstand verloren?«
»Ich habe sie nicht …«
»Sie haben sie mitten im Kaufhaus angeschrien, Miss Cavandish. Sie können nur hoffen, dass die Leute nicht schnurstracks gegangen sind.«
Hitze stieg in Mollys Wangen auf. Sie spürte die Blicke der beiden Frauen in ihrem Rücken.
Zu laut.
Zu hell.
Zu … alles.
Sie presste die Hand gegen den Bauch, doch das flaue Gefühl wurde nur noch schlimmer.
»Lasst mich in Ruhe«, flüsterte sie und spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen.
»Was erlauben Sie sich?«
Entsetzt sah Molly ihren Chef an. Hatte sie das gerade laut gesagt? Die Tränen, die sie mühsam zurückgehalten hatte, entkamen mit dem nächsten Blinzeln ihren Lidern. Sie wischte sie hastig mit dem Handrücken fort und trat einen Schritt von ihrem Vorgesetzten zurück.
»Ich … es tut mir … ich … «, stammelte sie. In ihrem Kopf schwirrte alles. Ihr Magen drückte und kniff und zwickte. Ihre Kehle schien keine richtigen Worte mehr zu bilden. Sie stolperte einen weiteren Schritt zurück, während ihr Chef ihr folgte. Gefahr, schoss es ihr durch den Kopf. So musste sich ein Tier in der Wildnis fühlen, wenn es einem Raubtier gegenüberstand. In einem anderen Moment hätte sie wohl darüber laut losgelacht, dass sie ihren Chef, der äußerlich eher dem Weihnachtsmann ähnelte, mit einem Raubtier verglich. In diesem Moment jedoch schien er wie ein Löwe. Geflankt von zwei Hyänen aus der Haushaltswarenabteilung hinter ihr. Sie warteten nur darauf, dass Molly einen Fehler begehen würde, stolpern würde, fallen würde. Dann würden sie sich auf sie stürzen und sie zerfleischen.
»Ich muss weg«, erklärte sie und drängte sich an ihrem Chef vorbei. Sie sah aus den Augenwinkeln, wie er die Hand nach ihr ausstreckte, doch sie konnte sich ihm entziehen und durch die geöffnete Tür zurück in den Laden fliehen.
»Miss Cavandish«, rief er ihr nach.
Molly drehte sich nicht um. Sie sollte es, das wusste sie, aber sie konnte es nicht. Ihre Füße trugen sie geradewegs weg vom Aufenthaltsraum der Mitarbeiter. Weg, weit weg davon.
»Kommen Sie sofort zurück!«
Nein. Sie ging weiter, immer weiter. Sie würde morgen dermaßen großen Ärger bekommen. Morgen. Aber nicht mehr heute. Nur noch hier raus. Raus und nach Hause. Ins Bett, unter die Decke. Weg. Weg von allen.
Zwei Kollegen riefen ihr nach, als sie im Erdgeschoss ankam und zur Eingangstür ging. Sie reagierte nicht. Ein Teil von Molly war sich bewusst, dass sie noch ihre Arbeitskleidung trug, keine Jacke anhatte, noch nicht Feierabend war. Doch dieser Teil von Molly funktionierte gerade nicht.
Flucht. Das war das einzige, woran sie gerade denken konnte. Weg. Raus.
Sie drängte sich mit den Menschenmassen hinaus in die Fußgängerzone. Der kalte Novemberwind blies ihr umgehend ins Gesicht und ließ sie erzittern. Molly ging weiter. Sie zwängte sich zwischen Menschen hindurch, ging die Straße entlang, ließ sich von den anderen Leuten geradezu mitziehen. Wie in Trance machte sie Schritt um Schritt vorwärts. Ihr Kopf schien leer und schwer zugleich. Zu viele Gedanken überschlugen sich darin, während sie an nichts dachte. Ihr Magen krampfte sich mit jedem Schritt zusammen.
Weg. Ich muss weg.
Weg.
Wohin? Es gab keinen Ort, an den sie fliehen konnte. So landete sie schließlich vor ihrem Haus. Der Schlüssel lag in ihrem Spind auf der Arbeit.
Molly starte die schwere Holztür vor sich an, als könne sie sie mit ihren Blicken dazu bewegen, sich vor ihr zu öffnen.
Was sollte sie tun? Sie konnte nicht zurück. Nicht heute. Hier warten? In der Kälte, im Dunkeln? Es war kurz vor fünf am Nachmittag, aber die Sonne stand schon tief genug, um es kaum mehr Tag nennen zu können.
»Miss Cavandish?« Eine Hand auf ihrer Schulter.
Molly fuhr zusammen, drehte sich um. Große blaue Augen sahen sie besorgt an.
»Ist … ist alles … in Ordnung?« Ihre Stimme verriet Molly, dass sie bereits wusste, dass dem nicht so war. Aisling, Paula Aisling, kam es ihr in den Sinn. Eine Etage über ihr. Als Molly nichts sagte, kniff Paula die Lippen zusammen und griff nach ihrem Handy. Sie tippte gezielt ein wenig auf dem Display herum, hielt sich das Telefon ans Ohr und wartete nur einen kurzen Augenblick, ehe Molly eine leise Stimme hören konnte.
»Charlie, bist du noch in der Praxis?«, erkundigte sich Paula. »Nein, nein, keine Sorge, bei mir ist alles okay. Ich habe eine Nachbarin getroffen, der es nicht gut geht. Können wir zu dir kommen?«
Ich will nicht, wollte Molly sagen, aber kein Wort kam über ihre Lippen. Sie starrte Paula nur an, während diese nickte und ihrerseits Molly ansah. Sie sagte noch etwas am Telefon, doch das Rauschen in Mollys Ohren wurde zu laut, um Paula noch zu hören. Ihre Stirn legte sich in Falten.
»Nein, Krankenhaus denke ich nicht, eher … ja, genau. Danke.« Sie beendete das Gespräch und schenkte Molly ein vorsichtiges Lächeln. »Okay, Miss Cavandish, das war mein Freund Charlie. Er ist Arzt und ich glaube, wir sollten jetzt zu ihm fahren.«
Ich brauche keinen Arzt. Ihre Sicht flimmerte, ihr Magen rebellierte, in ihren Ohren rauschte es.
Lüge. Sie konnte die Stimme nicht wegwischen.
»Okay?«, fragte Paula und drängte Molly mit ihrer Hand auf der Schulter leicht dazu, mit ihr zu kommen.
»Okay.« Mollys Stimme war rau. Sie zuckte zusammen, als sie sie hörte, doch Paula war sichtlich erleichtert.
Sie atmete hörbar aus und ihr Lächeln wurde breiter. »Okay, gehen wir. Mein Wagen steht da vorn auf dem Parkplatz. Wir sind in fünf Minuten an der Praxis.«
Molly nickte. Wieso sie das tat, wusste sie nicht. Sie verstand auch nicht, weshalb sie mit ihrer Nachbarin, mit der sie kaum mehr als ein paar Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht hatte, mitging.
Lüge.
Molly schloss die Augen und holte tief Luft. Ihr Magen zog sich noch enger zusammen.
In Paulas Auto, ein ziemlich neuer Kleinwagen, roch es nicht, wie in einem Neuwagen. Nicht der Geruch vom Leder des Lenkrads oder den Stoffbezügen der Sitze stieg Molly in die Nase, sondern der von Lebkuchen.
»Ich räum das schnell weg«, murmelte Paula und packte eine Bäckereitüte auf die Rückbank.
Molly liebte Lebkuchen. Jetzt wurde ihr von dem Geruch nur noch übler.
»Okay, wir sind gleich da.«
Molly nickte stumm. Paula schien keine Antwort zu erwarten. Vielleicht hatte sie auch nur sich selbst beruhigen wollen. Himmel, sie muss mich für verrückt halten, fuhr es Molly durch den Kopf und ihr wurde klar, dass das ihr erster klarer Gedanke seit … sie wusste nicht einmal, wie viel Zeit vergangen war, seit sie im Laden zusammengebrochen war. Gütiger Gott, was hatte sie getan? Sie fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, als ihr wieder schwindelig wurde.
»Tut mir leid«, murmelte sie und sah Paula aus den Augenwinkeln an.
Paula schüttelte den Kopf, behielt den Blick auf der Straße vor ihnen. »Muss es nicht. Jeder braucht mal Hilfe. Ich weiß das.« Sie sah kurz zu Molly herüber und ihre Blicke trafen sich. »Ich weiß auch, wie es ist, nicht um Hilfe zu bitten und wohin das führen kann.« Dann sah sie wieder auf die Straße.
Molly runzelte die Stirn. Sie brauchte keine Hilfe, nur ihren Hausschlüssel.
Lüge.
Die Stimme wurde lauter, ließ sich nicht mehr so leicht wegwischen.
»Wir sind da«, erklärte Paula, bevor die Stimme mehr sagen konnte.
Molly sah aus dem Fenster. Ein ganz gewöhnliches Haus mit mehreren großen Schildern neben der Eingangstür. Eine ganz gewöhnliche Praxis. Was hatte sie erwartet? Sie schüttelte leicht den Kopf.
Paula verstand ihre Geste falsch, legte ihr die Hand auf die Schulter. »Glauben Sie mir, es kann nur besser werden, wenn Sie reingehen. Charlie wird Ihnen helfen.«
Die beiden Frauen stiegen aus dem Auto und Paula wich Molly nicht von der Seite, als sie das Praxisgebäude betraten. Sie redete mit der Empfangsdame, die Molly nur einen kurzen Blick zuwarf und dann nickte.
Paulas Freund erwartete sie bereits.
Dr. Charles MacKintosh stand an der Tür, an der Paula klopfte. Eine tiefe Stimme bat sie, einzutreten.
»Ich warte hier.« Ein Versprechen oder eine Drohung. Molly wusste gerade nicht, wie sie Paulas Worte einordnen sollte, traute sich nicht zu, sie gerade richtig zu deuten. Sie nickte nur und betrat das Zimmer.