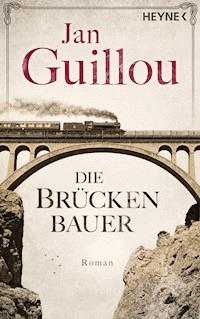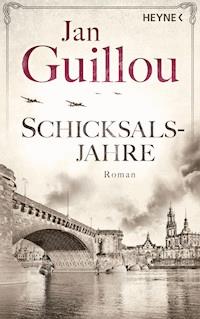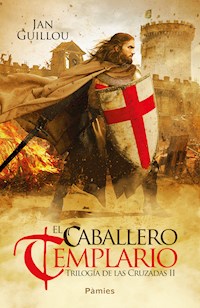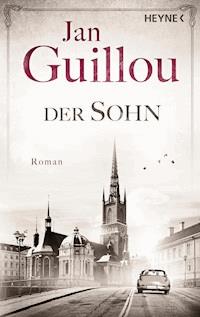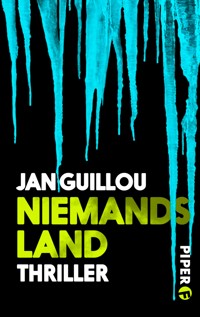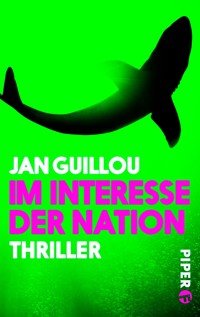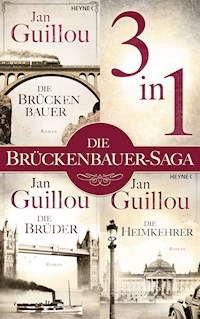Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die schwedische Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel Vägen till Jerusalem bei Norstedts Förlag, Stockholm.
Der Roman erschien in Deutschland bereits 2000 unter dem Titel Die Frauen von Götaland im Piper Verlag, München.
Copyright © Jan Guillou 1998Copyright © Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
ISBN : 978-3-641-04283-7V002
www.heyne.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
ZUM BUCH
ZUM AUTOR
Die Kreuzritter-Saga:
Inschrift
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ANHANG
Über Der Kreuzritter – Aufbruch
ARN – Der Kreuzritter: Einige Bemerkungen des Filmregisseurs
Die Schauplätze des Buchs
Copyright
ZUM BUCH
Mitte des 12. Jahrhunderts: Während im Heiligen Land die Kämpfe zwischen Kreuzrittern und Sarazenen toben, wächst der aus Götaland stammende Adelige Arn in einem Kloster auf, nachdem er einen Sturz vom Turm des elterlichen Anwesens wie durch ein Wunder überlebt. Seine Eltern wollen ihn deswegen der Arbeit Gottes weihen. Im Kloster studiert Arb nicht nur die Heilige Schrift, sondern wird auch in die Kunst des Schwertkampfes eingeführt. Schon bald kann er sich mit den Besten seines Landes messen. Als Arn 17 Jahre alt ist, beschließen sein Prior und Erzbischof Stephan, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Arn die Welt kennenlernt. Und so kehrt er auf das Gut Arnäs zurück, wo er sich in Cecilia, die Tochter des königstreuen Nachbarn, verliebt. Als er unwissend eine Blutschande begeht, wird er geächtet und muss dafür büßen: Arn wird für zwanzig Jahre als Tempelritter ins Heilige Land geschickt.
Der erste – in sich abgeschlossene – Roman der groß angelegten Saga um das abenteuerliche Leben des Arn Magnusson.
ZUM AUTOR
Jan Guillou wurde 1944 im schwedischen Södertälje geboren und ist einer der prominentesten Journalisten seines Landes. Seine preisgekrönten Kriminalromane um den Helden Coq Rouge erreichten Millionenauflagen. Auch mit seiner historischen Romansaga um den Kreuzritter Arn gelang ihm ein Millionenseller, die Verfilmungen zählen in Schweden zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Heute lebt Jan Guillou in Stockholm.
Die Kreuzritter-Saga:
Der Kreuzritter – Aufbruch Der Kreuzritter – Verbannung Der Kreuzritter – Rückkehr (Herbst 2009) Der Kreuzritter – Erbe (Frühjahr 2010)
»Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.«
JACULA PRUDENTUM, 1651, Nr. 170
VÄSTRA GÖTALAND 1150-1250
I
IM JAHR DES HEILS 1150, als die gottlosen Sarazenen, der Abschaum der Erde und die Vorhut des Antichrist, den Unsrigen im Heiligen Land viele Niederlagen beigebracht hatten, senkte sich der Heilige Geist auf Frau Sigrid hinab und schickte ihr eine Offenbarung, die ihr Leben veränderte.
Vielleicht könnte man auch sagen, dass diese Offenbarung ihr Leben verkürzte. Ganz sicher ist, dass sie danach nie mehr die Gleiche war wie zuvor. Weniger sicher ist, was der Mönch Thibaud lange Zeit später schrieb, dass nämlich in dem Augenblick, in dem der Heilige Geist sich Sigrid offenbart habe, in Wahrheit der Grundstein für ein neues Reich oben im Norden gelegt worden sei, das man später einmal Schweden nennen werde.
Es war am Tiburtiustag, den man als ersten Sommertag bezeichnete, und an dem im Westlichen Götaland das Eis zu schmelzen begann. So viele Menschen wie an diesem Tag waren in Skara noch nie versammelt gewesen, denn es war keine beliebige Messe, die jetzt gelesen werden sollte. Der neue Dom sollte endlich eingeweiht werden.
Die Zeremonien waren schon in ihrer zweiten Stunde. Die Prozession hatte dreimal die Kirche umrundet, und zwar unendlich langsam, da Bischof Ödgrim ein sehr alter Mann war, der mühsam dahinwankte, als wäre es seine letzte Wanderung. Außerdem schien er ein wenig verwirrt, da er das erste Gebet in der geweihten Kirche in der Volkssprache statt auf Lateinisch gesprochen hatte:
»Gott, der Du alles unsichtbar bewahrst,
doch für die Erlösung der Menschen Deine Macht sichtbar werden lässt,
nimm in diesem Tempel Deine Wohnung und herrsche hier,
damit alle, die sich hier zum Gebet versammeln,
Deines Trostes und Deiner Hilfe teilhaftig werden.«
Und tatsächlich ließ Gott jetzt seine Macht sichtbar werden, ob nun um der Erlösung der Menschen willen oder aus anderen Gründen. Es war ein Schauspiel, das kein Mensch im ganzen Westlichen Götaland je gesehen hatte: die blitzenden Farben der Bischofshabite aus goldenem Zwirn, hellblaue und dunkelrote Seide, betäubende Düfte aus den Weihrauchgefäßen, die die Domherren bei ihrem Rundgang im Kirchengewölbe schwenkten. Dazu erklang eine Musik, die so himmlisch war, dass kein Ohr im Westlichen Götaland so etwas je vernommen haben konnte. Und wenn man den Blick hob, war es, als schaute man zum Himmel hinauf. Es war unbegreiflich, dass die burgundischen und englischen Baumeister so hohe Gewölbe erschaffen konnten, ohne dass alles einstürzte, und sei es aus keinem anderen Grund, als dass die Eitelkeit, die es bedeutete, bis zu Ihm hinauf bauen zu wollen, den Herrn hätte erzürnen müssen.
Frau Sigrid war eine praktisch veranlagte Frau. Manche sagten gerade deshalb, sie sei hart. Sie hatte zunächst keinerlei Lust verspürt, sich auf die beschwerliche Reise nach Skara zu begeben, da der Frühling zeitig gekommen war und die Wege sich in tiefen Morast verwandelt hatten. Außerdem empfand sie Unruhe bei dem Gedanken, in ihrem jetzigen gesegneten Zustand in einem Wagen zu sitzen und auf den schlechten Straßen durchgeschüttelt zu werden. Mehr als etwas anderes in ihrem irdischen Leben fürchtete sie die baldige Geburt ihres zweiten Kindes. Und sie wusste sehr wohl, dass die bevorstehende Domweihe bedeutete, dass sie stundenlang auf dem harten Steinboden stehen und hin und wieder zum Gebet niederknien musste, was in ihrem Zustand eine Qual war. Was die vielen Regeln des kirchlichen Lebens betraf, so war sie wohlbewandert, sicherlich mehr als die meisten großen Männer und deren Töchter, die sie in diesem Augenblick um sich herum sah. Dieses Wissen hatte sie gewiss nicht aus Gläubigkeit oder aus freien Stücken erworben. Als sie sechzehn Jahre alt war, hatte ihr Vater nicht ganz unbegründet den Eindruck gewonnen, dass sie einem Verwandten aus Norwegen, der jedoch von allzu geringer Herkunft war, ein unangemessen großes Interesse entgegengebracht hatte, das zu Dingen hätte führen können, die nur in der Ehe etwas zu suchen hätten, wie ihr Vater das Problem barsch zusammengefasst hatte. Man hatte sie für fünf Jahre in ein Kloster in Norwegen geschickt, aus dem sie wohl nie mehr herausgekommen wäre, wenn sie nicht einen kinderlosen Onkel im Östlichen Götaland beerbt hätte, wodurch sie zu einem Menschen geworden war, den man lieber verheiratete, als ihn ins Kloster zu stecken.
Sie wusste also, wann man aufstehen und wann man niederknien, wann man die Paternoster und Ave-Maria mitleiern musste, die einer der Bischöfe da vorn vorsprach, und wann jeder sein eigenes Gebet zu murmeln hatte. Bei jedem Gebet, das sie selbst sprechen musste, betete sie um ihr Leben.
Gott hatte ihr vor drei Jahren einen Sohn geschenkt. Es hatte zwei Tage und zwei Nächte gedauert, ihn zu gebären; zweimal war die Sonne auf- und wieder untergegangen, während sie in Schweiß, Angst und Schmerz badete. Da wusste sie, dass sie sterben würde, und das wussten am Ende auch all die guten Frauen, die ihr beistanden. Sie hatten den Priester unten in Forshem kommen lassen, und er hatte ihr die Absolution erteilt und die letzte Ölung gegeben.
Nie wieder, hatte sie gehofft. Nie wieder diesen Schmerz, nie wieder diese Todesangst, betete sie jetzt. Das war ein selbstsüchtiger Gedanke, das wusste sie sehr wohl. Es war schließlich nicht ungewöhnlich, dass Frauen im Kindbett starben, und der Mensch sollte unter Schmerzen geboren werden. Sie hatte jedoch den Fehler begangen, zur Heiligen Jungfrau zu beten, gerade sie zu verschonen. Überdies hatte sie versucht, ihre ehelichen Pflichten so zu erfüllen, dass es nicht zu einem neuen Kindbett führte. Ihr Sohn Eskil war schließlich ein wohlgestalter und flinker kleiner Knabe mit allen Fähigkeiten, die Kinder haben sollen.
Die Heilige Jungfrau hatte sie natürlich gestraft. Die Menschen hatten die Pflicht, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, und wie konnte man erwarten, erhört zu werden, wenn man ausgerechnet darum bat, selbst von dieser Verantwortung entbunden zu werden? Jetzt warteten also neue Qualen, das war gewiss. Und dennoch betete sie immer wieder darum, glimpflich davonzukommen. Um zumindest die weit geringere und weniger elende Pein zu lindern, viele Stunden lang immer wieder aufzustehen und niederzuknien, hatte sie ihre Leibeigene Sot taufen lassen, damit sie sie in Gottes Haus mitnehmen und sich auf sie stützen konnte. Sots große schwarze Augen waren aufgerissen wie bei einem scheuenden Pferd von all dem, was sie hier zu sehen bekam, und wenn sie zuvor noch keine richtige Christin gewesen war, würde sie es jetzt wohl werden.
Drei Mannslängen vor Sigrid standen König Sverker und Königin Ulvhild. Die beiden ächzten unter der Last ihres Alters, und es fiel ihnen zusehends schwerer, ohne allzu viel Keuchen oder unpassende Laute des Allerwertesten immer wieder aufzustehen und niederzuknien. Sigrid befand sich jedoch ihretwegen im Dom und nicht für Gott. König Sverker schätzte weder ihre norwegischen und westgötischen Sippen noch die norwegischen und folkungischen Sippen ihres Mannes sonderlich hoch. Und jetzt, im hohen Alter, bot dem König das jenseitige Leben Anlass zu Misstrauen und Besorgnis. Es hätte zu Missverständnissen führen können, der großen, gottgefälligen Kirchenweihe des Königs fernzubleiben. Wenn ein Mann oder eine Frau mit Gott nicht im reinen war, ließ sich das möglicherweise mit Ihm selbst ausmachen. Sich mit dem König zu überwerfen, hielt Sigrid für schlimmer.
Doch als der Gottesdienst nun schon die dritte Stunde dauerte, begann sich in Sigrids Kopf alles zu drehen, und das beständige Niederknien und Aufstehen fiel ihr schwerer und schwerer. Das Kind in ihr trat und bewegte sich immer heftiger, als wollte es protestieren. Sie hatte das Gefühl, als würde der gelblich bleiche, blank geschliffene Kalksteinboden unter ihr schwanken, und sie glaubte zu sehen, wie er Risse bekam, als wollte er sich öffnen und sie plötzlich verschlingen. Da tat sie das Unerhörte. Sie ging resolut und mit raschelndem Seidenkleid zu einer leeren kleinen Seitenbank und setzte sich. Alle sahen es, auch der König.
Gerade als sie erleichtert auf die kleine Steinbank im Seitenschiff niedersank, zogen die Mönche von Lurö ein. Sigrid wischte sich Stirn und Gesicht mit einem kleinen Leinentuch ab und winkte ihrem Sohn dort hinten bei Sot aufmunternd zu.
Da begann der Gesang der Mönche. Sie waren schweigend und wie im Gebet mit gesenkten Häuptern durch den Mittelgang nach vorn geschritten und hatten sich ganz hinten beim Altar aufgestellt, wohin die Bischöfe und ihre Gehilfen sich jetzt zurückzogen. Zunächst klang es nur wie ein dumpfes, schwaches Murmeln, dann ertönten plötzlich laute Knabenstimmen; einige der Mönche von Lurö trugen braune statt weißer Kutten und waren ganz offensichtlich noch Knaben. Ihre Stimmen stiegen wie helle Vögel zu dem gewaltigen Deckengewölbe empor, und als sie so hoch hinaufgetragen worden waren, dass sie den ganzen gewaltigen Raum erfüllten, fielen die dumpfen Männerstimmen der Mönche ein, die das gleiche sangen und doch wieder nicht. Sigrid hatte Gesänge für zwei und drei Stimmen gehört, doch dieser Chor war mindestens achtstimmig. Es war wie ein Wunder, da schon drei Stimmen sehr schwer zustande zu bringen waren.
Sigrid starrte ermattet und mit aufgerissenen Augen dorthin, wo sich das Wunder ereignete. Sie lauschte mit ihrem ganzen Ich, mit ihrem ganzen Körper, bis die Anspannung sie erzittern ließ und ihr schwarz vor den Augen wurde, sodass sie nicht mehr sah, sondern nur noch hörte – so als müssten auch ihre Augen ihre volle Kraft für das Hören einsetzen. Es kam ihr vor, als verschwände sie, als würde sie in Töne verwandelt und zu einem Teil der heiligen Musik, die schöner war als alles andere in ihrem Erdenleben.
Einige Zeit später kam sie wieder zu Bewusstsein, als sie jemand bei der Hand ergriff, und als sie aufsah, merkte sie, dass es König Sverker höchstpersönlich war.
Sigrid unterdrückte entschlossen die Eingebung, ihm zu erzählen, dass der Heilige Geist soeben zu ihr gesprochen hatte. Ein solcher Bericht würde wohl nur den Eindruck erwecken, als wollte sie sich interessant machen, und Könige bekamen sicher mehr als genug von solchen Dingen zu hören. Stattdessen erzählte sie schnell und flüsternd, wozu sie sich soeben entschlossen hatte.
Wie der König sicher schon wusste, gab es Streit um ihr Erbe in Varnhem. Ihre Verwandte Kristina, die vor Kurzem diesen ehrgeizigen Erik Jedvardsson geheiratet hatte, beanspruchte den halben Besitz. Doch nun verhielt es sich ja so, dass die Mönche von Lurö eine Gegend mit weniger strengen Wintern bräuchten. Viel von ihrem Anbau dort drüben auf Lurö war vergeblich gewesen, das wusste jeder; indes, kein einziges schlechtes Wort über König Sverkers Freigebigkeit, ihnen Lurö zu stiften. Aber wenn sie, Sigrid, den Zisterziensern Varnhem schenkte, sollte der König die Gabe segnen und sie für gesetzlich erklären, und damit wäre das ganze Problem aus der Welt. Ein solches Vorhaben würde allen zugutekommen.
Sie hatte schnell, leise und ein wenig atemlos gesprochen, immer noch mit pochendem Herzen nach all dem, was sie in der himmlischen Musik gesehen hatte, als die Dunkelheit zu Licht geworden war.
Der König schien zunächst ein wenig überrumpelt. Er war es nicht gewohnt, dass Männer in seiner Umgebung so direkt und ohne höfische Umschreibungen zu ihm sprachen. Geschweige denn Frauen.
»Du bist in mehr als nur einer Hinsicht eine gesegnete Frau, meine liebe Sigrid«, sagte er schließlich langsam und ergriff von Neuem ihre Hand. »Morgen, wenn wir nach dem Gastmahl auf dem Krongut ausgeschlafen haben, werde ich Pater Henri zu mir rufen, und dann bringen wir das Ganze zu Papier. Morgen, aber nicht jetzt. Es schickt sich wohl nicht, dass wir noch lange hier sitzen und flüstern.«
Im Handumdrehen hatte sie jetzt ihr Erbe verschenkt. Varnhem. Kein Mann und keine Frau bricht ein dem König persönlich gegebenes Wort, ebenso wenig wie der König sein Wort brechen darf. Was sie getan hatte, ließ sich nicht mehr rückgängig machen.
Zugleich aber war es auch praktisch, wie ihr aufging, nachdem sie sich ein wenig erholt hatte. Der Heilige Geist konnte also auch praktisch sein, und die Wege des Herrn waren nicht immer unerforschlich.
Varnhem und Arnäs lagen gut zwei Tagesritte voneinander entfernt, Varnhem außerhalb von Skara, nicht weit vom Bischofsgut am Berg Billingen, und Arnäs oben am Ostufer des Vänersees, wo das Land Sunnanskog aufhörte und der Wald Tiveden in der Nähe des Berges Kinnekulle begann. Das Gut von Varnhem war neuer und in weit besserem Zustand, und aus diesem Grund wollte sie die kälteste Zeit des Jahres dort verbringen, vor allem da das schauerliche Kindbett jetzt näher rückte. Magnus, ihr Mann, wünschte, dass sie sein väterliches Erbe Arnäs zum Wohnsitz nahmen. Sie gab Varnhem den Vorzug, und sie hatten sich nie einigen können. Manchmal gar hatten sie darüber nicht so freundlich und mit solcher Geduld sprechen können, wie es sich unter Eheleuten gehörte.
Arnäs musste erneuert und umgebaut werden. Der Hof lag jedoch am Wald, in einer Grenzregion ohne Eigentümer. Dort befanden sich viele Allmenden und königliche Domänen, die man auf dem Verhandlungswege erwerben oder kaufen konnte. Dort ließ sich vieles zum Besseren wenden, vor allem, wenn sie mit all ihren Leibeigenen und allem Vieh von Varnhem dorthin umzog.
Der Heilige Geist hatte die Sache vielleicht nicht genau so ausgedrückt, als er sich ihr offenbarte. Sie hatte eine Vision gehabt, die nicht gerade von selbst verständlich war: Eine Herde sehr schöner Pferde, die in glänzenden Farben geschimmert hatten, war ihr auf einer Wiese voller Blumen entgegengelaufen. Die Pferde hatten weiße, saubere Mähnen und spöttisch erhobene Schweife und bewegten sich spielerisch und geschmeidig wie Katzen. In all ihren Bewegungen waren sie anmutig gewesen. Und irgendwo hinter den verspielten, ausgelassenen Pferden ohne Sattel kam ein junger Mann auf einem silberfarbenen Hengst angeritten, der ebenfalls eine weiße Mähne und einen hoch erhobenen Schweif hatte. Sigrid kannte den jungen Mann, zugleich aber auch wieder nicht. Er trug einen Schild, doch keinen Helm. Das Wappen kannte sie weder von ihren eigenen Verwandten noch von denen ihres Mannes; der Schild war vollkommen weiß mit einem großen, blutroten Kreuz.
Der junge Mann hatte sein Pferd direkt neben ihr zum Stehen gebracht und sie angesprochen. Sie hörte alle Worte und verstand sie, verstand sie aber auch wieder nicht. Doch sie wusste, dass das, was er sagte, bedeutete, dass sie Gott genau das zum Geschenk machen sollte, was im Augenblick in dem Land, in dem König Sverker herrschte, mehr gebraucht wurde als alles andere, nämlich einen guten Wohnsitz für die Mönche von Lurö.
Hinterher hatte sie sich die Mönche genau angesehen, als diese nach ihrer langen Vorstellung hinaustrotteten. Sie schienen nicht im Mindesten von dem Wunder erfüllt, das sie zustande gebracht hatten, sondern wirkten eher, als hätten sie irgendwo im Westlichen Götaland ihre Steinmetzarbeit für heute beendet, so als dächten sie in erster Linie an das Abendessen. Sie hatten sich leise miteinander unterhalten und sich den roten Ausschlag gekratzt, den viele auf dem grob rasierten Scheitel hatten. Die Haut im Gesicht und im Nacken hing vielen von ihnen in Falten hinab. Jeder konnte sehen, dass auf Lurö von Wohlleben keine Rede sein konnte, und der Winter war ihnen wohl auch nicht gnädig gewesen. Gottes Wille war folglich nicht schwer zu verstehen: Wer beim Singen Wunder vollbringen konnte, musste einen besseren Ort zum Leben und Arbeiten bekommen. Und Varnhem war ein sehr guter Ort.
Als Sigrid auf die Freitreppe des Doms hinaustrat, bewirkte die kalte frische Luft, dass ihr wieder klar im Kopf wurde. Fast als wäre der Heilige Geist noch einen Augenblick bei ihr geblieben, hatte sie eine plötzliche Eingebung, wie sie ihrem Mann alles sagen musste, der ihr gerade mit ihren Umhängen über dem Arm im Gedränge entgegenkam. Sie betrachtete ihn mit einem behutsamen Lächeln und fühlte sich dabei vollkommen geborgen. Sie hing an ihm, weil er ein sanfter Ehemann und ein fürsorglicher Vater war, wenngleich kein Mann, dem man Ehrfurcht oder Bewunderung entgegenbrachte. Es war schwer, zu glauben, dass er tatsächlich der Enkel des kraftvollen Jarls Folke des Dicken war. Magnus war ein zartgliedriger Mann, und ohne die ausländischen Kleider, die er jetzt trug, würde man ihn wohl für einen beliebigen Mann in der Menge halten.
Als er vor ihr stand, verneigte er sich und bat sie, ihren Umhang zu halten, während er seinen eigenen großen, himmelblauen und mit Marderfell gefütterten Mantel anlegte und ihn mit der norwegischen Silberspange unterm Kinn befestigte. Dann half er ihr, streichelte ihr mit seinen weichen Händen, die nicht die Hände eines Kriegers waren, die Stirn und fragte, wie sie in ihrem gesegneten Zustand einen so langen Lobgesang auf den Herrn hatte ertragen können. Sie erwiderte, es sei überhaupt nicht schwierig gewesen, da sie zum einen Sot als Stütze mitgenommen habe; zum andern sei es ihr vergönnt gewesen, dass sich ihr der Heilige Geist offenbart habe. Sie sagte es so, wie sie es immer tat, wenn sie etwas nicht ernst meinte. Er lächelte über das, was er für einen ihrer gewohnten Scherze hielt, und sah sich dann nach dem Mann aus seiner Leibwache um, der mit seinem Schwert aus der Vorhalle des Doms unterwegs war.
Als er das Schwert unter den Umhang steckte und das Gehänge befestigte, ragten seine beiden Ellbogen unter dem Umhang hervor und ließen ihn breiter und mächtiger aussehen, als er war.
Dann reichte er ihr den Arm und fragte, ob sie mit ihm ein wenig auf dem Marktplatz herumgehen und das Spektakel ansehen oder ob sie sich lieber gleich zur Ruhe begeben wollte.
Sie entgegnete schnell, sie wollte sich gern ein wenig die Beine vertreten, ohne ständig niederknien zu müssen. Er lächelte scheu über ihren frechen Scherz. Überdies, fuhr sie fort, wäre es lustig, sich all diese Spielleute und Gaukler anzusehen, die der König eingeladen hatte; mitten auf dem Platz traten fränkische Akrobaten und ein Feuerschlucker auf, es wurde auf Pfeifen und Fiedeln gespielt, und hinten bei einem der großen Bierzelte waren dumpfe Trommeln zu hören.
Sie bahnten sich vorsichtig einen Weg durch die Menge, in der die vornehmen Kirchenbesucher sich jetzt unter das gewöhnliche Volk und die Leibeigenen mischten. Nach einem kurzen Moment holte sie tief Luft und sagte ohne jede Umschweife alles auf einmal:
»Magnus, mein lieber Mann, ich hoffe, du bleibst jetzt männlich ruhig und würdevoll, wenn du zu hören bekommst, was ich soeben getan habe.« Sie holte erneut tief Luft und sprach schnell weiter, bevor er Zeit fand zu antworten. »Ich habe König Sverker mein Wort gegeben, Varnhem den Zisterziensermönchen auf Lurö zum Geschenk zu machen. Mein Wort dem König gegenüber kann ich nicht zurücknehmen, es ist unwiderruflich. Wir werden ihn morgen auf dem Krongut treffen, um es schriftlich niederzulegen und zu besiegeln.«
Wie sie erwartet hatte, blieb er abrupt stehen und sah ihr zunächst forschend ins Gesicht, um nach dem Lächeln zu suchen, das sie immer dann zeigte, wenn sie in der ihr eigenen Weise eine spöttische Bemerkung gemacht hatte. Doch ihm ging bald auf, dass es ihr vollkommen ernst war, und da überkam ihn der Zorn mit solcher Gewalt, dass er sie wohl zum ersten Mal geschlagen hätte, wenn sie nicht inmitten von Verwandten und Feinden und all dem niederen Volk gestanden hätten.
»Hast du den Verstand verloren, Frau! Wenn du Varnhem nicht geerbt hättest, würdest du immer noch im Kloster vertrocknen. Um Varnhems willen haben wir doch geheiratet.«
Er hatte sich im letzten Moment beherrscht und leise gesprochen, jedoch durch fest zusammengebissene Zähne.
»Ja, das ist wahr, mein lieber Gemahl«, erwiderte sie mit züchtig gesenktem Blick. »Hätte ich nicht Varnhem geerbt, hätten deine Eltern eine andere Partie gewählt. Es ist wahr, dass ich in dem Fall jetzt Nonne wäre, wahr ist aber auch, dass es Eskil und das neue Leben, das ich unter dem Herzen trage, ohne Varnhem nicht gegeben hätte.«
Er antwortete nicht. Es sah aus, als wären seine Gedanken zu hitzig, um in vernünftige Worte gekleidet zu werden. In diesem Moment trat Sot mit dem Sohn Eskil zu ihnen. Dieser lief sofort zu seiner Mutter, fasste sie bei der Hand und begann schnell und laut von all dem zu sprechen, was er im Dom gesehen hatte. Nachdem er so lange gezwungen gewesen war, stumm und still zu bleiben, strömten ihm jetzt die Worte wie Wasser aus dem Mund, so als hätte man im Frühling einen Damm geöffnet.
Magnus nahm seinen Sohn auf den Arm, strich ihm liebevoll übers Haar und betrachtete gleichzeitig seine angetraute Frau, erfüllt von einem etwas anderen Gefühl als Liebe. Doch dann ließ er den Knaben plötzlich wieder hinunter und befahl fast unfreundlich, Sot solle Eskil mitnehmen, um die Gaukler und Spielleute anzusehen. Sot nahm den Knaben erstaunt bei der Hand und führte ihn weg, während dieser quengelte und sich nur widerstrebend mitziehen ließ.
»Wie du aber auch weißt, mein lieber Gemahl«, fuhr sie schnell fort, um das Gespräch zu lenken und nicht zuzulassen, dass er sich ohne Sinn und Verstand vom Zorn übermannen ließ, »habe ich mir Varnhem als Morgengabe gewünscht, obwohl ich es selbst geerbt hatte. Ich habe es als Morgengabe erhalten, schriftlich und mit Siegel, und deshalb besitze ich jetzt kaum mehr als den Umhang, den ich trage, und ein wenig Gold, mit dem ich mich schmücken kann.«
»Ja, das ist wahr«, erwiderte Magnus mürrisch. »Aber gleichwohl ist Varnhem ein Drittel unseres gemeinsamen Eigentums, ein Drittel, das du Eskil jetzt genommen hast. Ich verstehe nicht, weshalb du so etwas getan hast, auch wenn du das Recht dazu hattest.«
»Lass uns langsam zu den Spielleuten gehen und nicht hier stehen bleiben. Das könnte so aussehen, als wären wir einander böse. Ich werde dir dann alles erklären«, sagte sie und bot ihm ihren Arm.
Magnus sah sich verlegen um, erkannte, dass sie recht hatte, lächelte bemüht und nahm ihren Arm.
»Hör mich an«, sagte sie nach einiger Zeit zögernd. »Lass uns mit den irdischen Dingen beginnen, die dir im Augenblick am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Ich nehme natürlich alles Vieh und alle Leibeigenen mit nach Arnäs. Varnhem hat zwar die besseren Gebäude, aber Arnäs können wir dafür von Grund auf neu aufbauen, besonders jetzt, da wir so viel mehr Hände bekommen, die für uns arbeiten können. So haben wir einen besseren Wohnsitz, besonders im Winter. Mehr Vieh bedeutet mehr Fässer mit gepökeltem Fleisch und mehr Häute, die wir mit dem Boot nach Lödöse schicken können. Du möchtest doch so gern mit Lödöse Handel treiben, und von Arnäs aus kann man das sowohl im Winter als auch im Sommer, von Varnhem aus jedoch nur schwerlich.«
Er ging vornübergebeugt und still an ihrer Seite, aber sie sah, dass er sich beruhigt hatte und interessiert zuzuhören begann. Da wusste sie, dass es keinen Streit mehr würde geben müssen. Sie sah alles so klar vor sich, als hätte sie viel Zeit darauf verwandt, sich alles auszudenken, obwohl die ganze Idee nicht älter war als eine Stunde.
Mehr Leder und Fässer mit gepökeltem Fleisch für Lödöse bedeuteten mehr Silber, und mehr Silber bedeutete mehr Saatgut. Mehr Saatgut bedeutete, dass mehr Leibeigene ihre Freiheit gewinnen könnten, indem sie neuen Boden urbar machten, Saatgut liehen und in Roggen doppelt zurückzahlten, den man nach Lödöse schicken und gegen noch mehr Silber eintauschen konnte. Dann könnten sie die Befestigungen in Angriff nehmen, an die Magnus schon immer gedacht hatte, da sich Arnäs schwer verteidigen ließ, besonders im Winter, wenn der See vereist war. Wenn sie alle Kräfte auf Arnäs konzentrierten, wären sie bald reicher und besäßen mit all dem urbar gemachten Boden überdies mehr Land. Ihre Wohnung wäre wärmer und geschützter, und sie würden Eskil ein größeres Erbe hinterlassen können als ursprünglich.
Als sie ans Ende der Menge gelangt waren – sie bahnten sich wie selbstverständlich und ohne viel Aufhebens ihren Weg -, blieb Magnus lange stumm und nachdenklich stehen. Keuchend kam Sot mit dem kleinen Eskil auf dem Arm heran. Sie hielt ihn vor sich in die Höhe, damit die Leute an seiner Kleidung erkannten, dass auch sie ein Recht hatte, sich an ihnen vorbeizudrängen. Der Junge sprang hinunter und stellte sich vor seine Mutter. Diese legte ihm sanft die Hände auf die Schultern, strich ihm zärtlich über die Wange und rückte ihm seine Mütze mit der Feder zurecht.
Die Spielleute vor ihnen trugen lustige Kleider in kräftigen Farben und kleine Glöckchen an Beinen und Handgelenken, sodass alle ihre Bewegungen von deren Klang begleitet wurden. In diesem Augenblick bauten sie einen hohen Turm, der aus Menschen bestand. Ganz oben stand ein sehr kleiner Knabe, der vielleicht nur ein Jahr älter war als Eskil. Die Leute riefen laut vor Entsetzen und Entzücken, und Eskil zeigte eifrig mit dem Finger und sagte, er wolle auch Gaukler werden, was seinen Vater in ein überraschend herzliches Lachen ausbrechen ließ. Sigrid sah ihn vorsichtig von der Seite an und dachte sich, dass die Gefahr mit diesem Lachen wohl vorüber sei.
Er ertappte sie dabei, dass sie ihn verstohlen anblickte und immer noch lächelte, als er sich vorbeugte und sie auf die Wange küsste.
»Du bist wahrlich eine bemerkenswerte Frau, Sigrid«, flüsterte er ohne Zorn in der Stimme. »Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast, und du hast in allem recht. Wenn wir all unsere Kräfte auf Arnäs konzentrieren, werden wir reicher. Wie könnte sich ein Kaufmann eine bessere und treuere Frau wünschen als dich?«
Sie erwiderte schnell und leise mit gesenktem Blick, dass keine Frau einen gütigeren und verständnisvolleren Gemahl haben konnte als sie. Doch dann hob sie den Blick, sah ihm ernst in die Augen und fügte hinzu, dass sie in der Kirche tatsächlich eine Offenbarung gehabt hatte. All das musste vom Heiligen Geist selbst gekommen sein, auch die klugen Gedanken und alles, was die Geschäfte betraf.
Magnus blickte ein wenig übellaunig drein, als glaubte er ihr nicht recht, fast so, als machte sie sich über heilige Dinge lustig; er war sehr viel gläubiger als sie, das wussten beide. Die Jahre im Kloster hatten Sigrid nicht im mindesten weicher gemacht.
Als die Spielleute und Gaukler ihren Auftritt beendet hatten und zum Bierzelt gingen, um sich das Freibier einschenken zu lassen und den sorgfältig gewendeten Braten zu verzehren, den sie sich verdient hatten, nahm Magnus seinen Sohn auf den Arm und ging mit Sigrid an der Seite und Sot zehn ehrerbietige Schritte hinter sich auf das Stadttor zu; jenseits des Bohlenzauns warteten ihr Wagen und ihre Leibwache. Unterwegs erzählte Sigrid klug und wortreich von ihrer Offenbarung und beschrieb, wie man die Botschaft zu deuten hatte.
Ihre erste Entbindung hatte sie ja nahezu getötet, und die Heilige Mutter Gottes hatte sie und Eskil erst auf der Schwelle des Todes gerettet. Und jetzt war es ja bald wieder so weit. Aber indem sie Varnhem den Mönchen zum Geschenk machte, waren ihr zahlreiche Fürbitten sicher, und zwar durch solche Männer, die zahlreiche Gebete beherrschten. Sie und das neue Kind würden leben dürfen.
Wichtiger aber war natürlich, dass ihre vereinten Geschlechter jetzt mächtiger werden würden, wenn Arnäs stark und reich ausgebaut wurde. Nur in einem Punkt war sie sich unsicher: Wer der junge Mann auf dem silberfarbenen Pferd mit der üppigen weißen Mähne und dem selbstbewusst gehobenen, langen weißen Schweif gewesen sein könnte. Der heilige Bräutigam jedenfalls nicht, denn der konnte wohl kaum auf einem feurigen Hengst mit einem Schild auf dem Arm angeritten kommen.
Das Problem schien Magnus zu beschäftigen. Er grübelte eine Weile und erkundigte sich dann nach der Größe der Pferde und ihrer Art, sich zu bewegen. Dann wandte er ein, solche Pferde gebe es gar nicht, und fragte, was sie damit gemeint hatte, dass auf dem Schild ein Kreuz aus Blut gewesen sei. Und woher konnte sie wissen, dass es nicht nur rote Farbe war?
Sie erwiderte, sie wisse es einfach. Das Kreuz war rot gewesen, aber aus Blut, der Schild dagegen völlig weiß. Von der Kleidung des Jünglings hatte sie nicht viel gesehen, da der Schild seine Brust verdeckt hatte, aber er war auf jeden Fall weiß gekleidet gewesen. Weiße Kleider, genau wie die Zisterzienser, aber ein Mönch war er auf gar keinen Fall gewesen, da er ja den Schild eines Kriegers und unter seiner Kleidung vermutlich einen Ringpanzer getragen hatte.
Magnus fragte nachdenklich nach Form und Größe des Schildes, doch als er erfuhr, dass dieser herzförmig und gerade so groß gewesen war, dass er die Brust schützte, schüttelte er misstrauisch den Kopf und erklärte, einen solchen Schild habe er noch nie gesehen. Aber als gewöhnlicher Mensch konnte man ja nicht alles verstehen, was einem offenbart wurde. Und am Abend sollten sie gemeinsam in Dankbarkeit beten, weil die Mutter Gottes ihnen so viel Milde und Klugheit erwiesen hatte.
Sigrid atmete auf. Sie empfand große Erleichterung und inneren Frieden. Das Schlimmste war überstanden, jetzt blieb nur noch, so auf den alten König einzuwirken, dass er ihr das Geschenk nicht wegnahm und es allein in seinem Namen den Mönchen vermachte. Im Alter hatte er sich zunehmend um die Zahl der für ihn gehaltenen Fürbitten gesorgt und schon zwei Klöster gegründet, um in dieser Frage Gewissheit zu erlangen. Das wusste jeder, seine Freunde ebenso gut wie seine Feinde.
König Sverker war grausam verkatert und überdies wütend, als Sigrid und Magnus den großen Saal des Kronguts betraten, in dem der König jetzt die Entscheidungen eines langen Arbeitstages treffen sollte – angefangen bei der Frage, wie die gestern auf dem Markt festgenommenen Diebe hingerichtet werden sollten, ob man sie nur hängen oder zuvor foltern sollte, bis hin zu Erbschaftsstreitigkeiten, die bei den gewöhnlichen Gerichtstagen nicht hatten gelöst werden können.
Was ihn jedoch noch mehr erzürnte als sein Kater, war die neueste Nachricht über seinen zweitjüngsten, lümmelhaften Sohn, der ihn jämmerlich hintergangen hatte. Johan war zu einem Plünderungszug ins dänische Halland aufgebrochen, was an sich nicht sonderlich bemerkenswert war. Derlei taten die jungen Herren, wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen wollten, statt nur mit Würfeln zu spielen. Allerdings hatte er gelogen, was die beiden Frauen betraf, die er geraubt und zu seinen Leibeigenen gemacht hatte. Es hatte den Eindruck erweckt, als handle es sich um irgendwelche ausländischen Mädchen. Doch jetzt war ein Schreiben des dänischen Königs eingetroffen, in dem bedauerlicherweise etwas völlig anderes stand: Die beiden Frauen waren die Ehefrau von Jarl des dänischen Königs in Halland und deren Schwester. Das hieß also Schmach und Freveltat, und jeder, der nicht gerade ein Königssohn war, hätte für ein solches Verbrechen sofort mit seinem Leben büßen müssen. Der Lümmel hatte die beiden Frauen geschändet. Folglich war es nicht einmal möglich, sie in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie geraubt worden waren. Wie sehr man die Sache auch drehte und wendete, das Ganze würde viel Silber kosten, und schlimmstenfalls würde der König deswegen einen Krieg an den Hals bekommen.
König Sverker und seine engsten Vertrauten hatten darüber so laut gestritten, dass schon bald allen Anwesenden im Saal die ganze Wahrheit aufgegangen war. Nur eins war vollkommen sicher – dass die Frauen zurückgegeben werden mussten. Aber damit war die Einigkeit schon zu Ende. Einige waren der Meinung, es hieße Schwäche zeigen, wenn man Silber zahlte. Dann könne sich der dänische König Sven Grate in den Kopf setzen, mit einem Heerzug einzufallen, zu plündern und Eroberungen zu machen. Andere meinten, dass viel Silber immer noch billiger käme als ein Feldzug und Plünderungen, gleichgültig, wer von ihnen einen solchen Krieg gewänne.
Nach langem und wortreichem Streit hatte sich der König plötzlich mit einem müden Seufzen an Pater Henri von Clairvaux gewandt, der ganz vorn im Saal saß und darauf wartete, dass die Lurö-Angelegenheit zur Sprache kam. Er saß mit gesenktem Kopf da, wie in ein Gebet versunken. Die spitze weiße Kapuze hatte er sich über den Kopf gezogen, sodass man nicht sah, ob er tatsächlich betete oder vielleicht schlief. Jetzt stellte sich heraus, dass er wohl eher geschlafen hatte. In jedem Fall hatte Pater Henri die hitzige Diskussion nicht verstanden, und als er jetzt dem König antwortete, hörte es sich eher an wie Latein als wie die Volkssprache, sodass niemand verstand, was er sagte. Es war kein anderer Gottesmann in der Nähe, da hier vor allem weltliche und geringe Streitfragen abgehandelt werden sollten. Der König sah sich erzürnt im Saal um und brüllte mit hochrotem Gesicht, man sollte sofort irgendeinen Kerl herbeischaffen, der diese vornehme Klerikersprache beherrschte.
Sigrid erkannte augenblicklich ihre Gelegenheit, erhob sich und schritt gesenkten Hauptes nach vorn. Sie verneigte sich in Ehrfurcht erst vor König Sverker und dann vor Pater Henri.
»Mein König, ich stehe dir gern zu Diensten«, sagte sie und erwartete stehend seine Entscheidung.
»Wenn es hier keinen Mann gibt, dann muss es eben auch so gehen, ich meine, wenn es hier keinen Mann gibt, der diese Sprache spricht«, seufzte der König müde. »Wie kommt es übrigens, dass du sie beherrschst, meine liebe Sigrid?«, fügte er mit viel sanfterer Stimme hinzu.
»Das Einzige, was ich während meiner Verbannung im Kloster wirklich gut gelernt habe, war Latein, wie ich zu meiner Schande gestehen muss«, erwiderte Sigrid leise und machte ein sittsam ernstes Gesicht, wobei Magnus als einziger Mann im Saal ihr spöttisches Lächeln bei diesen Worten erahnen konnte.
Der König hatte jedoch keinen Spott über heilige Dinge herausgehört und bat Sigrid prompt, neben Pater Henri Platz zu nehmen, diesem die Lage zu erklären und ihn dann um seine Ansicht in dieser Angelegenheit zu bitten. Sie gehorchte sofort, und während sie und Pater Henri eine gemurmelte Konversation begannen, die außer ihnen im Saal offenbar niemand verstehen konnte, breitete sich eine peinliche Stimmung aus; die Männer sahen einander forschend an. Einer zuckte die Achseln, ein anderer faltete mit übertriebener Gebärde die Hände und verdrehte die Augen.
Nach einiger Zeit erhob sich Sigrid und erklärte mit lauter Stimme, was das Gemurmel im Saal sofort verstummen ließ, Pater Henri habe sich die Sache durch den Kopf gehen lassen und sei jetzt der Meinung, dass es am klügsten wäre, den Lümmel zu zwingen, die Schwester der Jarlsgemahlin zu heiraten. Die Ehefrau des Jarls selbst sollte jedoch mit Geschenken und guter Kleidung, mit Fahnen und Musik zurückgeschickt werden. König Sverker und sein Sohn müssten allerdings auf eine Mitgift verzichten, womit auch die Frage gelöst war, ob Silber zu zahlen sei. Auf das, was der Lümmel selbst in dieser Sache dachte, konnte man keine Rücksicht nehmen, denn wenn man ihn und die Schwester der Jarlsgemahlin vermählen konnte, würden die Blutsbande einen Krieg verhindern. Etwas musste der Lümmel schließlich tun, um für sein vorwitziges Verhalten zu büßen. Krieg war trotz allem die teuerste Lösung.
Als Sigrid verstummt war und sich gesetzt hatte, wurde es zunächst vollkommen still, während die Anwesenden den Vorschlag überdachten, den der Mönch gemacht hatte. Doch dann breitete sich langsam ein zustimmendes Murmeln aus. Jemand zog sein Schwert aus der Scheide und ließ es mit der Breitseite hart auf die schwere Tischplatte niedersausen, die an den vorderen Längswänden entlang verlief. Andere folgten seinem Beispiel, und kurz darauf dröhnte es im Saal von Waffengeklirr, und damit war die Sache bis auf Weiteres entschieden.
Da Sigrid ohnehin schon am Kopfende des Saals saß und es den Anschein hätte, als hätte sie einen gewissen Anteil an dem klugen Vorschlag Pater Henris, beschloss König Sverker, die Gelegenheit zu nutzen, um die Frage der Zukunft von Varnhem aufzugreifen. Er winkte einen Schreiber heran, und dieser begann, die Urkunde zu verlesen, die der König bestellt hatte, um die Frage vor dem Gesetz zu entscheiden. Dem verlesenen Text zufolge hatte es jedoch den Anschein, als handelte es sich allein um ein Geschenk des Königs.
Sigrid bat, den Text in die Hände zu bekommen, um ihn für Pater Henri übersetzen zu können, nutzte aber auch die Gelegenheit, mit sanfter Stimme vorzuschlagen, dass vielleicht auch Herr Magnus an dem bevorstehenden Gespräch teilnehmen solle. Natürlich, natürlich, meinte der König und bedeutete ihr peinlich berührt zu schweigen. Er gab Magnus ein Zeichen, vorzutreten und sich neben seine Frau zu setzen.
Sigrid übersetzte rasch den Text für Pater Henri. Dieser hatte seine Kapuze inzwischen abgestreift und versuchte, sich mühsam durch den Text zu buchstabieren, während Sigrid mit dem Finger zeigte. Als sie fertig war, fügte sie schnell hinzu, sodass es den Eindruck machte, als übersetzte sie noch, das Geschenk komme von ihr und nicht vom König, dass sie aber vor dem Gesetz die Zustimmung des Königs brauche. Pater Henri warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. Seine Lippen umspielte ein feines Lächeln, das an ihres erinnerte. Er nickte nachdenklich.
»Nun«, sagte der König ungeduldig, als wollte er die Angelegenheit schnell vom Tisch haben. »Habt Ihr, hochwürdiger Pater Henri, in dieser Sache etwas zu sagen oder vorzuschlagen?«
Sigrid übersetzte die Frage und blickte dem Mönch dabei vielsagend in die Augen. Dieser hatte keine Mühe, ihre Gedanken zu lesen.
»Nun ja«, begann er vorsichtig, »es ist eine gottgefällige Tat, den Fleißigsten im Weinberg des Herrn etwas zu schenken. Doch vor Gott wie vor dem Gesetz kann ein solches Geschenk nur dann angenommen werden, wenn man mit völliger Sicherheit weiß, wer tatsächlich der Schenkende und wer der Empfänger ist. Handelt es sich hier um das persönliche Eigentum Eurer Majestät, an dem wir jetzt so freigebig teilhaben sollen?«
Mit einer kleinen Kreisbewegung der Hand bedeutete er Sigrid zu übersetzen. Sie leierte die Worte schnell und tonlos herunter.
Der König wurde sichtlich verlegen und warf Pater Henri einen scheuen Blick zu, während dieser den König nur freundlich und fragend anblickte, als setze er wie selbstverständlich voraus, dass alles seine Ordnung hatte. Sigrid sagte nichts. Sie wartete.
»Ja, vielleicht … vielleicht«, murmelte der König peinlich berührt. »Vielleicht könnte man sagen, dass ein solches Geschenk von Gesetzes wegen vom König stammen muss, denn so ist es ja. Ich meine, damit niemand die Rechtmäßigkeit anzweifeln kann. Aber das Geschenk kommt auch von Frau Sigrid, die hier unter uns steht.«
Als der König zögerte, wie er fortfahren sollte, nutzte Sigrid die Gelegenheit und übersetzte, was er soeben gesagt hatte, und zwar in dem gleichen förmlich leiernden Tonfall wie zuvor. Und da hellte sich Pater Henris Gesicht auf, gleichsam in freundlichem Erstaunen, als er jetzt erfuhr, was er schon wusste. Dann schüttelte er mit einem sanften Lächeln sachte den Kopf und erklärte mit einfachen Worten, aber doch mit der höfischen Gewundenheit, die erforderlich war, wenn man einen König zurechtwies, dass es vor Gott wohl passender wäre, sich auch in offiziellen Dokumenten an die ganze Wahrheit zu halten. Wenn man diesen Brief mit dem Namen des richtigen Spenders ausfertigte, dazu mit Billigung und Bestätigung des Geschenks durch Seine Majestät, war die Sache in Ordnung. Dann könnten Fürbitten sowohl für Seine Majestät als auch für die Spenderin gesprochen werden.
König Sverker fasste schnell einen Beschluss und fügte hinzu, der Brief sollte sowohl in Volkssprache als auch in Latein verfasst werden. Er wollte sein Siegel schon im Lauf des Tages daruntersetzen; und nun konnte man sich vielleicht etwas aufmuntern, indem man zu der Frage überging, wie und wann die Hinrichtungen stattfinden sollten.
Die Frage, was mit Varnhem geschehen sollte, war damit bis auf Weiteres entschieden.
An Philippus und Jakobi, dem Tag, an dem das Gras schon so grün und üppig war, dass man das Vieh auf die Weiden treiben und die Zäune in Augenschein nehmen konnte, ergriff Sigrid ein Schrecken, als hätte ihr eine kalte Hand das Herz zusammengepresst. Sie spürte, dass es jetzt beginnen würde. Doch der Schmerz verging so schnell, dass er ihr schon kurz darauf wie eine Einbildung vorkam.
Sie war mit dem kleinen Eskil an der Hand zum Bach hinuntergeschlendert, wo die Mönche und ihre Laienbrüder gerade damit beschäftigt waren, mit Blockrollen, Seilen und vielen Zugtieren ein gewaltiges Mühlrad in die richtige Lage zu hieven. Sie hatten die Ufer des Bachs mit Steinen ausgemauert, ihn schmaler und tiefer gemacht, um dort, wo das Mühlrad jetzt aufgehängt werden sollte, eine stärkere Strömung zu erzeugen. Das Mühlrad war aus mehr als tausend Eichenstücken kunstvoll zusammengefügt und sollte genügend Kraft liefern, um nicht nur eine Getreidemühle anzutreiben, sondern auch den Hammer in der Schmiede, die bald fertig sein würde.
Ein Stück weiter stromabwärts befand sich eine ähnliche, aber kleinere Vorrichtung. Dort sah das Wasserrad etwas anders aus: Es war wie eine lange Reihe von Eimern geformt, die Wasser aus dem Bach hoben und es in einen Kanal aus ausgehöhlten Eichenstämmen kippten. Zwischen dem Kanal und dem Gelände, auf dem die Kirche und die anderen Gebäude des Klosters stehen sollten, herrschte eine gewisse Fallhöhe. Der Wasserstrom sollte durch mehrere der Bauwerke verlaufen und dann wieder in den Bach geleitet werden. Man wollte ihn überbauen, damit er im Winter nicht gefror, und so würde man immer fließendes Wasser haben, sowohl im Kochhaus als auch in den Aborten.
Sigrid hatte an den Baustellen viel Zeit zugebracht, und Pater Henri hatte ihr geduldig erzählt, was dort geschah und welche Absichten man verfolgt. Sie hatte zwei ihrer besten Leibeigenen mitgenommen: Svarte, der Sot befruchtet hatte, und Gur, dessen Weib und Kinder oben in Arnäs lebten. Sie hatte ihnen alles sorgfältig in ihre Sprache übersetzt und erklärt, was Pater Henri beschrieben hatte.
Magnus hatte mit ihr darüber gezetert, dass sie unten in Varnhem doch ohnehin keine Verwendung für die besten Leibeigenen hatte, zumindest nicht die männlichen Geschlechts. Die hätten sich viel besser bei den Bauarbeiten in Arnäs nützlich machen können. Sigrid war jedoch hart geblieben und hatte erklärt, es gebe von den Burgunder Laienbrüdern und den englischen Steinmetzen, die Pater Henri eingestellt habe, viel Nützliches zu lernen. Und wie schon so oft hatte sie auch diesmal ihren Willen durchgesetzt, obwohl es einem Mann aus dem Westlichen Götaland nur schwer zu erklären war, dass die Ausländer so viel bessere Baumeister sein sollten.
In nur wenigen Monaten hatte sich Varnhem in eine große Baustelle verwandelt, auf der die Hammerschläge widerhallten, die Sägen kreischten und quietschten und die großen Schleifsteine aus Sandstein ächzten und lärmten. Beim ersten Anblick konnte das Ganze planlos und wirr aussehen, so wie man bei einem Ameisenhaufen den Eindruck hat, als liefen die Ameisen ohne Sinn und Verstand hin und her. Es steckten jedoch sorgfältig ausgearbeitete Pläne hinter allem, was geschah. Vorarbeiter war ein kräftig gebauter Mönch namens Guilbert de Beaune. Als einziger der Mönche packte er selbst mit an. Im Übrigen erledigten die braun gekleideten Laienbrüder alle Arbeit, die mit den Händen verrichtet werden musste.
Die anderen Mönche, die bis auf Weiteres das Langhaus von Varnhem als Wohnung und Andachtsraum übernommen hatten, befassten sich meist mit geistlichen Dingen oder dem Schreiben.
Nach einiger Zeit hatte Sigrid den Laienbrüdern die Hilfe von Svarte und Gur angeboten. Sie verfolgte damit eher das Ziel, die beiden gleichsam in die Lehre gehen zu lassen, als sich besonders hilfsbereit zu zeigen. Zunächst waren einige der Laienbrüder zu Pater Henri gekommen und hatten darüber Klage geführt, dass die ungehobelten und ungebildeten Leibeigenen sich bei fast allem, was man ihnen anvertraue, höchst ungeschickt anstellten. Pater Henri hatte alle diese Klagen jedoch mit einer Handbewegung abgetan, da er sehr wohl verstand, welche Absicht Sigrid mit diesen Lehrlingen verfolgte. Er hatte nämlich mit Bruder Guilbert unter vier Augen über diese Frage gesprochen, was zum Verdruss vieler Laienbrüder dazu geführt hatte, dass Svarte und Gur gerade dann, als sie sich an einem Arbeitsplatz einigermaßen geschickt zu zeigen begannen, an einen neuen weitergereicht wurden, wo die dumme Unbeholfenheit wieder von vorn begann. Die beiden Leibeigenen mussten Steine behauen und schleifen, glühende Eisen bearbeiten, Mühlräder aus Eichenstücken zusammenfügen, Brunnen oder Kanäle aufmauern, Gemüsebeete von Pflanzen säubern, die dort nichts zu suchen hatten, Eichen und Buchen fällen und die Stämme für verschiedene Zwecke bearbeiten. Schon bald hatten sie von den meisten Dingen einiges gelernt. Sigrid erkundigte sich nach ihren Fortschritten und machte Pläne für ihre künftige Verwendung. Sie stellte sich vor, dass die beiden ihre Freiheit durch Arbeit gewinnen sollten; nur wer etwas Nützliches beherrschte, konnte als Freigelassener im Leben zurechtkommen. Der Glaube und die Erlösung der beiden Männer interessierte sie weit weniger, und außer Sot hatte sie keinen ihrer Leibeigenen zur Taufe gezwungen.
Es war eine ruhige Zeit gewesen. Als Hausherrin hatte Sigrid nicht so viel zu tun gehabt wie als Eigentümerin von Varnhem oder wenn sie für alle Arbeit auf dem Hof oben in Arnäs verantwortlich gewesen wäre. Sie hatte sich bemüht, möglichst wenig an das Unvermeidliche zu denken, was so sicher bevorstand, wie der Tod zu allen Menschen kommt – zu Leibeigenen wie zu Menschen von Stand. Da das Langhaus nicht als Kloster geweiht war, konnte sie an den fünf Gebetsstunden teilnehmen, die dort täglich abgehalten wurden, wann immer sie wollte. Je weiter die Zeit voranschritt, umso fleißiger hatte sie die Gebetsstunden besucht. Sie hatte immer für das Gleiche gebetet: ihr Leben und das des Kindes, ferner dafür, dass die Heilige Jungfrau ihr Kraft und Mut verleihen möge, sowie um Verschonung von dem Schmerz, den sie beim ersten Mal erlitten hatte.
Jetzt ging sie mit kaltem Schweiß auf der Stirn, sacht und sehr vorsichtig, als würde sie mit allzu kräftigen Bewegungen den Schmerz auslösen, vom Bauplatz zum Hof hinauf. Sie rief Sot zu sich und brauchte ihr nicht zu sagen, wie es um sie bestellt war. Sot nickte und grunzte etwas in ihrer kargen Sprache, eilte zum Kochhaus und begann, mit den anderen leibeigenen Frauen alles herzurichten. Sie entfernten schnell alle Geräte, die zum Backen und Kochen dienten, fegten und putzten den Fußboden blank und trugen dann Strohpolster und Felle von dem kleinen Haus herbei, in dem Sigrid ihre eigenen Vorräte aufbewahrte. Als alles hergerichtet war, setzten zum zweiten Mal die Wehen ein. Diesmal war es sehr viel schlimmer als beim ersten Mal, und Sigrid wurde weiß im Gesicht, sank vor Schmerz in sich zusammen und musste zum Bett geführt werden, das in der Mitte des Raumes stand. Die leibeigenen Frauen hatten den Feuern im Haus mit Blasebälgen nachgeholfen und reinigten in großer Eile Dreifüße, die sie mit Wasser füllten und aufs Feuer stellten.
Als der Schmerz nachließ, schickte Sigrid nach Pater Henri und bat Sot, dafür zu sorgen, dass Eskil mit den anderen Kindern ferngehalten würde, damit er die Schreie seiner Mutter nicht hören musste, falls es dazu kommen sollte. Jemand musste aber auch die Kinder im Auge behalten, damit sie dem großen und gefährlichen Mühlrad nicht zu nahe kämen; mehr als alles andere in der Gegend hatte dies offenbar ihre Neugier geweckt.
Sigrid blieb eine Zeit lang allein liegen und blickte durch das Abzugsloch im Dach und das große offene Fenster der einen Längswand. Dort draußen zwitscherten die Vögel: die Finken, die tagsüber singen, bevor die Drosseln ihre Wohllaute erklingen lassen, sodass die anderen Vögel vor Scham verstummen.
Sigrid trat der Schweiß auf die Stirn, aber ihr war dennoch so kalt, dass sie zitterte. Eine ihrer Leibeigenen trat schüchtern zu ihr und strich ihr mit einem feuchten Leinentuch über die Stirn, wagte aber nicht, der Herrin in die Augen zu sehen.
Magnus hatte sie ermahnt, rechtzeitig kundige Frauen aus Skara kommen zu lassen, wenn die Zeit näher rückte. Doch es war, als hätte Sigrid das Unvermeidliche immer weiter aufschieben wollen, als hätte sie insgeheim darauf gehofft, gar nicht gebären zu müssen. Das war dumm gewesen und eitel. Jetzt würde sie am Ende doch unter lauter leibeigenen Frauen bleiben; sie wusste sehr wohl, was Magnus dazu sagen würde. Doch er war letztlich nur ein Mann und konnte nicht verstehen, dass die Leibeigenen, die sich meist viel stärker vermehrten als Leute von Stand, gute Kenntnisse besaßen, was die Geburt betraf. Mochten sie auch keine helle Haut haben, mochten sie auch keine schönen Reden führen und sich nicht höfisch benehmen wie die Frauen, die Magnus jetzt lieber hier gesehen hätte mit ihrem Geplapper und ihrem wirrköpfigen Umherlaufen, so besaßen die Leibeigenen doch genügend Wissen. Falls die Hilfe von Menschen überhaupt ausreichte. Die Heilige Jungfrau Maria würde helfen oder auch nicht, unabhängig davon, welche Seelen sich im Raum befanden.
Auch die leibeigenen Frauen hatten Seelen wie Menschen von Stand, darüber hatte Pater Henri in starken und überzeugenden Worten mit ihr gesprochen. Und im Himmelreich gab es nicht frei oder unfrei, erhaben oder niedrig, dort gab es nur die Seelen, die sich in Güte verdient gemacht hatten.
Als Pater Henri den Raum betrat, sah sie, dass er Gebetsbänder bei sich hatte. Er hatte verstanden, was für eine Art Beistand sie jetzt suchte. Doch er tat zunächst, als wüsste er von nichts, und machte sich nicht einmal die Mühe, die Leibeigenen hinauszujagen, die wie gehetzt mit neuen Wassereimern umherliefen, den Fußboden fegten und Leinentücher und Windeln brachten.
»Sei gegrüßt, verehrte Frau des Hauses. Soviel ich sehe, nähern wir uns in Varnhem einer freudigen Stunde«, sagte Pater Henri und sah sie freundlich und ruhig an.
»Oder einer Stunde der Trauer, Pater. Das wissen wir erst, wenn es vorüber ist«, sagte Sigrid stöhnend und starrte ihn angsterfüllt an, da sie glaubte, eine neue Wehe stünde bevor. Doch das hatte sie sich nur eingebildet, denn es kam keine.
Pater Henri trug einen kleinen dreibeinigen Hocker zu ihrem Lager, nahm ihre Hand und streichelte sie.
»Du bist eine kluge Frau«, sagte er, »und besitzt als Einzige, die ich in der Welt außerhalb des Klosters kennengelernt habe, den Verstand, lateinisch zu sprechen. Auch in vielen anderen Dingen beweist du diesen Verstand, indem du etwa deine Leibeigenen all das lernen lässt, was wir können. Sag mir: Warum sollte das, was dich erwartet, etwas so Besonderes sein, wenn auch alle anderen Frauen es durchmachen – hochwohlgeborene Frauen wie du, aber auch leibeigene und elende, Tausende und Abertausende von Frauen? Stell dir vor, gerade in diesem Augenblick bist du nicht allein auf der Welt. Vielleicht bist du eben jetzt, wo wir hier zusammensitzen, mit zehntausend Frauen auf der ganzen Welt verbunden. Sag mir also eins: Warum solltest ausgerechnet du etwas zu befürchten haben, mehr als alle anderen?«
Er hatte in wohlgesetzten Worten gesprochen, fast wie bei einer Predigt, und Sigrid sagte sich, dass er sie sich wohl schon mehrere Tage hatte durch den Kopf gehen lassen, die ersten Worte, die er zu ihr sprechen würde, wenn die Stunde des Schreckens näher rückte. Sie konnte nicht umhin zu lächeln, als sie ihn ansah, und er sah ihrem Lächeln an, dass sie ihn durchschaut hatte.
»Du sprichst weise, Pater Henri«, sagte sie mit schwacher Stimme. Sie fürchtete sich davor, erneut vom Schmerz überfallen zu werden. »Aber von den zehntausend Frauen, von denen du gesprochen hast, wird morgen vielleicht schon die Hälfte tot sein, und ich könnte eine von ihnen sein.«
»Dann würde es mir schwerfallen, unseren Erlöser zu verstehen«, erwiderte Pater Henri ruhig und immer noch lächelnd. Sein Blick suchte die ganze Zeit den ihren.
»Es gibt aber doch Dinge, die unser Erlöser tut und die du nicht verstehst, Pater?«, flüsterte sie, während sie sich in Erwartung der nächsten Schmerzwelle anspannte.
»Das ist wahr«, bestätigte Pater Henri mit einem Kopfnicken. »Es gibt sogar Dinge, die auch unser Gründer nicht versteht, der heilige Bernhard von Clairvaux. Etwa die schweren Niederlagen, welche die Unsrigen zurzeit im Heiligen Land erleiden. Er selbst forderte dringender als jeder andere, dass wir mehr Leute hinschicken. Er wünschte nichts sehnlicher als den Sieg über die Ungläubigen für unsere gerechte Sache. Dennoch wurden wir hart geschlagen, unserem starken Glauben und unserer guten Sache zum Trotz. Es ist wahr, dass wir Menschen unseren Erlöser nicht immer verstehen können.«
»Ich möchte noch Zeit für die Beichte haben«, flüsterte Sigrid.
Pater Henri schickte die leibeigenen Frauen hinaus, legte seine Gebetsbänder an, segnete sie und sagte, er sei bereit, ihre Beichte anzuhören.
»Vater, verzeih mir, denn ich habe gesündigt«, keuchte sie. Der Schrecken leuchtete ihr dabei aus den Augen. Dann musste sie einige Male tief Luft holen und sich sammeln, bevor sie fortfuhr.
»Ich habe gottlose Gedanken gehabt und weltliche, ich habe dir und den Deinen Varnhem nicht nur deshalb geschenkt, weil der Heilige Geist mir gesagt hat, dass es richtig und gut sei, sondern auch in der Hoffnung, mit dieser Gabe die Mutter Gottes besänftigen zu können. In meiner Torheit und Selbstsucht habe ich sie gebeten, mich von einem weiteren Kindbett zu verschonen, obwohl ich weiß, dass es unsere Pflicht und Schuldigkeit ist, fruchtbar zu sein und uns zu mehren.«
Sigrid hatte in Erwartung der nächsten Wehe schnell und leise gesprochen. Sie traf sie in dem Moment, in dem sie zu Ende gesprochen hatte. Ihr Gesicht verzerrte sich vor Schmerz, und sie biss sich kräftig auf die Lippen, um nicht loszuschreien.
Pater Henri war zunächst unsicher, was er tun sollte, doch dann erhob er sich und holte ein Leinentuch, das er in einen Eimer mit kaltem Wasser tauchte, der neben der Tür stand. Dann trat er zu ihr, hob ihren Kopf an, betupfte ihr Stirn und Gesicht und wischte Schleim und Blut ab, die ihr aus den Mundwinkeln liefen.
»Wahr ist, mein Kind«, flüsterte er, beugte sich zu ihrer Wange hinunter und spürte ihren dampfenden Schrecken, »dass Gottes Wohlgefallen nicht für Geld zu haben ist, dass es eine große Sünde ist, Dinge zu verkaufen oder zu kaufen, die nur Gott geben kann. Wahr ist auch, dass du in deiner menschlichen Schwäche Angst gespürt und die Mutter Gottes um Hilfe und Trost gebeten hast. Doch das ist keine Sünde. Und was die Schenkung von Varnhem betrifft, so hat sich der Heilige Geist auf dich herabgesenkt und dir eine Offenbarung gegeben, für die du bereit warst. Ich vergebe dir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du bist ohne Sünde, und ich verlasse dich nun, um selbst hinauszugehen und zu beten.«
Er ließ ihren Kopf behutsam auf das Kissen sinken und sah, dass sie tief in ihrem Schmerz dennoch ein wenig erleichtert aussah. Er ging schnell hinaus und befahl die wartenden Frauen in barschem Ton wieder ins Haus. Sie rannten los wie ein Schwarm schwarzer Vögel.
Sot zögerte jedoch und zupfte ihn behutsam an der Kleidung. Sie sagte etwas, das er zunächst nicht verstand, da er die Volkssprache genauso wenig beherrschte wie sie. Doch dann strengte sie sich erneut an, sprach sehr langsam und ergänzte ihre Wörter mit Handzeichen. Da verstand er, dass sie aus verbotenen Kräutern einen geheimen Trank gebraut hatte, der Schmerzen lindern konnte und den die Leibeigenen denjenigen ihrer Leute zu geben pflegten, die ausgepeitscht, verstümmelt oder entmannt werden sollten.
Er betrachtete nachdenklich das dunkle Gesicht der kleinwüchsigen Frau, während er überlegte. Er wusste sehr wohl, dass sie getauft war. Aus diesem Grund musste er zu ihr sprechen, als gehörte sie zu seiner Gemeinde. Er wusste auch, dass das, was sie erzählt hatte, der Wahrheit entsprechen konnte. Der Klostergärtner Lucien von Clairvaux kannte viele Rezepte, die die gleiche Wirkung erzielen konnten. Jedoch bestand das Risiko, dass das Getränk, von dem die Leibeigene sprach, mithilfe von Zauberei und bösen Kräften gebraut worden war.
»Hör zu, Frau«, sagte er langsam und so deutlich, wie er vermochte. »Ich gehe klugen Mann fragen. Wenn ich zurückkomme, dann Getränk. Wenn nicht, kein Getränk. Schwöre bei Gott, mir zu gehorchen!«
Sot schwor ergeben bei ihrem neuen Gott, und Pater Henri machte sich eilig auf den Weg, um erst ein Gespräch mit dem Klostergärtner zu führen, bevor er alle Brüder zu einem Gebet für seine Wohltäterin versammelte.
Kurz darauf traf er Bruder Lucien, der erschrocken mit beiden Händen abwehrte: »Diese schmerzlindernden Getränke sind sehr stark. Man kann sie Verwundeten verabreichen oder Sterbenden, und vielleicht auch, wenn einem Menschen der Arm oder der Fuß amputiert werden muss. Auf keinen Fall aber darf man sie Frauen geben, die gebären sollen, denn damit gibt man es auch dem kleinen Kind, das möglicherweise auf ewig verwirrt oder gelähmt auf die Welt käme. Allerdings wäre es interessant, bei Gelegenheit zu erfahren, wie dieser schmerzlindernde Trunk zusammengesetzt ist. Vielleicht bekommen wir dadurch eine neue Anregung.«
Pater Henri nickte beschämt. Das hätte er wissen müssen, selbst wenn er auf das Schreiben, auf Theologie und Musik spezialisiert war, und nicht auf Heilkunst und den Gartenbau. Er rief eilig die Brüder zusammen, um eine lange Gebetsstunde zu beginnen.
Sot hatte sich vorerst entschieden, dem Mönch zu gehorchen, obwohl sie es bedauerlich und eine Schande fand, das Leiden ihrer Herrin nicht lindern zu können. Doch jetzt gab sie den anderen Frauen im Raum ihre Anweisungen. Diese zogen Sigrid von ihrem Lager herunter und lösten ihr die Haare, sodass es ihr lang bis auf den Rücken fiel. Es glänzte und war fast genauso schwarz wie Sots Haar. Sie wuschen sie und wischten ihr den Schweiß von der Stirn, während sie vor Kälte zitterte. Dann streiften sie ihr ein neues Leinenhemd über und zwangen sie, im Raum umherzulaufen. Sie sagten, das werde die Geburt beschleunigen.
In einem Nebel aus Angst und in Erwartung der nächsten Schmerzwelle taumelte Sigrid zwischen zweien ihrer Leibeigenen umher. Sie schämte sich und fühlte sich wie eine Kuh, die auf einem Markt von Leibeigenen herumgeführt wird, die nur da sind, um etwas für ihren Herrn und Eigentümer zu verkaufen. Sie hörte Glockengeläut vom Langhaus her, war sich jedoch ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr sicher.
Dann spülte die nächste Schmerzwelle über sie hinweg. Diesmal begann sie tiefer in ihrem Körper, und sie ahnte, dass die Qual jetzt länger anhalten würde. Da schrie sie laut auf, wenn auch mehr aus Furcht denn vor Schmerz, und sank auf das Lager, auf dem eine der Leibeigenen ihr von hinten unter die Arme griff und sie leicht hochhob, während alle anderen sie immer wieder anschrien, sie müsse mithelfen, sie müsse pressen. Doch sie wagte nicht zu pressen und verlor bald das Bewusstsein.
Als die Dämmerung zur Nacht wurde und die Drosseln verstummten, überkam Sigrid so etwas wie eine Flaute. Die Wehen, die in den Stunden zuvor rasch aufeinandergefolgt waren, schienen jetzt verebbt zu sein. Das war ein Vorzeichen, das nichts Gutes verhieß – das wussten sowohl Sot als auch die anderen. Sie mussten etwas unternehmen.