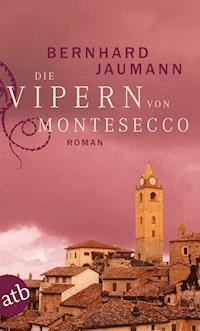9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Clemencia Garises Trilogie
- Sprache: Deutsch
Wann wird man je verstehen? In diesem klarsichtigen Kriminalroman stellt der preisgekrönte Krimiautor Bernhard Jaumann (u.a. Friedrich-Glauser-Preis, Deutscher Krimipreis) die Fragen von Schuld und Wiedergutmachung. Namibia und Deutschland: In Freiburg wird das Grab des Rassenforschers Eugen Fischer geschändet. In Windhoek wird die Frau des deutschen Botschafters entführt - zusammen mit einem schwarzen Kind, das sie adoptieren will. Und in Berlin wird ein Polizist umgebracht, just als eine Delegation ankommt, die zwanzig in der deutschen Kolonialzeit geraubte Hereroschädel nach Namibia zurückholen will. Werden hier Rechnungen beglichen, die seit mehr als hundert Jahren offenstehen? Während die Expolizistin Clemencia Garises in Namibia nach den Entführten sucht, ahnt der Journalist Claus Tiedtke in Berlin, dass ein Attentat droht. Trotz ihrer privaten Spannungen sind die beiden bei den Ermittlungen aufeinander angewiesen. Die großen Fragen der Geschichte können sie nicht lösen, doch verhindern sie letztlich, dass ein makabres Tauschgeschäft stattfindet. Der dritte Fall für Clemencia Garises schlägt den Bogen von deutschen Kolonialverbrechen bis zur aktuellen Diskussion um die Adoption afrikanischer Waisenkinder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bernhard Jaumann
Der lange Schatten
Die Clemencia Garises Trilogie
Kriminalroman
Über dieses Buch
Wann wird man je verstehen? In diesem klarsichtigen Kriminalroman stellt der preisgekrönte Krimiautor Bernhard Jaumann (u.a. Friedrich-Glauser-Preis, Deutscher Krimipreis) die Fragen von Schuld und Wiedergutmachung.
Namibia und Deutschland: In Freiburg wird das Grab des Rassenforschers Eugen Fischer geschändet. In Windhoek wird die Frau des deutschen Botschafters entführt - zusammen mit einem schwarzen Kind, das sie adoptieren will. Und in Berlin wird ein Polizist umgebracht, just als eine Delegation ankommt, die zwanzig in der deutschen Kolonialzeit geraubte Hereroschädel nach Namibia zurückholen will. Werden hier Rechnungen beglichen, die seit mehr als hundert Jahren offenstehen?
Während die Expolizistin Clemencia Garises in Namibia nach den Entführten sucht, ahnt der Journalist Claus Tiedtke in Berlin, dass ein Attentat droht. Trotz ihrer privaten Spannungen sind die beiden bei den Ermittlungen aufeinander angewiesen. Die großen Fragen der Geschichte können sie nicht lösen, doch verhindern sie letztlich, dass ein makabres Tauschgeschäft stattfindet.
Der dritte Fall für Clemencia Garises schlägt den Bogen von deutschen Kolonialverbrechen bis zur aktuellen Diskussion um die Adoption afrikanischer Waisenkinder.
Vita
Bernhard Jaumann wurde 1957 in Augsburg geboren. Er studierte in München und war zehn Jahre Lehrer für Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Italienisch in Bad Aibling, unterbrochen von Auslandsaufenthalten in Italien, Australien und Mexiko. Seit 1997 schreibt er regelmäßig Kriminalromane. Sein Aufenthalt in Namibia inspirierte den Autor zu dem Politthriller «Die Stunde des Schakals», für den er mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet wurde. 2012 erschien «Steinland». «Der lange Schatten» ist der dritte Band der Reihe.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Karte © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Tom Cockrem/Getty Images
ISBN 978-3-644-31001-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Landkarte
1 Freiburg im Breisgau
2 Windhoek, Namibia
3 Berlin
4 Windhoek
5 Berlin
6 Windhoek
7 Berlin
8 Windhoek
9 Berlin
10 Windhoek
11 Windhoek, Parlamentsgarten
Verwendete Literatur
Glossar
1Freiburg im Breisgau
Und was, wenn nicht mehr von dem Mann übrig war als der Name auf seinem Grabstein und der Hass, den er zu Lebzeiten in die Welt gesetzt hatte? Wenn seine Knochen schon längst zerfallen waren? Seit mehr als fünfzig Jahren lag er da in der Erde, in einer fetten Erde, in der man Mais und Gemüse pflanzen könnte. Dünn und unablässig schnürte der Regen auf sie herab. Kaiphas sah nach oben in den dunklen Himmel, eine grundlose Tiefe, auf der das Streulicht der Stadt als schmutziger Schein schwamm. Er schloss die Augen und versuchte die Tropfen zu zählen, die auf seiner Gesichtshaut zerplatzten.
Kaiphas hatte nichts gegen den Regen. Zu Hause in Namibia wäre ein solches Wetter als Segen empfunden worden. Die Weiden würden grün, die Rinder fett, und selbst zwischen den Blechhütten der Townships würde der Staub in der Luft einem Duft nach frischem Leben weichen. Auch hier in Freiburg war der Regen von Vorteil gewesen, als Kaiphas am Vormittag den Friedhof erkundet hatte. Kein Mensch war ihm begegnet, außer einer alten Frau, die ihren Schirm so tief gehalten hatte, dass sie gerade mal ihre eigenen Gummistiefel sehen konnte. Kaiphas war die Gräber systematisch abgegangen, Feld für Feld, Reihe für Reihe. Sorgfältig hatte er die Namen auf den Steinen gelesen, bis er nach etwas mehr als einer Stunde den richtigen gefunden hatte.
Er hatte sich die Lage des Grabs eingeprägt und dann eine Stelle gesucht, an der er später unbeobachtet über die Friedhofsmauer steigen konnte, denn die Deutschen schlossen ihre Toten in der Nacht ein. Vielleicht, weil sie nicht wussten, dass sich die Ahnen durch Mauern und Tore keineswegs abhalten ließen, wenn sie wiederkehren wollten. Aber die Geister der toten Deutschen beunruhigten Kaiphas kaum. Mit ihnen hatte er nichts zu schaffen, und was den einen anging, der hier unter seinen Füßen lag, nun, da hatte er noch in Windhoek vorgesorgt. Er hatte einen Gegenzauber in Auftrag gegeben und sich einen Talisman besorgt. Der würde ihn beschützen.
Die Nacht war herbstlich kühl, der Regen rauschte gleichförmig und verschluckte alle anderen Geräusche. Wenn es überhaupt welche gab um zwei Uhr morgens auf einem gottverlassenen Friedhof. Kaiphas zog Jacke und Hemd aus und verstaute beides in seinem Koffer. Den Lederbeutel mit dem Talisman ließ er um seinen Hals hängen. Dann setzte er den Spaten an. Mit der Schuhsohle trieb er ihn mühelos in die nasse Erde, doch als er anhob, merkte er, wie schwer sie war. Egal. Er war stark, er war ausgeruht und hatte Zeit genug. Er warf den Aushub auf das Grab nebenan.
Kaiphas arbeitete konzentriert, und bald wurde ihm warm. Nach einer Stunde war er schon gut einen Meter tief gekommen. Er richtete den Oberkörper gerade und streckte sich. Der Regen fiel, als wolle er nie aufhören. Kaiphas spürte, wie er schwitzte und wie die Tropfen den Schweiß von seiner Haut spülten. Es war ein gutes Gefühl, eines, das ihm bewies, dass nichts schiefgehen konnte. Er würde seinen Auftrag erledigen und als Held nach Namibia zurückkehren. Dort stünden ihm alle Möglichkeiten offen. Er könnte sich einen Laden kaufen, eine Kneipe oder ein Taxi, er könnte sich eine Frau nehmen und ein paar Söhne zeugen, er könnte sonst was machen. Vielleicht würde er sogar ins Hereroland ziehen und Rinder züchten wie seine Vorfahren. Warum nicht?
Kaiphas legte die Hand auf den Beutel an seiner Brust. Das Leder war nass, der Regen plätscherte, und von irgendwoher schlug ganz schwach eine Kirchturmglocke. Dreimal, glaubte Kaiphas. Er griff nach seinem Koffer, holte die Stirnlampe heraus, schaltete sie aber nicht ein. Noch stand er nicht tief genug, sodass der Lichtpunkt über das Grab hinaus sichtbar wäre. Ein zufälliger Beobachter sähe ein auf und ab, hin und her tanzendes Irrlicht, das hüfthoch über dem Boden schwebte. Wenn Kaiphas Glück hätte, würde man ihn für den Geist eines Toten halten, doch er wollte kein unnötiges Risiko eingehen. Er brauchte die Lampe noch nicht. Es war äußerst unwahrscheinlich, jetzt schon auf Knochen zu stoßen.
Kaiphas hatte sich informiert. Bis zu zwei Metern schachteten die Deutschen normalerweise aus. So tief, dass das Gewicht der Erde einen Sarg bald einbrechen ließ. Sie wollten kein Bett für die Ewigkeit, sie wollten niemanden bewahren, im Gegenteil: Erde zu Erde, Staub zu Staub. Nach fünfundzwanzig Jahren sollte nichts anderes mehr übrig sein. Nur die Gebeine hielten sich meist nicht an den Zeitplan der Friedhofsverordnungen. Doch ob sie auch nach fünfzig Jahren noch vorhanden waren, hing von der Bodenbeschaffenheit, der Erdverdichtung, dem Sauerstoffgehalt, dem Wassereintritt ab. Unter bestimmten Bedingungen würde man eine Wachsleiche mit Haut und Haaren freilegen, unter anderen wären auch die dicksten Knochen zerfallen. Es gab keine Formel, mit der man berechnen konnte, was fünfzig oder hundert Jahre unter der Erde bewirkten. Wer nicht nachgrub, würde es nie wissen.
Kaiphas richtete sich auf. Er konnte gerade noch über den Rand des Lochs hinwegsehen. Allmählich musste er in der richtigen Tiefe angelangt sein. Er senkte den Kopf und schaltete die Stirnlampe ein. Durch den Lichtkegel strich der Regen. Am Boden war nichts zu entdecken, was nach Knochen aussah. Nur Erde und die verriet nicht, ob sie mal ein Holzsarg oder ein Menschenherz gewesen war.
Mach mir keine Schwierigkeiten, Mann, dachte Kaiphas. Stell dich nicht so an wegen der paar Knochen! Du bist tot, Mann! Du hast bloß eine Vergangenheit, keine Zukunft mehr. Ich habe eine Zukunft, und die wirst du mir nicht kaputt machen!
Der Regen rauschte, und Kaiphas grub weiter. Je tiefer er vorstieß, desto schwerer fiel es ihm, den Aushub aus dem Grab zu befördern. Wenn er nicht weit genug warf, rutschte die Erde über die Grabumfassung zurück. Kleine Schlammlawinen prasselten auf seine Schultern, begruben seine Stiefel. Kaiphas lachte leise auf. Da war er zehntausend Kilometer von Windhoek nach Frankfurt geflogen, war mit dem Zug nach Freiburg gefahren, hatte das Grab gefunden, hatte sich in die Tiefe gegraben, buddelte immer weiter, ohne etwas zu finden, nur um letztlich selbst verschüttet zu werden? War das nicht komisch?
Er schüttelte den Kopf und machte sich daran, eine weitere Schicht freizulegen. Nein, hier war gar nichts komisch. Erde zu Erde, Staub zu Staub, verdammter Schlamm zu verdammtem Schlamm. War das wirklich alles, was geblieben war? Kaiphas spürte seine Muskeln müde werden. Zum Trotz arbeitete er nun hastiger als zuvor, keuchte bei jedem Spatenstich. Ein Klumpen Wut ballte sich in seinen Eingeweiden zusammen und stieg langsam nach oben. Dieser verfluchte Tote durfte sich nicht einfach so davonstehlen! Das konnte er ihm nicht antun. Kaiphas begann, in der Mitte des Grabs einen Schacht nach unten zu treiben. Dort, wo sich das Becken des Manns befunden haben musste. Er setzte den Spaten an, trat mit einer wilden Kraft zu, schippte die Erde achtlos nach vorn. Ja und ja und noch eine Schippe und nimm das und …
Kaiphas erstarrte in der Bewegung. War er laut geworden, hatte er jeden seiner Tritte mit einem Schrei begleitet? Er stützte sich an der nassen Erdwand ab, hörte sich schwer atmen. Sonst hörte er nichts. Da war nichts. Nur ein Friedhof mit abgesperrtem Tor. Nur Tote ringsum. Nur verwesende Vergangenheit. Und er, Kaiphas, der in einem knapp zwei Meter tiefen Loch stand. Er blickte nach unten.
Und da …
Na also!
Kaiphas sah etwas Fahlweißes im Schein der Stirnlampe aufschimmern. Er ließ sich auf die Knie fallen und wischte mit den bloßen Händen die Erde weg. Ja, das war ein Knochen, ein länglicher, leicht gebogener Knochen, eher eine Rippe als ein Teil vom Becken. Kein Stofffetzen, kein Muskelfleisch und keine Sehne einer Wachsleiche, nur ein schöner blanker Knochen. Alles war, wie es sein sollte. Nur zur Sicherheit krallte er die Faust um den Talisman in seinem Beutel.
«Du machst mir keine Angst, toter Mann», sagte Kaiphas leise. Dann brach er den Knochen über seinem Knie entzwei und warf die Teile in hohem Bogen aus dem Grab hinaus. Am Himmel sah der Mond bleich hinter zerrissenen Wolken hervor. Kaiphas hatte nicht bemerkt, wann es zu regnen aufgehört hatte.
Zweimal hatte Claus Tiedtke entfernte Verwandte in Deutschland besucht, ganze neun Wochen seines bisherigen Lebens hatte er im Land seiner Vorfahren verbracht. Dass seine Muttersprache zufällig Deutsch war, hinderte ihn nicht daran, Namibia als sein Heimatland anzusehen. Dort war er geboren und aufgewachsen, es war genauso sein Land wie das seiner Mitbürger, egal, welche Hautfarbe sie besaßen und in welcher Sprache sie ihre ersten Worte gestammelt hatten. Und doch schien sich die Distanz zwischen ihm und der Delegation vergrößert zu haben, seit sie in Frankfurt gelandet waren. Keine zwei Stunden war das her, sie warteten noch im Transitbereich auf den Anschlussflug nach Berlin.
Sie standen eng beieinander, ein Minister, einige Staatssekretäre und andere hohe Beamte, Kirchen- und Gewerkschaftsleute, Vertreter des Genozid-Komitees und der traditionellen Stammesbehörden, Namas wie Hereros, alles in allem an die siebzig Personen. Keines der Königshäuser, keiner der Chiefs, ob er nun der roten, der weißen oder sonst einer Flagge vorstand, hatte es sich nehmen lassen, an dieser historischen Mission teilzuhaben. Auch ein paar Herero-Frauen waren dabei. Sie trugen ihre bodenlangen Kleider und hatten, noch bevor sie dem Flugzeug entstiegen waren, wieder ihre traditionellen Kopfbedeckungen mit den an Rinderhörner erinnernden Auswüchsen aufgesetzt. Ob sie sich fragten, wie ihr Festtagsstaat hier wirkte?
Claus beobachtete die vorbeiströmenden Fluggäste. Geschäftsleute, Urlaubsheimkehrer, Städtetouristen. Keiner verlangsamte den Schritt, nur selten blieb ein Blick an den Herero-Frauen hängen, um gleich darauf weiterzuwandern. Nicht umsonst war Frankfurt der größte Flughafen Deutschlands. Hier hatte man schon alles gesehen, hier interessierte sich niemand für afrikanische Folklore und schon gar nicht dafür, warum sie getragen wurde und was die ganze Delegation nach Deutschland führte und ob vor mehr als hundert Jahren eine kaiserliche Schutztruppe einen Kolonialaufstand blutig niedergeschlagen hatte.
Im Terminal wogte es tausendfach hin und her, auf zig Gates zu, vorbei an Sitzreihen, auf denen zeitweilig gestrandete Passagiere schliefen, vorbei an den chromblitzenden Theken der Restaurationsbetriebe, wo junge Anzugträger in ihre aufgeklappten Laptops starrten. Rollkoffer surrten sanft die Gänge entlang, eine angenehme Lautsprecherstimme warnte, keine Gepäckstücke unbeaufsichtigt zu lassen, und Claus spürte, dass hundert Jahre nicht gleich hundert Jahre waren. In Deutschland war erheblich mehr Zeit vergangen als in Namibia. Zwei Weltkriege lagen zwischen damals und heute, eine kurze Republik, ein Tausendjähriges Reich, ein geteiltes Land und ein wiedervereinigtes neues, das sich mit seinem Geld gerade ganz Europa kaufte. Wer wollte da noch an die ehemaligen Kolonien denken? Wen juckte es, wenn in irgendwelchen Universitätskellern ein paar alte Schädel herumlagen?
In Namibia hatte es gejuckt, es hatte gebrannt und geschmerzt. Der Schmerz hatte die Schatten der Vergangenheit lang und länger werden lassen, er hatte die Zeit zusammengestaucht, fast so, als wären die Schädel erst gestern aus ihren Gräbern geraubt worden. Eine unbekannte Anzahl von Schädeln, die von den Kolonialherren ins Kaiserreich verschifft worden waren, um sie anthropologischen Sammlungen einzuverleiben oder rassenkundliche Forschungen an ihnen anzustellen. Zwanzig von ihnen, die ersten zwanzig, sollten nun in Berlin zurückgegeben werden. Den Hereros waren sie ein Beleg dafür, dass die alten Rechnungen auch nach einem Jahrhundert offenstanden. Ihrer Meinung nach sollten die Deutschen endlich ihre Schuld abtragen, mit Worten, mit Taten und mit Euros. Für viele von Claus’ deutschstämmigen Landsleuten stand dagegen ihr Ursprungsmythos auf dem Spiel. Ihre Vorfahren durften keine unmenschlichen Verbrecher gewesen sein. Deswegen redeten sie sich die Vergangenheit schön und unterstellten den Hereros, bloß unter einem fadenscheinigen Vorwand Kasse machen zu wollen.
Das Thema kochte hoch, die Angelegenheit war brisant genug, dass die Windhoeker «Allgemeine Zeitung» trotz ihrer wahrlich nicht rosigen wirtschaftlichen Lage Claus Tiedtke beauftragt hatte, die Delegation nach Deutschland zu begleiten. Und so saß er jetzt hier, im Frankfurter Flughafen, keine zehn Schritte von seinen namibischen Landsleuten entfernt, und fragte sich, wieso er sich ihnen gegenüber fremd fühlte. Und, ja, auch in gewisser Weise überlegen. Er war kein Rassist, er suchte sich seine Freunde nicht nach der Hautfarbe aus, er hatte sich mehr als jeder andere, den er kannte, für die Lebenswirklichkeit der schwarzen Mehrheit seines Landes interessiert und hatte in einem Anfall von Selbstüberschätzung sogar eine Zeitlang versucht, in der Township Katutura zu leben. Das konnte in zwei Stunden nicht einfach ausgelöscht werden, noch dazu, wenn eigentlich gar nichts geschehen war. Und doch empfand er fast so etwas wie Mitleid mit diesen Hereros und Namas, die sich einbildeten, irgendwen in Europa würde es interessieren, was ihren Vorfahren angetan worden war.
Vom Gate aus wurde zum Boarding für den Flug nach Berlin aufgerufen. Erst die Business-Class und Familien mit kleinen Kindern, dann die Fluggäste der hinteren Sitzreihen. Claus stand auf, steuerte auf die Delegation zu und arbeitete sich bis zu Minister Kazenambo Kazenambo durch.
«Claus Tiedtke, Allgemeine Zeitung», stellte er sich vor. «Wenn ich irgendwie helfen kann, Herr Minister … Ich spreche fließend Deutsch.»
Die Mitarbeiterin der Lufthansa begann, ihre Durchsage auf Englisch zu wiederholen. Der Minister lächelte, und Claus sagte: «Falls es mal nötig sein sollte.»
«Englisch wird in der deutschen Regierung ja wohl jemand beherrschen.» Das kam von Kuaima Riruako, dem Paramount Chief der Hereros. Er hatte sich Claus zugewandt und musterte ihn von oben bis unten. «Allgemeine Zeitung?»
Claus nickte. Als es beim Hererotag in Okahandja den Zwist um das heilige Feuer gab, hatte er Riruako mal interviewt, aber offensichtlich erinnerte der sich nicht an ihn.
«Wir haben Leute, die Deutsch sprechen. Gut genug, um zu verstehen, was in Ihrem Blatt geschrieben wird», sagte Riruako.
Dem Unterton nach zu schließen würde da noch Unfreundliches folgen. Claus wartete ab.
«Zum Beispiel, dass ein Abgesandter ausreichen würde, um die Schädel unserer Märtyrer nach Hause zu holen. Oder dass man sie aus Kostengründen gleich in eine Kiste werfen und per Seefracht schicken sollte.»
«Das entspricht keineswegs der Meinung unserer Redaktion», sagte Claus, «das stand in einem Leserbrief.»
«Und wer wählt aus, welche Leserbriefe gedruckt werden?», zischte Riruako. «Ist das vielleicht nicht Ihre Redaktion? Und rein zufällig wählt sie genau die Leserbriefe aus, in denen der Genozid an meinem Volk rundweg geleugnet wird.»
Ein Zufall war das nicht. Es lag schlicht daran, dass kaum andere Meinungsäußerungen eintrudelten. Claus hatte sich immer dafür eingesetzt, den schlimmsten Kolonialismusverherrlichern keine Bühne zu bieten. Wirklich überzeugt hatte er seine Kollegen nie, und wenn die Leserbriefseite halb leer zu bleiben drohte, kam doch wieder der unsäglichste Quark ins Blatt. Übrigens zu einem nicht geringen Teil aus Deutschland. Meist von verbitterten alten Männern, vermutete Claus, die noch überall den Kommunismus lauern sahen und denen in der deutschen Öffentlichkeit niemand mehr zuhören wollte.
«Nicht zu vergessen natürlich die Dankbarkeitsforderer. Die uns vorrechnen, wie viel Entwicklungshilfe Deutschland an Namibia zahlt, und die erwarten, dass wir dafür schweigend auf die Knie fallen», sagte Riruako.
«Meinungsfreiheit», sagte Claus, «beinhaltet, dass man auch Meinungen gelten lässt, die man nicht teilt. Aber sollten wir nicht langsam …»
Der Minister reihte sich gerade in die Schlange am Gate ein, und der Rest der Gruppe folgte ihm. Riruakos Hand legte sich schwer auf Claus’ Schulter, sein Mund näherte sich deutlich über die Distanz hinaus, die ein Deutschstämmiger zwischen Fremden als angemessen empfand. Als ob er Claus ein Geheimnis verraten wollte, flüsterte Riruako: «Ihr habt uns damals abgeschlachtet, weil ihr die Kanonen und Gewehre hattet. Fügsame Opfer waren wir aber nicht. Wir haben für unser Recht und unser Land gekämpft. Und heute werden wir wieder kämpfen. Mit dem Unterschied, dass wir nun auch Kanonen und Gewehre haben. Diesmal wird es umgekehrt ausgehen.»
«Darf ich das so zitieren, Chief?», fragte Claus kühl.
Riruakos fast schwarze Augen starrten ihn an. Im Weiß neben der linken Pupille war ein Äderchen geplatzt. Ein kleiner blutroter Fleck hatte sich im Augenwinkel gebildet. Schwarz-weiß-rot, wie die Flagge des Kaiserreichs, dachte Claus, und da verzog sich Riruakos Mund zu einem Grinsen. Seine Hand löste sich, klopfte Claus zweimal sacht auf die Schulter und wies dann Richtung Gate.
«Auf nach Berlin!», sagte Riruako und lachte.
Als Kaiphas’ Handy klingelte, blickte er kurz seitwärts zu seiner Sitznachbarin. Die hatte eine aufgeschlagene Illustrierte auf dem Schoß liegen, sah aber aus dem Zugfenster. Außen auf der Scheibe zog der Regen schräge Striche, dahinter flog ein graues Haus mit Ziegeldach vorbei. Dann folgten Wiesen in einem so satten, fast unwirklichen Grün, dass es in den Augen schmerzte.
«Ja?», sagte Kaiphas ins Handy. Keine Namen, hatte die Anweisung gelautet.
«Wo bist du?»
«Unterwegs.» Keine identifizierbaren Orte, keine von Außenstehenden nachvollziehbaren Berichte, nichts, was irgendwie verräterisch sein könnte.
Die Frau neben Kaiphas schlug die Augen nieder und blätterte um. Die Zeitschrift zeigte Hochglanzfotos von der Einrichtung eines Hauses. Eine Treppe aus Eisenrosten, unter der eine Kommode mit Blumenvase stand. Ein Badezimmer mit zwei freistehenden Waschbecken. Und so viel Platz dazwischen, dass man eine Großfamilie aus Katutura dort unterbringen könnte.
«Was ist mit deinem Gepäck?», fragte die Stimme aus dem Handy.
«Vollzählig.» Der Koffer lag auf der Ablage in der Mitte des Großraumabteils. Kaiphas hätte ihn lieber neben sich gehabt, doch andere Fahrgäste hatten protestiert. Immerhin hatte Kaiphas ihn im Blick.
«Also ist alles glattgegangen?»
Ob alles glattgegangen war? Kaiphas hatte sich eine Nacht um die Ohren geschlagen, er hatte einen Toten ausgegraben und dessen Knochen durch die Gegend geworfen. Der Talisman hatte ihn beschützt, sodass er den Friedhof unbemerkt verlassen hatte. Er war so rechtzeitig am Bahnhof gewesen, dass er die schmutzige Kleidung wechseln konnte. Nur seine Schuhe waren immer noch feucht und verschlammt. Kaiphas sagte: «Es hat geregnet.»
Wenn er ankam, würde er die Wäsche waschen, seine Schuhe putzen, sich selbst unter eine warme Dusche stellen und ein paar Stunden schlafen. Dann würde er den Auftrag zu Ende bringen, nach Namibia zurückfliegen und ein angesehener Mann sein. Er blickte aus dem Zugfenster und sagte ins Handy: «Es regnet schon wieder, und das Gras ist so grün, dass es in den Augen schmerzt.»
«Auf der Haifischinsel vor Lüderitz wächst kein Gras», sagte die Stimme aus dem Telefon. «Da gibt es nur graue Felsen und ein wenig Sand und den kalten Sturm aus Südwesten, der fast das ganze Jahr über weht. Dort hatten die Deutschen ein Konzentrationslager für ihre Gefangenen eingerichtet. Für die Reste des Herero-Volks. Achtzig Prozent der Inhaftierten haben die Insel nicht mehr lebend verlassen. Sie starben an Hunger, Skorbut, an anderen Krankheiten und Peitschenhieben mit der Sjambok. Und was taten die Überlebenden mit den Leichen, da es nur Stein und keinen Friedhof mit schönem grünem Gras gab? Sie haben sie bei Ebbe am Strand verscharrt. Die Flut hat sie dann wieder freigelegt und ins Meer hinausgespült, zum Festmahl für die Haie.»
Kaiphas blickte auf die Hand seiner Sitznachbarin, die lustlos durch das Magazin blätterte. Der goldene Ehering um den vierten Finger schnitt tief ein. Die Haut war zwar heller als seine, doch wirklich weiß war sie nicht. Eher rot. Kaiphas sagte: «Ich meine ja nur, dass der verdammte Regen hier anscheinend nie aufhört.»
«Ich melde mich wieder», sagte die Stimme. Dann war die Verbindung unterbrochen.
Kaiphas lehnte den Kopf zurück. Sein Koffer war genau da, wo er ihn abgelegt hatte. Kaiphas ließ seine Augen zufallen, zählte bis fünf und riss sie wieder auf. Schlafen konnte er später. Nicht auszudenken, wenn einer den Koffer klaute!
2Windhoek, Namibia
Der Neue lehnte an dem gemauerten Pfosten neben dem Eingang und hielt sein Gewehr in beiden Händen. Der Lauf zeigte anweisungsgemäß schräg nach unten. So war im Notfall eine schnelle Reaktion möglich, während andererseits nichts Gravierendes passieren sollte, falls sich versehentlich ein Schuss löste. Auf einem Schild neben dem Kopf des Neuen war die Aufschrift The Living Rainbow Children Centre zu lesen. Die Buchstaben waren in eine Platte aus gebürstetem Stahl eingraviert, die eher einer Anwaltskanzlei als Miki Selmas Waisenhaus angestanden hätte. Doch die Platte war ein Geschenk gewesen. Zwei Mitglieder des deutschen Vereins, der das Waisenhaus hauptsächlich finanzierte, hatten sie bei einem Besuch im letzten Monat mitgebracht. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, hatte Miki Selma gesagt und das Schild mit sechzehn statt der nötigen vier Dübel befestigen lassen, um am Materialwert interessierte Diebe von vornherein zu entmutigen.
Quer über die Straße hinkte ein kleiner Hund. Eine heruntergekommene weiß-braune Promenadenmischung, die sich offensichtlich den rechten Hinterlauf verletzt hatte. Mit eingezogenem Schwanz, als wüsste er schon, dass er nur Prügel zu erwarten hatte, näherte sich der Hund dem Neuen und blickte ihn von unten herauf an.
«Kscht!», sagte der Neue. Der Hund duckte sich ein wenig.
«Hau ab!», rief der Neue, aber erst als er das Gewehr anhob, um zuzuschlagen, sprang der Hund mit einem Satz zurück, knickte über dem verletzten Bein ein und trottete langsam am Zaun entlang Richtung Mshasho Bar.
Der Neue rückte ein wenig nach links, dem schmalen Schatten des Pfostens nach. Für Ende September brannte die Sonne viel zu heiß auf die flachen Dächer Katuturas herab. Obwohl der Sommer noch bevorstand, stöhnten die Bewohner der Townships schon unter den Temperaturen. Wer konnte, suchte sich einen schattigen Fleck, bewegte sich so wenig wie möglich und hoffte auf einen Lufthauch, der einen Anflug von Kühlung vortäuschen würde. In den aufgeheizten Häusern war es noch weniger auszuhalten als draußen, und so hätte es einen Fremden wohl verwundert, dass hinter dem Stacheldrahtzaun, der den staubigen Hof des Waisenhauses schützte, kein einziges Kind spielte. Doch Miki Selma hielt ihre tägliche Singstunde sommers wie winters im Gemeinschaftsraum ab.
Da weiß wenigstens jedes Kind genau, wo es stehen muss, pflegte sie zu sagen. Durcheinander gebe es schon genug im Leben, wenigstens beim Singen sollte Ordnung herrschen. Sonst würden die Kinder ja keine Lieder lernen, und das wäre nicht nur pädagogisch bedauerlich, sondern hätte auch erhebliche ökonomische Konsequenzen. Miki Selma war nämlich überzeugt, dass potenzielle Spender, die das Living Rainbow Centre besichtigten, nur durch frische Kinderstimmen dazu bewegt werden konnten, die Geldbörsen zu zücken.
Je nach Besuchergruppe hatte Miki Selma deshalb ein religiöses Programm, eines mit englischsprachigen Kinderliedern, eines mit traditionellen Volksweisen in Oshivambo und für die europäischen Gäste, die die Klick- und Schnalzlaute so lustig fanden, auch eines auf Nama-Damara parat. Seit Mara Engels, die Frau des deutschen Botschafters, als Freiwillige im Waisenhaus mithalf, hatte Miki Selma darüber hinaus begonnen, einige SWAPO-Lieder aus dem Befreiungskampf einzuüben. Es war nicht auszuschließen, dass über die Botschaftergattin mal ein Regierungsvertreter hier antanzte, und dann musste man vorbereitet sein, um eventuell staatliche Finanzierungsquellen anzapfen zu können.
Von der Mshasho Bar her näherte sich ein Taxi mit der groß aufgemalten Nummer P212. Es war ein weißer Ford Fiesta, in dem drei junge Männer saßen. Der Beifahrer hatte Rastalocken und ließ einen Arm aus dem offenen Fenster baumeln. Reggae-Musik schallte blechern aus dem Wageninneren. Im Schritttempo rollte das Taxi am Tor des Waisenhauses vorbei, beschleunigte und bog an der Kreuzung Richtung Norden ab. Der Neue nahm eine Hand von der Waffe, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Unter den Achseln zeichneten sich Flecken ab. Vielleicht wäre ein dunkleres Blau für die Uniformhemden doch geeigneter gewesen!
Nun drehte der Neue den Kopf in Richtung des Backsteingebäudes, durch dessen offene Tür die Melodie eines SWAPO-Kampflieds herauswehte. Mambulu djeimo mo Namibia – Buren, geht raus aus Namibia. Wenn man von Miki Selmas volltönender Altstimme absah, klang das Ganze etwas dünn, und so würde sich die Chorprobe wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen. Der Neue blickte nach unten und strich mit dem Zeigefinger über den Lauf des Gewehrs. Es sah aus, als würde ihm die Zeit lang. Sie glaubten alle, es sei wichtig, hart zu sein, entschlossen, mutig, kampfkräftig, aber darauf kam es beim Personenschutz nicht an. Zumindest nicht so sehr. Ein guter Leibwächter musste vor allem warten können, ohne die Geduld zu verlieren. Ungeduld, das war die erste Todsünde.
Von rechts kam ein Eisverkäufer mit tief ins Gesicht gezogener Schirmmütze angeradelt. Er trat schwer in die Pedale des dreirädrigen Gefährts, beugte den Oberkörper bei jedem Tritt so tief, dass er kaum über den großen Kühlbehälter vor dem Lenker hinwegsehen konnte. Aus der Tür des Waisenhauses war Miki Selmas Stimme zu hören. Sie forderte die Kinder auf mitzuklatschen, und zwar genau in ihrem Rhythmus. Dann brüllte sie, dass man das schöne Lied ja gar nicht mehr durch das Klatschen höre, weshalb jetzt alle mal ganz laut singen sollten. Der Eisverkäufer stoppte mitten in der Straße. Er stieg aus dem Sattel, setzte beide Füße auf dem Asphalt auf und rief dem Neuen zu: «Eis für die Kinder?»
«Schau, dass du weiterkommst!», sagte der Neue. Von links schlurfte ein Typ mit Rastalocken und einem weiten T-Shirt mit grün-gelb-roten Streifen heran.
«Hast du ’ne Kippe für mich, Bruder?», fragte der Eisverkäufer den Neuen. Der schüttelte nur den Kopf und blickte in Richtung des Rastafaris.
Irgendwo im Waisenhaus brüllte Miki Selma, dass Gott die Kinder als Fische erschaffen hätte, wenn er gewollt hätte, dass sie stumm blieben. «Also jetzt noch einmal von vorn! Alle zusammen!»
«Verdammte Hitze», sagte der Eisverkäufer, «und trotzdem kauft keiner …»
«Seh ich so aus, als ob ich mich unterhalten wollte?», fragte der Neue. Der Rastafari war vielleicht noch fünf Meter von ihm entfernt. An der Kreuzung fünfzig Meter hinter ihm tauchte ein Taxi auf und bog Richtung Waisenhaus ein. Es gab Tausende von Taxis in Windhoek, und eine ganze Menge davon waren weiße Ford Fiestas, doch wenn man darauf geachtet hatte, verriet einem die Nummer, dass es dasselbe war, das eben in der Gegenrichtung vorbeigekommen war. Mit dem Unterschied, dass nun nicht drei, sondern zwei junge Männer drin saßen und dass sie die Reggae-Musik ausgeschaltet hatten. Dafür hupte der Taxifahrer laut und anhaltend.
Umständlich machte sich der Eisverkäufer daran, sein Dreirad von der Straßenmitte wegzuschieben. Genau auf den Neuen zu, der immer noch am Torpfosten lehnte und sein Gewehr gesenkt hielt, als sei die Welt völlig in Ordnung. Der Rastafari schlurfte langsam an ihm vorbei. Das Taxi bremste hart, beide Autotüren sprangen auf, beim Aussteigen rief der Beifahrer: «Geht es noch ein bisschen langsamer?»
«Ist ja gut», murrte der Eisverkäufer.
Das schien das Zeichen gewesen zu sein, denn der Rastafari drehte sich blitzschnell um. Seine Hände waren nun waagerecht ausgestreckt, und die Pistole zwischen ihnen zeigte aus einem halben Meter Abstand auf den Kopf des Neuen. Der Rastafari brüllte: «Keine Bewegung, Arschloch!»
Der Taxifahrer hatte ebenfalls eine Pistole gezogen und kam von schräg links auf das Tor des Waisenhauses zu. Sein Beifahrer sprintete um das Heck seines Wagens. In seiner Hand blitzte ein Messer.
«Lass das Gewehr fallen, Bruder!» Der Eisverkäufer grinste.
Sie waren zu viert, sie waren bewaffnet, sie hatten den Neuen so umringt, dass er nicht die geringste Chance hatte. Weil er nicht aufmerksam genug gewesen war. Dass ein Eisverkäufer ein Gespräch suchte und dass ein Taxi umkehrte, nachdem es einen Fahrgast ausgeladen hatte, mochte ja noch angehen. Aber wieso schlenderte der angebliche Fahrgast bei dieser Affenhitze die Strecke, die er gefahren worden war, zurück? Und warum kam er just im gleichen Moment wie das Taxi hier an? Konnte es wirklich ein Zufall sein, dass genau dann ein Eisverkäufer die Straße blockierte und dem Taxifahrer einen Vorwand bot auszusteigen? Und war das Taxi nicht vorher schon auffällig langsam gefahren, als ob die Insassen sich Örtlichkeiten und Situation genau einprägen wollten?
In der Summe musste all das einen guten Wachmann stutzig werden lassen, doch der Neue war von dem Überfall völlig überrascht worden. Nicht weil er eins und eins nicht zusammenzählen konnte, sondern weil er die eine oder andere Eins gar nicht wahrgenommen hatte. Unaufmerksamkeit, das war die zweite Todsünde.
Clemencia Garises schob den Fliegenvorhang beiseite, durch den sie die Szene beobachtet hatte. Sie trat in das gleißende Sonnenlicht hinaus, wollte gerade das Gartentürchen aufstoßen, um zum Waisenhaus hinüberzugehen, als sich der Neue drüben bückte und das Gewehr niederlegte. Er kauerte einen Moment länger als nötig am Boden, nur einen Moment, der aber Clemencia ahnen ließ, was geschehen würde. Doch bevor sie reagieren konnte, schnellte der Neue hoch, nahm im Sprung den rechten Ellenbogen nach vorn und stieß ihn mit aller Gewalt in die Eingeweide des Rastafaris. Mit einem tiefen und überraschend lauten Ton schoss die Luft aus dessen Lunge. Der Oberkörper klappte nach vorn, die Pistole fiel in den Sand am Straßenrand.
Der Neue wirbelte mit geballten Fäusten herum, ließ einen wilden Schwinger in Richtung des Taxifahrers los, traf ihn hart an der Schulter. Der Taxifahrer torkelte ein paar Schritte zurück, ohne jedoch die Pistole loszulassen. Der Beifahrer stand bewegungslos und mit offenem Mund da. Dass er ein Messer mit fünfzehn Zentimeter langer Klinge in den Fingern hielt, schien er völlig vergessen zu haben. Clemencia spurtete über die Straße, der Rastafari stöhnte, der Eisverkäufer schrie: «Spinnst du, Mann?»
Der Neue setzte nach, stürmte auf den Taxifahrer zu, sprang ihn an, griff in seinen Arm und versuchte verzweifelt, ihm die Waffe zu entwinden. Sie rangen erbittert, stürzten, verschlangen sich auf dem Boden, und aus dem Waisenhaus drohte Miki Selmas Gesang mit etwas brüchiger Kinderstimmenunterstützung den Buren das Allerschlimmste an, wenn sie nicht aus Namibia verschwänden. Der Eisverkäufer brüllte: «Du bist tot, Mann. Kapierst du das nicht?»
«Schluss jetzt!», rief auch Clemencia und eilte an dem Eisdreirad vorbei auf die beiden Männer zu, die sich im Staub wälzten. «Hör auf, Kangulohi!»
Der Neue hatte es irgendwie geschafft, die Pistole in die Hände zu bekommen. Er sprang einen Meter zurück und richtete die Waffe auf seinen Kontrahenten. Der setzte sich auf, begutachtete die Schürfwunde an seinem Handgelenk, schüttelte den Kopf und sagte: «Der ist völlig durchgeknallt.»
«Hast du es immer noch nicht kapiert, Kangulohi?», fragte der Eisverkäufer.
Der Neue blickte erst zu ihm und dann zu Clemencia herüber. Er ließ die Pistole langsam sinken. Dann entnahm er ihr mit zwei schnellen Griffen das Magazin. Er sagte: «Leer.»
«Du wärst schon dreimal tot, Mann», sagte der Eisverkäufer.
«Es war bloß eine Übung?», fragte der Neue.
Clemencia deutete auf den Eisverkäufer. «Mein Bruder Melvin. Die anderen heißen John, Haimbodi und Eiseb, alle tätig im Auftrag der Firma Argus.»
«Es war ein Test für mich?», fragte Kangulohi.
Ja, es war ein Test gewesen, und er war schwer in die Hose gegangen. Kangulohi hatte so ziemlich alles falsch gemacht, was man in der Branche falsch machen konnte. Und er hatte Clemencias Anweisungen missachtet. Eigentlich hätte sie ihm sofort sagen müssen, dass er die neue Uniform wieder abgeben und sich anderswo einen Job suchen solle, doch irgendetwas ließ sie zögern.
«Ich habe die beiden mit den Pistolen entwaffnet», sagte Kangulohi. «Der mit dem Messer hätte mir kaum gefährlich werden können und …»
«Situationen nicht richtig einzuschätzen ist schlimm genug», sagte Clemencia, «aber schlimmer noch ist es, eigene Fehler im Nachhinein schönzureden. Wie willst du sie denn in Zukunft vermeiden, wenn du sie dir gar nicht eingestehst?»
«In welcher Zukunft?», fragte Melvin. «Er läge jetzt tot da im Staub.»
«Es waren vier, und zwei davon waren mit Pistolen bewaffnet. Warum bist du auf sie losgegangen?», fragte Clemencia.
«Wenn du den Helden markieren willst, schau dich mal auf dem Friedhof um! Da liegen massenweise welche herum, die das Gleiche probiert haben», sagte Melvin.
Kangulohi sagte nichts. Er schob das Magazin in die Führung zurück, ließ es einrasten und hielt die Pistole mit dem Griff voran Clemencia entgegen.
«Warum hast du das getan?», fragte Clemencia.
«Ich … ich dachte, ich hätte eine Chance.»
Die Pistole in Kangulohis Hand zitterte leicht. Selbst wenn er an eine Chance geglaubt hatte, hatte er abwägen müssen. Was wog so schwer, dass er das Risiko, sein Leben zu verlieren, in Kauf genommen hatte? Für irgendwen, den er kaum kannte? Für die zwölf Namibia-Dollar Stundenlohn, die Clemencia ihren Angestellten zahlen konnte? Das war weiß Gott nicht viel, doch es lag immerhin deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn, und wenn Kangulohi nach einer Zehn-Stunden-Schicht hundertzwanzig Dollar nach Hause brachte, konnte seine Frau nicht nur ein paar Kilo Maismehl für die Familie einkaufen, sondern ab und zu auch ein Stück Fleisch dazu, und wenn sie sich das nicht zu oft leisteten, reichte es sogar, um den Kindern eine gebrauchte Schuluniform zu besorgen.
Ein solches Leben war kein rauschendes Fest, aber es war ein Leben, für Kangulohi, für seine Frau, seine Kinder und wen sonst er noch ernähren musste. Jobs fielen nicht vom Himmel, jeder Zweite in Katutura war arbeitslos, da konnte es sich niemand leisten, gleich bei der ersten Bewährungsprobe in einem neuen Job zu versagen. Ja, Kangulohi hatte eine Chance gesehen. Auf ein kleines, einfaches Leben. Dafür konnte man schon einmal ein paar Kugeln riskieren. Clemencia nahm Kangulohi die Pistole aus der Hand und steckte sie in ihren Hosenbund.
«Was ist denn hier los?» Miki Selma stand in der Tür des Waisenhauses. Sie trug den kleinen Samuel auf dem Arm, und hinter ihren breiten Hüften schauten andere Kinder neugierig hervor.
«Du wärst beinahe entführt worden, Tante», sagte Melvin.
«Ich? Wieso?»
«Vielleicht, damit die schreckliche Singerei ein Ende hat? Wahrscheinlich hatten die Nachbarn die Schnauze voll. Sie haben zusammengelegt und ein paar Halunken beauftragt, dich aus dem Verkehr zu ziehen.»
«Die Nachbarn? Die sollten froh sein, dass sie …» Miki Selma brach ab. «Willst du mich auf den Arm nehmen?»
«Wenn du dreißig Jahre jünger wärst, vielleicht», sagte Melvin.
Miki Selma zeigte anklagend auf ihn. «Kinder, ihr müsst mir versprechen, dass ihr nie so werdet wie der da!»
Die Kinder blickten mit großen Augen auf Melvin. Keines traute sich hinter Miki Selma hervor.
«Versprecht ihr mir das?»
Melvin verzog das Gesicht zu einer Fratze, reckte sich und ging mit breiten, wiegenden Schritten auf die Tür zu. Die Arme hielt er ein wenig vom Körper abgespreizt, die Hände waren geöffnet wie bei einem Westernhelden, der gleich zum Duell ziehen wird. Kreischend rannten die Kinder ins Haus zurück.
«Blödmann», sagte Miki Selma und drehte sich würdevoll um.
Die anderen kicherten, nur Kangulohi nicht. Er sah Clemencia nicht in die Augen, als er fragte: «Wo soll ich die Uniform abgeben?»
«Drei Monate Probezeit», sagte Clemencia. «In den drei Monaten wirst du lernen, deinen Job zu machen. Wenn nicht …»
Wir kriegen dich, Mara. Diesmal war es ein Zettel, der unter den Scheibenwischer von Mara Engels’ Landrover geklemmt worden war. Vier simple Worte und gleichzeitig die vierte anonyme Drohung innerhalb von zwei Wochen. Die ersten drei waren per Post geschickt worden, eine an die Botschaft, die anderen an das private Postfach der Engels. Jetzt hatte das Ganze eine neue Qualität bekommen.
«Sie wollen uns zeigen, dass sie jederzeit wissen, wo du dich aufhältst, Mara», sagte Botschafter Engels.
«Es bestand keine Gefahr. Mein Wagen parkte vor Wecke & Voigts, an der belebtesten Stelle der Independence Avenue», sagte Mara.
«Du sollst dich nirgends sicher fühlen», sagte Engels. Er wollte ihr keine Angst machen, doch für seinen Geschmack ging sie viel zu leichtfertig mit der Sache um. Er hatte sie von Anfang an ernst genommen, nicht nur aus Besorgnis um seine Frau. Als deutscher Botschafter in Windhoek befand er sich in so exponierter Stellung, dass es schwerfiel, nicht an politische Hintergründe zu glauben, auch wenn die Drohbriefe sich darüber ausschwiegen.
Engels hatte sich unverzüglich an Sicherheitsminister Haufiku gewandt. Der hatte ihm jede Hilfe zugesagt und ihn an den stellvertretenden Polizeichef weitergereicht. Dieser wiederum hatte die VIP Protection Unit angewiesen, ein paar Beamte zu Maras Schutz abzustellen. Nur hatte sich deren Dienstauffassung als sehr lax erwiesen. Mal verloren die Leibwächter Mara im Einkaufszentrum Maerua Mall aus den Augen, mal zog eine Einheit bei Schichtende ab, ohne auf die Ablösung zu warten, die mit anderthalb Stunden Verspätung eintraf. Zudem zeigte sich Mara vom Machogehabe des einen oder anderen Agenten zunehmend genervt. Wenn sie sich schon bewachen lassen müsse, dann bitte von jemandem, über den sie sich nicht dauernd ärgern müsse.
Mara hatte die Idee gehabt, die VIP Protection Unit durch das private Personenschutzunternehmen Argus zu ersetzen. Deren Inhaberin, Clemencia Garises, hatte sie bei ihren Waisenhausbesuchen in Katutura kennengelernt. Engels war skeptisch gewesen, er hatte Erkundigungen einholen lassen. Das Dossier lag vor ihm auf dem Schreibtisch.
Clemencia Garises, 35 Jahre alt, geboren in Windhoek-Katutura, wohnhaft ebendort in der Frans Hoesenab Straat. Familienstand: ledig. Frau Garises stammt aus einfachen Verhältnissen, hat sich aber früh als sehr begabt und zielstrebig erwiesen. Schulbildung: Von der Jan Jonker Primary School trat sie mit einem Stipendium auf die St. George’s Private School über, wo sie als Jahrgangsbeste denHIGCSE-Abschluss machte. Wieder mit einem Stipendium studierte sie Kriminalistik an der University of Cape Town in Südafrika. Sie schloss mit Auszeichnung ab, kehrte nach Windhoek zurück und trat in den Polizeidienst ein. Nach verschiedenen Lehrgängen am Iyambo Police College und einer sechsmonatigen Fortbildung in Turku/Finnland war sie sechs Jahre lang erst als Detective Inspector, dann als jüngster Chief Inspector der gesamten namibischen Polizei bei der Serious Crime Unit Windhoek beschäftigt. Ihr gelangen spektakuläre Ermittlungserfolge, unter anderem bei der Aufklärung einer Mordserie an ehemaligen Mitgliedern des südafrikanischen Apartheidgeheimdienstes Civil Cooperation Bureau. Sie galt persönlich als absolut integer und zeichnete sich durch beharrliche Arbeit an der Reform des Polizeiapparats aus. Obwohl sie dabei Auseinandersetzungen mit einflussreichen Kreisen nicht scheute, schien ihr weiterer Aufstieg zum Superintendenten nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch völlig überraschend quittierte Frau Garises vor etwa einem Jahr auf eigenen Wunsch den Polizeidienst. Die genauen Hintergründe konnten nicht ermittelt werden, man munkelt aber, dass sie eine Vertuschungsaktion, an der neben höheren Polizeikreisen auch namhafte Politiker beteiligt waren, nicht mittragen wollte. Vor neun Monaten gründete Frau Garises die auf Personenschutz und Privatermittlung spezialisierte Firma Argus. Dank der zahlreichen Kontakte und des ausgezeichneten Rufs von Frau Garises konnte sich die Firma auf dem umkämpften Markt des Sicherheitsgewerbes bisher gut behaupten. Positive Referenzen von folgenden Personen und Institutionen liegen bei: das Büro Seiner Exzellenz, Staatspräsident Hifikepunye Pohamba, der Minister of Home Affairs Kawanyama, …
«Du kannst mir glauben, dass sie die Richtige ist», sagte Mara. Sie stand hinter Engels’ Ledersessel und hatte die Hand auf seine Schulter gelegt. Engels spürte die Wärme durch den Stoff seines Hemds dringen. Er legte den Kopf zur Seite, sodass seine Wange ihren Handrücken berührte. Ihre Haut war glatt und weich. Engels fragte sich jetzt seltener als früher, warum sie ihn geheiratet hatte. Ihm genügte, dass sie da war.
«Also gut, wir engagieren Frau Garises», sagte er, «aber du darfst deswegen nicht unvorsichtig werden. Geh nur aus dem Haus, wenn es unbedingt sein muss. Und bleibe um Gottes willen in sicheren Gegenden.»
Maras Hand griff fester um seine Schulter, zog an. Der Sessel drehte sich um hundertachtzig Grad. Mara beugte sich nach unten, sodass ihr Gesicht nur noch zwanzig Zentimeter von seinem entfernt war. Mit dieser völlig selbstverständlichen Bewegung, die er so liebte, strich sie sich das blonde Haar hinter das Ohr zurück und sagte: «Ich muss nach Katutura. Was Samuel jetzt am meisten braucht, ist Verlässlichkeit. Wie soll er denn Vertrauen gewinnen, wenn ich mal eben ein paar Wochen ausbleibe?»
«Wir können ihn doch ab und zu holen lassen und …»
«Wir haben uns gemeinsam entschieden, ihn zu adoptieren», sagte Mara. «Wenn wir jetzt von unserem Leben sprechen, dann gehören eben drei dazu: du, ich und Samuel.»
Sie hatte recht. Natürlich hatte sie recht. Interessen führten zu Entscheidungen, und Entscheidungen hatten Konsequenzen, die zu akzeptieren waren. Das lief im Privatleben nicht anders als in der Diplomatie. Engels sagte: «Ich möchte ja nur, dass du auf dich aufpasst.»
«Du kennst mich doch.»
«Eben», sagte Engels.
«Du siehst zu schwarz. Da erlaubt sich doch nur jemand einen dummen Scherz. So wichtig sind wir nun auch wieder nicht. Ich zumindest nicht.»
«Einspruch!», sagte Engels.
«Jetzt sag doch selbst: Wer würde jemanden wie mich schon entführen wollen?»
«Ich», sagte Engels, «wenn ich dich nicht schon hätte.»
Mara beugte sich nach vorn und küsste Engels auf die Lippen. Dann richtete sie sich auf. Engels griff nach ihrem Arm und hielt ihn fest. «Mara, ich brauche dich.»
«Klar», sagte Mara. Sie fuhr mit der freien Hand durch Engels’ Haare und verwuschelte sie. «Jemand muss ja schauen, dass Ihre Frisur immer ordentlich sitzt, Herr Botschafter.»
«Im Ernst», sagte Engels.
«Ich brauche dich auch», sagte Mara. «Ganz im Ernst. Und ich verspreche dir, dass ich auf mich aufpasse.»
Sie strich über seine Wange zum Kinn hinab. Engels nickte. Er ließ ihren Arm los und sagte: «Wir könnten doch heute Abend dem Handelskammerpräsidenten absagen und …»
«Unbedingt», sagte Mara. Sie wandte sich um und rief über die Schulter zurück: «Ich rufe sofort Clemencia Garises an.»
Die Tür schlug zu, die Klimaanlage brummte leise. Vielleicht hatte Mara ja recht, und die Drohbriefe waren wirklich nicht ernst zu nehmen. Dass sie sich vor lauter Angst selbst einsperrte, hätte Engels jedenfalls nicht gewollt. Es hätte so gar nicht zu ihr gepasst. Engels drehte sich mit dem Sessel zurück, vorbei am Porträtfoto des Bundespräsidenten an der sonst kahlen Wand.
«Na, alles klar?», fragte Engels zu seinem obersten Dienstherrn hin. Dann stand er auf und trat ans Fenster. Vom sechsten Stock des Sanlam Centres, in dem die Deutsche Botschaft untergebracht war, konnte man über Windhoek-West hinweg bis zu den Bergen des Khomas-Hochlands sehen. Weit hinten – die Entfernung war schwer zu schätzen – stieg eine Rauchwand in den blauen Himmel hoch. Bei der Hitze und dem trockenen Busch reichte ein Funken, um einen Veldbrand zu entfachen. Wenn der Wind blies, standen im Nu Hunderte, ja Tausende von Hektar in Flammen. Dort draußen würden die Farmarbeiter gerade verzweifelt versuchen, mit Feuerklatschen die Brandstreifen längs der Farmpads zu halten.
Engels setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Ganz oben im Posteingang lag die Antwort des Auswärtigen Amts auf das Memorandum, das sie vor einigen Wochen nach Berlin geschickt hatten. Engels und seine Mitarbeiter hatten einen halben Roman über die Bedeutung der anstehenden Schädelrückgabe verfasst, über den Zusammenhang mit der kolonialen Vergangenheit, die damit verbundenen Interessen der SWAPO-Regierung, die Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten in Namibia und speziell in den besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen der Hereros, Namas und Deutschstämmigen. Die Antwort umfasste magere sieben Sätze. Engels überflog sie und schüttelte den Kopf. Die in Berlin hatten nichts begriffen. Sie hatten nicht einmal begriffen, dass es wichtig sein könnte, die Problematik zu begreifen.
Nach kurzem Bedenken hatte Clemencia den Auftrag Mara Engels’ angenommen. Die nächsten Jahre würde sie es sich nicht leisten können, bezüglich ihrer Kunden wählerisch zu sein. Die Investitionen in Fuhrpark, Waffen, Funkausrüstung, Computer und was sonst noch alles dazugehörte, waren beträchtlich gewesen, die aufgenommenen Darlehen mussten getilgt werden. Dazu kam, dass die Frau des deutschen Botschafters die verlangten Tagessätze nicht nur umstandslos akzeptiert hatte, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch bezahlen würde. Bei namibischen Auftraggebern war das keineswegs selbstverständlich.
Trotzdem fühlte sich Clemencia nicht ganz wohl bei der Sache. Zum einen hatte sie wenig Interesse, der staatlichen Konkurrenz von der VIP Protection Unit ins Gehege zu kommen. Schwerer wog der zweite Aspekt, die unklare Gefährdungslage. Mara hatte ausgeschlossen, sich im privaten Leben Feinde gemacht zu haben. Gegen einen geschmacklosen Scherz sprach die Beharrlichkeit, mit der die Drohungen wiederholt worden waren. Ging es also um die öffentliche Rolle des Botschafterpaars?
Ob es politisch zu ernsteren Konflikten gekommen war, und wenn ja, mit wem, darüber konnte oder wollte Mara keine Auskunft geben. Und eins blieb äußerst seltsam: Wenn sich jemand durch die deutsche Regierung brüskiert gefühlt hatte, wieso drohte er dann nicht deren eigentlichem Repräsentanten, nämlich dem Botschafter selbst? Denn die vier anonymen Schreiben waren ausschließlich an Mara gerichtet.
Wegen der unübersichtlichen Ausgangslage hatte Clemencia den Personenschutzauftrag Mara Engels’ zur Chefsache erklärt. Deshalb stand sie nun im Living Rainbow Children Centre und verfolgte mit, wie sich Mara und Miki Selma in die Haare gerieten. Miki Selma hatte den Jungs befohlen, sich in Zweierreihen aufzustellen und den Nebenmann an der Hand zu fassen, um geordnet über den Hof zur Toilettenanlage zu marschieren.
«Im Gleichschritt womöglich?», fragte Mara.
«Natürlich im Gleichschritt», sagte Miki Selma. «Hopp, Jungs!»
«Zum Pinkeln dürfen sie aber die Hand des anderen loslassen, oder?»
Miki Selma war nur bedingt für Ironie empfänglich, doch selbst ihr schien zu schwanen, dass Mara eigentlich auf etwas ganz anderes hinauswollte. Miki Selma zog die Stirn in Falten, dachte nach, kam aber offensichtlich zu keiner befriedigenden Lösung und entschied sich daher, Maras Frage zu beantworten. «Natürlich pinkelt jeder allein, und dann wäscht sich jeder allein die Finger, und dann stellen sie sich wieder in Reih und Glied auf und fassen einander zum Rückmarsch bei den Händen.»
«Vielleicht müssen jetzt gar nicht alle pinkeln», sagte Mara, «vielleicht muss der eine erst in einer halben Stunde, ein anderer erst in zwei Stunden, und der Dritte kann überhaupt nicht auf Kommando. Sollte man die Kinder nicht selbst bestimmen lassen, wann sie aufs Klo gehen?»
«Und ich soll jedes Mal mitstiefeln? Während der Rest der Rasselbande alles auf den Kopf stellt?» Miki Selma stemmte die Arme in die Hüften.
«Es geht hier nun mal um elementare Bedürfnisse, da sollte …»
«Essen ist auch ein elementares Bedürfnis», fauchte Miki Selma. «Deswegen kann noch lange nicht jeder selbst bestimmen, wann er seine Schüssel gefüllt haben will. Frühstück gibt es um halb acht, Mittagessen um eins, danach müssen sich die elementaren Bedürfnisse eben richten. Sonst ist das ja gar nicht zu organisieren.»
Mara schüttelte den Kopf.
«Und außerdem haben wir das schon immer so gehalten», schloss Miki Selma in einem Ton, der suggerierte, dass bei dieser Frage das Selbstverständnis des gesamten afrikanischen Kontinents und speziell der identitätsstiftende Widerstand gegen eurozentrischen Kulturimperialismus auf dem Spiel standen.
Die Jungs verharrten geduldig in Zweierreihen, hielten den Nebenmann an der Hand und warteten auf das Kommando zum Abmarsch. Ohne dass Miki Selma es eigens angeordnet hätte, hatten sie sich der Größe nach aufgereiht. Samuel, als Kleinster und Schmächtigster von allen, stand ganz vorn. Mara ging vor ihm in die Hocke, sodass sie ungefähr auf Augenhöhe mit ihm war, und fragte, ob er auf die Toilette müsse. Samuel antwortete nicht, natürlich nicht. Soweit Clemencia wusste, hatte der Junge seit dem schrecklichen Unfall vor einem halben Jahr noch kein Wort gesagt.