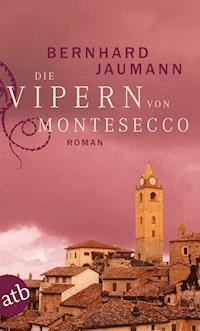9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Clemencia Garises Trilogie
- Sprache: Deutsch
Namibia im Januar: Die Regenzeit will nicht kommen, das Land ächzt unter Hitze und Dürre. Im Windhuker Nobelviertel Ludwigsdorf tollen die Kinder auch abends noch im Pool. Ein Mann, der seine Zitronenbäume wässert, wird über den Elektrozaun hinweg mit einer AK-47 erschossen. Neunzehn Jahre nach der Ermordung des SWAPO-Anwalts Anton Lubowski beginnt so eine Attentatsserie, der nach und nach die damaligen Täter vom südafrikanischen Geheimdienst zum Opfer fallen. Für die junge Windhuker Kriminalpolizistin Clemencia Garises werden die erbitterten Kämpfe aus der Endzeit der Apartheid lebendig, die sie bisher nur aus Erzählungen kannte. Ihr Job ist es, einen Mörder zu finden und die rassistischen Täter von damals zu schützen. Ihr Gegenspieler ist ein Killer, der so schnell verschwindet, wie er aufgetaucht ist. Er tötet in einem namibischen Villenviertel und findet Zugang zu einem südafrikanischen Gefängnis, er schmuggelt seine AK-47 über die Grenze, er wartet unter einem Kameldornbaum in der Kalahari-Wüste geduldig auf sein nächstes Opfer. Er ist todkrank, er ist allein, er mordet wieder. Clemencia ahnt schnell, dass ein selbsternannter Racheengel eine alte Schuld begleichen will. Doch wer ist der Täter? Und warum schlägt er erst nach fast zwei Jahrzehnten zu?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Bernhard Jaumann
Die Stunde des Schakals
Roman
1
SCHÜSSE
Keine Lügen mehr, keine Geschichten! Nur die Wahrheit zählt, und die Wahrheit ist der Tod. Vielleicht auch das Leben, aber mehr noch der Tod. Denn nicht jeder kann ein Leben sein Eigen nennen, doch der Tod, der klopft bei allen an. Früher oder später.
Er schob das gekrümmte Magazin in die Führung der AK-47 und vergewisserte sich, dass es fest saß. Dreißig Patronen, 7,62Millimeter. Als er sich zur Seite beugte, spürte er, dass ihm das Hemd schweißnass am Rücken klebte. Das Blut kochte in seinen Adern. Das lag nur an der Hitze. Sie staute sich im Wagen, obwohl die Scheiben ganz nach unten gekurbelt waren. Er legte die Kalaschnikow links neben sich auf den Beifahrersitz und lehnte sich in das Polster des Fahrersitzes zurück. Aus dem Autoradio sagte der Sprecher den Titel «Summer in the City» an. Es war ein afrikaanser1 Sender, Radio Kosmos, 94,1Megahertz.
Die Sonne stand noch zwei Handbreit über der Hügelkette jenseits des Klein-Windhoek-Riviers, aber auch, wenn sie untergegangen wäre, würde es kaum abkühlen. Genauso wenig wie gestern oder die Tage zuvor. Ganz Windhoek, ganz Namibia ächzte unter der Januarhitze und sehnte die dunklen Wolken herbei, die aus Nordosten den Regen bringen würden. Danach sah es jedoch nicht aus. Der Himmel im Nordosten war von einem unwirklich strahlenden Blau.
Er wischte sich die Handflächen an den Oberschenkeln ab. Der Sicherungshebel der AK-47 war in der mittleren Position eingerastet. Dauerfeuer. Er musste nur den Abzug durchgedrückt halten. Mit Lüge oder Wahrheit hatte das nichts zu tun. Er musste einen Job erledigen.
Die Palmen vor dem Haus Nummer 15 warfen lange Schatten über den Asphalt. Bis zur Kreuzung vorn war kein Mensch zu sehen, und das nicht nur, weil es brütend heiß war oder weil die Ursulastraße eine Sackgasse war. Hier im Windhoeker Stadtteil Ludwigsdorf ging man nicht auf die Straße. Man blieb in seinem eigenen kleinen Paradies, hinter hohen Mauern, die mit Stacheldraht bekränzt waren. Wer aus dem Haus musste, nahm den Wagen und vergewisserte sich, dass sich das Elektrotor hinter ihm schloss, bevor er sich entfernte. Ein Fußgänger war entweder ein Bettler oder ein Krimineller. Und auch ein fremdes Auto, das am Wendekreis der Sackgasse parkte, würde wahrscheinlich Verdacht erregen.
Doch er war gut vorbereitet. Er hatte einen weißen Toyota Corolla gestohlen, sich Schablonen angefertigt und das Logo der Sicherheitsfirma «Group 4Securicor» auf den Lack gesprüht. Sogar Nummernschilddubletten hatte er anfertigen lassen, nur für den Fall, dass misstrauische Anwohner bei der Zentrale anriefen. Man würde ihnen bestätigen, dass es sich wirklich um ein Fahrzeug der Firma handelte. Wahrscheinlich war diese Vorsichtsmaßnahme völlig übertrieben gewesen. Die G4S-Wagen standen schließlich oft irgendwo im Stadtgebiet herum.
Zur Talseite hin ging der Wendekreis in einen schmalen Streifen verdorrten Grases über. Ein paar Aloen mit spitzen, rötlichen Blättern standen vor dem hüfthohen Mäuerchen, das den Abhang sicherte. Von dem abwärtsliegenden Haus waren nur der Giebel und die Satellitenschüssel zu sehen, doch er wusste, dass er vom Mäuerchen aus die Terrasse und einen Großteil des Gartens überblicken konnte. Die Sonne stand jetzt hinter dem Wasserturm auf der gegenüberliegenden Höhe. Sie begann, sich orange zu verfärben, doch noch blendete sie zu stark. Er würde warten, bis sie untergegangen war.
Im Radio lief nun ein Song von Koos Kombuis. «Johnny is nie dood nie». Ob Johnny noch lebte, interessierte ihn nicht. Er schaltete das Radio aus. Durch das geöffnete Wagenfenster hörte er hinter der Mauer von Haus Nummer 15Kinderstimmen kreischen. Dann ein lautes Klatschen, als ob jemand in den Pool gesprungen wäre. Oder hineingestoßen worden war. Wasser schwappte, ein Prusten tauchte aus dem Geräusch auf. Empörte, halbverschluckte Worte, die er nicht verstand. Vielleicht gab es auch nichts zu verstehen. Vielleicht war einfach alles so, wie es war. Die Kinderstimmen, die AK-47 auf dem Beifahrersitz, sein schweißnasser Rücken, die Wahrheit, die Geschichten, der Dachgiebel mit der Satellitenschüssel und die Sonne, die jetzt rot in den Hügelkamm gegenüber sickerte.
Es war an der Zeit. Er griff nach dem Gewehr und öffnete die Fahrertür. Die Straße war menschenleer. Er stieg aus. Durch die Schuhsohlen glaubte er zu spüren, dass der Asphalt glühte, als brenne das Höllenfeuer direkt darunter, doch das war pure Einbildung. Die Hölle existierte nicht, denn sonst hätte es ja auch einen Himmel geben müssen. Alles nur Lügen, nur Geschichten. Hinter der Toreinfahrt von Haus Nummer 11 kläffte ein Köter los. Ein hartes tiefes Gebell fiel ein und wurde aus den Nachbargrundstücken vielstimmig erwidert. Das war normal. Wer in dieser Gegend wohnte, hielt meistens zwei Hunde, einen kleinen, nervösen, der Wache halten sollte, und einen scharfen Kampfhund.
«Alles in Ordnung», murmelte er. Er ging langsam bis zum Mäuerchen vor und legte die AK-47 darauf ab. Das Hundegebell verstummte allmählich. Eine Kinderstimme hinter der Einfriedung von Nummer 15 schrie: «Gib her! Los, gib schon her!»
Im Garten schräg unter ihm blinkte eine Fläche unwirklich grünen Rasens hinter zwei Akazien hervor. Die Sprinkleranlage war eingeschaltet. Auf der Terrasse saß ein etwa vierzehnjähriges Mädchen, das auf einem Handy herumtippte. Das musste die Tochter sein. Weiter links standen drei Obstbäume, der Form und den Blättern nach Zitronen, Naartjies oder irgendwelche anderen Zitruspflanzen. Im Abstand von circa einem Meter um die Stämme war die Erde kreisförmig aufgeschüttet, sodass sich in der Vertiefung das Wasser sammeln konnte, das aus einem Gartenschlauch lief. Der Mann, der ihn lässig in der Hand hielt, trug verwaschene Shorts und ein weißes T-Shirt, das über seinem Bauch spannte. Hals und Gesicht waren feist und gerötet, die Augen unter dem tiefsitzenden Schirm der Baseballkappe nicht zu erkennen. Dennoch gab es keinen Zweifel, dass es der richtige Mann war. Sein Opfer.
Er wischte sich ein zweites Mal die Hände ab und griff nach der Kalaschnikow. Als er sie in Anschlag brachte, spürte er den Drang, dem Mann dort unten noch etwas zuzurufen. Dass man früher oder später seine Rechnungen bezahlen müsse. Dass im Tod mehr Wahrheit als im Leben liege. Und dass wenigstens das verdammte Mädchen ins Haus verschwinden solle.
Natürlich rief er nichts. Er hustete kurz. Die Sonne war untergetaucht, hatte nur ein fahles Orange über der Anhöhe drüben zurückgelassen. Er fühlte eine eigenartige Wut in sich aufsteigen. Auf sich, auf das Leben und auf den fetten Mann dort unten. Wieso musste der ein weißes T-Shirt tragen, ausgerechnet ein weißes T-Shirt? Warum nicht dunkelrot oder schwarz? Wer ein weißes T-Shirt trug, hatte es sich selbst zuzuschreiben, wenn…
Er presste den Kolben der AK-47 fest an, zielte. Dann zog er den Zeigefinger durch und hielt den Abzug gedrückt. Dauerfeuer. Noch bevor er losließ, sackte das Opfer zusammen, ohne einen Laut von sich zu geben. Der Gartenschlauch glitt aus seiner Hand, wand sich und stieg wie eine angegriffene Speikobra. Das Wasser spritzte in Richtung Terrasse. Das Mädchen war aufgesprungen und drückte sich gegen die Ziegelmauer. Mit dem Gesicht zur Wand.
Das war das Letzte, was er sah. Er ging zum Auto zurück, legte das Gewehr auf den Beifahrersitz, stieg ein und startete den Motor. An der Kreuzung bog er nach links. Er fühlte sich weder besser noch schlechter als sonst. Nicht einmal sein Herz schlug besonders stark. Die Wut war verschwunden, doch nichts anderes war an ihre Stelle getreten. Er hatte früher schon auf Menschen geschossen, doch damals war er Soldat gewesen. Wenn ein Soldat einen anderen tötete, nannte das niemand Mord. Erst jetzt war er ein Killer. Es berührte ihn nicht. Er hatte gedacht, dass es sich anders anfühlen würde, auch wenn er nicht gewusst hatte, wie. Er hustete einmal, zweimal. Dann schaltete er die Scheinwerfer des Toyota an.
Es war 22Uhr 27, als Kriminalinspectorin Clemencia Garises per Handy von dem Mord erfuhr.
Der Anruf erreichte sie zu Hause in Katutura, und da der Fernseher in voller Lautstärke lief, brüllte sie ins Telefon, man solle ihr sofort einen Wagen schicken. Der mürrische Kollege vom Telefondienst wies sie darauf hin, dass es Sonntagabend war. Er würde aber sehen, was sich machen ließe. Das bedeutete, dass er gar nichts unternehmen würde. Und dass sie sich nicht so wichtig nehmen solle. Wahrscheinlich hatte man sie überhaupt nur informiert, weil ihre älteren Kollegen am Sonntagabend keine Lust verspürten, irgendwo die Leiche eines Weißen einzusammeln. Clemencia dagegen war ganz froh, von zu Hause wegzukommen. Nach dem Abendessen hatte ihre Familie plus der halben Nachbarschaft vor dem Fernseher gehockt und die Höhepunkte der dritten Staffel von «Big Brother Africa» angesehen. Die namibische Vertreterin, die sich für drei Monate Containerleben in Johannesburg qualifiziert hatte, war schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Alle waren sich einig gewesen, dass sie ihrem Land keine Ehre gemacht hatte. Sie sei viel zu scheu, zu langweilig gewesen und habe immer so gewirkt, als sei sie nicht sie selbst.
«Clemencia hätte das viel besser gemacht», hatte Miki Matilda gesagt.
«Ich?», hatte Clemencia gefragt.
«So hübsch wie die bist du schon lange. Warum bewirbst du dich nicht mal?»
Clemencia hatte nur abgewunken, doch Miki Selma hatte heftig protestiert. «Soll Clemencia vielleicht mit wildfremden Männern herumknutschen und sich dabei von ganz Afrika zusehen lassen?»
«Eben, ganz Afrika!», hatte Miki Matilda aufgetrumpft. «Es wäre doch gelacht, wenn sich da nicht ein paar ernsthaft für sie interessieren würden. Vielleicht findet sie ja endlich den Richtigen.»
«Mikis…», hatte Clemencia einzuwenden versucht, doch sie war nicht zu Wort gekommen.
«Das ist deine Sache, ich weiß schon, aber seine Meinung wird man ja wohl sagen dürfen.»
«Im Fernsehen hat noch keine ihr Glück gefunden», hatte Miki Selma gesagt. «Clemencia sollte sich lieber in der Nachbarschaft nach einem umsehen, der nicht trinkt und nicht raucht und…»
«Man muss jede Chance nutzen», hatte Miki Matilda eingeworfen.
«Ein Feuer verbrennt den, der es anfacht», hatte Miki Selma mit einem ihrer Lieblingssprichwörter gekontert, doch Miki Matilda hatte sich nicht aus dem Konzept bringen lassen.
«Wie alt bist du jetzt, Clemencia? Neunundzwanzig? Dreißig?», hatte sie lauernd gefragt. Natürlich wusste sie ganz genau, wie alt Clemencia war, doch es hätte nicht viel Sinn gehabt, sich darüber aufzuregen.
Clemencia hatte gesagt: «Einunddreißig.»
«Ein-und-drei-ßig!» Miki Matilda hatte die Silben gedehnt, um das Ungeheuerliche dieser Tatsache zu unterstreichen. «Mit einunddreißig war ich schon fast Großmutter!»
«Als du einunddreißig warst, herrschten hier noch die Südafrikaner. Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt ist Namibia unabhängig, und ich, ich bin Kriminalinspectorin», hatte Clemencia geantwortet. Aber sie hätte genauso gut nichts sagen können, denn Matilda und Selma hatten ungerührt weiterdebattiert, was sich für einunddreißigjährige Frauen im Allgemeinen und für Clemencia im Speziellen schickte, und so war sie froh gewesen, als ihr Handy geläutet hatte.
Sie stieg über die Beine ihrer Familienangehörigen und trat vor die Tür ins Freie. Die Ziegelmauer strahlte die tagsüber gespeicherte Hitze ab. Die Luft war wie warmes, weiches Wasser, und über Clemencia spannte sich ein sternklarer Nachthimmel. Schwarz zeichnete sich der Kirchturm der Holy Redeemer Parish vor ihm ab. Irgendwo aus dem Halbdunkel zwischen den einstöckigen Häusern und den um sie errichteten Blechhütten war unverständliches Palaver zu hören, das in ein lautes Gelächter mündete. Vom anderen Ende der Straße her tönten die dumpfen Bässe von Kwaito-Musik. Sie kam aus der Mshasho Bar, in der sich wahrscheinlich Clemencias jüngerer Bruder Melvin gerade mit Tombo-Bier betrank. Irgendwann musste sie noch einmal versuchen, ihm ins Gewissen zu reden.
Vor dem Haus schräg gegenüber kam der Nachbar mit seinem klapprigen Ford an, den er mit dem Kauf eines entsprechenden Schildes zum Taxi aufgewertet hatte. Illegal natürlich, aber das störte Clemencia jetzt wenig. Der Mann hatte eine Zwölfstundenschicht hinter sich und war alles andere als begeistert, erklärte sich aber angesichts ihrer Stellung als Polizistin bereit, sie ans andere Ende der Stadt zu chauffieren. In Katutura musste man noch auf Passanten achten, doch die weißen Viertel von Windhoek waren um diese Zeit wie ausgestorben. Wenn man die roten Ampeln ignorierte, kam man zügig voran. Auf der Nelson Mandela Avenue ließ Clemencia den Fahrer Gas geben. Kaum zehn Minuten später quälte sich der Ford den Berg von Ludwigsdorf hoch, und dann waren sie da. Vor einer verschlossenen Toreinfahrt standen zwei Wagen der City Police. Die Straße war nicht abgesperrt, kein Beamter war zu sehen.
Clemencia stieg aus und fand die Klingel rechts neben der Toreinfahrt. Ein Namensschild gab es nicht. Clemencia drückte auf den Klingelknopf. Die Luft war immer noch warm und weich, doch sie roch nach Tod. Vielleicht lag es auch nur an dieser unwirklichen Stille, wie sie in Katutura nicht einmal in den tiefsten Stunden der Nacht herrschen würde. Clemencia klingelte noch einmal.
Endlich machte ein Uniformierter auf. Clemencia wies sich aus und ließ sich in den Wohnraum führen, der mindestens doppelt so groß war wie das ganze Haus ihrer Familie. Obwohl Fenster und Terrassentür bis auf die Fliegengitter offen standen, herrschte eine Temperatur, als wäre die Sonne hier drinnen untergegangen. Trotz der Hitze hatte sich ein Mädchen mit angezogenen Knien ins Sofa vergraben. Es umklammerte ein Lederkissen und kicherte leise vor sich hin. Oder war das ein hilfloses Wimmern?
«Der Arzt hat ihr eine Beruhigungsspritze gegeben», flüsterte der Uniformierte Clemencia zu, «aber sie beruhigt sich nicht. Antwortet auf keine Frage und kreischt los, wenn man sie berührt. Selbst die eigene Mutter kommt nicht an sie heran.»
Um den Esstisch saßen ein Mann und vier Frauen. Alles Weiße. Es war nicht zu verkennen, wer die Mutter war. Sie war blass, ihre Gesichtszüge wirkten versteinert. Ihre Augen starrten auf den Aschenbecher vor ihr. Nur wenn sie die Zigarette zu den Lippen führte und gierig sog, merkte man, dass ihre Hände zitterten. Als sich Clemencia vorstellte, sah die Frau kaum auf.
«Sie leiten die Ermittlungen?», fragte der Mann neben ihr auf Afrikaans und maß Clemencia vom Scheitel bis zur Sohle.
«Schön, dass Sie auch schon da sind – dreieinhalb Stunden nach der Tat», sagte eine der Freundinnen bitter.
Clemencia bat darum, den Tathergang kurz zu schildern.
«Hören Sie, Mevrou van Zyl hat nichts gesehen», sagte der Mann. «Und Sie werden ihr jetzt nicht wieder genau dieselben fokken Fragen stellen, die sie den Streifenpolizisten schon stundenlang beantwortet hat.»
Clemencia sah zu, wie Frau van Zyl die Zigarette mit fahrigen Handbewegungen ausdrückte und sich sofort eine neue ansteckte. Es war nicht Clemencias Schuld, dass sie so spät eingetroffen war. Sie verstand ja, dass die Situation für die Hinterbliebenen nicht leicht war, aber konnte man nicht trotzdem ein wenig Kooperation erwarten? Clemencia fragte den Streifenpolizisten nach dem Fundort der Leiche. Er führte sie auf die Terrasse, wo zwei seiner Kollegen warteten und so taten, als ob sie Wache hielten. Als sie außer Hörweite waren, stellte sie ihre Kollegen zur Rede. Warum war sie nicht früher benachrichtigt worden? Doch die drei zuckten nur mit den Schultern.
«Dahinten!» Der Polizist wies ins Dunkel des Gartens. Clemencia stapfte auf ein paar halbhohe Bäume zu. Einer der Polizisten, die ihr folgten, knipste eine Taschenlampe an. Über den Rasen wand sich ein Gartenschlauch. Der große dunkle Fleck, der im Lichtkegel erkennbar wurde, mochte geronnenes Blut sein. Irgendwelche Tatortmarkierungen waren nicht zu sehen. Geschweige denn eine Leiche.
«Man kann einen Toten doch nicht stundenlang herumliegen lassen», sagte der Streifenbeamte entschuldigend.
«Nein?», fragte Clemencia.
«Das bringt Unglück», sagte der Uniformierte.
«Weil dann irgendwelche Geister herumspuken?», fragte Clemencia. Der Polizist kniff die Lippen aufeinander.
Ja, wenn es Unglück brachte, musste man natürlich darauf verzichten, einen Tatort ordentlich zu sichern. Da war es wohl besser, einen Leichenwagen kommen zu lassen und das Mordopfer abzutransportieren, bevor die zuständige Inspectorin auch nur informiert wurde.
«Der Täter hat von da oben geschossen.» Der Polizist leuchtete über die Gartenmauer den Abhang hinauf. Der Schein der Taschenlampe verlor sich in grauem Gestrüpp.
«Wahrscheinlich mit einer automatischen Waffe», sagte ein anderer der Uniformierten. Er kramte aus seiner Hosentasche eine Plastiktüte voller Patronenhülsen hervor. Wenigstens hatte er sie nicht lose eingesteckt, doch wie er sie aufgesammelt hatte, wollte Clemencia lieber nicht wissen. Sie fragte, ob es Tatzeugen gebe.
«Die Tochter war anwesend, aber die spricht nicht», sagte einer der Polizisten.
«Die Befragung der Nachbarn wollten wir Ihnen überlassen», sagte sein Kollege.
Soweit man das erkennen konnte, waren die Nachbarhäuser dunkel. Die Weißen gingen früh zu Bett. Sie hatten ja auch einen Grund, früh aufzustehen. In ihrem Viertel, der Township Katutura, waren geschätzte fünfzig Prozent der Leute arbeitslos. So genau wusste das niemand.
Clemencia maß mit den Augen die Höhe der Gartenmauer ab. Etwa zweieinhalb Meter. Im Schein der Taschenlampe sah sie die Elektrodrähte, die über dem Mauerkranz entlangliefen. Sie hatten den Mann genauso wenig schützen können wie die Alarmanlage.
Es war still. Nur ein lauer Wind raschelte durch die Blätter der Zitronenbäume. Clemencia kehrte ins Haus zurück. Die Tochter des Ermordeten sah ihr mit weit aufgerissenen Augen entgegen. Als Clemencia sie nach ihrem Namen fragte, begann sie wieder leise zu wimmern. Clemencia wandte sich an die Mutter. «Wenn Sie Hilfe brauchen, ich hätte da die Nummer einer Psychologin, die…»
«Ich bin selbst Arzt», fiel ihr der Mann am Tisch ins Wort.
«…die auf solche Traumata spezialisiert ist», sagte Clemencia.
«Das Mädchen braucht einfach Ruhe!», sagte der Arzt. Es klang wie: Machen Sie bloß, dass Sie hier verschwinden!
Clemencia setzte sich Frau van Zyl gegenüber. «Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.»
Frau van Zyl zog an ihrer Zigarette.
«Allein», sagte Clemencia. Sie wartete, bis sich der Arzt und die Frauen in die Küche begeben hatten. Dann fragte sie: «Ist Ihr Mann bedroht worden?»
Frau van Zyl schüttelte kurz den Kopf und stieß die Zigarette zwei-, dreimal in den Aschenbecher. Sie blickte auf die Kippe, von der ein dünner Rauchfaden hochstieg. In etwa zwanzig Zentimetern Höhe kräuselte er sich, krümmte sich, als ob er Schmerzen litte, zerfaserte dann und löste sich in langsam verblassende Schlieren auf.
Clemencia fragte weiter, auch wenn das ein mühsames Unterfangen war. Frau van Zyl musste zu jedem Wort genötigt werden, und selbst dabei kam kaum etwas Brauchbares heraus. Ihr Mann habe ein ganz normales Leben geführt. Geboren in Pretoria, Schule, Militärdienst, Ausbildung. Weil sie nicht aus ihrer Heimat wegwollte, sei er nach Windhoek gezogen. Sie hätten eine Familie gegründet, er habe sich zum leitenden Angestellten hochgearbeitet, am Feierabend den Garten gepflegt und am Sonntag den Gottesdienst in der NG Kerk besucht.
Seine Interessen, Vorlieben, Leidenschaften?
Frau van Zyl zuckte die Achseln. Er habe gern gejagt. Und er habe regelmäßig die Rugbyspiele der Springbokke im Fernsehen angeschaut.
Und sonst?
Das sei alles.
Politisches Engagement, Börsenspekulationen, Spielsucht, Vorstrafen?
Nein, nein, nein und nochmals nein. Es war, als hoffe Frau van Zyl, ihren Mann dadurch wieder zum Leben zu erwecken, dass sie jedes denkbare Mordmotiv kategorisch ausschloss.
«Aber jemand glaubte einen Grund zu haben, ihn zu erschießen», sagte Clemencia leise.
Frau van Zyl zündete sich eine neue Zigarette an. Benson & Hedges. Sie legte die Schachtel auf den Tisch und sah dann Clemencia zum ersten Mal in die Augen. Es war nur ein kurzer Blick, doch Clemencia las genug daraus: Mevrou van Zyl log, zumindest verschwieg sie etwas Entscheidendes. Und sie würde es auch weiterhin verschweigen, denn sie hatte Clemencia gewogen und für zu leicht befunden. Für zu jung, zu unerfahren, einer wenig vertrauenswürdigen Polizei und der falschen Rasse zugehörig. Das war ziemlich viel auf einmal. Clemencia wusste, dass sie dagegen nicht ankommen würde.
So sanft, wie es ihr möglich war, sagte sie: «Ich verspreche Ihnen, Frau van Zyl, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um den Täter…»
«Knallen Sie ihn ab!», sagte Frau van Zyl leise.
«Wir werden…»
«Es ist mir egal, wer er ist und warum er es getan hat.» Frau van Zyl sprang auf und schrie nun mit sich überschlagender Stimme: «Finden Sie ihn und knallen Sie ihn ab! Sofort! Was wollen Sie noch hier? Los, nun gehen Sie schon! Knallen Sie das Schwein ab!»
Die Tochter auf dem Sofa wimmerte lauter und brach in hysterische Schreie aus, die ihr die Atemluft zu nehmen schienen und in einem Gurgeln endeten. Der Arzt, der Clemencia abgekanzelt hatte, riss die Küchentür auf und eilte zum Sofa. Hinter ihm erschienen die Frauen und versuchten, Frau van Zyl zu beruhigen.
Auch wenn Clemencia wusste, dass das ungerecht war, kam ihr alles falsch vor. Tag für Tag beklagten sich die Weißen, dass rechtsstaatliche Verfahren angeblich ungenügend eingehalten würden, doch kaum waren sie selbst einmal Opfer eines Verbrechens, war alles vergessen. Dann wollten sie Rache, wollten das Blut spritzen sehen. Dabei war die Gefahr, umgebracht zu werden, für einen Schwarzen immer noch zehnmal größer. Nur krähte kein Hahn danach, wenn in Katutura eine Sechzehnjährige auf dem Weg zur Außentoilette vergewaltigt und ermordet wurde. Oder wenn eine alte Frau abgestochen wurde, weil sie die dreißig Namibia-Dollar, mit denen sie über die nächste Woche kommen wollte, nicht sofort herausrückte. Der Mord an Meneer van Zyl würde dagegen für Schlagzeilen sorgen.
«Und jetzt?», fragte einer der Streifenbeamten leise.
Clemencia wusste, wie man eine Ermittlung führte. Sie hatte nicht nur die interne Ausbildung am Iyambo Police College mit Bravour absolviert, sondern konnte als einziges Mitglied der Behörde einen Master in Kriminalistik vorweisen. Das Studium in Südafrika hatte sie sich durch ein Vollstipendium leisten können. Erst vor kurzem war sie von einem sechsmonatigen Aufenthalt in Helsinki zurückgekommen, finanziert durch ein Programm der finnischen Regierung, das die Professionalisierung von Staatsbeamten in Drittweltländern zum Ziel hatte. Clemencia hatte die verschiedenen Abteilungen der dortigen Kriminalpolizei durchlaufen, sie hatte bei der Kriminaltechnik und der Gerichtsmedizin hospitiert, sie war auf Außendiensteinsätze mitgenommen worden und hatte die Arbeit von Mordkommissionen studiert. Doch ihr Wissen nützte ihr gar nichts. Sie befand sich nicht mehr in Finnland, sie war in Windhoek. Im südlichen Afrika. In einer anderen Welt.
«Unsere Schicht ist gleich zu Ende», flüsterte der Streifenbeamte Clemencia zu. «Hier können wir sowieso nichts mehr machen.»
Clemencia wählte die Nummer der Scenes of Crime Unit an, die für Spurensicherung zuständig war. Wahrscheinlich würden die sagen, dass man ebenso gut bis morgen früh warten könne, wenn schon so viel Zeit verloren war. Aber das taten sie nicht. Sie gingen gar nicht erst ans Telefon. Clemencia fragte sich, was sie mehr hasste: die Unprofessionalität ihrer Kollegen oder das Misstrauen und den kaum verhüllten Rassismus der Weißen.
Er saß in der Wartehalle des Hosea-Kutako-Flughafens auf einem der Stühle, die zu einer längeren Reihe zusammengeschraubt waren. Er hatte einen der mittleren Sitze gewählt, weil diese am wenigsten begehrt schienen. Wenn es sich lohnen würde, hätte er darüber nachgedacht, warum dieselben Leute, die im Leben so gern im Mittelpunkt standen, in Flughafenwartehallen einen Randsitz bevorzugten. Und warum sie jeden, der ihnen diesen Platz weggenommen hatte, kritisch musterten.
Er wollte nicht gemustert werden. Abgesehen davon war ihm sein Platz egal. Einen Platz seinen Platz zu nennen, als hätten dort nicht schon tausend andere gesessen, als würden nicht noch Tausende nach einem kommen, war sowieso eine Anmaßung. Jeder war ständig unterwegs, tappte blindlings mal hier-, mal dorthin, nur das Ziel, das stand fest. Um den Tod kam keiner herum.
Er hustete. Er hatte sich nicht gesetzt, weil er müde war oder sich gar schwach gefühlt hätte. Er saß nur, weil er im Stehen mehr aufgefallen wäre. Und weil er von hier einen guten Blick auf die Glastüren hatte, deren Flügel sich automatisch öffneten, sobald ein Fluggast den Zollbereich passiert hatte. Etwa fünf Meter vor den Türen hielt ein Absperrband die Wartenden auf Distanz. Ein paar von ihnen hatten Schilder dabei, auf denen «SWA Safaris» oder «Karivo Lodge» oder «Fam. Beyer» stand. Die jungen Männer, die die Schilder hochreckten, wenn einer der ankommenden Passagiere suchend in die Runde blickte, sahen alle gleich aus: Farmerhut, Khakihemd, Shorts und viel zu feste Kudulederschuhe. Keiner von ihnen trug eine Group-4-Securicor-Uniform.
Er hatte auch einen Namen auf ein großes Blatt Papier geschrieben. Es lag mit der Schrift nach unten auf seinen Oberschenkeln. Zwischen seinen Füßen stand die längliche blaue Tasche.
«Für Tennis ideal», hatte der Verkäufer im Sports Warehouse gesagt. «Bis zu drei Schläger passen hinein, und es bleibt genügend Platz für alles, was Sie sonst noch brauchen.»
«Perfekt», hatte er geantwortet.
Er wartete. Er sah ein paar rotgesichtige Jagdtouristen durch die Tür kommen und zielstrebig zu dem Schalter ziehen, an dem ihre Waffen ausgegeben wurden. Eine übermüdete Mutter trug ein Kind auf dem Arm und zerrte ein anderes hinterher, dem Mann nach, der einen hochbeladenen Gepäcktrolley auf den Avis-Stand zusteuerte. Hinter dem SWA-Safaris-Schild sammelten sich allmählich die Safari-Schäfchen und beäugten einander, als fragten sie sich, wer als Erstes geschlachtet würde.
Und dann kam der Mann, dessen Namen er auf ein Blatt Papier gemalt hatte. Er zog eine Rolltasche hinter sich her und trug in der anderen Hand einen kleinen Alukoffer. Der Mann war groß und muskulös. Obwohl er schon auf die fünfzig zugehen musste, schien er gut in Form zu sein. Man sah, dass er regelmäßig Sport trieb. Wahrscheinlich ging er jeden Abend nach der Arbeit zwei Stunden ins Gym, immer zur selben Zeit, absolvierte sein immer gleiches Programm, radelte, stemmte Gewichte, schwamm zwanzig Bahnen. Ein Mann mit Prinzipien. Oder zumindest mit Gewohnheiten.
Er selbst war anders. Er legte keinen Wert auf Gewohnheiten. Die spielten einem nur vor, dass man dem Leben Gesetze aufzwingen könne. Für ihn waren sie ein hilfloser Versuch, die Zukunft berechenbar zu machen, indem man das Immergleiche der Vergangenheit fortschrieb. Alles Lüge, alles Selbstbetrug. Ihn hatte die Wahrheit zu interessieren, und die Wahrheit ließ sich nicht zwingen. Sie blieb so bitter und einzigartig, wie es ihr gefiel. Er hustete kurz, stand auf, warf die Tasche über die Schulter und ging auf den Mann zu. Das Blatt Papier hielt er vor seiner Brust.
Der Mann schaute auf die Schrift, schaute ihm in die Augen und fragte: «Was wollen Sie?»
«Meneer van Zyl hat mich geschickt, um…»
«Wo ist er?»
«Es tut ihm leid, er konnte nicht selbst kommen. Ich soll Sie zu ihm bringen.»
Der Mann stellte seine Rolltasche ab und musterte ihn von oben bis unten. Er fragte: «Privater Sicherheitsdienst?»
«Windhoek ist gefährlich geworden.»
Der Mann grinste. «Na, dann ist es ja gut, dass ich Sie dabeihabe. Also los!»
Der Mann packte den Griff seiner Rolltasche. Ohne sich umzusehen, ging er auf den Ausgang des Flughafengebäudes zu.
Also los! Als ob man im Leben immer selbst entscheiden könne, wann etwas losging. Er spürte das Gefühl von gestern Abend wieder in sich hochsteigen. Die Wut, als er gesehen hatte, dass der fette Bure ein weißes T-Shirt trug. Dieser hier war drahtiger, hatte Gewohnheiten und trug ein Aluköfferchen, doch sonst waren sie gleich. Irgendwelche Männer, die nicht wussten, wie sehr sie sich über alles täuschten, was zählte.
Draußen auf dem Parkplatz öffnete er den Kofferraum des Corolla und lud das Gepäck des Mannes ein. Seine eigene Tasche warf er auf die Rückbank. Als er am Kassenhäuschen bezahlt und die Schranke passiert hatte, fragte der Mann neben ihm, wie lange er schon für van Zyl arbeite.
«Es ist nur ein Job», sagte er.
Was van Zyl Wichtiges zu erledigen habe? Das wisse er nicht. In der Tat, die Hitze sei wirklich schlimm. Ja, am Nachmittag würde es noch heißer. Nein, er habe keine Ahnung, wie heiß. Ja, die Klimaanlage könne er einschalten.
«Sie reden wohl nicht gern?», fragte der Mann.
«Einen Moment, bitte», antwortete er und lenkte den Wagen auf den Sandstreifen am Straßenrand. Dann stieg er aus, öffnete die Sporttasche auf der Rückbank, holte die Kalaschnikow heraus, hielt sie dem Mann auf dem Beifahrersitz an den Kopf und sagte: «Vielleicht könnten Sie jetzt ein Stück fahren, Meneer Maree?»
Aus einem Gartenschlauch tropfte Blut. Der Rasen war schwarz. Zitronenbäume klapperten im Wind. Statt der Früchte hingen Patronenhülsen an den Zweigen. Ein weißes Mädchen klammerte sich an ein Lederkissen und schrie. Mit höhnischem Grinsen kam ein Mann näher und näher. Er beugte sich herab. So weit, dass sein Gesicht unscharf wurde und zerfloss. Statt ihm war plötzlich die Nacht da mit ihren huschenden Schatten, und von irgendwoher dröhnte dumpf der Klang ziegenfellbespannter Trommeln. Rhythmisch, beständig, unaufhörlich, als gelte es, magische Rituale zu begleiten und dunkle Neumondstunden zu durchtanzen, um im Morgengrauen völlig erschöpft zusammenzubrechen und neben der Asche des längst herabgebrannten Feuers einzuschlafen.
Clemencia Garises öffnete die Augen. Sie lag nackt auf einem Bett. Es dauerte einen Augenblick oder zwei, bis sie die Orientierung wiederhatte. Sie befand sich weder in den Weiten der Kalahari noch an einem Kralfeuer im Kaokoveld. Sie war in ihrem Zimmer, zu Hause, wo sie aufgewachsen war. In Katutura, der Heimat von hundertsiebzigtausend Menschen, in der das Leben brodelte und der Tod allgegenwärtig war, in der es vieles gab, fast alles, doch niemanden, der Buschtrommeln schlug wie in einem Hollywoodfilm über Safaris durchs tiefste Afrika. Clemencia richtete sich auf. Das Trommeln kam von der Tür.
«Mach auf!», rief Miki Matilda von draußen und rüttelte an der Klinke. Clemencia sperrte immer ab. Nicht so sehr, weil sie Angst vor Überfällen gehabt hätte, sondern weil sie ihr kleines Reich mit Zähnen und Klauen gegen die Invasionsversuche ihrer Familie verteidigen musste. Sicher, das Häuschen besaß nur zwei Zimmer, und eines davon für sich allein zu beanspruchen, mochte anmaßend erscheinen, wenn ihre acht bis zwölf hier lebenden Verwandten sich das andere und die Blechhütten, mit denen Garten und Vorhof im Lauf der Jahre zugebaut worden waren, teilen mussten. Doch Clemencia brauchte einfach etwas Eigenes.
Es gibt zwei Möglichkeiten, hatte sie gesagt, als sie den Posten bei der Polizei bekommen hatte, entweder ich miete mir eine kleine Wohnung im Zentrum und lege dafür zwei Drittel meines Gehalts hin, oder ich schieße das Geld in den Haushalt, aber dann will ich das Zimmer für mich allein. Der Familienrat hatte für die zweite Möglichkeit votiert, was aber nicht bedeutete, dass Clemencias Bedingung wirklich akzeptiert wurde. Im Gegenteil, Tag für Tag musste sie um ihr bisschen Privatsphäre kämpfen. Des Öfteren war sie dessen müde und schon fast entschlossen gewesen auszuziehen, aber das ging ja nicht, wenn sie nicht die Familie vor die Hunde gehen lassen wollte. Mit dem kleinen Gemüsestand, den Miki Selma vor dem Haus betrieb, kam fast nichts herein. Clemencias Schwester Constancia putzte zweimal die Woche in Klein Windhoek, aber sonst hatte keiner ein geregeltes Einkommen. Ohne Clemencias Zuschüsse sähe es düster aus. Zumindest ihr Bruder wäre garantiert auf die schiefe Bahn geraten. Wenn er es nicht sowieso schon war.
«Mach endlich die Tür auf!», rief Miki Matilda.
Clemencia warf sich etwas über und öffnete. «Was ist?»
Miki Matilda beglückwünschte Clemencia zu ihrem gesunden Schlaf, merkte aber im gleichen Atemzug an, dass die Morgenstunden zu dieser Jahreszeit am allerschönsten wären oder, besser gesagt, die einzig erträglichen. Man dürfe sie nicht verschwenden, sondern müsse rüstig sein Tagwerk beginnen, vor allem, wenn man so vom Glück geküsst und gesund sei, wie sie beide, Clemencia und Matilda, was ja leider nicht für alle ihrer Mitmenschen zuträfe.
«Was willst du?», fragte Clemencia.
«Es geht um Joseph Tjironda. Den kennst du nicht. Ein guter Freund von Petrus. Der wohnt mit seiner Familie am Rand von Wanaheda.»
«Was ist mit ihm?», fragte Clemencia.
Das wusste Miki Matilda nicht so genau. Etwas Ernstes wahrscheinlich, denn Josephs Sohn habe am Telefon sehr besorgt geklungen. Er könne das leider nicht ausführen, da er kein Guthaben mehr auf dem Handy habe, doch Miki Matilda solle bitte sofort zurückrufen. Und zack, habe er aufgelegt.
«Und warum rufst du nicht zurück?», fragte Clemencia.
«Ich habe auch kein Guthaben mehr», gestand Miki Matilda.
Clemencia trat ins Zimmer zurück und holte ihr Handy. Sie achtete darauf, dass Miki Matilda den Zugangscode, den sie beim Einschalten eintippte, nicht mitbekam. Es war ja nicht auszuschließen, dass sie das Handy mal unbeaufsichtigt herumliegen ließe. Sie bat darum, es kurz zu machen.
Überraschenderweise verzichtete Miki Matilda auf langwierigen Smalltalk und hörte fast ausschließlich zu. In Anbetracht dessen fiel die Erklärung, die sie nach Ende des Telefonats gab, allerdings sehr knapp aus: «Joseph Tjironda ist krank.»
«Was hat er denn?»
«Schmerzen.»
«Kopf, Brust, Magen, linker Oberschenkel, rechter Zeh?»
«Ich muss ihn erst sehen», sagte Miki Matilda.
Bei dem Teil ihrer Bekannten, die an traditionelle Heiler glaubten, hatte sie keinen schlechten Ruf, doch wenn sich ihr ein neuer Patient anvertraute, wollte er ihre Fähigkeiten normalerweise erst einmal testen. Die wichtigste Probe bestand darin, dass der Heiler von sich aus sagte, was dem Kranken wehtat. Nicht umgekehrt, wie bei den studierten Ärzten. Einmal durfte man falschliegen, doch wer beim zweiten Versuch nicht erkannt hatte, wo das Problem lag, dem traute logischerweise keiner zu, es lösen zu können.
«Wie siehst du denn, ob einer Kopf- oder Magenschmerzen hat?», hatte Clemencia einmal gefragt. Miki Matilda hatte gelächelt. Das sehe man halt, wenn man ein wenig Erfahrung besitze. Clemencia ging trotzdem lieber zu einem ausgebildeten Arzt, wenn sie krank war.
Miki Matilda gab das Handy zurück und sagte: «Ich muss sofort los.»
«Viel Erfolg!», sagte Clemencia und schlug die Tür zu. Auch sie musste gleich los. Als sie sich angezogen hatte und die Tür wieder öffnete, stand Miki Matilda immer noch davor.
«Kannst du mir das Taxigeld leihen?», fragte sie. «Bis ich zu Fuß dort ankomme, ist der Mann wahrscheinlich schon tot.»
Das war wahrscheinlich ziemlich übertrieben, doch Clemencia hatte wenig Lust, sich wochenlang als herzlose Mörderin beschimpfen zu lassen. Da rückte sie lieber die sieben Dollar fünfzig heraus, die eine Fahrt innerhalb der Stadt kostete. Dann brach sie auf, nahm ebenfalls ein Taxi bis zum Hauptquartier an der Bahnhofstraße. Von den Kollegen der Serious Crime Unit war noch keiner da. Immerhin konnte sie sich so einen funktionsfähigen und aufgetankten Wagen sichern, mit dem sie nach Ludwigsdorf hinausfuhr.
Nahe der Stelle, von der aus der Mörder geschossen hatte, wartete Clemencia auf die Scenes of Crime Unit. Wenn sich hier noch etwas finden ließe, wäre das unverschämtes Glück, da ihre Kollegen gestern Abend eventuelle Spuren gründlich zertrampelt hatten. Clemencia blickte zum Garten der Familie van Zyl hinunter. Bei Tageslicht wirkte er wie ein kleines Paradies. Eine große schattige Terrasse und ein sattgrüner Rasen. Unter den Zitronenbäumen hatte der Tote gelegen.
Von hinten fragte plötzlich eine Männerstimme, wer sie sei und was sie hier zu suchen habe. Clemencia drehte sich um. Im Tor des Grundstücks, vor dem die Palmen aufragten, stand ein älterer Weißer mit einem Gewehr im Anschlag. Er zielte auf Clemencia. Sie hob die Arme ein wenig und konnte den Mann nach einigem Hin und Her davon überzeugen, dass sie sich als Kriminalinspectorin ausweisen könne, wenn er sie nicht sofort erschieße, sobald sie in ihre Tasche greife. Während der Mann ihren Ausweis studierte, dachte sie, dass sie die Patrouillen nicht vergessen durfte. Mindestens eine Woche lang mussten hier im Viertel ein paar Uniformierte Präsenz zeigen. Das würde zwar zur Aufklärung des Mordes nichts beitragen, aber vielleicht verhindern, dass sich die Nachbarn in die Überzeugung verrannten, der Staat könne und wolle sie eh nicht schützen. Es wäre nicht zum ersten Mal, dass einer der armen Schlucker, die nachts die herausgestellten Mülltonnen durchwühlten, abgeknallt würde.
Als die Spurensicherung kam, machte sich Clemencia an die Befragung der anderen Nachbarn. Die Schüsse auf van Zyl waren zwar nicht zu überhören gewesen, aber verständlicherweise hatte sich niemand sofort auf die Straße getraut. Einer hatte immerhin von der Terrasse aus beobachtet, dass ein Group-4-Securicor-Wagen unmittelbar nach der Tat in hohem Tempo weggefahren war. Das Nummernschild hatte er auf die Entfernung genauso wenig erkennen können wie den oder die Insassen des Fahrzeugs. Zumindest war es ein Anfang.
Zwar wusste Clemencia, dass die Angestellten der Sicherheitsfirma pro Stunde gerade mal fünf Namibia-Dollar und sechsundsechzig Cent, also ungefähr den Gegenwert einer Dose Cola, verdienten. Dafür stürzte man sich nicht unbedingt todesmutig in die Schusslinie eines Mörders. Aber man hätte wenigstens erwarten können, dass der Wachmann sofort per Funk die Zentrale alarmierte. Das war jedoch nicht geschehen, wie Clemencia bei ihrem Telefonat mit der Sicherheitsfirma erfuhr. Der einzige Alarm nach dem Mord sei von Frau van Zyl ausgelöst worden. Als sie die Schüsse hörte, sei sie ins Schlafzimmer gestürzt und habe den Alarmknopf gedrückt. Sieben Minuten später sei der erste G4S-Wagen am Tatort eingetroffen, lange vor der Polizei, aber doch zu spät, um den Täter noch stellen zu können. Dass sich zur fraglichen Zeit ein Wagen der Firma in unmittelbarer Nähe befunden habe, könne man ausschließen. Die Zentrale halte ständig Funkkontakt, und jeder Positionswechsel eines Patrouillenfahrzeugs müsse durchgegeben werden.
Natürlich konnte sich ein Fahrer aus mehr oder weniger harmlosen Gründen über diese Vorschrift hinweggesetzt haben. Man musste das ebenso überprüfen wie die Frage, ob einer der G4S-Leute in der Vergangenheit mit Meneer van Zyl aneinandergeraten war. Für wahrscheinlicher hielt Clemencia, dass der Wagen nur als Tarnung gedient hatte. Und das bedeutete, dass sich der Mörder mit beträchtlichem Aufwand vorbereitet hatte. Auch die Tatwaffe sprach dafür, dass ein Profi am Werk gewesen war. Nicht jeder hatte ein automatisches Gewehr im Schrank stehen.
Nein, hier hatte kein Einbrecher, der überrascht worden war, die Nerven verloren. Hier ging es auch nicht um eine Tat aus dem Affekt heraus. Jemand hatte Abraham van Zyl gezielt aus dem Weg räumen wollen und das eiskalt geplant und durchgezogen. Dafür musste es einen gewichtigen Grund geben. Hatte Abraham van Zyl für jemanden eine Bedrohung dargestellt? Und wenn ja, wodurch?
Im Hauptquartier existierte keine Akte Abraham van Zyl. Oder wenn eine existierte, war sie jedenfalls nicht auffindbar. Gleiches galt für die Leiche. Als der Gerichtsmediziner sie obduzieren wollte, um offiziell festzustellen, was sowieso klar war, dass der Mann nämlich seinen Schussverletzungen erlegen war, fand er die Leichenkammer leer vor. Die Diensthabenden der vergangenen Nacht erklärten das mit einem technischen Defekt der Kühlanlage, der sie genötigt hätte, die schon vorhandenen Leichen vorübergehend auszulagern. Sonst hätte es nämlich eine Riesensauerei gegeben. Mit dieser Arbeit sei man völlig ausgelastet gewesen, sodass man sich geweigert habe, den Neuzugang anzunehmen. Wer den Mann dann wohin gebracht habe, wisse man nicht. Es dauerte Stunden, bis sich der Leichensack in einer abgelegenen Ecke der Polizeigarage fand.
«Immerhin nicht in der prallen Sonne», sagte Clemencia sarkastisch, als sie ihrem Chef Bericht erstattete. Oshivelo hörte sich ruhig an, was noch alles schiefgegangen war, machte sich nur ab und zu eine Notiz. Clemencia wusste sich mit ihm einig, dass die Arbeitsabläufe wesentlich effektiver organisiert werden mussten. Auf seine Anregung hin hatte sie ihre Ideen für ein Programm skizziert, das die dringendsten Maßnahmen in den Bereichen Kommunikation, Organisation, Qualifizierung ansprach. Ohne Finanzierung und das grundsätzliche politische Placet ging natürlich gar nichts, doch Oshivelo hatte versprochen, sich dafür einzusetzen. Das konnte er nicht nur, weil er Deputy Commissioner und gleichzeitig Leiter der Serious Crime Unit war, die sich mit Tötungsdelikten befasste. Als prominenter SWAPO-Kämpfer der neunzehnhundertsiebziger und -achtziger Jahre hatte er auch beste persönliche Kontakte zu vielen Kadern der Partei, die inzwischen Schlüsselpositionen in Verwaltung und Regierung besetzten.
Während Clemencia zur Vorgehensweise im aktuellen Mordfall überleitete, blickte sie auf die beiden Porträtfotos an der Wand hinter dem Chef. Das eine zeigte Staatspräsident Hifikepunye Pohamba, das andere den Gründungsvater der Nation, Sam Nujoma.
«Ich denke, wir müssen uns auf das Motiv konzentrieren. Wenn wir wissen, warum Abraham van Zyl erschossen worden ist…»
«Wer?», fragte Oshivelo.
«Abraham van Zyl. Das Opfer.»
Oshivelo nickte und zupfte an seinem grauen Bart. Wenn er sich so in seinen Sessel zurücklehnte, glich er ein wenig dem Altpräsidenten Nujoma.
«Sagt Ihnen der Name etwas?», fragte Clemencia.
«Nein.» Oshivelo schüttelte den Kopf. «Fahren Sie fort!»
Es gab nicht viel fortzufahren. Clemencia brauchte ein paar Leute, die sich das Umfeld des Toten– Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen – vornehmen würden und seine finanziellen Transaktionen überprüften. Das Übliche eben. Daneben sollte man sich an den einschlägigen Orten umhören, ob jemand ein automatisches Gewehr gekauft hatte. Oshivelo gestand ihr vier Beamte zu, mehr ginge beim besten Willen nicht.
Eine Stunde später hatte Clemencia ihr Team beisammen. Immerhin war Angula dabei. Den anderen drei Männern sah man ihren Unwillen, von einer Frau kommandiert zu werden, mehr oder weniger deutlich an. Ein Weißer war darunter, Bill Robinson, der bei früherer Gelegenheit zu verstehen gegeben hatte, dass er nichts gegen das Affirmative-Action-Gesetz habe, mit dem ehemals rassisch Benachteiligte in Führungspositionen befördert werden sollten. Ganz im Gegenteil, er verlange nur, dass dem Wortlaut des Gesetzes entsprochen werde, und da stehe eben, dass qualifizierte Schwarze vorrangig zu berücksichtigen seien. Seiner Meinung nach gehörten zur Qualifikation eines Inspectors notwendig ein paar Jahre praktische Erfahrung im Außendienst – «da, wo es brennt», hatte er gesagt – und nicht nur ein Studium und gute Noten auf dem Papier. Den Neid, der daraus sprach, konnte Clemencia wegstecken. Wütend machte sie, dass Robinson aus Mevrou van Zyl wahrscheinlich wirklich mehr Informationen herausgeholt hätte als sie, und das keineswegs, weil er ein besserer Polizist gewesen wäre.
Oshivelo war dabei, als Clemencia ihre Leute einwies. Sie wusste, dass er ihre Führungsqualitäten überprüfen wollte, aber sie verhielt sich keinen Deut anders, als sie es sonst getan hätte. Zuerst stellte sie klar, was sie erwartete: keine Alleingänge, umfassende Information untereinander, die lückenlose Dokumentation aller Ergebnisse, die jederzeitige Erreichbarkeit aller Teammitglieder, und, bitte schön, was der Presse mitgeteilt würde, entscheide nur sie in Absprache mit dem Chef. Sie spürte, dass ihre Ansprache harscher klang, als sie es meinte, und beeilte sich, zum aktuellen Mordfall zu kommen. Erst als sie daranging, die Aufgaben zu verteilen, meldete sich Angula, der älteste ihrer Leute, zu Wort.
«Das Opfer ist nicht zufällig Abraham ‹Slang› van Zyl?»
Slang, die Schlange?
«Der war damals im Civil Cooperation Bureau des südafrikanischen Geheimdienstes tätig und soll bei der Ermordung von Anton Lubowski seine Finger im Spiel gehabt haben.»
«Dann müssten wir doch eine Akte haben», sagte Clemencia.
«Wir konnten ihn seinerzeit nicht einmal vernehmen. Er hatte sich rechtzeitig nach Südafrika abgesetzt.»
Clemencia war zwölf Jahre alt gewesen, als Anton Lubowski erschossen worden war. Sie hatte die Hintergründe damals nicht mitbekommen, doch sie konnte sich gut an die Gedenkfeier erinnern. Ganz Katutura war auf den Beinen gewesen, der Kirchhof der Ephesians Lutheran Church hatte die Trauergäste nicht fassen können. Überall wehten SWAPO-Fahnen, und ein dumpfes Brodeln lag in der Luft, mehr Wut als Trauer. Auch Clemencia hielt ein Papierfähnchen in der linken Hand, sang die Afrikahymne «Nkosi Sikelel’i Africa» laut mit, reckte die rechte Faust nach oben, wie sie es bei den Erwachsenen sah, und hatte das Gefühl, dass jeden Moment etwas Großes, etwas Unerhörtes geschehen müsse. Der spätere Außenminister Theo-Ben Gurirab hielt die Trauerrede, und auch sonst war alles da, was in der Partei Rang und Namen hatte. Bis heute hatte Clemencia die Kinder des Ermordeten vor Augen, den Sohn im SWAPO-T-Shirt und vor allem das kleine Mädchen, das ein schönes Kleidchen mit roten, blauen und grünen Streifen trug, wie sie es auch gern besessen hätte.
«Und wieso sollte van Zyl dann wieder nach Windhoek zurückgekommen sein?», fragte Robinson.
Angula wischte sich den Schweiß von der Stirn und zuckte die Achseln. «Vielleicht wurde es ihm in Südafrika zu heiß, als 1994Mandela und der ANC an die Macht kamen. Van Zyl hatte sicher auch dort jede Menge Dinger gedreht, die ihn Kopf und Kragen kosten konnten. Aus dem Lubowski-Fall war nach mehr als fünf Jahren die Luft längst raus.»
«Und wir haben ihm eine Aufenthaltsgenehmigung gegeben?» Robinson schüttelte den Kopf, doch auch er musste wissen, dass bei der Immigration noch mehr danebenging als bei der Polizei.
«Das Mordopfer stammte aus Südafrika, und seine Frau ist Namibierin.» Clemencia spürte, dass sie auf der richtigen Spur waren.
«Wenn ich mich recht erinnere, wurde Lubowski mit einer AK-47 erschossen», sagte Angula.
«Damals hatte praktisch jeder Zugang zu einer AK-47», sagte Robinson, «die SWAPO-Kämpfer, die Koevoet-Leute und alle, die irgendjemanden auf einer der beiden Seiten kannten.»
«Aber heute nicht», sagte Angula, «und wenn da jemand die alten Zeiten wiederaufleben lässt…»
«Neue Aufgabenverteilung!», entschied Clemencia. «Angula und van Wyk suchen alles an Information über den Lubowski-Fall heraus, was zu finden ist. Mit besonderer Berücksichtigung von Slang van Zyl. Robinson, du fährst zur Witwe und stellst sicher, dass es sich bei Abraham van Zyl um denselben Mann handelt.»
«Reicht es nicht, wenn ich anrufe und nach dem Geburtsdatum frage?», murrte Robinson.
Nein, das reichte nicht, denn wenn die Vermutung zutraf, musste Mevrou van Zyl ernsthaft ausgequetscht werden. Dann hatte man nämlich ein mögliches Motiv. Oder zumindest etwas, was Abraham van Zyl von all seinen Nachbarn unterschied. Von diesen war sicher keiner in den aufsehenerregendsten politischen Mord der namibischen Geschichte verwickelt gewesen.
«Langsam», sagte Oshivelo. «Selbst wenn er Slang van Zyl war, heißt das noch lange nicht, dass der Mord an ihm etwas mit der Lubowski-Sache zu tun hat. Immerhin sind zwanzig Jahre seit damals vergangen.»
Das war ohne Zweifel richtig. Clemencia sah nach oben. Der Deckenventilator rührte hilflos durch die Hitze. Eine Klimaanlage gab es nur im Arbeitszimmer des Chefs.
«Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit», sagte Oshivelo. «Wir leben heute in einem anderen Land, und die Wunden von damals sind vielleicht noch nicht völlig verheilt, aber zumindest vernarbt.»
«Möglich», sagte Clemencia. Sie fragte sich, wieso sich Oshivelo einmischte. Das war sonst nicht seine Art. Sie fuhr fort: «Aber es ist eine Spur, die wir…»
«Natürlich», sagte Oshivelo. «Sie sollten nur im Auge behalten, dass Morde aus vielen Gründen begangen werden. Wieso sollte es nicht auch mal zufällig einen Ex-Rassisten erwischen?»
Vielleicht, weil Mevrou van Zyl bezüglich der Vergangenheit ihres Mannes so schweigsam geblieben war? Vielleicht, weil die Vergangenheit gar nicht so vergangen war? Vielleicht, weil die van Zyls und ihr Freundeskreis und vermutlich die gesamte Welt, in der sie sich bewegten, im Grunde noch genauso rassistisch waren wie in der Apartheidszeit? Clemencia sagte nichts.
Bill Robinson stand auf. Er wolle dann mal los. Er war noch nicht an der Tür, als einer von der Telefonzentrale hereinkam, der dringend den Chef zu sprechen wünschte. Die Group-4-Securicor-Leute hätten angerufen. Sie seien verständigt worden, dass einer ihrer Wagen ausgebrannt im Buschveld bei der Heja-Lodge stünde. Sie hätten ein paar Patrouillen hingeschickt und eine verkohlte Leiche auf dem Fahrersitz gefunden. Seltsam sei, dass sie keinen ihrer Wagen vermissten. Und auch keinen ihrer Leute.
«Verdammt!», sagte Oshivelo. «Ist der Tote schon identifiziert?»
Der Mann schüttelte den Kopf.
Es war drückend heiß im Raum 214 der Dienststelle. Eine Leiche in einem falschen G4S-Wagen! Genau so ein Wagen, in dem sich wahrscheinlich van Zyls Mörder vom Tatort entfernt hatte. Clemencia nahm das zur Kenntnis, doch sie war nicht hundertprozentig bei der Sache. Ihr Gespräch mit dem Chef ging ihr nicht aus dem Kopf. War es wirklich möglich, dass Oshivelo den Namen Abraham van Zyl nie gehört hatte? Einer wie er, der zur Zeit des Lubowski-Attentats an vorderster Front des politischen Kampfs gestanden hatte. Der seit der Unabhängigkeit in verantwortlicher Position bei der Kriminalpolizei war und die Ermittlungen im Lubowski-Fall hautnah mitbekommen haben musste. Konnte man so etwas einfach vergessen haben?
Ndangi Oshivelo, Deputy Commissioner der namibischen Polizei:
Zum ersten Mal begegnete ich Anton Lubowski 1983 im Internierungslager Osire. Die Südafrikaner beschuldigten mich, einen Sprengstoffanschlag in Klein Windhoek begangen zu haben, und hatten mich nach Osire gebracht, um dort ungestört ein Geständnis aus mir herauszuprügeln. Natürlich hatte ich keinen Anwalt benachrichtigen dürfen, aber die Genossen hatten sich darum gekümmert. Wie es Lubowski geschafft hatte, zu mir vorzudringen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hing es damit zusammen, dass die Südafrikaner aus politischen Gründen schnell jemanden verurteilt sehen wollten und den Prozess ohne Verteidiger schlecht eröffnen konnten, wenn sie die rechtsstaatliche Fassade einigermaßen aufrechterhalten wollten.
Als Lubowski hereinkam, war ich natürlich froh, überhaupt jemanden zu sehen, dachte aber auch, dass dieser Mann mir garantiert nicht helfen konnte. Man sah einfach, dass er aus einer anderen Welt stammte. Ein tadellos sitzender grauer Anzug, eine passende Krawatte, der Siegelring am Finger, das Aktenköfferchen in der linken Hand. Die etwas zu langen lockigen Haare wollten zu der dezenten Aufmachung nicht recht passen. Als wollte er damit signalisieren, dass er nicht bloß Anwalt sei. Er war noch jung damals, einunddreißig Jahre alt, und wirkte so, als habe er ein Recht darauf, dass ihm alles von selbst zuflog. Als bestehe seine Hauptaufgabe darin, das Leben in vollen Zügen auszukosten.
Später stellte sich heraus, dass er auch eine ganz andere Seite hatte. Wenn es nötig war, nahm er in Kauf, was seinesgleichen sonst tunlichst zu vermeiden pflegte. Insgesamt sechsmal haben ihn die Südafrikaner festgenommen. 1987 saß er selbst im Osire Camp ein. Mehr als drei Wochen Einzelhaft in einer verrosteten Eisenhütte. Dass das kein Spaß ist, kann ich aus eigener Erfahrung versichern. Ein kleines Fenster unter dem Dach ließ gerade genug Licht herein, um Tag und Nacht unterscheiden zu können. Die Zellenwände heizten sich tagsüber unerträglich auf, während es nachts bitterkalt wurde. Eine einzige Decke bekam man, und bis auf die Unterhose wurden einem die Kleider weggenommen. Du sitzt da, Tag für Tag, Nacht für Nacht, starrst irgendwohin, fühlst deinen Körper zittern und beben und würdest gern verrückt werden, wenn das nicht genau das wäre, was die Folterknechte beabsichtigen.
Jedenfalls kam Lubowski damals in Osire auf mich zu, blieb stehen. Noch bevor er mich begrüßte, deutete er auf die blauen Flecken in meinem Gesicht und fragte den Aufseher, der unser Gespräch überwachte: «Da ist er wohl gegen eine Tür gelaufen, oder?»
Der Aufseher zögerte, zuckte dann die Achseln.
«Ich hätte gern Namen, Vornamen und Dienstgrad der Tür», sagte Lubowski.
Der Aufseher sagte nichts, aber irgendwie gelang es Lubowski später doch, zwei der Prügler zu identifizieren und bei meinem Prozess vorladen zu lassen. Er setzte ihnen ziemlich zu und konnte nachweisen, dass ich gefoltert worden war. Das vorgefertigte Geständnis, das ich unterzeichnet hatte, war damit wertlos. Zusammen mit dem Alibi, das ich für die Zeit des Attentats hatte, reichte das. Sie mussten mich freisprechen.
Von da an war ich mit Lubowski befreundet, obwohl mir seine Welt weiterhin fremd blieb. Die schicken Anzüge, die Seidenhemden, den blütenweißen Bademantel, in dem er oft noch herumlief, wenn ich morgens bei ihm klingelte. Lubowski war einer, dem der Pool in seinem Garten nicht genügte. Noch kurz vor seinem Tod, als wir alle – er eingeschlossen – zwanzig Stunden am Tag für die Partei arbeiteten, ließ er sich außerdem eine Sauna einrichten. Mit ihm bin ich zum ersten Mal in einem Mercedes gefahren, bei ihm habe ich zum ersten Mal Austern gegessen. Aus Lüderitzbucht, seiner Geburtsstadt. Das seien die besten, hat er gesagt. 1984 trat er dann offiziell in die SWAPO ein. Da er der erste Weiße war, der diesen Schritt tat, war das öffentliche Interesse enorm.
Auch die Parteispitzen leckten sich die Finger. Als lebender Beweis dafür, dass man keine rassischen Partikularinteressen verfolgte, und als Brückenbauer zu liberalen weißen Gruppen war Lubowski unbezahlbar. Entsprechend weit oben stieg er in der Hierarchie ein, flog zur Exilführung in Luanda, war auf internationalen Kongressen und nach Sam Nujoma wahrscheinlich der SWAPO-Vertreter, der am meisten Interviews geben musste. In seinen Kreisen wurde Lubowski als Verräter beschimpft, privat geschnitten, beruflich boykottiert. Nach der dreißigsten anonymen Morddrohung habe er zu zählen aufgehört, sagte er mir ein paar Wochen vor seinem Tod.