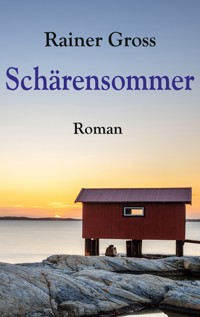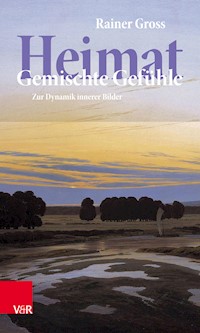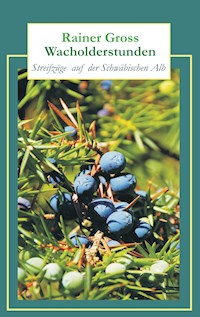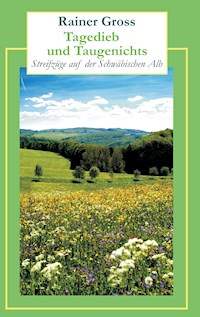Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise durch Irland, um den letzten Geschichtenerzähler zu finden. Eine Reise aus Not, weil da eine Geschichte in Roberts Leben ist, für die er eine neue Sprache braucht, um sie zu erzählen: damals in Kilkee. Unterwegs trifft er Sara, jung und unbeschwert, sie nennt ihn Onkel Brian und er sie Deirdre. Als Onkel und Nichte fahren sie über die Insel, auf den Spuren der Vergangenheit, als wäre weiter nichts zwischen ihnen. In Donegal im Norden werden sie von Eamon eingeladen, der auf Gälisch schreibt und Windhunde züchtet. Gerade dort spuken die Geschichten der Vergangenheit, der IRA, der Verräter und Opfer. Robert versteht das Land und seine Menschen immer tiefer, begreift, dass es mit einer neuen Sprache nicht getan ist. Und er fürchtet, dass er für Deirdre nicht nur der Onkel sein will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Reise durch Irland, um den letzten Geschichtenerzähler zu finden. Eine Reise aus Not, weil da eine Geschichte in Roberts Leben ist, für die er eine neue Sprache braucht, um sie zu erzählen: damals in Kilkee. Unterwegs trifft er Sara, jung und unbeschwert, sie nennt ihn Onkel Brian und er sie Deirdre. Als Onkel und Nichte fahren sie über die Insel, auf den Spuren der Vergangenheit, als wäre weiter nichts zwischen ihnen. In Donegal im Norden werden sie von Eamon eingeladen, der auf Gälisch schreibt und Windhunde züchtet. Gerade dort spuken die Geschichten der Vergangenheit, der IRA, der Verräter und Opfer. Robert versteht das Land und seine Menschen immer tiefer, begreift, dass es mit einer neuen Sprache nicht getan ist. Und er fürchtet, dass er für Deirdre nicht nur der Onkel sein will.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller seit 2014 in Reutlingen.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).
Bei BoD u.a. erschienen: Die Welt meiner Schwestern (2014); Das Glücksversprechen (2014); Yūomo (2014); Haus der Stille (2014); Schrödingers Kätzchen (2015); Drei Tage Wicklow (2015); Haut (2015); Halleluja (2015); My sweet Lord (2016); Holiday (2016).
Inhaltsverzeichnis
a haon: eins
a dó: zwei
a trí: drei
a ceathair: vier
a cúig: fünf
a sé: sechs
a seacht: sieben
a hocht: acht
a naoi: neun
a deich: zehn
a haon déagh: elf
a dó déag: zwölf
a trí déag: dreizehn
a ceathairí déagh: vierzehn
a haon: eins
Swansea. Nachtfähre. Unruhiger Schlaf, auf dem Boden neben der Aufzugstür. Müde Augen, matter Kopf. Auf dem Promenadendeck atmest du frische Luft; Passagiere, die sich ergehen. Blickst du vom Heck aus übers pastellene Meer, nebelduftig, die Sonne kühl und glimmend wie ein Botschafter des Morgens. Sollten Albatrosse aufsteigen von hinter dem Horizont, sollten ein tausendfaches Willkommen geben der Insel. Stattdessen hüllt grauer Nebel das Schiff ein, dumpfe Stille, die Maschinen laufen träge, es dümpelt, wartet. Worauf? Wie weit ist es: Irland?
Da tönt das Nebelhorn. Echo kehrt samtig und einsam zurück.
Wieder Ton, der tragende Ruf übers Wasser.
Wer antwortet?
Wo seid ihr?
Da reißt das Luftlaken auf, wird weggezogen zu einer Theaterbühne: die Küste! Ganz nah Häuser, der Hafen, grüne Hügel. Das Schiff hält auf die Bucht zwischen Bergen zu, ein Schattenloch, der Eingang zur Insel.
Dann fällt das Gespenstertuch wieder über den Morgen, wieder bleckendes Weiß und einsamer Ruf, aber du weißt ja jetzt: Dort liegt es! Dort, unsichtbar.
Du kommst.
Ist es nur eine Frage der Zeit.
Steckst du dir eine Zigarette an und schaust aufs grünschwarze Wasser, so weit es der Nebel gewährt. Spürst du die Unruhe schwinden, die du mitgebracht hast vom Festland. In deinem Wagen liegt das Gepäck bereit seit Langem. Zwei Jahre hast du geforscht, telefoniert, Pläne gemacht, Adressen gesammelt. Hat sie dich unruhig gemacht, deine Mission.
Geheime Mission. Weißt nur du, weshalb du hier bist. Dunkles Gespür, ein Verlangen aus den Tiefen deines Gemüts. Den Wal suchst du, der auf deine Gesänge antwortet, uralte Hymnen, getragen durch die Wasser der Zeit.
Der Rauch zerbläst im Wind. Zupfst du dir die Tabakfäden von der spröden Lippe.
Erste Station: County Kerry. Wirst du von Rosslare aus in ein, zwei Stunden da sein, wirst dich wieder an den Linksverkehr gewöhnen, wie damals: wie vor zehn Jahren. Die Landstraßen haben dir gut getan, die schmalen Sträßchen zwischen Steinmauern und Fuchsienhecken, der raue Asphalt, das Unterwegssein. Ziellos.
Damals.
Heute wirst du nicht ziellos sein. Hast du deine Mission.
Dann ist es Zeit, zum Wagen hinunter zu steigen und das Öffnen des Mauls zu erwarten. Der Wal speit dich aus. Ninive wird begnadigt.
Wirfst du die Zigarette kurzen Bogens ins Meer. Schlägst du den Kragen, mit Kordsamtfutter, deiner Jacke hoch.
Irland hat dich.
Wie damals.
Hinterm Steuer packst du das Lenkrad fester. Ist es immer auf der falschen Seite: In den Innenkurven lugst du in den Straßengraben, in den Außenkurven bist du zu weit weg vom Gegenverkehr. Das macht dich verwegen und übermütig.
Packst du das Steuer fester und pfeifst, schiebst dann eine CD in den Spieler. Capercaillie. Die Fiddel jagt dir Gänsehaut über den Rücken.
Fegst du mit siebzig, achtzig Sachen über die holprigen Boreens, weißt du ja, dass keiner auf die Verbote was gibt.
Erinnerst du dich, wie das war, vor zehn Jahren. Den Weg zu den berühmten Klippen hast du gesucht, nicht auf den Touristenparkplatz, sondern auf Schleichwegen. Autobreit im Irrgarten der Steinmauern, von Schafen bedrängt, bähend und blökend. Hast du den Bauern nach dem Weg gefragt und kein Wort verstanden. Warst du noch gar nicht in der Gaeltacht, gewundert hast du dich. Nachgefragt.
Kein Wort verstanden.
Nachgefragt.
Man muss sich einhören, ganz klar.
Der Bauer hat englisch gesprochen.
Man muss sich einhören.
Zehn Jahre her.
Musst du dich wieder einhören. Sprachübungen zuhause, im Schlafzimmer, immer wieder die breiten, harten, verdunkelten Laute im Kopfhörer, keine Frage, Musha, du hast dazugelernt!
Lachst du jetzt, während Capercaillie dir einen trillert und fetzt, und freust dich geradezu auf den ersten Bauern, die ersten Schafe, den ersten Irrweg.
Hast du ja aber die Straßenkarte, die ist besser als damals, und hast du ein Ziel. Nicht die berühmten Cliffs: eine Adresse in Kenmare.
Hältst du am Straßenrand, auch wenn da kein Platz zum Halten ist. Efeu, verwunschen, lose Steine. Heckenwände so groß wie Häuser. Ist vielleicht ein Haus drunter?
Steigst du aus und über die Mauer. Stehst in einer Weide, enges Geviert, seit Jahrhunderten fest umrissen. Weshalb können Weidegrenzen so lange unverändert bleiben?, fragst du dich.
Du steckst dir eine Zigarette an, betrittst ein Wäldchen und krachst gebückt durchs Unterholz. Eiben, Hasel. Koboldhöhle, hast du dir früher, von Mutter, die Märchengeschichten angehört, die Märchen aus ihrem Land. Früh als Kind hast du gedacht, dass du deine Lust aus Mutters Land hast: die Lust am Erzählen. Am Erfinden, die Zuhörer atemlos, aufgerissene Augen, immer unglaublichere Faseleien, und am Schluss lässt du sie platzen, die schillernden Blasen aus Wörtern.
Mutters Erbe.
Dann hast du erfahren, dass sie gar nicht aus dem Land kommt. Nie dort war. Vater hat sie ausgelacht.
Den Misston hast du noch im Ohr. Der giftige Triumph.
Hat er Mutter immer verachtet, für ihre versonnenen Augen, für ihre Untauglichkeit. Hast du ihm das nie verziehen. Denn du bist Mutters Sohn.
Dann ist sie gestorben.
In der Straßenbahn.
Herzinfarkt.
Vater und du sind geblieben.
Und Mutters Land?
Regnet es wieder. Wird es dir kalt, schlägst du wieder den Kragen hoch, gerade noch Verdeck offen, und jetzt Schauer. Gefällt dir’s Wetter nicht, warte fünf Minuten. Alles Bluff – sagen sie auch in Neuseeland oder auf Guernsey.
Die Zigarette wird nass, einen Zug noch, dann schnippst du die Kippe in die Wiesen.
Kein Vieh im Steinpferch. Ein altes Gattertor, umwuchert von Lichtnelken. Siehst du über den Mauersteinen die Autodächer vorbeiflitzen.
Dir schwant, dass es nicht leicht wird.
Dicke Publuft, rote Nasen und Sarkasmus. Nächte in B&B-Betten mit durchgelegenen Matratzen. Gesichter, Stimmen.
Nein, leicht wird es nicht.
Immer das Ohr aufs Meer hinaus, in die Fanggründe der Wale.
Sirenenklang.
Die Insel hat dich.
Endlich.
Nicht mehr weit bis Kenmare. Die Berge rücken näher. Nein: Steigt die Straße manchmal unmerklich und die Hänge sind von Farn und Ginster bewachsen, rotbraun vom Winter. Schäumende Flüsse, malzbraun, die weiße Gischt lächelt blendend. Dangerous bridge ahead! Einsamer sind die Straßen jetzt, verkehrt man zwischen Dörfern, nicht mehr zwischen den Städten.
Hältst du an einer Bilderbuchbrücke, Steinbogenidyll, gehst die paar Schritte durch Busch und Heide und setzt dich auf die Schieferfelsen, im Atem des Wassers.
Torfbraun. Erinnert dich das an das erste Buch, das du gelesen hast über die Insel. Nicht von einem Iren. Von einem Deutschen. Damals, im Dachzimmer. Büchereiexemplar, lichtrandig, mit einem Haar im Falz. Blond und gekräuselt.
Bleiche Kartoffeln in braunem Wasser, erinnerst du dich. Auf das Wasser freust du dich, modrig duftend in der Blechkanne, auf den ersten Tee heute Abend in der Unterkunft.
Lichtberge in der Ferne. Was soll dich hindern zu bleiben, wenn nicht die jagenden Schauer vom Meer her. Die Augen schließt du, um der Geschwätzigkeit des Wassers zu lauschen.
Nie endendes Gedicht.
Wasser-Ode.
Zieht es unter den Brückenbögen heran, rauscht an den Schnellen, strömt zufrieden talwärts.
Andere halten und drehen an ihren Objektiven. Versteckst du dich hinter deinem Kragen und rauchst wieder. Du stellst dir vor: Hier ein Haus bauen, hier Kinder zeugen, hier allein sein. Begreifst du auf einmal, dass du dein Leben lang nicht mehr allein sein wirst.
Wer, wenn es nicht Gott ist, an den du da glaubst, am Fluss unter der Brücke.
Gott, der Walfänger.
Der Prophetenausschicker.
Schnippst du die Zigarette ins Wasser, als hätte es genug erzählt, stehst auf, kehrst du, im Stillen lächelnd, zum Wagen zurück.
Du mit deiner Mission.
Suchst du einen von deinem Kaliber, nein, aus anderem Holz geschnitzt.
Suchst du einen Alten, Weisen.
Einen Gleichgesinnten.
Um ihn zu retten vor dem Wal?
Oder vor Ninive?
Oder vor Gott?
Die letzte Strecke bringst du hinter dich.
Kenmare, nettes Städtchen. Tourismus, aber kein Disneyland. Pulloverläden, hand-knit, Imbisse mit Fish’n’Chips, eine Bank, ein Geschäft für Mobiltelefone.
Ein schmales Haus in einer Pflastergasse ist deine Adresse. Merkst du dir den Weg und schaust nach einer Unterkunft. B&B, Vorsaison, immer was frei.
a dó: zwei
Ist er jetzt im Krankenhaus, der alte Seamus.
Die Tochter, füllige Irin mit schwarzem Haar und wulstigen Unterlippe, bittet dich herein auf einen Kaffee. Wollte sie dich noch anrufen, aber nicht erreicht. Warst du schon unterwegs.
Ja ja, sagt sie. Der olle Daddy. Jetzt liegt er in Killarney. Seit einer Woche. Geht ihm schlecht, sagt sie und spielt mit dem Löffel, Hirnschlag, leicht zwar, aber er hält wohl nicht mehr lang durch.
Ich hätte ihn sehr gerne kennengelernt, sagst du.
Ja ja, das glaub ich.
Sie verstehst du gut, sie redet verständliches Englisch. Einmal hast du den alten Seamus am Telefon gehabt, und hat dich seine Stimme sofort in den Bann geschlagen. War wie Gesang. Walgesang, genau. Und die Sprache drang ihm aus allen Poren, das gewohnte Selbstgespräch des Irischen mit sich selbst, mit der Insel und den abertausend Jahren Geschichte, mit dem Meer und den Winden der Zeit. Eine Stimme, die es gewohnt ist zu erzählen. Für die jedes Wort eine Note ist und jeder Satz ein Lied. Eine Gänsehaut hast du: Was für Geschichten kann diese Stimme erzählen? Was für fantastische Reiche tauchen in ihr an die Oberfläche? Was für dunkle Geheimnisse birgt ihr Klang?
Da musst du zuhören, hast du gedacht. Diese Geschichten musst du herauf holen, sie müssen ans Licht, sie müssen gehört werden. Hast du das als deine Aufgabe gesehen. Eine Berufung. Ist dadurch der Gedanke an die Suche entstanden, die dich hierher gebracht hat. Und ist der alte Seamus jetzt im Krankenhaus in Killarney.
Denken Sie, wir können ihn einmal besuchen?, fragst du behutsam.
Besuchen ist grad schlecht, sagt sie und knabbert an einem der Kekse, die sie auf einem Teller mit Rosenmuster dazu gestellt hat. Im Moment. Ich ruf jeden Tag an und frag, aber sie haben was dagegen. Obwohl es ihm jetzt gut täte, wenn er vertraute Gesichter um sich hätte. Aber vielleicht ist er eh nicht bei sich.
Du lässt dir noch einmal erklären, was er gemacht hat mit seiner Stimme. Den Enkeln Gutenachtgeschichten erzählt, die sind auf Opa ganz scharf, sagt sie. Mitgesungen bei den zwei Musikern, die in der Umgegend in Pubs singen. Einmal im Jahr zur Folkwoche nach Killarney. Saß er im Hintergrund mit der Ziehharmonika und hat den Chor gemacht. Und die Ansagen. Klein, zusammengesunken mit seiner Mütze auf dem Kopf in der hitzigsten Wirtshausluft, einem schmalen Mund, der immer ironisch lächelte, und zu den Liedtiteln eine Anekdote erzählt oder einen Witz über das Publikum gemacht. Für ihn gab es kein Publikum. Waren das einfach Leute, Leute, die er kannte oder auch nicht. Fremde sind ja nur Freunde, die man noch nicht kennt, zitiert sie ihn.
Geschrieben hat er nie. Nur Briefe, früher viele, an Maureen, seine Frau, die Oma. Die ist schon vor zwanzig Jahren gestorben. Schreib doch mal deine Memoiren, habe ich ihm gesagt, erzählt die Tochter, aber vom Schreiben hat er nicht viel gehalten. In den Wind gesprochen, vom Wind zerstoben, war so ein Spruch von ihm. So soll’s sein. Was ist das, wenn Worte dauern über das Leben des Sprechers hinweg, in anderen Generationen, in eine andere Zeit hinein, die nichts mehr weiß und wissen will? Sagt Seamus.
Und jetzt ich, sagst du, der aus Deutschland kommt und seine Stimme mitnehmen will, auf Band, hinüber tragen in ein anderes Leben, eine ganz andere Sprache.
Schaut sie dich fragend an.
Walgesänge, sagst du und grinst.
Ich schenke Ihnen noch Kaffee ein, sagt sie. Ihre Tasse ist leer.
Du hast beschlossen zu warten. Auf die Gelegenheit, ihn doch noch zu sehen. Zwei Tage, drei Tage in Kenmare. Hast du beschlossen, jeden Tag Pansy anzurufen, seine Tochter. Sympathische Frau. Hast du sie geneckt mit ihrem Namen, weil du ihn für einen Spitznamen gehalten hast. Stiefmütterchen. Still und fröhlich blüht sie vor sich hin, mit den Kindern, mit dem Mann, der in Killarney arbeitet bei einer IT-Firma. Pansy. Auf ihren Anruf wartest du, dass sie sagt: Kommen Sie mit, ich fahre ins Krankenhaus.
Deine Ausrüstung wirst du nicht brauchen: Mikrophon, Recorder, Laptop, um seine Stimme aufzuzeichnen. Nicht im Krankenhaus. Aber ihm begegnen willst du, dem alten Seamus, ihn einmal gesprochen, ihn gesehen haben. Vielleicht einen der alten Geschichtenerzähler.
Im B&B ist dir kalt. Die Heizung aufdrehen nützt nichts. Im Bad stehst du barfuß und zögerst. Dann ziehst du dich aus und lässt Wasser ein, viel vom linken Hahn, wenig vom rechten. Das Wasser rauscht und dampft und ist leicht goldbraun.
Setzt du dich in die flache Wanne und drückst etwas von deinem Duschgel aus der Flasche. Es schäumt und duftet. Legst du dich zurück mit dem Rücken auf das kalte Porzellan, schließt die Augen, spürst die Hitze nadeln in den Beinen und Armen.
Ruhe.
Draußen der Regen, gischtender Verkehr.
Eine Stimme im Haus, die Wirtin. Spricht mit ihrem Mann am Telefon, lernst du ihn vielleicht kennen später in der Küche, am Abend, hast du Lust, Leute kennenzulernen, deshalb bist du hier.
Zehn Jahre.
Auf der Suche nach dem Feenland der Mutter, damals. Wunder, Märchen, Zauberkreis. Wandern über die Grashügel, unten das Meer, Schafe weit entfernt und weichen sie dir aus, wenn du näher kommst. In Pubs sitzen und die alten Männer Märchen erzählen hören, so hast du dir das vorgestellt. Gefunden hast du anderes.
Nach dem Bad ist dir warm. Rubbelst du dir die Haare mit dem Handtuch, vor dem beschlagenen Spiegel mit Föhn und Kamm. Frische Kleider.
Dann einen Tee. Hast du dir auf der Fähre einen Blechkanister mit Beuteln gekauft, Pyramidenbeuteln, wenn du öffnest und die Nase hineinhängst: ein dunkler, malziger Duft nach Wohlbehagen.
Füllst du das kochende Wasser in die Blechkanne, fluppen die Beutel luftprall unterm Wasserguss nach oben. Der Deckel klappert. Nimmst du die Kanne mit hinaus vor die Tür. Einen Lieblingsplatz hast du entdeckt, auf der Bank vor dem Haus, mit der Teekanne auf dem Fenstersims und der Tasse in der Hand. Kommt herangetrottet ein Hund aus der Nachbarschaft, Sam heißt er, ein Bassett mit traurigen Augen. Setzt er sich neben dich, kraulst du ihm die Ohren, und schaut ihr beide in den Abend hinein und den Leuten zu, die vorbei kommen, den Autos, die unterwegs sind.
Einmal hält ein Wagen und steigt der Fahrer aus. Trifft er einen auf der Straße und hält ein Schwätzchen mit ihm. Sam steht auf und trottet hinüber, sie kennen und streicheln ihn. Dann kommt er zurück. Der Fahrer schaut ihm nach, sieht dich und hebt grüßend die Hand.
Enjoy yourself.
Nachts, im Bett, die Matratze zu weich und die Decke zu dünn, leuchtet von draußen Straßenlicht herein.
Erste Nacht auf der Insel.
Dünne Gedanken, flatterhaft.
Das Große an deinem Hiersein kannst du nicht fassen.
Drehst du dich im Bett wie die Tür in der Angel.
Dann, zwischen wunderlichen Bildern von der See und Klippen und wartenden Booten, kommt Schlaf.
Schüttet es. Die Straße schwimmt. Unterm Schirm flüchtest du ins nächste Geschäft. Regenjacken, Holzfällerhemden, T-Shirts mit Shamrockaufnähern. Gedämpfte Stille, gehst du durch die Reihen der Regale, fühlst du den Stoff: Wolle. Schurwolle. Schafwolle, unbehandelt, mit den öligen, drahtigen Fasern. Daher die Stille: von all den Pullovern.
Dir haben solche Pullover immer gefallen, und hast du vor zehn Jahren einen mitgebracht. Den hast du jetzt nicht dabei. Kühler auf der Insel als erwartet. Schaust du dich um. Wenige Leute im Laden wegen des Wetters. Tagestouristen, lächelnde Verkäuferin.
Riecht es streng, feucht nach Tieren und Stall. Die Pullover kommen von den Aran-Inseln. Fischerpullover, warm und dicht gegen Wind und Wetter. Jede Familie hat ihr eigenes Muster, wird dir erklärt, eingewoben Segen für Gesundheit, Gewinn oder Glück. Oder um die Leichen zu identifizieren nach Wochen im Salzwasser. Hoffst du, nicht auch im Salzwasser zu enden, wenn du einen Sweater kaufst. Schaust du dir einige an. Muster gefallen dir wenige. Gibt es dichte und loser gestrickte.
Welche Größe?, fragt das irische Mädchen und hält dir einen hin. Dürfte passen, sagt sie.
Ich mag sie fälliger, sagst du, aber die Vokabel fehlt dir. Sagst du: größer
In Natur? Oder in Weiß?
Natur.
Ziehst du einen über, nachdem du die Jacke abgelegt hast. Begehrtes Prädikat, siehst du am Etikett: handknit. Handgestrickt. Nur vierzig Euro, Angebot, Touristen aus Übersee zahlen zollfrei. Auf den Etiketten liest du die kleinen Geschichten irischer Heimarbeit: This garment has been handknitted by me in my own house, und darunter, in weiblichen Handschriften: Sheila O’Shea, Mary Broderick, Eileen O’Sullivan.
Aus der Hand einer Hausfrau, denkst du. Was hat sie dabei gedacht, beim Stricken? Was für ein Heim war das? Fischerheim auf den Aran-Inseln, trübe Beleuchtung, dunkle Tage? Was für Frauen, was für Familien, welche Lebensgeschichten? Sollte man schon deshalb die Pullover kaufen?
Sie sehen damit aus wie ein Ire, sagt es deutsch neben dir.
Drehst du dich um und entdeckst ein schmales Mädchen, schwarzhaarige Mähne, die dich sonderbar mustert.
Woher wissen Sie, dass ich Deutscher bin?, entgegnest du.
Sie führen Selbstgespräche, antwortet sie. Auf Deutsch.
Im Ernst, sagt sie. Sie sehen aus wie ein Ire. Richtig einheimisch.
Und Sie, sagst du und schaust sie an, von oben bis unten. Sie sehen auch nicht aus wie eine Touristin.
Sondern?
Sie könnten ein Abkömmling jener Spanier sein, die mit der Armada vor Irland Schiffbruch erlitten.
Das ist doch ein Märchen! Sie lacht.
Gewiss nicht. Sie könnten Deirdre heißen, sagst du und wunderst dich nicht über das warme Gefühl, das in dir hochsteigt. Deirdre O’Mara. Das würde passen.
Sie haben recht, sagt sie und wundert sich auch nicht.
Womit?
Meine Mutter war Irin. Ich heiße Sara, Sara Brendel.
Nimmst du ihre Hand, so eine schmale, zierliche Mädchenhand mit festem Griff, und schüttelst sie.
Robert Dellwing. Auch meine Mutter war Irin.
Und wie du das sagst und es heraus ist, wird es endlich Wirklichkeit. Ja, deine Mutter war Irin, und du bist hier in deiner Mutter Heimat und forschst auf ihren Spuren.
Verlegen werdet ihr wegen eurer Förmlichkeit und lacht.
Im Ernst, sagt sie. Nehmen Sie den Pullover, er steht Ihnen. Sie sehen darin sehr Vertrauen erweckend aus. Distinguiert, wenn Sie verstehen, was ich meine. Fehlt nur noch Pfeife und Buch.
Musst du grinsen. Die Kleine geht auf dich zu, das bist du nicht mehr gewohnt seit zwanzig Jahren. Hat einen guten Riecher. Willst du mehr wissen über sie und sie mehr von dir. Nicht hier, im Laden, im Stallgeruch.
Lässt du dir den Pullover einpacken und gibst die Scheine. Kassenklingeln, elektronisch. Kleine bedruckte Quittung rattert aus dem Drucker.
Lassen Sie uns irgendwo was trinken gehen, sagst du. Haben Sie Zeit?
Und Sie?
Ich habe hier Quartier für ein paar Tage. Warte auf einen alten Mann im Krankenhaus.
Und sonst? Was machen Sie hier in Irland?
Ich bin auf der Suche, sagst du.
Wonach?
Gefällt dir ihre Neugier und beschließt du, geheimnisvoll zu sein.
Nach dem Gesang eines Wals.
Nickt sie nur.
Ich mache hier meine Abschlussarbeit an der Hochschule in Berlin. Fotografie, wissen Sie. Ich nehme mir ein paar Tage hier unten, dann will ich in den Norden. Nach Derry.
Londonderry?
Derry.
Verstehe.
Ich will die Bogside dokumentieren. Was von den Unruhen geblieben ist. Das Straßenleben. Den Alltag. Die Graffiti an den Wänden. Die Schulkinder. So was. Daraus mache ich meine Abschlussarbeit.
Dass du einen Weg hinauf nach Connemara hast und sie mitnehmen könntest, verschweigst du. Geht zu schnell. Erst einmal in einem Café zum Erzählen und Zuhören kommen. Bist du ja Spezialist fürs Geschichtenerzählen.
Ein Café findet ihr, nett und ein bisschen kitschig, aber es gibt heiße Getränke und Gebäck. Sie nimmt einen Cappuccino, du einen Tee. Gehen draußen wahre Fluten nieder.
Es regnet gerade viel, sagt sie, den Blick nach draußen gewandt. Hast du Gelegenheit, ihr Profil zu betrachten. Stupsnase, sogar Sommersprossen, zierliches Kinn mit Halsfalte, rundes Gesicht, zarte Augenbrauen, aber dunkel, die Wimpern leuchten im Regenlicht.
Traust du dich nicht, sie Sara zu nennen. Sagst du: Deirdre.
Deirdre, Sie sehen so melancholisch aus.
Ich?
Wie Sie da aus dem Fenster schauen.
Sie lächelt abwesend. Nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee.
Wenn ich’s recht überlege, sagt sie, bin ich auch auf der Suche. Und wenn ich’s recht überlege, habe ich gefunden, was ich gesucht habe.
Jetzt, denkst du, wäre Unverbindliches über Irland zu sagen. Vielleicht gelingt es dir, die Unterhaltung auf irische Kunst, auf Steinkreuze und Lindisfarne und das Book of Kells zu lenken.
Nach einer Stunde landet ihr bei Yeats, und staunend hörst du sie von den taubengrauen Sanden sprechen und jenem Leid jenseits von Worten, das du selbst einmal in einem irischen Pub rezitiert hast, aufgestanden und mit lauter Stimme rezitiert, hat das niemanden gekümmert, hat man dir höflich zugehört und ist der Betrieb danach einfach weitergegangen, an einem Tisch mit den jungen Studenten, damals, vor zehn Jahren.
Ein Leid jenseits von Worten, sagst du und bist ergriffen von deiner alten Leidenschaft für Bücher, – denkst du, das gibt es?
Ja.
Und hast du so ein Leid schon erlebt?
Ja.
Wie kommt es dann, dass der Dichter es in Worte fasst? Dass wir uns darüber unterhalten können?
Das tun wir nicht, sagt sie. Er hat uns nur ein Zeichen gegeben, einen Platzhalter für unsere Erfahrungen. Sein Leid ist namenlos.
Denkst du, dass nicht der Name zum Leid gehört? Dass man die Geschichte nicht ohne Namen erzählen kann?