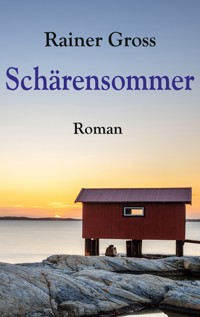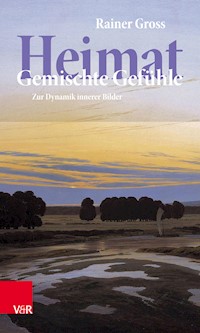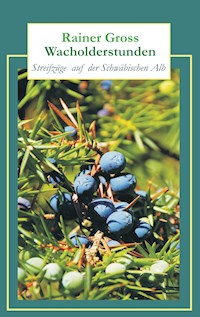Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Zeiten der Corona-Pandemie ist die zunehmende Vereinsamung in der Gesellschaft in den Mittelpunkt politischer und medialer Debatten gerückt. Rainer Gross beleuchtet dieses Thema aus soziologischer, psychologischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive und beantwortet die Frage, wie es im Zeitalter von Lockdowns, sozialen Netzwerken und zunehmender Entfremdung um unser soziales Gefüge bestellt ist. Mit fundiertem Fachwissen und kulturwissenschaftlichen Exkursen, sei es zu Jean-Jacques Rousseau, Hermann Melville bis hin zu den Beatles oder Game of Thrones, werden die vielen Facetten des Allein- und Zusammenseins anschaulich dargestellt. Das Buch ist nicht nur ein Wegweiser durch die Krise, sondern auch ein Plädoyer für mehr Solidarität und Toleranz sich selbst, aber auch anderen gegenüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Gross
ALLEIN ODER EINSAM?
Die Angst vor der Einsamkeit und die Fähigkeit zumAlleinsein
Böhlau Verlag Wien Köln
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021 Böhlau Verlag, Zeltgasse 1/6a, A-1080 Wien,
ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden,
Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Lektorat: Vera M. Schirl Umschlagsgestaltung: Michael Haderer, Wien Layout: Bettina Waringer, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage |www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-21397-0
Wir wissen wenig voneinander. Wir sind Dickhäuter, wir strecken die Hände nacheinander aus, aber es ist vergebliche Mühe, wir reiben nur das grobe Leder aneinander ab – wir sind sehr einsam.
Georg Büchner
All the lonely people – where do they all come from?
Paul McCartney
In der Folge gellte von jemand ein wiederholtes „Ich bin allein!“ Das erste Mal ein Schluchzen, das zweite Mal ein Triumphgeheul.
Peter Handke
Inhalt
Einleitung
Im Jahr der Pandemie: Wie gefährlich ist Einsamkeit wirklich? (Mediale vs. sozialwissenschaftliche und medizinisch-psychiatrische Positionen)
Soziologie und Statistik: Die Außenperspektive
Zwischen Innen und Außen: Einsamkeit als soziales Problem und/oder als psychische Krankheit?
Die Innenperspektive: Welche Faktoren fördern oder verhindern Einsamkeit?
Anmerkungen zur Einsamkeit im Lockdown
I. Außenperspektiven
Gibt es wirklich eine loneliness epidemic?
Die japanische Extremvariante des sozialen Rückzugs: Hikikomori
Korea: Der Honjok-Lebensstil: Allein oder doch einsam?
Der Blick auf die Einsamkeit – zwischen Idealisierung und Entwertung
Odo Marquard: Plädoyer für die Einsamkeitsfähigkeit
Anthony Storr: Einsamkeit als Basis für Kreativität
Alice Koller: The Stations of Solitude
Sara Maitland/How to Be Alone
Unterschiedliche Arten von Einsamkeit?
Einsamkeit und Vertrauen: Angst vor Abhängigkeit als Einsamkeitsrisiko?
Vertrauen und Enttäuschung in der Psychotherapie
Exklusion – die soziale Komponente der Einsamkeit?
Soziale Isolierung
II. Zwischen Außen und Innen: Einsamkeit und Identitätskonstruktion
Die Kulturgeschichte der Einsamkeit im Schnelldurchlauf
Einsamkeit und soziale Medien
Entfremdung/Resonanz/Einsamkeit
Einsamkeit und Identitätskonstruktion: Konzepte der Stärke und Schwäche
Alleinsein im Kontext eines starken Selbstbildes
Gemeinsam statt einsam: Ist das immer die bessere Option?
Globalisierung vs. Isolationismus: Die politische Dimension von Alleinsein
Mikroerlebnisse von Einsamkeit im Alltag
Im Schlaf ist jeder allein – in der Schlaflosigkeit fast jeder einsam
Einsamkeitsgeneratoren
III. Innenansichten der Einsamkeit
Psychische Erkrankungen und Einsamkeit
Separation anxiety disorder: Trennungsangststörung im Erwachsenenalter
Soziale Phobie: Einsamkeit als Folge von aktiver Kontaktvermeidung
Ein „Tsunami an Einsamkeit und Depressionen“ als Folge von Corona?
Drei Ebenen unserer Persönlichkeit/Identität
Jeder hält sich selbst für normal – die anderen aber
Soziale Genussfähigkeit
Psychoanalytische Positionen zur Trennungsangst/Angst vor dem Alleinsein
Trennungsangst bei S. Freud
Melanie Klein
Blicke auf uns: Glanz im Mutterauge oder Angst vor Verurteilung?
Alleinsein in Gegenwart eines anderen: Donald W. Winnicott und die Fähigkeit zum Alleinsein
Incommunicado: Der innerste Kern des Selbst muss allein bleiben
Die begabten Kinder der „toten“ Mutter
André Green: Die tote Mutter
Mit einem Buch bist du nie allein: Zwischen der Isolation des Lesers und seiner Kunst, mit Abwesenden zu reden
Die Suche nach dem Kompromiss zwischen Verschmelzung und Isolation
„Der ist ja nur einsam …“ – Einsamkeit und Psychotherapie
IV. Coda
Plädoyer für „hinlänglich gute“ Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Menschen
Plädoyer für Solidarität
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Nachweis der Motti (S. 5)
Einleitung
Jeder Mensch wünscht sich glückliche Beziehungen, will aber wohl auch mit sich selbst allein sein können, ohne sich dabei verlassen oder einsam zu fühlen. Diese Fähigkeit zum befriedigenden Alleinsein ist ein zentrales Therapieziel aller psychotherapeutischen Schulen und wird in unserer Zeit der Reizüberflutung als wichtige Voraussetzung für ein gelingendes Leben hochgeschätzt. Sichtlich aber verfügen nicht alle über diese emotionale und soziale Kompetenz: Wir lesen immer mehr über die wachsende Zahl jener Menschen, die sich einsam fühlen oder Angst davor haben, speziell im Alter zu vereinsamen. Bei Eingabe der Begriffe loneliness und epidemic erzielt man viele Tausende Treffer im Internet – inklusive zahlreicher dramatischer Warnungen vor einer loneliness epidemic in den reichen westlichen Staaten der EU und in den USA. Leben wir wirklich schon in einer „Kultur der Einsamkeit“? Haben wir diese selbst durch die Leitwerte des Neoliberalismus unfreiwillig gefördert? Wodurch entscheidet sich, wer allein mit sich zufrieden sein kann und wer nicht? Bedeutet Einsamkeit nur einen Zustand des nicht selbstgewählten Alleinseins? Wovon also sprechen wir, wenn wir vom Alleinsein oder aber von der Einsamkeit sprechen?
Im Jahr der Pandemie: Wie gefährlich ist Einsamkeit wirklich? (Mediale vs. sozialwissenschaftliche und medizinisch-psychiatrische Positionen)
Soziologie und Statistik: Die Außenperspektive
Schon wenige Minuten der Recherche im Internet liefern eine Vielzahl an statistischen Daten zum Beleg der zunehmenden Einsamkeitsepidemie und der Angst davor: In den meisten Studien wird Einsamkeit hier definiert als „keinen Menschen zu haben, an den man sich in Notsituationen um Hilfe wenden kann“. (Siehe Simmank 2020 – auch für die Zahlen dieses Kapitels.) Die folgenden Zahlen zum Thema sind großteils noch vor Beginn der Corona-Epidemie erhoben worden. Wie weit sie durch die Bedingungen der Pandemie noch erhöht wurden, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand verlässlich sagen.
In den USA fühlt sich demnach jeder dritte ältere Amerikaner einsam, in der EU immerhin sechs Prozent aller Europäerinnen. Innerhalb der EU gibt es allerdings große Unterschiede mit 17 Prozent einsamer Menschen in Frankreich, 13 Prozent in Italien, nur vier Prozent hingegen in Österreich, in Ungarn gar nur zwei Prozent.
Jeder dritte Haushalt im EU-Bereich ist ein Single-Haushalt, in Skandinavien sind sogar mehr als 50 Prozent der Haushalte von nur einer Person bewohnt. 40 Prozent dieser Singles wiederum sind EU-weit älter als 65 Jahre. Jeder Dritte von ihnen ist von Armut bedroht. In Österreich haben sich die Single-Haushalte bei den Männern zwischen 1971 und 2017 fast verdreifacht, fast jede fünfte Frau lebt bereits als Single.
In vielen Studien werden die Anzahl der Single-Haushalte und die Zahl der einsamen Menschen de facto gleichgesetzt. Bei dem Versuch eines statistischen Fazits durch die wissenschaftlich seriöse Website Our World in Data der Universität Oxford allerdings ergab sich ein anderes Bild: Die Zahl jener Menschen, die sich einsam fühlen, ist in den letzten zehn Jahren in der EU und auch in den USA in etwa gleich geblieben. Gestiegen ist die Zahl der Einsamen oder Einsamkeitsgefährdeten nur bei den Jüngeren. Trotz Zunahme der Single-Haushalte betonen Soziologinnen, dass die Zahl der Allein-Lebenden nicht verantwortlich sei für die Zunahme an Einsamkeit: Vielmehr steige die Zahl derer, die unter einem subjektiv erlebten Mangel an sozialer Unterstützung und dadurch unter dem Gefühl der Einsamkeit leiden würden. (Siehe Simmank 2020) Kleine Zwischenbilanz also: Einsamkeit ist weniger an der Zahl meiner Mitbewohner abzulesen als am subjektiven Gefühl eines emotionalen Mangels. Kein Wunder, dass durch die COVID-bedingten Einschränkungen ein solcher Mangel bei vielen Menschen „überschwellig“ wurde, also bereits Probleme bzw. Symptome auslöst.
Zwischen Innen und Außen: Einsamkeit als soziales Problem und/oder als psychische Krankheit?
Schon seit Beginn der Moderne zählt die Einsamkeit für viele Soziologen und Sozialphilosophinnen zu den Insignien des modernen Individuums. Dafür gibt es unzählbare philosophische und literarische Beispiele von Nietzsches Zarathustra über Jean-Paul Sartres Ekel bis zu Karl Ove Knausgård. Diese oft fast kokette Selbstbeschreibung der Intellektuellen wurde spätestens in der Ära des Existentialismus populär und damals auch als Erklärung für diverse gesellschaftliche Fehlentwicklungen herangezogen.
Heute aber wird Einsamkeit in den USA wie auch in Europa primär als sozialpolitisches Problem empfunden: In Großbritannien gibt es bereits eine Staatssekretärin für (oder wohl eher: gegen) Einsamkeit – im Rahmen des Ministeriums für Sport, Familie, Zivilgesellschaft und Einsamkeit. In London und auch in Berlin gibt es bereits einen „Einsamkeitsnotruf“ („Silver Line“ bzw. „Silbernetz“). Für Wien kündigte die Caritas eine solche Notrufnummer an. Wie bei so vielen anderen sozialen Problemlagen wurde auch hier durch die Corona-Pandemie eine bereits bestehende Mangelsituation noch verschärft.
Aber wie bei so vielen anderen Problemen droht auch hier die Individualisierung und die Pathologisierung einer sozialen Notlage, also deren Umdeutung zum medizinischen Problem: Die Konjunktur der Warnungen vor einer Einsamkeitsepidemie in den Medien ist auch dadurch bedingt, dass ein chronisches Gefühl von Einsamkeit das Risiko nicht nur für psychische, sondern auch für somatische Erkrankungen nachweislich erhöht – und damit die Gesamtkosten des Gesundheitssystems.
Einsame Menschen kontaktieren und beanspruchen das Gesundheitssystem häufiger als andere. Davon kann man sich in jeder Ordination eines praktischen Arztes überzeugen. Eine Metastudie zum Thema untersuchte die Beziehung zwischen Einsamkeit und körperlicher Gesundheit mit dem Resultat, dass Einsamkeit als starker Mortalitätsprädiktor bezeichnet wird: Der negative Effekt der Einsamkeit auf das Sterblichkeitsrisiko sei sogar gleich hoch wie das Risiko eines Menschen, der täglich 10–15 Zigaretten raucht oder aber mehr als 10 kg Übergewicht mit sich herumschleppt und dabei noch körperlich inaktiv ist. Einsamkeit scheine insgesamt den Alterungsprozess zu beschleunigen. (Holt-Lunstad, zitiert nach Simmank, S. 46)
Daher warnte der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer 2018 vor der Einsamkeit als „unerkannter Krankheit“:
Stellen Sie sich vor, es gebe eine Krankheit, die hierzulande immer häufiger auftritt und chronische Schmerzen verursacht, eine ansteckende, von der medizinischen Wissenschaft noch kaum erforschte Krankheit […] Sie wäre tückisch, denn viele Betroffene wüssten gar nicht, dass sie an ihr leiden. Diese Krankheit gibt es tatsächlich. Ihr Name: Einsamkeit. (Manfred Spitzer, S. 9)
Einsamkeit zählt noch nicht zu den psychiatrischen Diagnosen; es werden uns auch keine „Anti-Einsamkeitsdrogen“ angeboten, zumindest noch nicht.
Es gibt allerdings einen übereinstimmenden und auf den ersten Blick verblüffenden Befund der Sozialpsychologie: Das subjektiv erlebte Gefühl der Einsamkeit korreliert NICHT mit der Anzahl der Sozialkontakte eines Menschen, auch nicht mit dem Ausmaß der für ihn verfügbaren realen sozialen Unterstützung.
Sehr wohl allerdings korreliert das Einsamkeitsrisiko mit der Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen und mit ihrer Erwartungshaltung an die von ihnen ersehnten Beziehungen: Sowohl ein niedriges Ausmaß an Vertrauen in andere Menschen als auch ein hoher „sozialer Perfektionismus“ (also ein Wunsch nach idealen zwischenmenschlichen Beziehungen) können das Einsamkeitsrisiko erhöhen. Es gibt sogar Hinweise auf einen biologisch-hereditären Faktor im Sinne eines Mangels an Rezeptoren für das „Glückshormon“ Oxytocin.
Komplizierend kommt noch hinzu, dass viele Betroffene ihr Gefühl der Einsamkeit dann als besonders schmerzlich erleben, wenn sie von Familienmitgliedern oder Freunden umgeben sind. Insgesamt scheinen einsame Menschen andere zu fürchten und ihnen zu misstrauen, während sie sich gleichzeitig trotzdem nach Beziehungen sehnen.
Eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen von Alleinsein und Einsamkeit ist daher wichtig:
•Die Frage, ob ein Mensch ALLEIN ist, ist quantifizierbar und daher „objektiv“ durch die Anzahl seiner Sozialkontakte in einem vorgegebenen Zeitraum zu beantworten. Dieses Faktum des Alleinseins kann aber positiv oder negativ besetzt sein: Man kann sich allein durchaus zufrieden oder sogar glücklich fühlen, jedoch auch zutiefst unglücklich und einsam.
•Das Gefühl der EINSAMKEIT hingegen ist eine Emotion und meist negativ besetzt.
•In der Formulierung des Sozialphilosophen Svendsen bedeutet Alleinsein „mit sich selbst zusammen sein“, Einsamkeit hingegen bedeutet „allein sein mit sich selbst“. Die satirisch-zynische Definition von Einsamkeit stammt schon aus dem 20. Jahrhundert von Ambrose Bierce: „Alone. In bad company!“
Die Innenperspektive: Welche Faktoren fördern oder verhindern Einsamkeit?
Selten sind sich die Psychoanalyse, die Säuglingsbeobachtung, die Neurowissenschaften und die Bindungsforschung so einig wie in diesem Punkt:
Die Basis für unsere capacity to be alone (Winnicott 1958) oder aber für eine fear of loneliness (Winnicott 1958) wird in den ersten Jahren unseres Lebens gelegt. Wie leicht und oft dann durch Erlebnisse von Trennung im späteren Leben und auch beim Erwachsenen diese frühen Erfahrungen von Einsamkeit oder Sicherheit, von Gehaltenwerden oder aber Verlassenwerden wieder reaktiviert werden, davon kann man sich in fast jeder Psychotherapie überzeugen.
Es geht aber nicht nur um die realen Erfahrungen, mindestens ebenso wichtig sind deren innere Verarbeitung, die inneren Bilder von einer „guten“ Beziehung und die subjektiven Konzepte von Autonomie und Bindungsfähigkeit: Wenn im Idealfall ein Kleinkind das Glück hat, nach einer ausreichend langen und sicheren symbiotischen Phase, in der ihm die Mutter ganz zur Verfügung gestanden ist, dann von seinen Eltern auch noch zum Hinausgehen in die Welt, zur Entwicklung seiner Autonomie ermutigt zu werden – wenn das Baby also den Übergang von der sicheren, aber entwicklungsbegrenzenden Dyade in die Autonomie schafft –, dann (aus Sicht der Psychoanalyse: nur dann!) hat es die so wichtige Fähigkeit zum Alleinsein erworben. Diese Ressource wird ihm das gesamte künftige Leben erleichtern. Alleinsein ohne allzu große Angst ist auch eine wichtige Voraussetzung der Symbolisierungsfähigkeit: Sie ermöglicht es dem Menschen, auch für abwesende wichtige bzw. geliebte Menschen („Objekte“) innere Bilder in seiner Seele (sogenannte Objektrepräsentanzen) zu bilden und im Gedächtnis zu behalten. Das wiederum macht es leichter, die Abwesenheit des Objektes und damit das Alleinsein zu ertragen.
Sehr viele Psychotherapiepatientinnen besitzen diese Fähigkeit leider nicht in ausreichendem Maß: Sie können nur schwer allein sein, ohne sich dabei einsam zu fühlen. Gleichzeitig aber scheuen sie oft intensive oder intime Beziehungen, weil sie Angst vor Abhängigkeit und Autonomieverlust haben. Im Idealfall können sie in der Therapie wie in einer Laborsituation eine sicherheitgebende Beziehung erleben, die sie nicht einengt. Psychoanalyse bedeutet ja nichts anderes, als allein zu sein in der Gegenwart eines anderen.
Neben dieser individuellen entwicklungspsychologischen Komponente gibt es allerdings auch einen sozialen, ja sozialpolitischen Aspekt des Problems: Der aktuelle neoliberale Zeitgeist propagiert ein Konzept der forcierten Autonomie bis hin zu einer emotionalen Autarkie: Jeder soll sein eigener Herr sein, ausschließlich rational für sich selbst entscheiden. Er ist dann allerdings auch ganz allein verantwortlich für sein Wohlergehen.
Daher das individualistische Credo: Ich brauche niemanden, ich bin von niemandem abhängig. Ich verweigere jegliche Abhängigkeit. Falls ich sie spüre, muss ich sie als Schwäche empfinden und deshalb verleugnen.
Menschen mit einem solchen Selbstbild kommen heute meist erst dann zum Therapeuten, wenn sie sich in Krisensituationen dafür schämen, diese forcierte Autonomie-Position nicht mehr durchhalten zu können. Auslöser kann eine Trennung sein, der Verlust eines Arbeitsplatzes oder aber die Angst vor dem Nachlassen der Kräfte im Alter. Solche Situationen werden als hochgradig beschämend erlebt.
Ein so überdehntes Autonomie-Konzept ist eindeutig narzisstisch und schon deshalb einsamkeitsgenerierend: Sowohl Beziehungswünsche als auch die Möglichkeit solidarischen Fühlens und Handelns müssen dadurch vernachlässigt werden.
Auch die Frage, wie weit das Gefühl der Einsamkeit fast unweigerlich auch die Entfremdung von sich selbst inkludiert, spielt hier eine Rolle. Aus der eigenen Pubertät und Adoleszenz kennen fast alle Menschen ein solches Gefühl: Die Vorstellung, anders als alle anderen zu sein, zwar einzigartig, dadurch aber auch unverstanden und allein.
Es ist oft schwer zu entscheiden, wann der gesunde Wunsch nach Autonomie und zufriedenem Allein-Sein-Können durch den aktuellen Zeitgeist allzu stark forciert wird. Gleichzeitig wird unsere Furcht vor Einsamkeit noch durch das Stigma des „Losers“ verstärkt, der dem Idealbild des glücklichen, souveränen Menschen nicht genügen kann. Hier stehen soziale Faktoren in der Genese dieser Ängste vor Einsamkeit den intrapsychischen Faktoren aus unserer Biografie gegenüber. Gerade die Interdependenz dieser äußeren und inneren Faktoren bei der schwierigen Balance zwischen Fähigkeit zum Alleinsein und Angst vor Einsamkeit sind Thema dieses Buches.
Die theoretischen Ausführungen werden dabei immer wieder unterbrochen durch Fallbeispiele: Es sind Biografien von realen Personen aus der Geschichte, meist aber sind es imaginäre Figuren: Denn auch unsere positiven oder negativen Bilder von Einsamkeit werden beeinflusst von Gestalten aus der Fiktion, von Beziehungen in Büchern, Filmen und Liedern: Vom lonesome hero bis zum soulmate, von Platon bis zu den Beatles, ja bis zu Game of Thrones und Twilight – aus Kultur und Populärkultur kann man viel erfahren über die Sehnsucht der Menschen nach Autonomie und auch über ihre Angst vor der Einsamkeit.
Aber Einsamkeit ist kein Schicksal, auch einsame Menschen müssen nicht einsam bleiben. Sie können sowohl wieder zu befriedigenden Beziehungen fähig werden als auch zum sinnstiftenden sozialen Handeln. Für beide Auswege aus der Einsamkeit hoffe ich, Anregungen bieten zu können.
Auch wenn ich zutiefst davon überzeugt bin, dass meine Einsamkeit ausschließlich die Folge äußerer Faktoren ist, dass ich ausgegrenzt, zu wenig beachtet oder wertgeschätzt werde; auch dann kann ich nicht darauf vertrauen, dass mein soziales Umfeld oder das sozialpolitische Klima sich meinen Wünschen entsprechend ändert: Bei aller oft auch berechtigten Verbitterung wird es mir nicht erspart bleiben, zumindest die ersten Schritte hinaus aus der Einsamkeit selbst zu gehen.
Anmerkungen zur Einsamkeit im Lockdown
Als Psychoanalytiker bin ich überzeugt davon, dass einer der psychischen Gründe für die tiefe Verunsicherung fast aller Menschen seit Beginn der Pandemie darin besteht, dass ein menschliches Grundbedürfnis unser Handeln plötzlich nicht mehr bestimmen darf. Jetzt wird das genaue Gegenteil von uns gefordert:
Alle Menschen sind von Geburt an darauf programmiert, menschliche Nähe zu suchen. Wir assoziieren Nähe, Hautkontakt und Gehaltenwerden mit dem Gefühl der Sicherheit. Ohne eine solche Nähe zur Mutter könnte kein Säugling überleben.1 Die Sehnsucht nach solch körperlicher Nähe, die Gleichsetzung von Sicherheit und Zufriedenheit in intimen Beziehungen prägt auch das Gefühlsleben aller Erwachsenen. Berührung wirkt auf uns wie ein Signal der Sicherheit, lässt uns Stress und Angst besser ertragen.
Jetzt aber gilt plötzlich die Umkehrung: Körperliche Nähe bedeutet Gefahr, Ansteckungsrisiko, schlimmstenfalls schwere Erkrankung und speziell für ältere Menschen oder Risikopatientinnen Lebensgefahr. Distanz und Berührungsverbote hingegen bedeuten weniger Risiko und mehr Sicherheit. Das führt im zweiten Jahr des Lebens unter pandemischen Bedingungen zu Reaktionen, die noch Anfang 2020 völlig absurd gewesen wären: So berichtete mir eine Patientin, dass sie bei einem älteren Film erschrocken sei, als sich zwei Menschen mit Handschlag begrüßten. Sie überlegte dann und konnte sich gar nicht mehr genau erinnern: Hatten wir uns früher wirklich in jeder Therapiestunde mit Handschlag begrüßt und verabschiedet? Ihr Körper erinnerte sich noch deutlich daran – wohl deshalb war es für sie besonders schmerzlich.
Im Herbst 2020 zielte die Werbung bereits auf diese Sehnsucht nach Berührung bei gleichzeitigem Wissen um deren Unmöglichkeit: Eine Fastfood-Kette versprach, dass ihr Kaffee „dich von innen umarmt“. (McDonalds-Werbung, September 2020)
•Auf biologischer Ebene gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und dem Zustand des Immunsystems: Laut Sheldon Cohen (1991 und 1997) erhöht Einsamkeit das Risiko von Infektionen, und zwar – aktuell interessant – auch und speziell von viralen Infekten. Angeblich bleibt dieser zusätzliche Risikoeffekt für einsame Menschen auch dann aufrecht, wenn man alle anderen Variablen herausrechnet. (Vgl. Spitzer, S. 143)
•Demnach müssten einsame Menschen auch ein erhöhtes Risiko bezüglich Corona-Infektion aufweisen. Gleichzeitig wiederum sind sie durch ihre selteneren Sozialkontakte weniger gefährdet.
•Jenseits von Einsamkeit allerdings zeigen die Daten Ende 2020 sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, den USA oder in England eine massive sozio-ökonomische Komponente des Corona-Risikos: So starben z. B. in Großbritannien (Stand Ende November 2020) laut Michael Marmot zwölf von 100.000 Akademikerinnen an Corona, hingegen 40 von 100.000 Hilfsarbeitern (deren Sterblichkeit sogar signifikant höher war als die der Krankenschwestern mit 26/100.000). Je ärmer der Wohnbezirk, je beengter die Wohnverhältnisse, desto höher das Risiko. (Vgl. Zeit vom 26.11.2020, www.zeit.de)
•Interessanterweise konnte man auch erleben, dass jene Menschen, die schon vor der Corona-Pandemie an Einsamkeit litten, die aktuelle Extremsituation sogar als weniger belastend empfanden als die Allgemeinbevölkerung: Ein Patient von mir, der seine Wohnung außer zum Gang an die Arbeitsstätte so gut wie nicht verlässt und seine Freizeit ausschließlich vor dem Computer oder im Bett verbringt, äußerte trocken und etwas hämisch: „Um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, für mich hat sich ja nichts verändert …“
•All jene, für die bis jetzt schon die einsamen Wochenenden quälend lang erschienen, sind vielleicht sogar besser für die aktuelle Extremsituation gerüstet als die nicht so einsame Mehrheit der Bevölkerung.
•Für Einsame, in Beziehung Lebende oder auch im familiären Kontext „Zusammengesperrte“ gilt: Fast alle von uns werden die Funktion der sozialen Medien und des Internets nach dieser Corona-Pandemie anders einschätzen:
•Selbst die schärfsten Kritikerinnen der selfieversessenen Jugend und die Kulturpessimisten, die schon vor Jahren die „digitale Demenz“ befürchteten (wie z. B. Manfred Spitzer): Sie alle werden wohl jetzt zugestehen müssen, dass eine vergleichbare Quarantänesituation vor dreißig Jahren ohne Internet noch deutlich belastender gewesen wäre.
•Das betrifft nicht nur die Jugend: Nie zuvor haben Menschen verschiedenster Altersgruppen so intensiv in/mit den neuen Medien kommuniziert.
•Laut der „Vermächtnisstudie“ in Deutschland mit immerhin 3000 Befragten zwischen 16 und 80 Jahren gibt es daher digitale Hoffnung für alle Einsamen: Zwischen 2015 und 2020 (Umfrage nach erstem Frühjahrs-Lockdown) ist die Zustimmung zur folgenden Aussage deutlich gestiegen: „Ich fühle mich nie alleine, weil ich über das Internet mit anderen Menschen in Kontakt stehe.“ Ob man die Zustimmung zu diesem Satz nun als erfreulich oder eher bedenklich einschätzt – sichtlich bedeutet digitale Kommunikation für viele alleinlebende Menschen zumindest „besser als gar nichts“.
•Dies gilt wahrscheinlich auch für die Durchführung von Psychotherapien unter Covid-Bedingungen: Auch wenn zumindest nach meiner Erfahrung eine Telefonstunde für die Therapeutin wesentlich anstrengender ist und auch von der Qualität her mit dem direkten persönlichen Kontakt nicht vergleichbar, so ist sie für die meisten Patienten immer noch besser als gar keine Therapiestunde.
•Viele Patientinnen sind auch dankbar dafür, dass der emotionale Kontakt zur Therapeutin in solchen Extremsituationen verlässlich aufrecht bleibt: Wohl auch deshalb, weil für viele psychisch Kranke Einsamkeit eines ihrer größten Probleme ist: Dieser Teufelskreis ist altbekannt und bestens dokumentiert – aber leider nur schwer zu verändern: Einsamkeit fördert die Entstehung psychischer Erkrankungen, psychische Krankheiten wiederum bewirken oft schmerzliche Einsamkeit. Denn viele psychisch Kranke leiden ja neben anderen Symptomen an Schwierigkeiten bei der Beziehungsaufnahme, bei ihrer „sozialen Feineinstellung“: Sie haben größere Schwierigkeiten bei persönlichen Kontakten und ziehen sich daher immer mehr zurück. Am Ende steht oft eine völlige Vereinsamung.
•Ob aber psychisch krank oder gesund: Für sehr viele Mitmenschen fällt jetzt durch den Zwang zum Homeoffice (oder schlimmstenfalls durch die Arbeitslosigkeit) eine sehr verlässliche „Einsamkeitsprophylaxe“ weg, deren Wichtigkeit wir meist unterschätzen: Die tägliche Arbeit. So schildern fast alle Befragten, dass Homeoffice ja durchaus erträglich sei und auch Vorteile habe – aber: So gut wie alle vermissen die sozialen Kontakte mit den Kollegen, das Tratschen in der Kaffeepause oder vielleicht noch bei der gemeinsamen Zigarette. Wenn diese sozialen Kontakte im Job aber die einzigen sozialen Kontakte waren, dann bewirken die Corona-Restriktionen oft ein akutes Abrutschen in eine schmerzliche Einsamkeit.
•Gegenprobe: Die oben geschilderte schwierige Situation einsamer oder durch die Pandemie vereinsamter Menschen kann man relativieren durch den Hinweis auf andere, wohl ebenso große Schwierigkeiten für Paare und speziell Familien mit kleinen Kindern in der aktuellen Situation: Wahrscheinlich gab es noch nie einen so flächendeckenden „Stresstest“ für Paarbeziehungen und Familiensysteme: Dabei ist wie bei so vielen sonstigen medizinisch-virologischen und sozialen Folgen noch kaum abschätzbar, wie diese Versuchsanordnung in verschiedenen Ländern, für verschiedene ökonomische Klassen und auch Kulturen ausgehen wird – wahrscheinlich aber wird auch hier der berüchtigte „Matthäus-Effekt“ gelten: Wer hat, dem wird noch gegeben, wer aber nicht hat, dem wird sein Weniges genommen. Abstrakter ausgedrückt: Da die Stressregulation durch gegenseitige Berührung jetzt nur mehr im privaten Haushalt möglich ist, werden sowohl angenehme als auch unangenehme Effekte dieser gegenseitigen Hautkontakte stärker spürbar. Gute Beziehungen werden die Krise überstehen, man wird sich vielleicht sogar noch näher kommen oder das gemeinsame Bewältigen einer Extremsituation als positiv erleben können. Brüchige Beziehungen hingegen werden in vielen Fällen die Krise nicht überleben.
Leider werden die Einschätzungen der Folgen mit Fortdauer der Pandemie immer pessimistischer: In den Wochen des ersten Lockdowns überwog die Hoffnung auf ein Erstarken der Solidarität, ja sogar auf ein generelles Umdenken, eine Abkehr vom Narzissmus. Wir würden gemeinsam gestärkt aus dieser Prüfung hervorgehen: So der Titel des Zeit-Magazin am 19.03.2020 (www.zeit.de), also nach einer Woche des Lockdowns: „Nie war es so wichtig, gemeinsam allein zu sein. Um auf alle aufzupassen.“
Ein paar Monate später war von Solidarität nur mehr wenig zu hören. Immer häufiger wurden die beschwörenden Aufrufe, doch die Schwächsten nicht allein zu lassen: So auch in einem Text des EU-Kommissars für Wirtschaft Paolo Gentiloni gemeinsam mit Dubravka Šuica: Der Kommissar sowie die ehemalige EU-Parlamentarierin betonen, dass „Einsamkeit eines der großen, drängenden Probleme ist, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist. Sie ist kein Phänomen, das erst durch die Corona-Pandemie entstanden ist. Doch ganz klar ist sie dadurch größer geworden und stärker ins Bewusstsein gerückt.“ Deshalb rufen sie auf, durch die Erfahrungen mit der Pandemie zu besserer Gesundheit und mehr Solidarität vor allem zwischen den Generationen zu finden. Das aber müsse auch die Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung und unser Engagement gegen die Ungleichheit betreffen, denn besonders einsam würden sich Arme und Arbeitslose fühlen.
Ein bisschen klingt das schon wie das Pfeifen der Politiker und Ökonomen im dunklen Wald: So etwas wie Vertrauen, sei es in die Weisheit der Mächtigen oder in unsere eigene Kompetenz scheint kaum mehr möglich. Dadurch aber fühlen wir uns letztlich alleingelassen, allein mit unserer Angst: Wir wissen nicht, wie sich das Virus weiter verhalten wird, wie sich die Menschen verhalten werden und wie lange wir das Alleinsein in unseren Wohnungen noch aushalten müssen – sei es nun mit oder ohne Partnerin und Familie.
1Siehe das Kapitel „Psychoanalytische Positionen zur Trennungsangst/Angst vor dem Alleinsein“ zur problematischen Gleichsetzung von Mutter und primary caregiver.
I. Außenperspektiven
Gibt es wirklich eine loneliness epidemic?
Tausende von Zeitungsartikeln haben in den letzten Jahren vor der „Einsamkeitsepidemie“ in Europa und den USA gewarnt. Die Evidenz für diese alarmistische Gesellschaftsdiagnose aber ist verblüffend schmal, ja kaum existent: Es gibt keine Daten, die die Hypothese eines massiven Anstiegs der Einsamkeit unterstützen – ganz zu schweigen von einer Epidemie.
Wahr hingegen ist, dass immer mehr Menschen speziell in den wohlhabenden Ländern allein leben. Die Tatsache ihres Alleinlebens aber bedeutet weder, dass sie sich alle einsam fühlen noch, dass sie keine soziale Unterstützung hätten. Die Website Our World in Data fasst die Datenlage zusammen: Schlagzeilen über eine Einsamkeitsepidemie seien unwahr und nicht hilfreich. (https://ourworldindata.org/loneliness-epidemic)
Wahr hingegen ist das verblüffende Ergebnis einer Umfrage in England 2017: Es ging um subjektive Selbsteinschätzung bzw. um Antworten auf die Frage: „Wie oft fühlen Sie sich einsam?“ Überraschenderweise berichten nicht so sehr vereinsamte Oldies darüber, dass sie sich „often/always“ oder zumindest „some of the time“ einsam fühlen: Die Altersgruppe mit den höchsten Einsamkeitsraten sind eindeutig junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren: Zehn Prozent von ihnen fühlen sich „often or always“ einsam – im Vergleich zu nur drei Prozent der Pensionisten über 65. Laut OWiD bestätigen vergleichbare Umfragen aus anderen Ländern wie Neuseeland, Japan und den USA dieses Ergebnis. (https://ourworldindata.org/loneliness-epidemic) Aber in diesen Studien geht es um Individuen. Wenn die Frage im Generationenvergleich gestellt wird – also ob Menschen heute einsamer sind als ihre Altersgenossen in der Vergangenheit – dann könnte es anders sein:
In einer Studie aus Psychology and Aging von Louise Hawkley ergab sich, dass die Selbstzuschreibungen von Einsamkeit im Alter von über fünfzig Jahren abnahmen und erst nach dem Alter von fünfundsiebzig Jahren wieder zunahmen. Diese Zunahme hing allerdings eindeutig zusammen mit gesundheitlichen Problemen und dem Verlust von Ehepartnerinnen.
Interpretation der Autorin: Es gibt zwei gegenläufige Faktoren, nämlich eine direkte Beziehung zwischen Alter und Einsamkeit – hier sinkt Einsamkeit mit dem Alter, weil unsere sozialen Erwartungen sich an die Realität anpassen und wir selektiver werden bezüglich der Kontakte, die uns emotional stützen. Ältere Menschen haben also weniger, aber dafür engere Freunde. Aber es gibt eine indirekte Kraft in die Gegenrichtung und deshalb steigt Einsamkeit mit dem Alter dann doch wieder an, aber nur in Kombination mit gesundheitlichen Problemen und Verlust von Freunden und Verwandten. Im mittleren Lebensalter dominiert der erste Effekt, erst in wirklich höherem Alter beginnen die negativen indirekten Effekte.
In derselben Studie fand Hawkley, dass es bezüglich des „Kohorten-Trends“ in den USA kaum eine Differenz in der selbstberichteten Einsamkeit von Menschen verschiedener Generation gab: Die zwischen 1920 und 1947 Geborenen berichteten über dieselben Verläufe von Einsamkeit während ihres Lebenszyklus wie die zwischen 1948 und 1965 Geborenen. Die älteren Menschen scheinen sich im Durchschnitt heute nicht einsamer zu fühlen als vor zehn Jahren.
Auch die Hypothese, dass Menschen in den sogenannten „individualistischen“ Gesellschaften ihre höhere individuelle Freiheit mit häufigerer Einsamkeit bezahlen, ist durch Daten nicht belegbar: So zeigt sich bei Studien z. B. in Dänemark und der Schweiz (bei jeweils sehr hohen Anteilen von Single-Haushalten) kein höheres Ausmaß von subjektiv empfundener Einsamkeit.
Eine Gegenfrage gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen den Eindruck haben, dass sie auf Freundinnen oder Verwandte als soziale Unterstützung zählen können: In Island sind dies unglaubliche 98 %, in Norwegen 94 %, in den USA 90 %, in Griechenland 82 %. (https://ourworldindata.org/loneliness-epidemic)
Fazit: Bei sehr vielen Zahlen gibt es praktisch keine Belege für eine epidemische Verbreitung von Einsamkeit und kaum einen Zusammenhang mit individualistischer Ausrichtung der Gesellschaft oder der Anzahl von Single-Haushalten.
Als Folge des großen medialen Interesses an der Einsamkeit wurde in England 2018 von der BBC gemeinsam mit der Wellcome Collection und Forschern dreier Universitäten unter dem Titel The Loneliness Experiment die angeblich weltgrößte Befragung zur Einsamkeit durchgeführt: Es war eine Online-Umfrage mit über 55.000 Teilnehmerinnen. (The Anatomy of Loneliness, https:www.bbc.co.uk/programmes/m0000mj9) Also ein riesiges Sample, allerdings wieder mit eingeschränkter Aussagekraft: Da es eine Online-Umfrage war, dürfte der Anteil jüngerer Teilnehmer überdurchschnittlich groß gewesen sein. Außerdem war es ein self-selecting sample, also dürften viele Menschen teilgenommen haben, die sich ohnehin einsam fühlten und daher für das Thema sensibilisiert waren.
Trotzdem sind die Ergebnisse bestürzend: Ca. ein Drittel der 55.000 Teilnehmerinnen fühlte sich oft oder sehr oft „lonely“ (wobei durch die Fragestellung sehr wohl zwischen allein und einsam bzw. alone/lonely unterschieden wurde: 80 % der Befragten berichteten, dass sie manchmal durchaus gern allein seien). Die – wahrscheinlich überrepräsentierten – Jungen berichteten über ein verblüffend hohes Einsamkeitserleben: 40 % der 16- bis 24-Jährigen in dieser Umfrage fühlten sich oft bzw. sehr oft einsam, hingegen nur 27 % der über 75-Jährigen.
Folgende Ergebnisse wurden in der Studie hervorgehoben:
•In höherem Ausmaß einsam fühlen sich behinderte bzw. diskriminierte/sich diskriminiert fühlende Mitbürger.
•Sehr viele Menschen schämen sich ob ihrer Einsamkeit.
•Wenn sich Teilnehmerinnen als einsam beschrieben, dann schätzten sie sich selbst auch als überdurchschnittlich mitfühlend ein.
•Die sich einsam Fühlenden berichten über weniger Vertrauen in ihre Mitmenschen.
•Einsame haben zwar mehr Online-Freunde, verbringen aber nicht mehr Zeit im Internet als Nicht-Einsame. (Aber: Bei den Einsamen überlappen sich Online-Freundinnen und Freunde im realen Leben weniger als bei Nicht-Einsamen.)
•Das Gefühl der Einsamkeit korreliert mit einer schlechteren körperlichen und psychischen Gesundheit.
•Insgesamt bestätigten diese Zahlen der BBC-Umfrage die Ergebnisse jener ebenfalls groß angelegten Studie, die letztlich zum Auslöser für die Errichtung des Staatssekretariats für Einsamkeit in Großbritannien wurde: Die Community Life Survey wurde 2016/2017 durchgeführt und erbrachte nur relativ bescheidene 5 % der Erwachsenen in England, die sich „oft“ oder „immer“ einsam fühlten. Auch in dieser Umfrage war der Anteil der jüngeren, vor allem aber der behinderten Bevölkerungsgruppen überdurchschnittlich hoch. (https://www.gov.uk/government/collections/community-life-survey)
•Betont wurde das erhöhte Einsamkeitsrisiko bei Arbeitslosen, die sich mit 12 % dreimal so oft einsam fühlten wie vergleichbare Personen im Arbeitsprozess. Und immerhin fühlten sich nur 3 % der Menschen in einer aufrechten Partnerschaft oft oder immer einsam, jedoch 10 % der Alleinlebenden.
•Die Bilder der vereinsamten Alten auf der Parkbank oder beim resignierten Blick aus dem Fenster, die wir aus dem Fernsehen kennen, haben also sichtlich wenig mit der Realität zu tun. Sie passen aber zusammen mit unseren inneren Bildern, die Einsamkeit und Alter „zusammenschalten“. Für die jungen Einsamen gibt es noch weniger Bilder in den Datenbanken der Medien und auch in unserer kollektiven Vorstellung von Einsamkeit.
Vielleicht gibt es noch einen zusätzlichen Faktor, der die so deutlich höheren Einsamkeitseinschätzungen der Jungen im Vergleich zur Pensionistinnen-Generation bewirkt: Könnten auch die Ansprüche der Jüngeren an Beziehungen im Sinne eines sozialen Perfektionismus gestiegen sein? Empfinden die Jungen deshalb ihren Zustand auch beim Leben in aufrechter Partnerschaft und bei bestehenden Freundschaften öfter als wenig zufriedenstellend, fühlen sich auch dabei eher einsam als die heute Älteren dies vor dreißig Jahren bei identer Situation empfunden hätten? Wäre demnach die loneliness epidemic auch ein Symptom der zunehmenden Dominanz des „subjektiven Faktors“ nach der Devise: Wenn ich mich einsam fühle, dann bin ich das auch – egal ob eine liebevolle Frau, meine Kinder und eine Zahl von Freunden um mich besorgt sind oder nicht. Denn alle oben angeführten Prozentsätze der Einsamkeit sind Ergebnisse von „Self-Assessment“: Also Selbsteinschätzungen, Selbstzuschreibungen der Betroffenen. Diese müssen subjektiv bleiben – Einsamkeit bleibt damit letztlich trotz aller Umfrageanstrengungen schwer messbar.
Die japanische Extremvariante des sozialen Rückzugs: Hikikomori