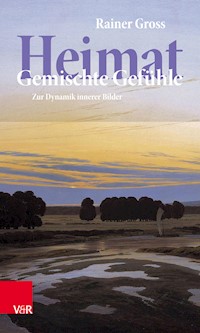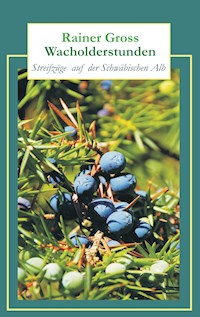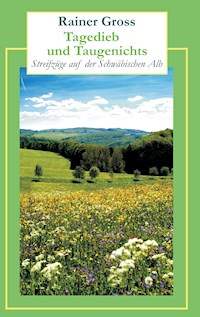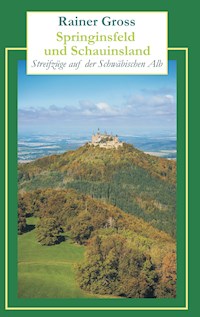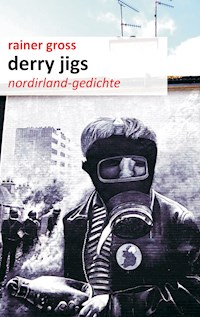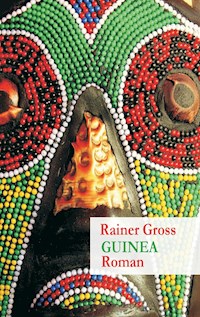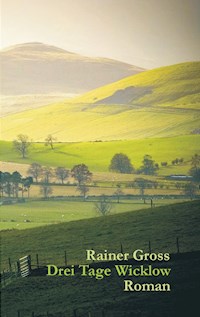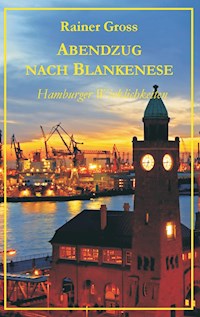Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr des Fuchses: einer Welt, in der es ewig Sommer ist, hat der junge Held seine Bestimmung gefunden. Er zieht als Minstrel, als Fahrender Sänger umher. Er findet Freunde und Weggefährten, verschmäht kein amouröses Abenteuer und folgt doch der wahren Minne eines Minstrels: der Königsminne. Immer wieder hat er Begegnungen mit Menschen, die in ihrem Schicksal gefangen sind. Als Streiter für die Wahrheit und selbst Suchender setzt er Laute und Schwert ein, um Hilfe zu bringen. Doch das Jahr des Fuchses verändert sich. Die Straße der Träumer ist zu einer Straße der Heimkehr geworden, alles strebt nach Hause, und überall stößt er auf Spuren der alten Zeit, als der König noch herrschte. Wird auch er eine Heimat finden in dieser fremden Welt? Wird seine Königsminne ihn nach Hause führen? Ein Roman voller Geschichten und Rätsel, voller Poesie und Märchen. Ein Picaroroman, ein Künstlerroman, ein überzeugendes Credo in einer zauberhaften Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Jahr des Fuchses: einer Welt, in der es ewig Sommer ist, hat der junge Held seine Bestimmung gefunden. Er zieht als Minstrel, als Fahrender Sänger umher. Er findet Freunde und Weggefährten, verschmäht kein amouröses Abenteuer und folgt doch der wahren Minne eines Minstrels: der Königsminne.
Immer wieder hat er Begegnungen mit Menschen, die in ihrem Schicksal gefangen sind. Als Streiter für die Wahrheit und selbst Suchender setzt er Laute und Schwert ein, um Hilfe zu bringen.
Doch das Jahr des Fuchses verändert sich. Die Straße der Träumer ist zu einer Straße der Heimkehr geworden, alles strebt nach Hause, und überall stößt er auf Spuren der alten Zeit, als der König noch herrschte.
Wird auch er eine Heimat finden in dieser fremden Welt? Wird seine Königsminne ihn nach Hause führen?
Ein Roman voller Geschichten und Rätsel, voller Poesie und Märchen. Ein Picaroroman, ein Künstlerroman, ein überzeugendes Credo in einer zauberhaften Welt.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen, studierte Philosophie, Literatur und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er erhielt 2008 den Friedrich-Glauser-Debütpreis.
Bisher erschienene Fantasy von Rainer Gross: Der Tempel des Königs (2016); Das Jahr des Fuchses (2025)
All what we see or seem
Is but a dream within a dream.
EDGAR ALLEN POE
Mit Schwert und Laute
Inhalt:
Die erste Nacht
Schmetterlingsmorgen
Hyazinthes Gärtlein
Freund Fuchs
Marigold
Die Prinzessin
Mittagsgesicht
Lebt wohl, ihr Fürsten!
Schlafen, vielleicht träumen
Im Steinbruch
Der Yngling
Savina und die Sanduhr
Beim Heckenwirt
Wind in den Weiden
Arya
Die Nachtigall
Wiedersehen mit dem Fuchs
In den Weihrauchbergen
Ein Wald voller Geheimnisse
Im Land des Donnerkeils
Das Schwert im Stein
Wer zum Schwert greift
Das Kind der Zeit
Mandragorn
Die Stadt am See
Merlin, der Falke
Die Segel von Sharon
Der Fliegende Berg
In Arkadien
Auf den Inseln
Saramantha
Leander
Der Fant
Königskammer
Alissia
Fuchsgeheimnisse
Die Herberge zur Grünen Laterne
1Die erste Nacht
Er wurde wach, mit jener unbemerkten Plötzlichkeit, mit der man nicht sagen kann, wann man erwacht ist. Augenblicke zuvor musste er noch geschlafen haben. Es war, als hätte ihm jemand jahrzehntelang den Atem geraubt.
Ein erschrockenes Atemholen: Endlich bin ich da!, wollte er rufen, doch seine Zunge zuckte wie etwas Fremdes.
Reglos blieb er liegen, als müsste er sich erst noch von seinem Hiersein überzeugen. Milde Wärme spürte er auf dem Gesicht, dann öffnete er die Augen, blinzelte, starrte. In jenen ersten Augenblicken blieb alles öd und leer, von sinnloser Fremdheit. Dann spürte er die Dunkelheit, die Größe und Weite, die ihn umgaben.
Er starrte in den Himmel hinauf, in die Schwärze. In seinem Kopf rauschte der schwere Schlaf, dem er kaum entronnen war. Er hatte geträumt, wirr, aufwühlend. Es kam ihm vor, als hätte er ein ganzes Leben geträumt. Ein fremdes, unbekanntes, etwas längst Vergangenes oder etwas, das auf ihn zukam, oder etwas, das nur hätte sein können. Der Sog wollte ihn zurückziehen, in jenen Dämmer zwischen Wach und Traum, in dem alles möglich wäre.
Auf seinem Gesicht spürte er den Wind, einen warmen, feuchten Wind. Der Geruch nach Meer, nach Gras und Sand umgab ihn. Und als sähen seine Augen erst jetzt, klaffte plötzlich in dem Raum, der ihn umschloss, ein riesiger Abgrund auf. Er lag auf dem Rücken und blickte in den Nachthimmel hinauf!
Die Lichter der Sterne schimmerten wie Juwelen auf Samt, ein Bildnis erstand daraus, ein prächtiges Nachtgeschmeide. Immer mehr Sterne tauchten aus der Tiefe auf, Gestalten und Muster bildeten sich, die ihm vertraut waren. Eine große Sorglosigkeit überkam ihn.
Es drohte keine Gefahr.
Die Zeit kam und ging vorbei, lautlos.
Er fürchtete, dass vielleicht die Mauer der kargen Empfindungen zu schwach sein könnte, um das Gewicht des hinter ihm liegenden Traumes zu tragen. Er bekam Angst, als wäre er hier, in seinem Leib, an diesem Ort, nicht sicher.
Lebenslange Träume, aus denen man endlich zu erwachen meint, dachte er. Unentrinnbare Träume, die sich erst im Erwachen enthüllen, und für einen winzigen Augenblick das Entsetzen, niemals aus Träumen entrinnen zu können. Dann öffnete er die Augen wieder.
Er atmete auf.
Nur er war dort: Lag im Gras im Herzen der Welt.
Er war im Jahr des Fuchses.
Das Meer rauschte. Er lachte vor Glück. Seit wann er nun war, wo er nun war: Hier war er!
Es war eine Nacht am Meer, seine erste am Meer im Jahr des Fuchses. Er erinnerte sich, wie sehr er es hatte sehen wollen, wie er hierher gewandert war auf staubigen Straßen, wie er fern das Blau erblickt hatte, ein viel versprechendes, heiteres, inselschwangeres Blau, das bis in den Himmel reichte.
Ja, er war ein Minstrel im Jahr des Fuchses. Er war der Minstrel ohne Namen. Er zog umher und spielte seine Lieder, erzählte seine Geschichten denen, die sie hören wollten, er hatte keine Heimat und erkundete die Welt. Seine Erinnerung reichte weit zurück, und er wusste, dass er im Jahr des Fuchses bereits eine Geschichte hatte. Wie er zuerst ein sorgloser Landstörzer gewesen war, dann ein Held mit einem Schwert und dann die Berufung zum Minstrel erhielt. Er erinnerte sich an die Fuchsfibel an seinem Hemd, griff danach, fühlte das kalte Metall in seiner Hand. Daran erkannten ihn alle. Der Geschwänzte hatte ihn ausgezeichnet. Das galt noch immer.
Menschen fielen ihm ein, denen er begegnet war, mit denen er etwas erlebt, die er liebgewonnen hatte. Er konnte ihre Namen aufzählen und tat es.
Er stand auf und schaute auf den bleichen Strand und die Brandung, die grün leuchtete von verborgenem Schimmer. Er drehte sich um und sah schattenhaft die Heide hinter sich liegen, die Büsche und Bäume, das weite Hinterland. Die Wärme der Luft hatte jetzt eine Botschaft. Sie sagte: Du bist hier. Wir sind bei dir. Du bist in Sicherheit.
Er ging hinunter an den Strand, tauchte die nackten Füße in das laue, heran gischtende und zurück schäumende Meer. Aus der Dunkelheit lief das Wasser auf, lautlos und sanft.
Dann fiel ihm das Wort eines Poeten ein, das er einmal gehört hatte:
All das wir glauben oder schaun
ist nur ein Traum in einem Traum.
Dann lachte er plötzlich.
»Es war nur im Schlaf. Im Schlaf!«
Er ließ den Ort zurück, wo er gelegen hatte, die Kuhle im Sand, seine erste Nacht am Meer. Er ging landeinwärts in die Heide hinein.
2Schmetterlingsmorgen
Schwälbchen badete am Mittag. Die Quelle, die hier erstaunlicherweise entsprang, leitete sie mit Rohren in ein großes Holzfass, worin sie saß, nackt, und plantsche und schrubbte und nebenher ein Lied sang.
Er kannte das Lied bereits. Sie sang es oft. Es passte zu ihr, und irgendwie war es auch eine Botschaft an ihn, aus der er aber nicht schlau wurde. Sie sang selbstvergessen, rollte das R und wölbte die Lippen beim U, und manchmal drehte sie sich um zu ihm, und er sah ihre meerblauen Augen leuchten, und die Sonne fing sich in ihrem goldenen Haar, und ihre Haut schimmerte bronzefarben.
Schwälbchen, dachte er verzückt. Schwalbenschwanz ohne Schwanz, sagte sie immer. Den hast du. Ein frivoles Weib, dachte er. Das gefiel ihm. Sie liebte die Schmetterlinge, die Zwiegaukler, die aus dem Hinterland kamen, wo ein Meer von Wildblumen blühte, die Sommervögel, die versonnen um ihre Blumen vor der Hütte gaukelten und mit ihrem Rüssel Nektar sogen. Sie ist selbst ein Sommervogel, dachte er. Flatterhaft, wunderschön und nicht zu fangen.
Sie trällerte und goss sich Wasser über den Rücken. Er stand im Schatten der Laube und genoss den Anblick. Schon seit Tagen. Seit Tagen war er hier, und sie hatten leichtmütige Morgen verbracht hier am Meer, heiße Nachmittage mit dem Bouquet der Wildblumen drinnen in der Heide, und warme Nächte mit dem Duft, den der Wind vom Land herüber wehte.
Sie schliefen in verschiedenen Betten, und jede Nacht trieb es ihn aus seinen Decken, er stand in der Laube und lauschte der fernen Stimme des Meeres, manchmal hinab gelockt an den Strand, wo er im Dunkel die Nähe spürte, die große und bergende Nähe. Er erinnerte sich an seine erste Nacht, an den Traum, den er gehabt hatte, an das Gefühl, dass er wirklicher war als das Jahr des Fuchses.
Aber er war hier! Er lebte.
Er führte sein leichtmütiges Vagabundenleben, wie es ihm gefiel.
Manchmal stand er an ihrem Bett und betrachtete sie. Das Mondlicht fiel auf sie und machte ihren Leib marmorweiß. Er betrachtete ihren Arm, den sie unter den Kopf geschoben hatte, ihren Oberkörper, halb aufgedeckt, ihre Brüste, wie sie in die Armbeuge gedrückt rund und prall waren, ihre Lider, die zuweilen zuckten, ihre Lippen, die sich vergessen hatten und ihren eigenen Traum träumten. Dann dachte er: Ich kann sie nicht lieben.
Er konnte sie nicht lieben hier im Jahr des Fuchses. Sie ist ein Geschöpf dieser Welt. Ein Sommervogel, nicht zu greifen, eine Wildblume, nicht zu pflücken. Was wollte er von ihr? Was tat er hier?
Aber die Morgen zwischen ihnen waren leichtmütig und sorglos, die Tage zogen vorbei wie die Wolken weit draußen auf ihrem Weg nach Osten, die Zeit war eine Sache des Binnenlandes und zerrann hier wie Sand.
Dann aßen sie eine Kleinigkeit, unter dem flirrenden Schatten der Laube, und immer gab es den Nektar der Wildblumen, den die Schmetterlinge sammelten. Davon lebte Schwälbchen. Ein bisschen Brot, Wasser hatte sie aus der Quelle, und wo sie sonst sich herumtrieb an den Nachmittagen, wusste niemand.
Wenn sich ein Schwarm der Zwiegaukler an ihren Blumenbeeten versammelt hatte, zeigte sie ihm jeden Einzelnen und nannte die Namen. Das war wie ein Kinderreim, den sie aufsagte, eine unbekümmerte Litanei von Kosenamen, die sie sich ausgedacht hatte.
»Sieh«, sagte sie zu ihm: »Schwalbenschwanz. Schachbrett. Parnassus mit den roten Augen. Eisvogel. Königsmantel. Landkärtchen. Der Fuchs mit seinem orangefarbenen Pelz. Das Pfauenauge mit seinem betörenden Blick. Alle kommen sie hierher zu mir, alle laben sie sich an den Wildblumen der Heide, alle trinken sie den Nektar und bringen mir die Götterspeise!«
Und er begriff, dass sie wirklich ein Sommervogel war, einer, der sich stets in ein Mädchen und zurück verwandelte, ein Geschöpf der immerwährenden Huld, die in dieser Welt wohnte. Das würde auch erklären, warum sie an den Nachmittagen niemand sah.
Er hingegen strich am Nachmittag durch die Heide und entdeckte den bunten Flor der Blumen, die zwischen Birken, Sanddorn und Heidekraut blühten. Geschützt durch seinen Hut gegen die Sonne, streunte er umher, pflückte die sauren Beeren des Sanddorns, legte sich mitten zwischen die Blumen und döste vor sich hin. Auch ihre Namen hatte sie ihm beigebracht, und manchmal nahm er seine Laute und sang ein Lied dazu, denn er war ja ein Minstrel.
In der Heide hörte er das Rauschen der Brandung nicht mehr. Da schrillten die Heimchen und balzte traurig der Upupa, die Ginsterkatze schlich und jagte das Getier, und in all den Blüten sammelte sich aus dem Tau des blauen Abends neuer Nektar.
Nur manchmal kam er in der Heide an die Dünen heran. Dann stieg er durch den kalten Schattensand und den heißen Sonnensand hinauf ins Blau, stand dort im Wind und schaute die ganze Küste entlang, den weißgrünen Landstrich, der hier den Saum des Meeres zierte wie Spitze ein kostbares Gewand.
Das Meer. Nun hatte er es endlich gesehen.
Nun wusste er, weshalb er nicht vorher hierher gekommen war. Es weckte eine Sehnsucht in ihm, die unstillbar war. Jene Sehnsucht, die er schon kannte, seit vielen Sommern. Jene Sehnsucht, die kein Ziel hatte, die ihn immer wieder auftrieb und auf die Landstraße schickte und die vermutlich durch nichts im Jahr des Fuchses befriedigt werden konnte.
Er hatte das oft erlebt. Es war die Sehnsucht, die er fühlte, wenn er sich in ein Mädchen verliebte, die Sehnsucht, die ihn ergriff, wenn er an ferne Länder dachte, jene Sehnsucht, die ihn antrieb, wenn er etwas studierte und das Reich des Wissens betrat – und sie konnte nie durch eine Liebe, durch eine Reise oder durch eine Academia gestillt werden.
Schwälbchen konnte ihm dabei nicht helfen. Sie war selbst Grund dieser Sehnsucht. Was er sich von ihr wünschte, konnte er nicht benennen, und wenn er es benannte, musste er einsehen, dass sie das nicht geben konnte. Er wollte sie lieben können. Er wollte mit ihr eine Minne leben, die keine größere Erfüllung kennt als den Anderen, eine Zugehörigkeit, die ihn fest verankerte auf der Erde und im Himmel. Er wollte, wohin er auch ging, wissen, dass sie zusammen waren und es niemanden gab, der sich zwischen sie drängen konnte.
Da fiel ihm Alissia ein, seine Seelenschwester. Vieles von dem, was er sich wünschte, traf auf sie zu. Manchmal dachte er an das Schlösschen im Wald, in dem sie wohnte, wie an ein Zuhause, und er spürte das Verlangen, jetzt sofort sich auf den Weg zu machen und zu ihr zurückzukehren. Und doch zögerte er.
Er hatte kein Zuhause. Das war nur wieder so eine Sehnsucht, so ein Traum, der ihn begleitete. Er zögerte zu sagen, dass er ihr gehöre und niemand Anderem. Wenn er zu jemandem gehörte, dann zu ihr, aber es war fraglich, ob er überhaupt jemandem gehören konnte. Ob er nicht immer allein und frei war, ungebunden, heimatlos.
Nein, Schwälbchen konnte ihm nicht helfen. Sie wollte es auch nicht, obwohl sie nie darüber sprachen. So gut lernten sie sich nicht kennen. Sie blieb eingesponnen in ihre Schmetterlingsduftigkeit, er haschte sie in der Heide nicht, wenn sie als Sommervogel Nektar trank, und ihr vorwitziges Liedchen, das sie morgens beim Baden in der Quelle sang, wenn das Trällern sich mit dem Rieseln des Wassers mischte, dieses Liedchen bedachte ihn fast mit mildem Spott.
Schmetterlingsmorgen
und Wildblumentag,
bin ohne Sorgen,
weil ich dich mag.
Gingen wir noch
zweisam am Strand,
haben uns doch
zu wenig gekannt.
Steig auf den Hügel,
steig auf den Mond!
Fang mich, du Lieber,
wo der Meerwind wohnt!
Er sang es selbst, notierte es in sein Buch. Vielleicht würde er es einmal vortragen, ein Liedchen unbeschwert und leichthin, das vorwitzige Gemüter zurechtstutzen würde.
Ich kann nicht bleiben, dachte er.
Wie lange müsste einer bleiben, um einen Sommervogel zu fangen? Um das Geschenk des Nektars zu erhalten? Um am Mittag nicht den Schlaf und die Schwere zu erleiden, den Traum, der ängstigte und betäubte?
Er musste weiterziehen.
»Du hast es gewusst«, sagte er eines Morgens, als sie wieder badete.
»Nun ... «, meinte sie und drückte den Schwamm aus, dass es platschte.
»Du wusstest, dass ich nicht bleiben kann. Du bist ein Traum, ein lebendes Schlafgespinst.«
»Ich bin, was ich bin. Ich wollte dich gerne bei mir haben, an den Abenden, und an den Morgen. Die Morgen am Strand waren alles Schmetterlingsmorgen – «
»Ich weiß, und mittags überm Land blühte ein Wildblumenmeer. Wir würden uns nicht lange genug kennen. Das wusstest du.«
Er küsste sie auf ihre nackten, filigranen Schultern, nahm sein Felleisen und seine Laute und ging. Noch lange in der Heide hörte er, vom Seewind verweht, ihren Gesang.
3Hyazinthes Gärtlein
Am Wegrand fiel der Buchenwald steil ins Tal hinab. Es ging sich in dem grünen Saal heiter und unbeschwert. Er hatte auf einmal das Gefühl, dass es nach Hause gehe. Das veränderte seinen Weg. Das veränderte jedes Erlebnis und jede Begegnung. Die Straße der Träumer war zu einer Straße der Heimkehr geworden.
Da entdeckte er seitab einen Felsvorsprung, der über das Tal hinaus ragte. Er spürte plötzlich, dass dort eine Geschichte auf ihn wartete. Er kletterte hinüber, der Grat wurde schmal, und dann langte er auf einem kleinen Plateau an. Alte Bäume verbargen es vor Blicken, eine zerfallene Mauer erhob sich wie der Zahn der Zeit, und im Hof, den die Mauern bildeten, blühte ein See blauer Blumen, und ein Beet mit Salat war in einem Winkel angelegt.
Es war ein kleines, abgeschiedenes Gärtchen, das er da entdeckt hatte. Ein lieblicher Ort. So klein der Ort war, zeugte er doch von einer geduldigen Sorge und Pflege, geschont und gehegt für tausend kleine Wünsche, für eine trällernde Hoffnung am Mittag im Schatten einer Buche. Regen gingen dort nieder, die Winde wechselten, die Frucht reifte über den Sommer, der Stein trug geduldig und scherbte manchmal klingelnd ins Tal, Vögel besuchten die Kronen und sangen ihre Lieder. Ein Ort, an dem man bleiben konnte für eine Weile.
Er kostete den Salat, er schmeckte herb und nussig und knirschte zwischen den Zähnen. Dann betrachtete er die Blümchen näher und fand sie wie einen Schwarm von Schmetterlingen mit vier Blütenflügeln, in der Mitte ein Nest aus Gelb. Zufrieden setzte er sich unter eine der Buchen und wartete auf die Geschichte. Die Sonne flimmerte im Laub, aus einem Brunnenrohr rieselte es, ein schwermütiger Laut an diesem verborgenen Ort.
Statt der Geschichte erschien ein Mädchen. Es tauchte plötzlich im Geviert auf und schaute ihn zornig an.
»Wie kommt Ihr denn hierher?«, fragte sie.
»Zu Fuß«, sagte er wahrheitsgemäß.
»Wer hat Euch das erlaubt?«
»Das Jahr des Fuchses«, gab er zur Antwort. »Gehört denn dieser Garten jemandem?«
»Natürlich«, sagte das Mädchen und stemmte die Hände in die Hüften. »Hyazinthe!«
»Und wer ist Hyazinthe?«
»Das bin ich.«
»Guten Tag, Hyazinthe! Ein schönes Gärtlein hast du.«
»Es ist das Einzige, was ich ganz für mich habe. Und nun kommt Ihr daher«, sagte sie und verzog wieder das Gesicht.
»Keine Sorge! Ich bleibe nicht lange, nun, nachdem ich weiß, dass dieser Ort jemandem gehört. Ich suche nur nach einer Geschichte, die sich hier versteckt hat.«
»Eine Geschichte?« Jetzt strahlte ihr Gesicht. »Seid Ihr ein Geschichtenerzähler?«
»Ja. Ich bin Fahrender Sänger und Jäster zugleich. Ich bin ein Minstrel.«
Sie schaute ihn eine Weile an, dann lachte sie. »Ihr seid der berühmte Minstrel ohne Namen, habe ich recht?«
»Ob berühmt, weiß ich nicht. Aber der bin ich.«
Sie lief zu ihm hin und blieb vor ihm stehen. Jetzt lag ein verzweifeltes Bitten in ihren Augen.
»Ihr müsst mir eine Geschichte erzählen!«, bettelte sie und hob die Hände. »Bitte!«
»Nun, nun«, meinte er und wusste nicht, ob er sich geschmeichelt oder bedrängt fühlen sollte. »Ich bin ein Jäster. Da wird sich schon eine Geschichte finden. Setz dich her.«
Sie nahm neben ihm Platz, die Buche schenkte ihnen Schatten, er lehnte sich mit dem Rücken gegen den Stamm und begann.
»Es war einmal ein Mädchen, das hieß Sonnenwirbelchen. Es war in einem Turm gefangen, weil es immer den Salat aus dem Garten der Stiefmutter genascht hatte. Da kam eines Tages – «
»Doch nicht diese Geschichte«, unterbrach das Mädchen enttäuscht. »Die kenne ich.«
»Die kennst du?«, fragte er verdutzt. Er hatte eigentlich geglaubt, sie gerade erst zu erfinden.
»Ja. Und das mit dem goldenen Haar, das das Mädchen herab lässt, damit der Prinz hinauf steigen kann – das sind olle Kamellen.«
»So. Aha.«
»Nein, ich brauche eine Geschichte, die ich noch nicht kenne. Eine ganz bestimmte. Eine Geschichte von Hyazinthe und ihrem Gärtlein.«
»Aber Hyazinthe bist doch du«, wandte er erstaunt ein. »Ich soll dir deine eigene Geschichte erzählen?«
»Neiiiin«, sagte sie ungeduldig. »Nicht die Hyazinthe in der Wirklichkeit. Die Hyazinthe in der Geschichte. Die kenne ich nämlich noch nicht. Sonst wäre ich ja nicht hier gefangen. Erzähl mir eine Geschichte, und wenn es die richtige ist, bin ich frei.«
»Frei? Wovon frei?«
»Von dem Bann. Ich bin hierher verbannt worden, das Gärtlein zu hüten, egal wie lange. Es ist eine Geschichte, versteht Ihr, und wenn ich die Geschichte erfahre, und vor allem: wenn ich weiß, wie sie ausgeht, dann löst sich der Bann.«
So etwas Verrücktes hatte er noch nicht gehört. Was es alles gab im Jahr des Fuchses!
Er blieb misstrauisch. Er hatte den Eindruck, das Mädchen erzählte ihm nicht die ganze Wahrheit. Er vermutete eher, dass sie eigentlich hier ganz zufrieden war und nicht weg wollte. Und was würde passieren, wenn er tatsächlich die richtige Geschichte erzählte? Das Mädchen würde der Wahrheit gegenüber stehen und plötzlich gehen müssen. Da konnte werweißwas geschehen!
»Und was geschieht, wenn ich die falsche Geschichte erzähle?«
Sie blickte zu Boden und meinte nebenhin: »Nichts weiter.«
»Nichts weiter als was?«
»Ich weiß es nicht. Keine Ahnung«, sagte sie und zuckte mit den Schultern.
»Sind denn schon viele gekommen, die du um eine Geschichte gebeten hast?«, fragte er argwöhnisch.
»Ihr seid der Erste. Das schwöre ich!«, meinte sie eifrig.
»Hör mal zu! Wenn du mich hier anlügst, kann ich dir keine Geschichte erzählen. Dann gehe ich einfach wieder, und du kannst bis in alle Ewigkeit hier deinen Salat wässern.«
»Das«, sagte sie verlegen und blickte ihn nicht an, »geht leider nicht.«
»Was? Wieso geht das nicht?«
»Ihr habt das Gärtlein betreten. Ihr seid jetzt mit unter dem Bann. Ihr könnt nicht mehr gehen.«
Da wurde er wütend und erhob sich. »Das wollen wir doch mal sehen!«, rief er und wollte gerade sein Felleisen schnappen und davon stapfen – ungehindert natürlich –, weil ja kein Zauber im Jahr des Fuchses eine Wirkung auf ihn hatte. Bann und Fluch und Geschichten konnten ihm also herzlich egal sein. Aber das Mädchen tat ihm leid. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz aufrichtig war, wollte er ihr doch ihre Geschichte geben. Ob sie dann frei war oder von selbst gemachten Bindungen immer noch gefesselt, würde sich heraus stellen.
»Also gut«, sagte er und setzte sich wieder. Jetzt tauchte in ihren Augen Hoffnung auf.
»Aber bist du sicher, dass du die Geschichte hören willst? Es kann nämlich sein, dass sie dein Leben verändert. Dass hinterher nichts mehr so ist, wie es war ... «
»Das wird sich zeigen«, seufzte sie und drückte sich zutraulich an ihn. »Fangt an!«
Er hatte keine Ahnung von der Geschichte. Sie war es sicher, die er gespürt hatte. Er hatte gedacht, sie in aller Ruhe suchen zu können. Und jetzt musste er aus dem Stegreif irgendetwas erfinden. Wenn er Geschichten erfand, war es ihm oft, als kämen sie ihm zugeflogen oder als wären sie schon vorhanden und er brauchte sie bloß nachzuerzählen. Er hoffte, dass das auch diesmal so war.
Als er den Mund öffnete, hörte er plötzlich eine Stimme in seinem Kopf. Tatsächlich: Sie erzählte ihm die Geschichte. Der Ort selbst erzählte sie ihm, der Mittag, die Sonne im Laub, der Wind in den Bäumen. Hyazinthe sah ihn erwartungsvoll an, und er wiederholte nur, was ihm die Stimme erzählte.
»Auf einem Hof wohnte eine Familie mit drei Kindern. Eines davon aber, die kleine Hyazinthe, war nicht ihr eigenes. Jeden Abend, wenn sie im Bett lag und unten in der Stube die Stimmen der Eltern hörte, sah sie vor sich einen Garten mit Bäumen und Büschen und Beeten voll schwarzer Erde, in denen tausend blaue Blumen blühten. Der Garten war von Mauern umgeben und lag hoch oben im Himmel. Sie wusste, dass dies ihre ganz eigene Erinnerung war und nicht von ihrem Elternhause herkam.«
So geht es oft in der Welt, dachte er und seufzte. Ein Mensch tritt auf und hat sich nicht ausgesucht, wie und wozu, und hinterher muss er feststellen, dass er woanders hingehört, und trägt ein Leben lang daran.
Woran?, fragte es da in seinem Kopf.
Oha, also!, dachte er überrascht. Die erste Geschichte, die mit sich reden lässt. Das habe ich noch nicht erlebt.
An der verfehlten Heimat, dachte er.
Oder der verlorenen.
Oder der verlorenen. Herkunft und Zukunft sind einander so ähnlich, dass sie aufs Gleiche heraus kommen. Wenn einer zu weit zurück geht, kommt er sich schon wieder entgegen.
Du weißt viel von Geschichten, mein geneigter Erzähler. Du hast mich gefunden, das allein ist eine Unerhörtheit. Das kann nur einer im Jahr des Fuchses, und ich mutmaße, das bist du. Ich habe von dir gehört, und ich bitte dich, tu, wozu du hergekommen bist.
Wozu bin ich denn hergekommen?, dachte er.
Um mich zu erzählen. Um Hyazinthe zu erlösen.
Das tue ich gern, dachte er, und die Stimme und er erzählten weiter.
»Hyazinthe wurde älter und sah sich im Spiegel eine Maid werden: den schlanken Leib, die schmalen Hüften, die langen Beine und die kleinen festen Brüste. Es war ihr nicht geheuer damit, eine Jungfer zu werden, und mehr denn je dachte sie an den Garten mit den blauen Blumen. Dabei fiel ihr ein, dass es im Garten auch einen Jungen gegeben hatte.«
Hatte sie Angst davor, zu werden, was sie war?, dachte er.
Wer hat das nicht?, antwortete die Geschichte freundlich.
Und was hat es mit dem Spiegel auf sich?
Gerade du solltest das wissen. Im Spiegel schaute sie ihr Gegenüber. So etwas schaut man nur in Spiegeln, wenn überhaupt.
Gegenüber? Du meinst: das verlorengegangene Gegenstück?
Nein.
Dann das höhere Selbst?
Was für ein drolliger Ausdruck! Mitnichten!
Dann: die Antithese, die zur Synthese führt?
Jetzt wirst du albern. Nein, es ist alles viel einfacher. Erzähl weiter!
»Hyazinthe und der Junge spielten den Tag über gemeinsam, und wenn es Abend wurde, pflückte ihr der Junge immer einen Strauß von den blauen Blumen und schenkte ihn ihr. Er behauptete jedesmal, es seien tausend, aber da hätte in den Beeten ja keine einzige mehr stehen dürfen. Sie nahm sich immer vor, sie zu zählen, konnte sich jedoch nicht daran erinnern, es jemals getan zu haben. Sie vergaß es wohl jedesmal, weil der Abschied, den sie am Abend voneinander nahmen, so traurig war. Obwohl sie beide immer nach Hause gingen, hatte eines doch weder den Weg noch das Ziel des andern.«
Immer nach Haus, dachte er wehmütig, – geht es darum?
Ja, darum geht es.
Dann ist es eine traurige Geschichte.
Im Gegenteil. Erzähl weiter! Hyazinthe wird schon ungeduldig.
»Später stellte sie sich immer öfter vor den Spiegel und betrachtete sich. Sie drehte sich, schaute sich über die Schulter, schlang die Arme um den Leib, prüfte und musterte sich und wurde auf einmal zornig. Sie brachte ihr Gesicht so nah vor den Spiegel, dass das Glas von ihrem Atem beschlug, und forschte wild darin nach irgendetwas. Sie packte sich an den Haaren, stierte sich in die Augen, drückte Kinn und Wangen, und schließlich entdeckte sie es: Da lag noch ein anderes Gesicht in ihrem, das Gesicht eines Jungen mit den gleichen Zügen, genauso zornig, genauso scheu. Es schien nach ihr zu verlangen, als sollte sie es aus dem Spiegel befreien. Es war, als wäre sie selbst dieser Junge oder wäre sie jene Maid, die jener Junge war, der sich wünschte, jene Maid zu sein, die jener Junge war.«
»Das ist aber ganz schön verwickelt«, sagte Hyazinthe da und lachte. »Aber die Geschichte ist gut! Es könnte die richtige sein.«
»Ja, nicht wahr?«, sagte er. »Sie war sich selbst ein Spiegel. Mit einer Schere schnitt sie sich die Haare ab und drohte dem Gesicht im Spiegel, dass sie irgendwo, wo immer es diesen Jungen gäbe, es finden werde. Ein Junge, der ebenso vor dem Spiegel stünde und sich drehte und wild in seinen Zügen forschte und sich wünschte, jene Maid zu sein, die jener Junge war, der sich wünschte undsoweiter. Daran würde sie es erkennen. Das konnte keine Lüge sein, dachte sie. Doch wenn der Spiegel selbst die Lüge war, dann konnte keiner vor Schande sicher sein, oder?«
»Was hast du immer mit deinem Spiegel?«, rief Hyazinthe. »Erzähl mir lieber, wie es ausgeht.«
»Wie soll’s ausgehen?«, sagte er, weil die Stimme in seinem Kopf auf einmal schwieg. Was ist los?, dachte er. Warum erzählst du nicht weiter? Aber die Geschichte hatte sich verabschiedet, und nun saß er da ohne Fortgang und Ende.
»Wie immer bei getrennten Geschwistern«, sagte er achselzuckend. »Das ist nicht weiter von Belang.«
»Aber wohl!«, rief Hyazinthe und sprang auf. »Was sind das für Geschichten, die kein rechtes Ende haben! Gerade auf das Ende kommt es bei dieser Geschichte doch an!«
»Nun«, sagte er, weil er wirklich in Verlegenheit war, »dann kannst du dir doch selbst ein Ende für die Geschichte denken, oder nicht? Versuch es einmal!«
Hyazinthe schaute ihn verblüfft an und begann dann zu überlegen. »Gut«, sagte sie. »Dann ist sie eines Tages in den Spiegel hinein gegangen und dort bis an ihr Lebensende gefangen geblieben, platt und kalt und eins mit ihrem Traum von den blauen Blumen.«
»Pfui!«, sagte er. »Wie kannst du dir nur so etwas ausdenken!«
»Oder«, meinte sie leichthin, »wenn Euch das lieber ist: Sie hat sich aufgemacht in die weite Welt und den Jungen im Spiegel niemals gefunden und geheiratet und Kinder geboren und ist fett geworden wie alle.«
»Noch schlimmer. Das ist doch kein Ende für Hyazinthe.«
»Aber so ist es im Leben. Die Geschichten sollten anders ausgehen, aber das tun sie eben nicht. Nicht im wirklichen Leben.«
Hyazinthe verzog plötzlich das Gesicht, und er sah, dass ihr die Tränen kamen.
»Und in der Geschichte? Wie endet es da?«
Jetzt weinte sie und erzählte unter Schluchzen: »Sie findet einen Jungen, der ihr wirklicher Bruder ist, und sie kehrt nach Hause zurück. Und wenn sie dann vor dem Spiegel steht, ist sie froh, die Schwester ihres Bruders zu sein. Und wenn das ginge, würden sie heiraten und keine Kinder kriegen und bis an ihr Lebensende glücklich sein.«
»Und der Garten?«
»In dem würden sie wohnen, und der König würde sie besuchen, und sie würden ihm jedesmal einen Strauß von den blauen Blumen schenken. Weil ... es war nämlich der Garten des Königs, von Anfang an ... und der König ist ihr Vater ... und ...«
Er nickte und nahm das Mädchen in den Arm. Sie war ganz aufgelöst und plapperte weiter und schluchzte ein bisschen. Er tätschelte ihr den Rücken und tröstete sie.
»Du hast ganz Recht. Sie kehrt nach Hause zurück. Und die Welt hat immer auf sie aufgepasst, damit sie den Weg findet. Alle Wege führen nach Hause.«
»Aber nur in der Geschichte«, schluchzte sie und sah ihn an, mit verweinten Augen, in den Nasenlöchern glänzte der Rotz, die Lippen waren geschwollen.
»Nein«, sagte er und wusste plötzlich, dass es stimmte: »Auch im wirklichen Leben. Im Jahr des Fuchses führen die Wege immer nach Hause. Mach dir keine Sorgen! Ob Spiegel oder Eltern oder verlorener Bruder: Dein Gärtlein hat dir die Welt schon bereitet. Du wirst nach Hause zurückkehren. Da, wo du hingehörst, von Anfang an.«
»Und das ist nicht bloß eine Geschichte, die du erfindest?« Sie schaute ihn argwöhnisch an und nagte an ihrer Unterlippe.
»Wenn es eine Geschichte ist, dann die des Jahrs des Fuchses selbst. Dann ist das ganze Jahr eine Geschichte, und die Welt führt uns hinein und hindurch und dorthin, wo wir eigentlich hingehören. Dort, wo alle Geschichten enden, weil alles Wirklichkeit ist und nichts sonst.«
»Du bist ein guter Erzähler«, sagte Hyazinthe und gab ihm einen Kuss auf die Nase. »Ich glaube dir.« Dann rannte sie davon und füllte eine Gießkanne am Brunnenrohr, mit der sie den Salat wässerte.
»Die Erde ist ein bisschen trocken«, rief sie ihm zu. »Die Sonnenwirbelchen brauchen Wasser.«
»Und was ist mit dem Bann?«, rief er hinüber.
»Ich hab dich ein bisschen angeschwindelt«, rief sie lachend. »Ich bleibe gern hier. Und jetzt noch lieber, da ich die Geschichte von Hyazinthe kenne.«
Hab ich‘s mir doch gedacht!, dachte er und grinste zufrieden. Aber dass die Geschichte ihn auf halber Strecke hatte hängen lassen, das nahm er ihr übel.
Sie pflückte von den kräuseligen Salatblättern und brachte sie ihm. Sie schmausten den Salat und ein wenig Brot, das er im Felleisen hatte, und dann verabschiedete sie sich. Sie tat es frohen Herzens.
»Wisst Ihr«, sagte sie, »vielleicht ist es auch ein bisschen Eure Geschichte, Minstrel. Glaubt Ihr auch daran, dass alle Wege nach Hause führen?«
Er lachte. Sie hatte ihn ertappt.
»Ich weiß nicht, ob ich das glaube«, antwortete er ehrlich. »Aber ich versuche es. Ich wünsche mir, nach Hause zu kommen. Nur hab ich keinerlei Ahnung, wo das sein soll oder wie das aussieht. Anders als du mit deinem Gärtlein.
»Das ist schön«, sagte sie. Sie winkte ihm zum Abschied zu und rief noch: »Wir sehen uns dann dort!« und war irgendwo zwischen die Mauern geschlüpft.
Nun war er allein.
Die Blumen dufteten auf einmal stark, und etwas zog ihn zu ihnen hinüber. Er schaute sie genau an, strich zärtlich mit der Hand darüber und fühlte eine Bangigkeit im Herzen.
Was ist das?, fragte er sich. Aber er wusste es bereits: Es war Heimweh.
Gedankenverloren wollte er eine von ihnen pflücken und sich ans Hemd stecken; sie würde immer frisch bleiben und nicht welken, das wusste er. Doch dann hielt er inne.
Wenn es tausend wären, dann stimmte die Geschichte. Dann durfte er keine einzige davon nehmen. Wenn es weniger wären, dann käme es nicht darauf an. Dann war die Wirklichkeit sowieso krumm. Wenn es aber eine zu viel wäre, dann könnte er Geschichte und Wirklichkeit in Übereinstimmung bringen. Also begann er, die Blumen zu zählen.
Er zählte bis zum Abend, als die Sonne hinter den Talhang sank und er kaum mehr etwas sehen konnte, und am Schluss kam er auf eintausendundeins.
Die eine Blume ist für mich, dachte er.
Und er pflückte sie und steckte sie sich ans Hemd und ging dann zurück in den Wald, wo er in der Nacht noch eine gute Strecke zurücklegte.
4Freund Fuchs
Die Straße der Träumer. Die Straße der Heimkehr. Er ging sie mit einer Last im Herzen. Er spürte einen Schmerz rings um sich her, ein Weh in der Welt. Er hörte die Blätter seufzen, hörte das Klagen im Wind, hörte die Tiere jammern und spürte im fallenden Regen die Sehnsucht. Sie kannte er. Es war die Sehnsucht, die er immer in sich gespürt hatte, ein Fehlen von irgendetwas. Früher hatte er in der Welt nur das Leben gespürt, die Freude, da zu sein. Nun aber vernahm er den leisen Schmerz in allem. Die Welt wollte irgendwohin. Die Welt wollte, wie er, heim.
Aber wohin?
Dorthin, wo die Dinge endlich sie selbst waren. Wo sie aufgingen in ihrer Fülle, wo sie angefüllt waren von Sinn und Licht. Wo sie nichts waren als sie selbst.
Waren denn die Dinge, fragte er sich, als er so auf der Landstraße ging von irgendwoher nach irgendwohin, nur Zeichen? Hinweise auf etwas Anderes, Spuren, Fährten, Bilder für das, was sie erst sein würden? War nicht alles ein Traum, in dem einer nur Schatten begegnete, aber nicht den Dingen selbst? Und auch die Menschen, jeder Einzelne von ihnen – mussten sie nicht alle heim? Waren sie nicht auch Fremde in einer fremden Welt, die nicht ihr Zuhause war, wie er? Aufwachen aus einem Traum, dachte er. Aber wie und wohin?
Er war zuweilen melancholisch. Weltschmerz und Schwarzgalligkeit plagten ihn. Das rührte von Blaublume her, die er sich damals in der Grotte einverleibt hatte. Seither überfiel ihn manchmal der Blaue, saß in seinem Nacken und verführte ihn mit leisen, traurigen Melodien.
Der Tag neigte sich. In der Dämmerung ging er durch weite Wiesen, hüfthoch stand das Gras, Grashüpfer stoben davon unter seinem Schritt. Ihr Lied machte den Ort einsam. Er überlegte sich schon, wo er die Nacht verbringen sollte, er wollte nicht im Freien übernachten, er sehnte sich nach einem Dach und vier Wänden, oder zur Not hätte es auch eine Reisighütte getan. Da hörte er in seinem Kopf eine vertraute Stimme.
Sei gegrüßt, Minstrel ohne Namen!
»Fuchs!«, rief er erfreut, obwohl er den Fuchs im Zwielicht nicht ausmachen konnte. »Meister des Waldes, Hüter der Flur, Bewahrer der Welt! Wie kommst du hierher?«
Ich bin gekommen, weil du mich brauchst. Durch das Gras sah er eine kleine Gestalt auf sich zukommen, leise, zutraulich.
»Oh, mein Freund!« Er hatte Tränen in den Augen. »Ja, du hast recht. Ich brauche dich.«
Der Fuchs blieb vor ihm stehen, und er kniete sich nieder und drückte sein Gesicht in den Pelz, umarmte den Freund, hielt ihn fest. Er roch den Geruch, der ihm mehr Geborgenheit gab als irgendetwas, der Fuchs roch nach Wildheit und nassem Fell und Verlässlichkeit.
»Es ist gut, dass du da bist.«
Komm! Ich lade dich in meinen Bau ein.
Der Fuchs war der gute Geist des Jahres, das nach ihm benannt war. Seit er zwei Monde in seinem Bau gewohnt hatte, bei ihm untergekrochen war und sein ganzes Leben träumte, im Dunkeln saß und darüber nachdachte, wie es nach dem Verlust seines Schwertes weitergehen sollte – seither waren sie Freunde.
Er folgte dem Fuchs, der hinüber trabte zu einem bewaldeten Hügel. Unter den Bäumen war es finster, er sah den Fuchs kaum noch, konnte aber spüren, wo er war, und schließlich erreichten sie einen Hügel mitten im Wald.
Der Fuchs verschwand in einem Busch. Dort war der Eingang.
Folge mir. Du kennst das ja.
Er kroch dem Fuchs hinterher und spürte wieder wohlig die Wände aus Erde und Wurzeln um sich. Es ging bergab, an eine Abzweigung, dann ging es wieder leicht bergauf, und endlich kroch er hinein in die Kammer in der Mitte des Baus, wo der Fuchs saß, den Schwanz eingerollt, und auf ihn wartete.
Er holte wie damals sein Lichtchen hervor, eine kleine Blechbüchse mit einem blauen Lichtstein darin, der zu strahlen begann, sobald er die Blechklappen fallen ließ.
Der Fuchs blinzelte ihn an.
Bleib heute Nacht hier, wenn du magst.
»Das werde ich tun.« Er freute sich und baute sich mit dem Süßgras und dem Tüpfelfarn eine Schlafkuhle.
Du hast Fragen, die dich belasten.
»Zuerst«, sagte er freudig, »habe ich ein kleines Poem für dich mitgebracht. Es ist mir eingefallen, als ich an dich dachte.«
Oh, ein Geschenk des Minstrels an den Fuchs. Wie schön!
Der Fuchs lächelte. Er schien sich zu freuen und schaute ihn mit seinen Fuchsaugen an, in denen der Widerschien der Lampe glänzte.
»Eine Melodie fehlt noch dazu«, sagte er, »aber die könnte ich hier drin sowieso nicht singen. Nun denn, also.«
Und er trug mit heiterer, aber durchaus gemessener Stimme vor:
Der Fuchs dort mit dem Schwanz
sitzt in der Abendwiese:
ein Scherenschnitt im Glanz,
und auch die leise Brise
verrät dir nicht, wer er in Wahrheit ist:
Er wahrt die Welt, weiß immer, wer du bist.
Hübsch, sagte der Fuchs in seinen Gedanken. Das gefällt mir. Ernsthaft und doch mit der nötigen Leichtigkeit. Du hast mich gut getroffen, du Minstrel ohne Namen. Du hast viel gelernt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.
»Ja, das habe ich. Aber nun scheint sich mein Weg wieder zu wenden ...«
Wie ich sehe, trägst du noch meine Auszeichnung.
»Die Fuchsfibel, ja. Seit ich meine Berufung durch sie gefunden habe, halte ich sie in Ehren.«
Du irrst dich. Deine Berufung, die ich meinte, war nicht dein Umherziehen als Minstrel. Das hast du dir selbst ausgesucht.
»Stimmt«, gab er zu, »da hast du recht. Aber was ist denn dann meine Berufung?«
Deine Frage ist falsch, Freund. Deine Berufung wird dich finden, am Ende, wenn du sie erfüllt hast. Meine Auszeichnung soll dich stärken in deinem Zutrauen darauf, und sie soll dich den Leuten erkennbar machen.
»Du kennst meine Fragen, nicht wahr? Du weißt, womit ich herum kämpfe. Du weißt, dass ich nun auf der Straße der Heimkehr bin.«
Nenne den Weg, den du gehst, wie du magst. Das ändert nichts. Aber du spürst, dass sich etwas verändert im Jahr des Fuchses. Nicht wahr?
Eigentlich wollte er gar nicht reden. Er legte sich in die Kuhle, die er sich gemacht hatte, drückte sich in das duftende Heu und wollte auf einmal nichts weiter als schlafen. Schlafen an einem sicheren, geborgenen Ort.
Du hast recht. Verzeih! Fühl dich sicher und geborgen hier. Ich streife durch die Nacht und werde über dich wachen. Nur eins noch: Du bist mit deinem Weh nicht der Einzige.
Der Fuchs ließ ihn allein. Er hörte den Freund in den Gängen scharren und schnuffeln, dann war er fort.
Er legte sich bequem, löschte die Lampe und starrte im Dunkeln noch eine Weile vor sich hin. Aber er konnte keinen klaren Gedanken fassen, und bald schlief er ein.
Mitten in der Nacht wachte er auf. Er wusste nicht, wie spät es war. Der Fuchs lag zusammengerollt neben ihm und atmete leicht und regelmäßig.
Er lag eine Weile mit offenen Augen. Er spürte wohltuend die Erde um sich herum, den Grund über sich, die fünf Klafter bis zur Oberfläche. Hier war er sicher, aber nicht sicher vor dem, was ihn umtrieb. Auch in der Erde, im Fels, unter dem Getier, das kroch und sich wand, spürte er das Weh. Die Erde schien unterwegs zu sein, aufgebrochen vorwärts in die Zeit. Auch in ihr war ein Fehlen. Auch sie wollte heim. Und in sich fühlte er die Sehnsucht deutlicher als je. Er fragte sich, was es für einen Sinn hatte, unterwegs zu sein, Lieder zu singen und Geschichten zu erzählen, die Menschen auf den König aufmerksam zu machen, wenn alles gleich blieb. Wenn der Sommer endlos war und das Jahr des Fuchses die einzige Welt, die es gab.
Aber, wie der Fuchs gesagt hatte: Die Welt änderte sich. Sie war im Wandel, und er spürte es in der Erde, im Wasser, in der Luft.
Und er? Wohin war er unterwegs auf dieser Straße der Heimkehr? Wo war sein Heim, das er sich wünschte und zugleich nicht vorstellen konnte? Es ging nicht um Haus und Frau und Kinder. Es ging nicht um Sesshaftigkeit. Es ging darum, irgendwohin zu gehören. Mit etwas verbunden zu sein, das stärker war als das Alleinsein auf der Landstraße. Wenn er das hätte, könnte er frei und unbekümmert in der Welt herum ziehen, könnte er die fernsten Länder erkunden und die aberwitzigsten Leute treffen: Er wüsste immer, wohin er gehörte.
Gab es nicht nur das Jahr des Fuchses? Gab es wirklich eine Welt jenseits davon? Gab es eine Welt, die auf sie alle zukam, stand sie an der Pforte, schickte sie ihre Boten?
Du hast recht, Freund, meldete sich plötzlich der Fuchs. Er hatte nicht bemerkt, dass er aufgewacht war. Aber das Jahr des Fuchses ist nur ein Übergang. Es wurde als Übergang geschaffen, damit wir offen sind für das, was kommt.
»Hast du sie geschaffen?«, fragte er ins Dunkel.
Nein, das weißt du. Der König hat sie geschaffen. Als er fortging.
»Und jetzt ... verändert sie sich?«
Du spürst es in allem. Du bist einer der wenigen,die das vermögen. Auch das gehört zu deiner Berufung.
»Wohin will die Welt? Wohin will ich? Was ist das, das da plötzlich als Zukunft, als Heimat auftaucht? Ich habe das Gefühl, dass es so weit zurückliegt, dass es uns in der Zukunft schon entgegenkommt. Das kenne ich ja. Ist das Alte, das Uralte, der Anfang, zugleich das Neue, das Kommende?«
Die Zeit ist wie das Leben. Sie strömt in allem, und ist doch selbst nichts. Achte nicht auf sie. Das Wahre ereignet sich in langer Zeit, aber es ist nicht Gewesenes oder Kommendes. Es ist alles in der ewigen Ankunft.
»Also doch ewig?«
»Ewig im Jahr des Fuchses. So, wie der Sommer ewig ist im Jahr des Fuchses.«
Nun brauchte er Licht. Er entflammte seinen Lichtstein, öffnete aber nur eine Klappe. Gespenstisch erhellte die Lampe die Kammer. Der Fuchs saß und schaute ihn an.
Er legte die Arme um ihn und schmiegte sich an seinen mageren Leib. Er roch das Fell, roch die Wildheit und Unzähmbarkeit, fühlte das Zutrauen, die Sanftheit der Freundschaft in seinem Fell. Er schloss die Augen und spürte die Nähe des Freundes. Unerhört, dass er ihn so nahe kommen ließ. Empfand der Fuchs Zuneigung? Konnte er sich einem bestimmten mehr zuwenden als allen, für die er sorgte? Der Fuchs war die Freundlichkeit selbst, aber eine Freundschaft mit ihm – war das möglich?
Ich bin kein Gott oder so etwas, meinte der Fuchs freundlich. Ich bin ein Geschöpf wie jedes im Jahr des Fuchses. Auch ich bin einsam, denn ich bin der einzige Fuchs in dieser Welt. Eine Gefährtin gibt es für mich nicht, und gerne würde ich einfach Fuchs sein, in der Abendwiese eine fette Maus jagen, durch die Auen streifen und das Leben wittern. Aber ich bin der, nach dem diese Welt benannt wurde. Ich bin der, der sie zu hüten hat. Ich habe eine Gabe der Freundlichkeit empfangen, sie hilft mir zu tun, was getan werden muss. Ich bin kein Ankläger, kein Verteidiger, kein Richter. Ich bin nur der Fuchs.
Er schwieg und ließ den Fuchs los. Er wusste nicht, ob er ihm zu nahe getreten war. Ob er sich ungebührlich verhalten hatte. Dann entdeckte er im Fell des Fuchses, auf dem Rücken, etwas Weißes. Er forschte mit den Fingern und zog die Strähne lang. Sie war weiß wie Silber.
»Was ist das?«, fragte er arglos. Dann kam ihm ein fürchterlicher Verdacht.
»Du wirst älter!«
Auch ich verwandle mich.
»In was?«
Am Ende werde ich ein ganz gewöhnlicher Fuchs sein. Ich werde eine Gefährtin bekommen, und wir werden Junge haben und die ganze Welt mit Füchsen bevölkern. Dann werde ich nicht mehr der Einzige sein.
»Und wann wird das sein? Steht der Wandel unmittelbar bevor, oder dauert es noch lange?«
Der Wandel hat bereits begonnen. Der Wandel setzte ein, als das Jahr des Fuchses erschaffen wurde. Erst jetzt wird er allmählich sichtbar. Tausend Sommer mögen wie ein Tag erscheinen, und ein Tag wie tausend Sommer.
»Und ich? Werde ich nach Hause kommen?«
Du bist wie jeder. Alle Wege führen nach Hause, egal wie du sie nennst.
»Und wird es dann dies alles hier nicht mehr geben? Wird es dahin sein, wie jetzt die alte Zeit dahin ist?«
Verwechsle nicht die Vergänglichkeit mit Sterblichkeit. Nicht alles, was vergeht, stirbt. Nicht alles, was vergeht, wird Geschichte. Und nicht alle Geschichte ist vergangen. Manche Geschichte ist noch nicht zu Ende. Hör auf den Großen Erzähler, Freund! Hör, wie er seine Geschichte erzählt, und warte auf das Ende. Erst dann wirst du verstehen.
»Danke, lieber Freund«, sagte er und strich dem Fuchs über das Fell. »Ich bin froh, dass du mich gefunden hast.
Ich weiß, dass mein kleines Liedchen über dich von gestern Abend nicht an dich heran reicht. Es ist vielleicht albern und unnütz, aber ich kann nichts Großes dichten. Ich lebe von dem Kleinen, das sich freut, da zu sein.«
Mach dir keine Gedanken darüber, Freund, sagte der Fuchs und lächelte. Du tust, was du tust. Es gibt keinen Maßstab, der groß von klein unterscheidet. Alles ist Leben. Und nun schlaf weiter, Freund. Die Nacht ist noch jung.
Als der Fuchs gegangen war, löschte er das Licht und wägte die Worte, die er gehört hatte. Er hätte nicht im Traum daran gedacht, dass sich das Jahr des Fuchses einmal ändern könnte. Dass die Welt selbst unterwegs war, wie er. Er dachte daran, dass auch der Fuchsbau für ihn keine Heimat sein konnte. Er war eine Zuflucht, ein Versteck, und er dachte daran, wie viele Zufluchten er auf seinen Wanderungen bereits gefunden hatte, Winkel, in denen er unterkriechen konnte. Vielleicht war das alles an Heimat, was er kriegen konnte im Jahr des Fuchses: Oasen. Oasen der Geborgenheit und Nähe, kurzzeitige Begegnungen, in denen ihn die Minne streifte, Freundschaften, Zuneigung, Huld, aber immer flüchtig, immer vergänglich.
Er war dankbar dafür. Zwar konnte er auf diesen Inseln, die aus dem Meer des Tagfürtag heraus ragten, nicht bleiben, aber er bekam eine Ahnung davon, was Bleiben heißen würde.
Dann merkte er, dass ein Frieden in ihm eingezogen war, für diese Nacht, für diesen Augenblick, und er kuschelte sich ins Heu und schlief bald ein.
5Marigold
Ein rechter Springsinsfeld sein, dachte er und sprang tatsächlich in das Feld, das mit goldenem Kukuruz und raschelnden Blättern im Mittag lag, zwischen Wäldchen und der Landstraße, die nah vorüberzog. Hier würde ihn niemand finden. Er zwängte sich durch die Stauden, hatte seine Stiefel auf das Felleisen geschnallt und ging barfuß, spürte die trockene Erde unter den Fußsohlen, fand ein Loch, in dem der Hamster baute, störte die kleinen Vögel auf, die im Kukuruzwald Insekten fingen, und fand manches verloren gegangene Blümchen, das hier Asyl gefunden hatte.
Er legte sich lang, schob das Felleisen unter seinen Kopf, zog den Hut über die Augen und schaute sich die braungoldene Dämmerung hinter seinen Lidern an. Er horchte.
Vogelstimmchen. Das Rascheln des Windes in den Blättern. Ein Guckigauch, der fern über den Wäldern rief. Der Katzenschrei eines Greifs hoch oben im Himmel. Eine Feldlerche, die im Steigen und Sinken ihre Melodienreigen herab perlen ließ. Die Landstraße, die stumm und geduldig ihre Bahn zog. Das Getier in der Nähe, das wimmelte und wuselte. Eine Kutsche kam gerollt, ihr Rasseln und das Klippklapp der Pferdehufe. Ein Trip ins Ungefähre, ins Heitere, dachte er. Fairy, blond wie Feenhaar. Landsitze tauchen in den Feldern auf, Seen liegen wie Seide hinter den Wiesen, der Wald duftet nach Holz und Blatt, und die Damen setzen zierliche Füße in den Staub, raffen die Röcke, pflegen eine versonnene Unterhaltung und hegen leichtsinnige Heiratspläne. Hochzeit in Weiß. Lauben auf dem Anger, blumenbesteckt. Desiree’s Bouquet. Kornblumen, Mohn und weiße Margeriten. Orakelblume: Erliebt-mich-er-liebt-mich-nicht. Lange Tafel, Festtafel, und sie beide, schuldlose Lämmer, reingewaschen mit strahlenden Kleidern, ihr Goldhaar geflochten und zum Kranz hochgesteckt. Hand in Hand. Blanke Blätter, von keines Geschichte beschrieben. Um ihre Finger das heitere Gold des Bundes, lange zuvor geschlossen. Eh ich dir die Hand gegeben, hab ich ferne dich gekannt. Fahrt ins Ungefähre, ins Heitere.
Er schreckte hoch. War er eingenickt? Was war das gewesen?
Seine Fantasie war wieder auf Abwege geraten. Das passierte öfter. Wenn er nicht auf sie aufpasste, galoppierte sie davon ins Reich der Wünsche und Träume. Kutschen, Feenhaar, Hochzeitstafel. Woher kam das?
Er dachte eine Weile nach und beschloss, dass ihn das nichts anzugehen brauchte. Er hatte geträumt, es war ein lichter Traum gewesen, voller Schönheit und Versprechen, und dabei wollte er es belassen.
Schönheit war das Versprechen des Glücks.
Wer hatte das gesagt? War das nicht Leander gewesen, damals, als er seine Berufung fand? Und hatte er ihm nicht die Grundlagen der Musica beigebracht?
Wenn er so lag im Mittag, versteckt im Kukuruzfeld, und die prallen Kolben in den Blättern sah, gut verpackt mit dem braunen Haarpuschel am Ende, schien es ihm wieder, als ob sich nie etwas änderte. Hier war einmal kein Weh zu spüren. Hier herrschte die reine Freude am Leben.
Und das war es, was ihn immer wieder zum Dichten trieb. Er konnte die Welt sich nicht einfach ereignen lassen. Indem er zuhörte und zuschaute und recht ein Teil davon war, musste er etwas damit anfangen. Etwas hervor bringen, was es so noch nicht gab: nämlich das Bild der Welt, wie er sie gerade erlebte. Anfangen: am besten ein Lied oder eine Geschichte. Es bereitete ihm großes Vergnügen, dann etwas in der Hand zu haben von dem, was so ungreifbar um ihn her vorging. Er schuf Edelsteine und sammelte Schätze. Schätze, die er weitergeben konnte, damit andere sein Erlebnis teilten. Das war es, was seinem Minstreldasein Sinn gab.
Auch jetzt juckte es ihn wieder, wie er da so lag und döste. Beim Lauschen wurde er immer unruhiger. Bald musste er zugreifen und sich das Beste, das Wesentliche heraus fischen. Bald gaukelte der Zwiefalter so keck vor seiner Nase, dass er ihn fangen musste. Und bald klang das Liedchen, das ihm zugeflogen war, so süß in seinem Gemüt, dass er es zum Klingen bringen musste.
Eigentlich ein unruhiges Dasein, dachte er und lächelte unter seinem Hut. Immer die Sinne offen. Immer auf dem Sprung. Immer machen und tun. Aber es war ein heiteres Metier, ein Geschäft, dass sich wohl Tag für Tag erledigen ließ, ohne mühselig zu werden.
Er setzte sich auf, rückte seinen Hut zurecht und bemerkte, dass neben ihm ein Marigold blühte. In sattem Orange mit gelber Mitte, an aufrechtem Stängel mit gefiederten Blättern.
»Ach, was machst du denn hier?«, sagte er, holte seine Laute hervor und kniete sich vor das Blümchen hin. Und weil er Hochzeitstafeln und Goldringe im Kopf hatte, zupfte er eine kleine Melodie und sang leise der niedlichen Schönheit dort zwischen dicken Kukuruzstauden:
Aus Birkenlaub und Marigold
flecht ich dir einen Kranz.
Ich bitte dich, sei mir so hold
und nimm mich wenn, dann ganz!
Er blickte auf das Blümchen nieder, ob dem wohl der Gesang gefalle, und entdeckte plötzlich ein Paar nackter Füße mit angemalten Nägeln, die im Gras standen.
Er schaute daran empor und sah schlanke, braungebrannte Beine, den Saum eines Kleides, die schmalen Hüften, den keuschen Ausschnitt und dann das sommersprossige Gesicht, aus dem ihn neugierige Augen anstarrten. Das Haar war lang und blond, wie Feenhaar, und um den Kopf herum saßen große orangene Blütenblätter.
»Na?«, fragte das Mädchen, als er fertig war mit Anschauen.
»Wer bist du denn?«
»Ich bin die, die du gefreit hast. Und ich sage: Ja!«
»Gefreit? Habe ich wen gefreit?«
»Ich bin Marigold. Das siehst du doch. Und nun sind wir vermählt.«
»Mach keinen Quatsch, Mädchen!«, sagte er rüde. Er fand das nicht lustig. Aber tatsächlich stand die Blume nicht mehr, wo sie vorher gestanden hatte. Sie war verschwunden. Stattdessen stand dieses Mädchen da.
»Ist das ein Gaukel?«, fragte er brüsk. »Wenn ja, dann muss ich dir sagen, dass kein Zauber im Jahr des Fuchses bei mir verfängt.«
»Was wird das ein Gaukel sein!«, schimpfte das Mädchen. »Ich bin es wirklich. Marigold. Und noch niemand hat mir einen Antrag gemacht. Aber nun gilt’s. So ist die Welt.«
»Wie, was? Antrag? Wieso Antrag?« Er war zu verdattert, um zu verstehen, was vorging.
Statt einer Antwort packte sie ihn am Arm und zog ihn hoch. Er war einen halben Kopf größer als sie. Sie umarmte ihn und gab ihm einen feuchten Kuss auf die Wange.
»Puh«, sagte sie, »du solltest dich mal wieder rasieren!«
»Jetzt Moment mal!«, sagte er entschieden und schob sie mit den Armen auf Abstand. »Ich bin jetzt mit dir vermählt, nur weil ich einer unschuldigen Blume ein Liedchen gedichtet habe?«
»So geht’s in der Welt«, sagte das Mädchen leichtfertig. Aber leichtfertig war ja wohl er gewesen. Er hätte wissen sollen, dass Lieder und Geschichten im Jahr des Fuchses manchmal ungeahnte Wirkungen zeitigten.
»Und wir sind jetzt ein Leben lang zusammen?«, fragte er und befürchtete das Schlimmste.
»Zumindest einen Tag lang. Wir wollen Spaß und Kurzweil haben, nicht wahr, mein lieber Gam?«
»Nur diesen Tag?« Er atmete erleichtert auf. Dann schaute er sie noch einmal von oben bis unten an. »Gut, ich denke, das lässt sich ertragen. Du willst Spaß und Kurzweil. Was stellst du dir darunter vor?«
»Du musst dir was einfallen lassen. Das ist deine Aufgabe als Gam.«
Das kann ja was werden, dachte er. Vorbei ist es mit der Muße. Das hat einer davon, wenn einer leichtsinnig von Hochzeiten träumt.
Sie hüpfte von einem Bein aufs andere und war ungeduldig.
»Los, mach einen Vorschlag!«, mahnte sie. »Oder sollen wir uns vielleicht zuerst lieben? Es heißt ja, dass die Menschen besonderes Vergnügen daran haben. Ich würde es gern einmal ausprobieren ...«
»Oh nein, nein«, wehrte er ab. Das fehlte noch, dass er am helllichten Tag, mitten im Kukuruzfeld, mit einem wuschigen Blumenmädchen zugange wäre. »In der Nähe ist ein Fayre, soweit ich weiß. Lass uns dorthin gehen!«
»Was ist ein Fayre?«, fragte sie neugierig.
»Das wirst du sehen, wenn wir dort sind.«
Und damit ihr unterwegs nicht langweilig würde und damit er sich nicht ihr unentwegtes Geplapper anhören musste, gab er ein paar von seinen Liedchen zum Besten, die ihm in leichten Stunden eingefallen waren. Kleine lustige Dinger, die guten Laune machten und auch ein wenig Übermut besaßen.
»Du bist aber ein lustiger Gesell«, sagte sie, befremdet, aber nicht ohne Bewunderung.
»Ich bin ein Minstrel. Ein wandernder Sänger und Erzähler. Und du bist das erste Geschöpf aus meinen Liedern, das lebendig wird.«
»Bah!«, machte sie. »Ich bin nicht aus einem deiner Lieder. Mich gab es schon, bevor du deinen Antrag gemacht hast. Bild dir bloß nichts ein!«
Dann kam das Dorf in Sicht, in dem der Fayre stattfand, und ein großes Transparent, mit Blumen bekränzt, hieß sie willkommen. Die Leute hatten alte Leintücher zusammengenäht und in fröhlichen Farben darauf gepinselt: Fayirie.
Sie hörten schon die Musik spielen, der Duft von Gegrilltem wehte ihnen entgegen, und lauter lustige Leute waren unterwegs. Marigold mit ihren Blütenblättern fiel gar nicht auf, und er als Fahrender Sänger schon gar nicht. Irgendwie schienen die Leute Lust an Kostümen zu haben, wenn sie auf den Fayre gingen, sie trugen Helme mit Hörnern aus Pappmaché, blumenbunte Kittel und klappernde Holzschuhe, einer hatte sich die Haare zu einer grünen Mähne gefärbt, ein anderer trug seine Mistgabel wie eine Standarte, die Frauen hatten sich heraus geputzt und schnatterten rotbackig mit den Nachbarinnen, und alle genossen das Fest, das einmal im Sommer stattfand – aber Sommer war ja immer! – und zu dem viele Leute aus der Gegend anreisten.
Hinein ins bunte Treiben, und Marigold staunte, was es da alles an Buden und Ständen in den schmalen Gassen gab. Manche Bauern boten auch die Früchte ihrer Arbeit an, aber meistens wurde Firlefanz und Kinkerlitzchen verkauft, die keiner brauchte, Naschereien und Getränke und Spiele, bei denen man unnütze Gewinne machen konnte.
Ihm fiel ein, dass er derzeit keine Münzen im Beutel hatte. Das hatte er nicht bedacht, als er den Fayre vorgeschlagen hatte. Marigold sah nicht so aus, als wollte sie es beim Zugucken belassen. Aber – seltsam genug – Marigold bekam alles, was sie wollte, umsonst. Sie ging zu einem Stand, weil sie Durst hatte, und kam mit zwei Bechern Waldmeisterpunsch zurück.
»Wohlsein!«, sagte sie und leerte den Becher in einem Zug. Er ließ sich mehr Zeit und kostete den mildsüßen, krautigen Geschmack aus.
Sie ergatterte für sie beide knusprige Teigfladen, die mit Rahm bestrichen und Speck und süßem Kraut belegt waren, frisch aus dem Ofen, und krachend bissen sie ins Gebäck.
Sie wollte an der Lotterie teilnehmen und gewann mit ihrem Los einen Spielzeugbären aus Gras; sie warf Bälle auf Dosen und traf nicht einmal eine; sie fuhr mit der Schiffsschaukel und jauchzte vor Vergnügen; sie naschte Liebesäpfel und Mamelukischen Honig, sie knusperte Magenbrot und gebrannte Mandeln; sie ließ sich Eiskrem auf eine Waffel streichen und leckte genussvoll alles auf; sie angelte in Holzwolle versteckte Päckchen und bekam eine winzige kupferne Schelle, die sie an ihr Dekolletee knüpfte und die fortan mit ihrem Klingkling ihren gemeinsamen Gang begleitete.
Einmal blieb er bei einem Jäster stehen und hörte ihm zu. Es war einer, der noch der alten Sitte verpflichtet war; er erzählte Geschichten aus der alten Zeit, und er machte es nicht schlecht. Ihm gefiel die Geschichte, auch wenn er sie schon kannte, aber Marigold langweilte sich. Sie wollte etwas erleben. Also gingen sie weiter, und der Jäster strich seinen mageren Lohn an Groschen und Batzen ein.
Marigold zeigte mit dem Finger und stellte Fragen. Auf einem Schimmel hatte sich ein Mädchen mit kurzem Kleid und rotem Haar als werweißwer verkleidet. Wanderstöcke aus Weichselholz wurden feilgeboten, aus Strohballen war den Kindern eine Burg gebaut worden, in der sie klettern und sich verstecken konnten, Latwerge und Kräuterpasten gab es, jemand verkaufte Salböle und Seifen, und stracks ging er zu dem Stand und hielt Marigold ein Stück Seife unter die Nase.
»Kennst du den Duft?«
»Das riecht wie ich«, sagte sie erstaunt.
»Kein Wunder«, entgegnete er und lachte. »Die wird ja auch aus den Säften deiner Blüte gemacht.«
»Pfui, du bist geschmacklos!«, empörte sie sich, und er stupste sie auf ihre so herrlich kraus gezogene Nase.
An einer Bude wurde getöpfert und gebrannt, kleine zierliche Gefäße mit stillen Mustern, die ihm sehr gefielen. Marigold auch. Aber sie stellte fest, dass sie wenig damit anfangen konnte, und er wusste, dass Gebranntes zu zerbrechlich war fürs ständige Unterwegssein.
Der Nachmittag verging leicht und unbeschwert. Marigold amüsierte sich prächtig, und er genoss das kurzweilige Treiben um ihn her. Einmal überlegte er, dass er sich auch hinstellen und etwas aus seinem Repertoire darbieten könnte. Aber er hatte keine Lust. Münzen brauchte er nicht, und der Tag mit Marigold war zu vergnüglich. Immer wieder umhalste sie ihn und küsste ihn auf die Wange, und immer bekam er zu hören, dass er sich doch mal wieder rasieren solle.
Hast du eine Ahnung, dachte er. Er war so froh, dass ihm die Haare im Gesicht wuchsen. Denn es gab ja eine Zeit, da war das bisschen Kraut an seinem Kinn nicht weitergediehen, ums Verrecken nicht!
So wurde es allmählich Abend. An den Buden wurden Lichter und Laternen entzündet, der Duft eines Spanferkels am Spieß zog durch die Gassen, und mehr und mehr verfügten sich die Leute auf den Festplatz mitten im Dorf, wo eine Kapelle spielte und ein Tanzboden aufgebaut war.