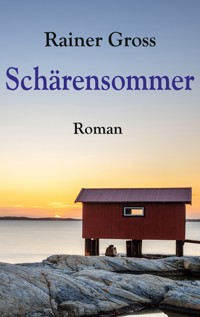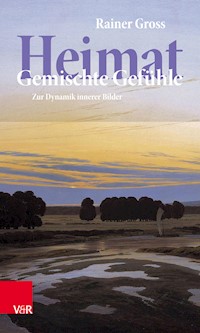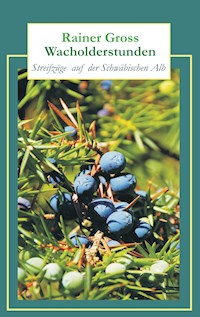Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Richard Eder, 44 Jahre, lebt mir seiner Frau Anne auf Juist und arbeitet als Ingenieur beim Wasserwirtschaftsamt. Eines Tages bekommt er Schlafstörungen, Angstattacken und Depressionen. Er wird krankgeschrieben und beginnt eine Therapie bei Dr. Schrödinger auf dem Festland. Der rät ihm, sein Leben aufzuschreiben, und weil Richard keine Ahnung hat, was mit ihm los sein könnte, folgt er dem Rat. Das Schreiben allerdings verwirrt ihn und wirft beunruhigende Fragen auf. Wer ist das, der da über sich selbst schreibt? Was war das, damals während des Studiums, mit seiner ersten Liebe Franziska? Was zieht ihn jetzt, während er krank ist, zu Jenny, der Vogelschutzwartin von Memmert, hin? Und was hat das alles mit seiner Faszination für das Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger zu tun, genannt „Schrödingers Katze?“ Erst als Richard sich selbst ein Kätzchen anschafft, lichtet sich das dunkle Geheimnis in seiner Lebensgeschichte. Das Protokoll einer abenteuerlichen Selbsterkundung, eingebettet in die nordische Meereslandschaft. Spannend wie ein Krimi, witzig wie eine Satire, bewegend wie ein Drama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller in Reutlingen.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).
Bei BoD u.a. erschienen:
Die Welt meiner Schwestern
Das Glücksversprechen
Yūomo
Haus der Stille
Ich mag meine Katze nicht, und es tut mir leid, dass ich jemals etwas mit ihr zu tun hatte.
ERWIN SCHRÖDINGER
Ich heiße Richard Eder und bin vierundvierzig Jahre alt. Ich interessiere mich für Quantenphysik. Das ist eine Liebhaberei von mir. Ich frage gern nach dem Ursprung des Universums und dem Wesen der Wirklichkeit. Ich meine, wissen wir denn wirklich, was um uns herum ist?
Daran muss ich manchmal denken, wenn ich aus dem Fenster meines Arbeitszimmers im ersten Stock auf das Meer hinausschaue. Das Haus steht an der Südseite, ich schaue also aufs Juister Wattenmeer. Drüben auf dem Festland liegt Norddeich, das ich aber nicht sehen kann, und die dunkelblauen Streifen der Memmertbalje und der Juister Balje, dazwischen das glitzernde Band des Nordlands. Ich sehe links drüben den Leuchtturm und rechts die Vogelinsel. Es ist ein beruhigender Blick. Beruhigender als auf der Nordseite, wo man auf die weite Nordsee hinaussieht und die Dünen sind und die Wellen an den Strand schlagen. Dort wird alles Mögliche angeschwemmt, sogar Leichen könnten es sein, das gefällt mir nicht.
Jedenfalls interessiere ich mich für Quantenphysik, und das ist schon ein seltsamer Zufall, dass der Psychologe, zu dem ich seit Neuestem gehe, drüben, in Norden, auf dem Festland, weil ich kaum noch Schlaf finde, ausgerechnet Schrödinger heißt. Wegen Schrödingers Katze, dem berühmten Gedankenexperiment aus der Quantenphysik, und er, der Psychologe, hat tatsächlich eine. Mehr ein junges Kätzchen, das auf seinem Schoß liegt und schnurrt und das er krault, mit wühlenden Fingern in dem flaumigen Fell, während ich ihm erzähle. Das stört mich manchmal und manchmal tut es mir fast körperlich wohl.
Warum mir die Sache mit Schrödingers Katze, also dem Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger, nicht aus dem Kopf geht, warum sie mir so wichtig ist, dass ich sie überhaupt hier hinschreibe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie etwas mit diesem Schreiben oder meinen Schlafstörungen zu tun hat. Schrödinger hat mir empfohlen, meine Gedanken aufzuschreiben. Mehr so für mich selbst, aber wenn ich wolle, könne ich ihm auch daraus vorlesen.
Das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Ich habe immer nur einen Termin in der Woche, die Fährfahrt zum Festland ist weit, und ich habe nur eine Dreiviertelstunde, da möchte ich Dringenderes mit ihm besprechen als diese Aufzeichnungen hier. Zum Beispiel meine Nervosität und die plötzlichen Heulkrämpfe, die ich bekomme. Die Tabletten, die mir der Neurologe verschrieben hat. Die Krankschreibung, wegen der sie mich auf der Insel schon scheel anschauen. Warten Sie’s ab, hat er gesagt. Schreiben Sie sich an das Problem heran, hat er gesagt.
Welches Problem?
Er hat immer wieder nach meiner Vergangenheit gefragt. Ob es in meinem Leben schwierige Situationen oder schmerzliche Erlebnisse gegeben habe, einen tiefen Einschnitt oder so. Aber da gibt es nichts, das habe ich ihm versichert. Nur die Trennung damals von Franziska, aber das ist ja schon über zwanzig Jahre her.
Trotzdem will er, dass ich schreibe. Also schreibe ich halt.
Ich soll aus meinem Leben erzählen, sagt er. Ich soll einfach mal drauflosschreiben, und wir könnten dann gemeinsam versuchen, ein Muster darin zu erkennen. Was für ein Muster? Der Ansatz stamme von einem bekannten, inzwischen verstorbenen Schweizer Schriftsteller, Max Frisch, von dem ich noch nie etwas gelesen habe. In der Schule hatten wir den vielleicht, auf dem Gymnasium in Freising, ich kann mich da verschwommen an etwas erinnern, irgendein Ingenieur, der sich schließlich in seine eigene Tochter verliebt, ohne es zu wissen, so eine Art Ödipus, aber ich weiß nicht.
Ich war damals ja in der reformierten Oberstufe und hatte Deutsch als drittes Prüfungsfach, sprachlich konnte ich mich schon immer gut ausdrücken, und in Diktat und Aufsatz hatte ich früher immer eine Eins, also in diesem Deutsch-Grundkurs kam ich zum ersten Mal mit Franziska zusammen. Wir waren Freunde, weiter nichts. Dass wir zusammen waren, kam erst später. Als ich studierte, an der TU in München. Ich habe 1990 ein Studium zum Ingenieur für Wasserwirtschaft begonnen und es 1994 mit dem Diplom abgeschlossen.
Aber sollte ich nicht lieber am Anfang beginnen? Wie erzählt man aus seinem Leben? Da ist doch zuerst eine Art Lebenslauf nötig, damit man die Eckdaten kennt, oder? Aber ich kenne die Eckdaten ja, wieso soll ich sie hier noch einmal aufschreiben? Sie glauben, Ihr Leben zu kennen, sagt Schrödinger, aber schreiben Sie ruhig einmal das Bekannte und Vertraute auf. Wir werden dann gemeinsam sehen, ob sich ein Muster zeigt.
Was für ein Muster?
Vielleicht sollte ich einmal bei diesem Max Frisch nachschauen. Ich muss Schrödinger fragen, wo das bei dem steht.
Es ist ganz angenehm, hier am Rechner zu sitzen und zu schreiben. Durch die Krankschreibung habe ich ja jetzt viel Zeit und kann zuhause bleiben. Anne ist das auch ganz recht, dann passt jemand auf das Haus auf, während sie im Jugendheim ist.
Soll ich das jetzt erklären? Jugendbildungsstätte August Wilhelm Reutter e.V.? Wo Anne pädagogische Leiterin ist? Egal.
Jedenfalls kann ich im Haus schalten und walten, wie ich will. Es ist ein kleines Backsteinhaus direkt an der Billstraße, die hier bloß ein Weg aus Knochensteinen ist, weil ja sowieso kein Auto fährt. Weil auf der Insel kein Autoverkehr erlaubt ist und die Leute mit dem Fahrrad fahren oder die Pferdekutsche nehmen, besonders die Touristen.
Aber das ist doch alles Quatsch! Für wen schreibe ich das denn? Für mich, dachte ich. Dann kann ich mir die Erklärungen auch sparen. Oder ich habe das Gefühl, dass ich es noch für jemand anderen schreibe, einen außenstehenden Leser, einen Beobachter, oder jemanden, dem ich mein Leben erkläre. Das ist natürlich Blödsinn, aber vielleicht ist das beim Schreiben so. Vielleicht hat sich Schrödinger das so gedacht. Ich muss ihn fragen.
Ich sitze am Rechner, der Bildschirm steht auf meinem Schreibtisch am Fenster im ersten Stock, durch das ich aufs Watt hinausblicken kann. Das habe ich, glaube ich, schon geschrieben. Ich mache mir unten in der Küche einen Schwarztee, einen Ceylon Blatt, und trage das Tablett mit dem Stövchen, der Kanne und der Tasse mit ostfriesischem Rosenmuster die Wendeltreppe hinauf. Ich stelle das Tablett auf einem kleinen Tischchen ab, einem Teetischchen mit gedrechselten Füßen und Holzintarsien, und mache mich an die Arbeit.
Als Arbeit sehe ich das natürlich nicht. Anfangs, nach der Krankschreibung, hat es mich schon Mühe gekostet, nicht an meinen Job zu denken, nicht liegenbleibende Arbeit doch zuhause zu erledigen. Ich habe alle Programme, die ich brauche, auf meinem privaten Rechner, weil ich oft zuhause nochmal etwas nachrechnen muss, deshalb kann ich ihn auch von der Steuer absetzen. Dass ich jetzt hier sitze und Zeit habe und keine Berechnungen oder Ähnliches anstelle, ist ungewohnt. Aber mittlerweile gefällt mir das ganz gut. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann: so nachdenken und ab und zu ein paar Sätze schreiben, aus dem Fenster schauen, die Zeit verstreichen lassen.
Die Zeit.
Was ist die Zeit?
Zeit ist relativ, sagt Einstein. Zeit ist eine vierte Dimension des Raums. Wenn es Tachyonen gibt, die schneller als Licht fliegen, dann bewegen sie sich rückwärts in der Zeit. Und für einen Astronauten, der mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, steht die Zeit still. Was soll man davon halten, wenn man so am Rechner sitzt, den Ceylon FOP neben sich auf dem Stövchen, und über sein Leben nachdenkt?
Man glaubt zu wissen, was Zeit ist, aber wird man danach gefragt, kann man nicht sagen, was sie ist.
Die Sache mit Erwin Schrödingers Katze verhält sich so: In einer Kiste wird eine Menge radioaktiven Materials untergebracht, wovon innerhalb einer Stunde so viel zerfallen kann, dass höchstens ein Teilchen freigesetzt wird. Dieses Atom des Materials kann also in einer Stunde ebensogut zerfallen wie es nicht zerfallen kann. Das Teilchen wird, falls es freigesetzt wird, von einem Geigerzähler aufgefangen, der dann über ein Relais ein Hämmerchen auslöst, das eine Zyankalikapsel zertrümmert. In diese Kiste wird nun eine Katze gesetzt, die Kiste verschlossen und abgewartet.
Durch die Konstruktion aus radioaktivem Atom, Geigerzähler und Zyankalikapsel ist das Ganze ein geschlossenes, miteinander verschränktes System, einschließlich der Katze. Das Leben der Katze hängt also davon ab, ob innerhalb einer Stunde ein Atom zerfallen wird, also von einem quantenphysikalischen Vorgang.
Bei solchen Vorgängen im Innern der Atome kann man nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Man weiß nicht, wann ein bestimmtes Atom zerfallen wird, man weiß nur, dass im statistischen Mittel nach einer bestimmten Zeit die Hälfte der Atome zerfallen sein wird. Die Wahrscheinlichkeit für ein Atom in der Kiste beträgt also jeweils fünfzig Prozent, dass es zerfallen oder dass es nicht zerfallen ist. Deshalb beträgt auch die Wahrscheinlichkeit jeweils fünfzig Prozent, dass die Katze lebt oder dass sie tot ist. Die Katze befindet sich nicht in einem bestimmten Zustand, sondern in der Überlagerung zweier Zustände, nämlich dem des Totseins und des Lebendigseins.
Die Katze erfüllt, nach der Kopenhagener Deutung der Quantentheorie von 1927, die gesamte Kiste nicht als Objekt, sondern als Wahrscheinlichkeitsfunktion. Solange niemand in die Kiste hineinsieht, also niemand diese quantenphysikalisch verschränkten Vorgänge beobachtet, kann niemand sagen, in welchem Zustand sich das System befindet. Die Katze ist demnach weder tot noch lebendig oder sie ist beides zugleich. Schrödinger drückte das drastisch aus: Sie ist zu gleichen Teilen gemischt oder in der ganzen Kiste verschmiert.
Erst der Blick in die Kiste lässt, wieder nach der Kopenhagener Deutung, die Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammenbrechen, beendet die Überlagerung und realisiert das Atom, die Kapsel und die Katze in einem bestimmten Zustand: Entweder findet man eine lebendige oder eine tote Katze.
Erst das Hineinschauen also tötet die Katze, oder noch verrückter: lässt sie rückwirkend gestorben sein. Bis dahin ist sie eine scheintote oder scheinlebendige Wahrscheinlichkeitswelle.
Das ist nach dem gesunden Menschenverstand so hirnrissig, wie Schrödinger es 1935 beabsichtigt hatte. Es ist ja nur ein Gedankenexperiment, das zeigen sollte, wie abstrus die Kopenhagener Deutung ist, wenn man sie von quantenphysikalischen auf makroskopische Vorgänge, also Geigerzähler, Zyankalikapseln und Katzen, überträgt.
Ich finde das Experiment trotzdem faszinierend. Erst in dem Moment, wenn ein Zuschauer von außen in das System eingreift, wird über den Tod der Katze entschieden. Zuvor kann sie alles sein, und niemand weiß es. Ist die Rückseite des Mondes da, auch wenn keiner hinsieht? Ist mein Haus da, auch wenn ich einkaufen gehe und es keiner anschaut? Ist jemand in der Vergangenheit gestorben, auch wenn ich nicht dabei war und es gesehen habe? Oder stirbt er erst in dem Augenblick, da ich die Vergangenheit ansehe, in die Kiste schaue?
Ich habe Schrödinger davon erzählt. Ich habe gemerkt, dass er damit nicht viel anfangen kann. Ich solle mich weniger um die Katzen seines Namensvetters kümmern, als darum, mein Leben zu erzählen, sagt er.
Aber mich lässt diese Katze in der Kiste nicht los. Irgendwas daran begeistert mich. Vielleicht, dass die Wirklichkeit nicht das ist, was wir von ihr meinen. Dass nichts so festgelegt und bestimmt ist, wie wir tagtäglich glauben.
Jedenfalls, für mich ist klar, dass ich nicht in die Kiste schauen würde; dann hätte die Katze wenigstens noch eine Chance, am Leben zu sein.
Manchmal sitze ich auf dem Sofa unten im Wohnzimmer und weiß nicht mehr weiter. Wirklich: Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Mir ist nicht bloß langweilig, nein, alles, was mir einfallen würde zu tun, ergibt keinen Sinn mehr. Ich kann es tun oder auch lassen, es bewirkt nichts, es führt zu keinem Gewinn oder Erfolg oder auch nur zu einem guten Gefühl. Alles ist gleichgültig. Dann lasse ich es lieber. Ich will mich gerade auf nichts einlassen, lieber so sitzen und aus dem Fenster schauen, den Wolken zuschauen, wie sie über dem Watt ziehen, den wechselnden Lichtstimmungen, den Regen, die grau und düster kommen, den Spaziergängern auf der Billstraße.
Ja, diese Spaziergänger gehen, als hätte das bloße Gehen für sie einen Sinn. Sie leben ein Leben, das ihnen gehört und von dem sie nicht im Traum denken würden, dass es verlorengehen könnte. Ich beneide sie darum. Man lernt erst schätzen, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Mir ist das früher nie aufgefallen, wie selbstverständlich und leichthin man herumgeht und sein Leben besorgt, sich nie fragt: Wozu eigentlich? Was kommt am Ende dabei heraus? Ist es der Mühe wert?
Diese Selbstsicherheit, diese Unbekümmertheit habe ich verloren. Ich habe mein altes Leben verloren und noch kein neues bekommen. Ich weiß nicht mehr, wozu ich aufstehen und mich waschen, wozu ich mir die Zähne putzen und mich rasieren und anziehen soll. Wozu ich nach unten in die Küche gehen und mir einen Becher Tee machen soll.
Der Becher Tee ist noch das Einzige, was mich aufrechthält. Ich freue mich darauf. Es ist ein fester Punkt in meinem Tageslauf, und wenn ich ihn getrunken habe, befällt mich die Angst, dass jetzt nichts weiter kommt.
Ich rasiere mich nicht mehr. Anne meint, ich sehe verwegen aus. So fühle ich mich gar nicht. Ich fühle mich bloß müde, ausgebrannt, leer. Anne meint, da ich jetzt so viel zuhause sei, könne ich doch einkaufen und Essen kochen, bis sie abends von der Arbeit komme. Ich könne auch die Sachen am Haus erledigen, die schon lange anstehen.
Zuerst war ich empört, weil ich doch krankgeschrieben bin. Vielleicht hat sie ja recht. Sie meinte, das werde mir sicher guttun. Was die Leute sagen, wenn ich als Kranker draußen herumlaufe und einkaufe und Wäsche wasche und die Dachrinne ausputze, weiß ich nicht. Es gibt sowieso schon Gerede.
Heute habe ich eingekauft. Es soll Labskaus geben und Spiegeleier und rote Beete. Darauf hatte ich Appetit. Und ein gutes Bier dazu. Schon lange habe ich kein Bier mehr getrunken, überhaupt kaum Alkohol. Mal ein Glas Wein zum Essengehen oder einen Whisky am Abend zu einem schönen Film. Aber Bier, zum Durstlöschen? Dazu war Mineralwasser viel besser, oder wie man in meiner Heimat sagt: Sprudel.
Sprudel. Ein komisches Wort. Der Sprudel. Der Sprudel kommt aus dem Fels, sprudelt und gischtet in seinen natürlichen Trog, perlt und schäumt; man tunkt seinen Kopf hinein, bis es eisig schmerzt; man schöpft die Hände voll und trinkt daraus.
Sprudel.
Lebendiges Wasser.
Beim Zeitschriftenhändler habe ich mir gestern einen Zigarettentabak gekauft, einen zum Rollen. Und Papierchen. Ich hatte Lust zu rauchen.
Anne schüttelte den Kopf. Das Rauchen hatte ich seit dem Umzug nach Kiel aufgegeben. Und selbst gedreht habe ich seit damals an der TU nicht mehr. Franziska hat mich aufgezogen, weil meine Zigaretten immer dünn und krumm wurden.
Ich habe nach dem Tabak gefragt, den ich damals geraucht habe, aber den gibt es nicht mehr. Schade. Hab ich halt einen anderen genommen, einen Halfzware, die hab ich früher gemocht. Aber ich rauche nicht auf Lunge, das könnte ich gar nicht mehr. Ich inhaliere den Rauch so halb, paffe mehr, der Rauch beißt in den Augen und gibt einen würzigen Duft im Zimmer. Ich darf nur in meinem Arbeitszimmer rauchen, Anne mag das nicht. Und draußen rauchen ist bei dem Wind, der meistens geht, ziemlich witzlos.
So sitze ich jetzt in meinem Zimmer am Rechner, schaue aus dem Fenster und rauche. Vielleicht drei, vier Zigaretten am Tag. Immer wenn mir beim Schreiben nichts mehr einfällt. Der Gestank nach einem Tag, wenn ich morgens aus dem Bad hereinkomme, hat etwas Bedrohliches, das ist merkwürdig. Einerseits riecht es wie damals in Franziskas Dachzimmer, während des Studiums in München, und das macht mich irgendwie froh. Andererseits hat es etwas von Verwahrlosung, von Chaos und Rücksichtslosigkeit, an die Tabaksaftflecken an den Fingern und die Raucherzähne muss ich denken, und morgens hereinzukommen, wenn die Asche kalt geworden ist und stinkt, ist trostlos.
Aber es ist mein Zimmer. Ich lüfte morgens, und nach der ersten Zigarette rieche ich es nicht mehr. Anne will gar nicht mehr hereinkommen, sie zieht die Nase hoch, und dann denke ich einfach: Dann bleib halt draußen.
Oft weiß ich nicht weiter. Ich bin dann ganz froh, wenn es etwas zu tun gibt, das Abendessen vorbereiten oder einkaufen oder die Verandamöbel reinigen. Obwohl ich solche Sachen ohne Freude mache. Ich tue sie, damit ich etwas zu tun habe, ich könnte sie genausogut lassen, aber weil sie anstehen, mache ich sie.
Wenn ich dann wieder auf dem Sofa oder am Rechner sitzen kann und die Leere, das Nichtstun mich wieder einfängt, bin ich erleichtert und denke, dass ich nun wieder zum Wesentlichen komme. Aber was soll am Herumsitzen und aus dem Fenster Schauen wesentlich sein?
Auch das Schreiben ist nichts Wesentliches. Ich tue es einfach, und wie der morgendliche Becher Tee gibt es mir einen festen Anhalt im Tageslauf. Aber manchmal lasse ich die Hände sinken und gebe die Tastatur frei, als sollte sie von selbst weiterschreiben, und die Leere ist wieder da, die Sinnlosigkeit. Jedes Wort, das ich dann schreibe, ist sinnlos und hohl, überflüssig, aber weil alles keinen Sinn hat, kann ich auch Überflüssiges tun.
Ich kann nicht einfach von meinem Leben erzählen. Das langweilt mich. Ich will nicht über mein Leben nachdenken. Es ist alt und verbraucht und fühlt sich jetzt so an, als wäre es schon vorbei. Das Einzige, was mich ein bisschen reizt, sind die Geschichten aus der Studienzeit, so eine Art Nostalgie. Ich wollte nicht wieder zwanzig sein, auf keinen Fall, und ich denke auch nicht, dass mein Leben damals sinnvoller war als heute. Aber es war irgendwie witziger, bunter, interessanter, es war etwas darin, was heute fehlt.
Schrödinger würde mich fragen: Was fehlt denn?
Der Sprudel, würde ich sagen.
Ein Lebenslauf. Ausformuliert. Curriculum vitae, sagte mal ein Professor damals an der TU. Ich habe nie tabellarische Lebensläufe geschrieben, mir gefielen ausformulierte besser. Wo fängt man an mit dem Erzählen seines Lebens? Am Anfang. Das nähme sich dann so aus:
Ich wurde als drittes Kind des Wachstuchfabrikanten Rudolf Schrödinger und der Emilia Brenda am 12. August 1887 in Wien geboren. Mein Großvater mütterlicherseits war ein berühmter Chemieprofessor an der k.u.k. Technischen Hochschule. Mein Vater war katholisch, meine Mutter protestantisch, aber wir Kinder wurden evangelisch aufgezogen.
Mit zwölf Jahren ging ich auf das Akademische Gymnasium in Wien und studierte danach, von 1906 bis 1910, Mathematik und Physik am Wiener Physikalischen Institut. Daselbst Habilitation.
Den Weltkrieg überlebte ich und folgte danach Berufungen an die Universitäten Jena, Stuttgart, Breslau und Zürich. Hier hatte ich den Lehrstuhl für Theoretische Physik inne, den zuvor Albert Einstein vertreten hatte, und formulierte die nach mir benannte berühmte Gleichung, mit der ich die Wellenmechanik als Beschreibung der Quantenphysik begründete.
Am sechsten April 1920 heiratete ich Annemarie Bertel, mit der mich bis heute ein zärtliches Angedenken verbindet.
Sieben Jahre später trat ich die Nachfolge von Max Planck an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin an. Im Jahr der Machtergreifung Hitlers verließ ich Deutschland und bekam eine Stelle am Magdalen College in Oxford, wo mir im selben Jahr der Nobelpreis verliehen wurde. Das ebenfalls berühmte, nach mir benannte Gedankenexperiment erfand ich 1935.
Wie es dazu kam, dass ich 1936 nach Österreich zurückkehrte, aber zwei Jahre später erneut meine Heimat verlassen musste und 1943 in Dublin am Trinity College meine bekannten Schrödinger lectures gab, tut hier nichts zur Sache.
Jedenfalls kehrte ich 1956 nach Wien zurück und lehrte dort bis zu meinem Tod am Institut für Theoretische Physik der Universität Wien. Ich starb am 4. Januar 1961 an Tuberkulose. Begraben wurde ich wunschgemäß in Tirol, wo ich an den Hochschultagen teilgenommen und es mir zu Lebzeiten außerordentlich gefallen hatte.
Was ist das für ein Ton? Der übliche Ton von Biografien? Der amtliche Lebenslauf-Ton? Wie absurd das wird, wenn einer tot ist, wenn einer sich selber zu Ende schreibt! Ich muss mir meine alten Lebensläufe nochmal anschauen. Wie habe ich damals geschrieben? Ich brauchte ja, glaub ich, nur zwei zu schreiben. Der letzte auf die Stelle hier in Norden ist zehn Jahre alt.
Ich wurde als einziges Kind des Einzelhandelskaufmanns Otto Theodor Eder und der Hausfrau Roswitha Eder, geb. Zierngiebl, am 15. November 1968 in Pulling, Kreis Freising geboren – was für ein banaler Blödsinn! So kann ich jedenfalls nicht aus meinem Leben erzählen.
Lebenslauf. Curriculum vitae. Altmodisch. Wo soll ich einen Lebenslauf für mich hernehmen? Ich werde einen erfinden müssen. Vielleicht erfindet man sein Leben immer.
Schrödinger will einen Lebenslauf? Dann soll er einen bekommen. Wird schon sehen, was er davon hat.
Franz Wilhelm Sternbald wurde am 31. Dezember 1963 als siebentes von dreizehn Kindern geboren, im Regen der Raketen und Feuersterne, die seine erste Erinnerung ausmachen. Sein Vater Freimut Sternbald war Diplomat im Fürstentum Liechtenstein, seine Mutter Laetitia eine gefeierte Sopranistin.
Früh entwickelte er eine tiefe Zuneigung zu seiner nächstälteren Schwester Franziska, die im Alter von neunzehn Jahren in eine Haftstrafe wegen Inzucht mündete.
In der Grundschule schrieb er fantasievolle Aufsätze, die die Bewunderung seiner Lehrerin hervorriefen, und im Gymnasium verblüffte er das Kollegium mit seinem umfassenden Verständnis der Schrödinger-Gleichung.
Im Jahr 1983 verließ Franz seinen Geburtsort und begann ein Globetrotterleben, das ihn durch die ganze Welt führte. Er lebte in Thailand in einem buddhistischen Tempel, trat im Orient einem Derwisch-Orden bei, erlebte die Wirren des kongolesischen Bürgerkriegs und zog in Hongkong einen internationalen Gewürzhandel auf. Als er in Valparaiso die Reederei seines Großonkels übernahm, kam es zu einem vollständigen Familientreffen, bei dem er wehmütige Heimatgefühle nicht unterdrücken konnte.
Im Jahr 2002 ergriff er die Laufbahn eines erfolgreichen Schriftstellers und veröffentlichte zwei Jahre darauf mit dem Roman Franz Sternbalds Wanderungen einen Bestseller. Er heiratete seine Cousine Françoise und lebt seither als Kosmopolit und Berater für Quantenheilung auf Sansibar.
Diese biografische Darstellung fand ausdrücklich seine Billigung.
Morgens bleibe ich jetzt lange im Bett. Ich finde keinen Grund aufzustehen. Ich schlafe bis sieben, bis Anne aufsteht, dann, wenn sie weg ist, schlafe ich wieder ein. Die letzten Stunden döse ich herum, habe intensive, aber wirre Träume und komme nicht in den Tag hinein. Gegen zwölf stehe ich dann auf, aber nur deshalb, weil ich das Herumdösen und Träumen nicht mehr aushalte. Ich mache mir einen Becher Tee, einen Assam im Beutel etwa, und rauche. Meistens zwei Zigaretten. Ich schalte den Rechner ein und lese, was ich gestern geschrieben habe. Oder auch nicht.
Oft sitze ich am Rechner und weiß nicht, was ich schreiben soll. In meinem Kopf ist es wüst und leer. Tohuwabohu. Nein, es ist eigentlich nicht leer. Es herrscht ein Knäuel von Gedanken, Bildern und Stimmungen. Lauter Fäden baumeln heraus, und wenn ich einen von ihnen zu fassen kriege und daran ziehe, schnürt sich das Knäuel noch enger zusammen.
Morgen ist Mittwoch. Da fahre ich wieder nach Norden, zu Schrödinger. Dann werde ich ihn nach diesem Max Frisch fragen und danach, ob es normal ist, dass einem beim Schreiben immer einer zuschaut.
Ein weiterer Lebenslauf:
Robert Rede war der zweite Sohn des Werkmeisters Karl Rede und der Hausfrau Else Rede, geb. Jenssen. Er wurde am 23. Juni 1981 in Bremen geboren und brach sich bei der Geburt den rechten Arm, was aber aufgrund einer Fehleinschätzung der Hebamme erst einen Tag später entdeckt wurde.
Robert Rede war in der Grundschule immer ein Außenseiter, was sich im Gymnasium fortsetzte. Er behauptete eine Sonderstellung aufgrund seiner herausragenden Leistungen und fand nur wenige Freunde. Dort lernte er Maria Koch kennen und zog mit ihr nach dem Abitur zusammen. Beide begannen ein Studium an der Universität Bremen, er mit den Fächern Theologie und Germanistik. Er trat aus der Kirche aus, verweigerte den Kriegsdienst mit der Waffe, verließ jedoch vor der Verhandlung vor dem Landesgericht seine Heimat und suchte in der Südsee sein Glück. In Samoa allerdings, einer Station seiner Anreise, scheiterte sein Ausstieg, weil das Reisebüro ihm in betrügerischer Absicht ein ungültiges Flugticket verkauft hatte.
Nach seiner Rückkehr war er ohne Orientierung. Maria Koch hatte inzwischen ein Verhältnis mit seinem engsten Freund begonnen, den sie später auch heiratete. Robert Rede versuchte erfolglos, als Förster, Kapitän und Zimmermann unterzukommen, bevor er sein begonnenes Studium wiederaufnahm.
Er verweigerte sich zunehmend dem Studienbetrieb, den an ihn gestellten Forderungen einer konventionellen Bildungskarriere und der kommerziell geprägten Leistungsgesellschaft in Deutschland. Nach nur zwei Jahren brach er das Studium ab, lebte eine Zeit lang von Gelegenheitsarbeiten und staatlicher Unterstützung, bis er 1986 unter einem Fernzug der Deutschen Bundesbahn sein frühes Ende fand.
So kann ich das nicht stehen lassen. Es gibt immer Alternativen. Wer weiß, welche versteckten und offenen Weichenstellungen einen Lebenslauf so willkürlich, so zufällig erscheinen lassen. Also:
Robert Rede war der zweite Sohn des Werkmeisters Karl Rede und der Hausfrau Else Rede geb. Jenssen. Er wurde am 23. Juni 1981 in Bremen geboren und brach sich bei der Geburt den rechten Arm, was aber aufgrund der Besorgnis des Vaters früh genug entdeckt wurde.
Als Kind zogen ihn besonders Zoologische Gärten und Häfen an, und sein Vater unternahm mit ihm ausgedehnte Wanderungen in der Umgebung Bremens. Seine Vorstellung von der großen weiten Welt hat dort nach eigenem Angaben ihren Ursprung.
Robert Rede nahm in der Grundschule immer eine besondere Stellung ein, was sich im Gymnasium aufgrund seiner herausragenden Leistungen fortsetzte. Er lernte dort Maria Koch kennen und zog mit ihr nach dem Abitur zusammen. Beide begannen ein Studium an der Universität Bremen, er mit den Fächern Theologie und Germanistik. Er trat aus der Kirche aus, verweigerte den Kriegsdienst mit der Waffe, verließ Deutschland jedoch vor der Verhandlung am Landesgericht und suchte in der Südsee sein Glück.
Bereits während des Studiums hatte er sich zunehmend dem Studienbetrieb, den an ihn gestellten Forderungen einer konventionellen Bildungskarriere und der kommerziell geprägten Leistungsgesellschaft in Deutschland verweigert.