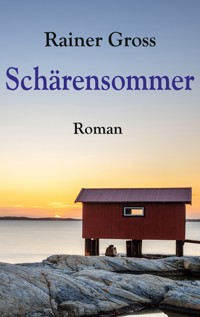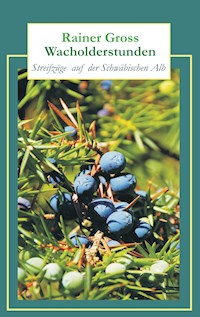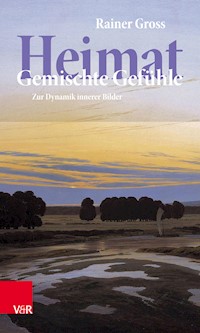
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Heimat« löst Erinnerungen und intensive Gefühle aus – ein Assoziationsgenerator, heute auch ein politischer Kampfbegriff: Der Text analysiert personale und kollektive Bilder von »Heimat«: Der soziologische Blick von außen stellt die Frage nach der Funktion von Heimat für individuelle und nationale Identitätsbildung. Deren oft unbewusste Voraussetzungen – so Gross' These – liegen primär in der Psychodynamik und Genese von »Heimat-Gefühlen« im Spannungsfeld zwischen vorgegebener Herkunft und selbstgewählten Sehnsuchtsorten der Ankunft, zwischen Idealisierung eines verlorenen Paradieses und utopischer Verklärung der Sehnsuchtsorte, zwischen Kollektivpsychologie und individueller Biographie. Immer mehr Menschen sehnen sich heute nach Zugehörigkeit, versuchen aber im Gegensatz zu den exkludierenden, starren Bildern von Heimat ihren Heimatbegriff im Plural zu denken: aufgehoben sein, daheim sein, bei sich selbst, in Beziehungen, Beruf ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Gross
Heimat
Gemischte Gefühle
Zur Dynamik innerer Bilder
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Caspar David Friedrich: Das Große Gehege bei Dresden | bpk | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | Jürgen Karpinski
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-90140-4
Inhalt
Einleitung
IHeimat – die Sicht von außen
Heimat – Was ist das, was soll das sein? Ein Ort? Ein Gefühl?
Heimat aus Herkunft – Heimat als Ankunft
Heimat aus Herkunft
Heimat im Plural: Die Fähigkeit, sich in Beziehungen/Orten/Konstellationen zuhause zu fühlen
Heimatgefühle »light«: Volksmusik, Lederhosen und Politik
Heimat, Heimatliebe und Nationalstaat – eine natürliche Einheit?
Nationalstolz und Nationalismus – in Deutschland und anderswo
Ein Psychoanalytiker als »Gewissen der Nation«: Alexander Mitscherlich, Heinrich Böll und Günter Grass denken öffentlich über Heimat nach
Staatsbürgerschaft als letzte Identitätsstütze?
Populärkultur als Identitätsstütze: Der deutsche Heimatfilm
Ein Heimatfilm als Hollywood-Welterfolg: The Sound of Music
Der Weltbürger: Vom philosophischen Ideal zum Lieblingsfeind der Gegenwart?
Jeder soll irgendwo dazugehören – der Weltbürger als »citizen of nowhere«?
Michael Balint: Philobaten und Oknophile
»Unsere Wurzeln« – eine potentiell gefährliche Metapher vom Ursprung
Von den Wurzeln zur Konstruktion einer Biographie
IIIdentität und Heimat – Identität als Heimat?
Sozialpsychologische Positionen zur Identität: Lothar Krappmann und Heiner Keupp
Psychoanalytische Positionen zur Identität
Sigmund Freud
Von Erik H. Erikson bis Otto Kernberg
Neuere psychoanalytische Identitätskonzepte
Identität als Verzahnung zwischen Individuum und Gruppe
Identitätsdiskurse zwischen politischer Philosophie, Populismus und Psychoanalyse
Ganzheit, Totalität und Ambiguitätsintoleranz
»Wir sind wieder wer«: Die Fußball-National-Elf als Testlabor für Nationalgefühle
Salman Akhtar: Identität und Immigration
Kultur des Individuums vs. kollektivistische Kultur independent self – interdependent self
Die entscheidende Wichtigkeit der Sprache
Heimat in der Sprache – Entfremdung in der Fremdsprache
Eva Hoffman: Lost in Translation
Nostalgie und Heimweh: Verschiebung und Idealisierung?
Politische Nostalgie: Reaktionäres Denken oder der Glanz der Vergangenheit
Politische Nostalgie und Ressentiment als Identitätsstützen: Das Beispiel der »Ostalgie«
IIIDer Blick von innen: Psychoanalyse und Heimat
Sigmund Freud: Freiberg/Wien/London: »Die Fremde ist überall so ungastlich …«
Der störungsanfällige Weg zum »inneren Objekt Heimat«
Inzest-Verbot und Exogamie-Gebot
Roger Kennedys Konzept der »Seelen-Heimat«
Phantasien von Einheit und Reinheit: Die Kehrseite der Heimatsehnsucht als Sehnsucht nach dem idealen prä-ambivalenten Zustand
Ressentiment/Nationalgefühl/Heimat: Ein Fallbeispiel um 1800
Ein Analytiker als Friedensstifter: Der »Feindgruppenanalytiker« Vamik Volkan
Deutsche Mythen nach 1945: Vom Wirtschaftswunder und anderen identitätsstiftenden Narrativen
Soll sich der Patient in der Therapie daheim fühlen?
Selbstgewählte Orte der Heimat – Symptom und/oder Bewältigungsstrategie
Heimatgefühle sind immer gemischte Gefühle
Literatur
Anmerkungen
Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben.
JEAN AMÉRY
Ich finde das Wort Heimat schön. Ich bin dafür, es zu erhalten, es neu zu definieren.
HEINRICH BÖLL
Wir taten uns schwer mit der Bedeutung des Wortes Heimat.
NORA KRUG
Einleitung
Heimat, daheim, heimisch: Kaum ein anderes Konzept hat im medialen Diskurs der letzten Jahre eine solche Hochkonjunktur erlebt. Das Nachdenken über Heimat als Ort oder aber Heimat als Gefühl, die Ängste vor der Gefährdung dieser Heimat durch Zuwanderung, die identitätsstiftende Funktion von Heimat – das sind Dauerthemen der letzten Jahre geworden, allgegenwärtig in den Medien spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015.
Auch in diesem Fall gilt wohl die Regel, dass der besonders häufige Gebrauch eines Begriffs meist ein Hinweis darauf ist, dass es um den Inhalt dieses Begriffs nicht zum Besten steht: Für »Heimat« würde das bedeuten, dass wir uns fast alle in Zeiten der Verunsicherung und Entwurzelung, in Zeiten von globalem Uniformierungsdruck zunehmend fremd und unbehaglich fühlen – eben nicht heimisch in einer kälter gewordenen Welt. Heute wünscht sich vermutlich jeder einen Ort, an dem er zuhause ist. Sei dies nun ein realer Ort in der eigenen Kindheit, ein Herkunftsort – oder aber ein ersehnter Ort der Ankunft in der Zukunft, in einer Familie, einer Liebesbeziehung oder in der Zugehörigkeit zu einer Gruppe.
Die in diesem Diskurs evozierten inneren Bilder von Heimat oszillieren zwischen Gedächtnis und Sehnsucht, zwischen nostalgischer Verklärung der Vergangenheit und utopischen Zukunftsvisionen. Wir kennen dumpfe rückwärtsgewandte Bilder von Heimat bis hin zur nationalistisch-exkludierenden Gefühlsmischung eines brütenden Ressentiments. Wir kennen aber auch offenere, inklusivere Formen und Konzepte von Heimat: Denn während Heimatgefühle bis vor wenigen Jahren von fortschrittlichen Menschen, von Intellektuellen abschätzig bis misstrauisch betrachtet wurden als sentimentale Gefühlsaufwallungen von Volksmusik-Fans, als Charakteristikum kitschiger, tränenseliger Heimatfilme, hat sich dies deutlich geändert: Viele Jahrzehnte lang schienen sowohl Bildung als auch eine »kritische« politische Haltung fast automatisch eine Verachtung der naiven Heimatsehnsucht »einfacher Menschen« zu inkludieren. Theodor W. Adornos Diktum, dass es fast schon moralisch geboten sei, sich »bei sich selbst nicht zuhause zu fühlen«1 – zumindest der liberale Teil des Bildungsbürgertums und die jüngere Generation hätten es wohl mehrheitlich unterschrieben und über die Musikantenstadl-Fans gelächelt.
Heute aber können sehr viele – durchaus auch jüngere und nicht konservative – Menschen den Begriff »Heimat« für sich selbst positiv besetzen: Sie berichten über ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Ankommen, nach dem Erleben von Sicherheit in einer Gemeinschaft. Im Gegensatz zum klassisch-konservativen Heimatbegriff aber ist es für sie möglich und auch wünschenswert, sich an mehreren Orten, in unterschiedlichen Situationen, mit verschiedenen Personen nebeneinander oder auch nacheinander zuhause zu fühlen.
Daher müsste man eigentlich zur Begriffsklärung dieser verschiedenen Facetten von Heimatgefühlen eingangs fragen: Von welcher Heimat, von wessen Heimat sprechen wir eigentlich, wenn wir heute von Heimat sprechen? Schon das Wort »Heimat« steht nicht allein – es steht etwa in der Mitte einer Kette verschiedener Begriffe. Diese beginnt am »Kältepol« mit den martialisch-klirrenden Worten »Nation« oder »Vaterland«, setzt sich dann über das fast immer positiv konnotierte Wort »Heimat« fort hin zum hellen, wärmeren Gegenpol mit den Adjektiven heimatlich, heimisch und dem Adverb zuhause. An diesem »Wärmepol« aber scheint die Begriffskette offen. Sie franst geradezu aus in unverbindlich-positive Werte wie Sicherheit, Zugehörigkeit, Aufgehobensein. Letztlich geht es hier um ein allgemeines diffuses Wohlfühlen im Sinne von »psychischer Wellness«. So verwundert es auch nicht, dass uns die Werbung nicht nur gesunde Nahrungsmittel, sondern fast alle Gebrauchsgegenstände als »heimisch« und damit auch »natürlich«, ganzheitlich und insgesamt positiv verkaufen will.
Beim weiteren Nachdenken über Heimat sind wir also konfrontiert mit den gegensätzlichen Gefahren einer allzu engen oder aber allzu weiten, überdehnten Definition des Begriffs: Im Falle der Engführung des Heimatbegriffs wird dieser meist auf einen konkreten Ort begrenzt, auf den Herkunftsort, die Familie und maximal noch die umgebende Region. Damit wird das Konzept zwar ziemlich trennscharf und ausreichend stabil, aber eben auch starr und exklusiv bzw. exkludierend. Im Gegensatz dazu droht bei einer allzu großzügigen Ausweitung des Begriffs bis hin zum unverbindlichen Wohlfühlen und zur Gemütlichkeit die Beliebigkeit: Der Begriff ist dann allzu weit und dadurch flach geworden. Er bietet kaum noch Trennschärfe, bedeutet fast nichts mehr bzw. für jeden Anwender Unterschiedliches.
Man könnte vermuten, dass gerade die Auseinandersetzung mit der schillernden Vieldeutigkeit des Begriffs »Heimat« hier entweder durch die Engführung des Fundamentalismus oder aber durch die übergroße Ausdehnung bis hin zur Gleichgültigkeit erfolgreich vermieden wird.
Bei allem Nachdenken über Heimat bleiben die dazugehörigen Emotionen immer in einem Spannungsfeld zwischen Herkunft und Ankunft, zwischen vorgegebener Biographie und veränderbarer, selbst erkorener »Wahlfamilie« oder auch ersehnten »Wahlheimaten«: Der Begriff »Heimat« bleibt ein Assoziationsgenerator und damit immer auch ein politisch umkämpftes Konzept. Aber das Nachdenken über die ganz individuelle Bedeutung des Begriffs »Heimat« bietet für jeden Einzelnen auch eine Chance zur Klärung, dadurch auch zur Stärkung und Stabilisierung der eigenen Identität – zwischen Herkunft und Hoffnung, zwischen den eigenen Wurzeln und Flügeln.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert: Ich beginne mit dem Versuch, über historische, soziologische und politische Positionen zum Begriff »Heimat« nachzudenken. Ich verfolge die Geschichte des Begriffs vom Deutschland der Romantik über die Funktionalisierung von »Heimat« im Nationalismus und die folgende Pervertierung im Nationalsozialismus. Konsequenz davon war das Misstrauen speziell der Intellektuellen gegenüber diesem »kontaminierten« Konzept nach 1945. In den letzten Jahren hat diese Skepsis eine Wandlung erfahren bis hin zum Nachdenken über einen »aufgeklärten« Begriff von Nationalismus.
Heimatgefühle gibt es heute nicht nur bezüglich des Ortes unserer Herkunft und Kindheit, Heimat können wir auch suchen und finden in Situationen und Konstellationen der Ankunft: Wir empfinden uns als zugehörig auf persönlicher, beruflicher, politischer oder spiritueller Ebene. All diese verschiedenen Mosaiksteine von Heimat, diese Heimaten im Plural konstituieren gemeinsam unsere Identität als Erwachsene.
Im zweiten Teil werden soziologische, psychologische und psychoanalytische Konzepte zur Identität untersucht – wobei Identität hier verstanden wird als ein Scharnier zwischen psychischer Innenwelt und äußerer, sozialer Realität. Die wichtige Funktion von Heimatbildern nicht nur für individuelle, sondern auch für kollektive Identitäten wird hier diskutiert.
Im dritten Teil geht es dann um die Psychodynamik unserer inneren Bilder von Heimat – um genuin psychoanalytische Positionen zum Thema: Beginnend mit Sigmund Freuds Äußerungen zum Thema über die bekannte psychoanalytische Standard-Analogie von Heimat und Mutterleib bis hin zu neueren psychoanalytischen Positionen zur Interdependenz von Individuum und Kollektiv werden diese theoretischen Entwicklungsstränge nachgezeichnet.
Aufgelockert werden die Theorieteile durch kürzere Anwendungsbeispiele, um die Praxisrelevanz der vorgestellten Ideen zu illustrieren.
Wir Psychoanalytiker sehen uns als Spezialisten für das »Zwischen«, für die Beobachtung der komplexen Passagen und Transformationen von Ideen, Phantasien und Wünschen zwischen intrapsychischer und interpersoneller Ebene, zwischen Innen und Außen – und zwischen Individuum und Gesellschaft. Insofern dürfte es nicht verwundern, dass die thematische Dreiteilung im Sinne eines Blickes von außen/auf die Identitäten/von innen lebendig und durchlässig ist und die verschiedenen Perspektiven durch intensive Interdependenzen einen vielfältigen Mehrwert anbieten.
Gestatten Sie mir am Ende dieses einleitenden Textes den Versuch, eine prinzipielle Kritik an »noch einem Buch über Heimat« vorwegzunehmen: Es ist wohl fast ebenso schwer, über Heimat nachzudenken oder gar zu schreiben wie über die Liebe. In beiden Fällen genügt das bloße Aussprechen oder Lesen des Wortes allein, um bei jedem Leser eine intensive und hochkomplexe Mischung von Gefühlen und Erinnerungen zu aktivieren. Diese Emotionen sind stark, aber sehr schwer in Worte oder gar Begriffe zu fassen. Daher wohl auch das Misstrauen gegenüber jenen Autoren, die genau dies mit nur teilweisem Erfolg versuchen.
Für Liebe und Heimat gilt auch gleichermaßen: Gerade bei jenen Gefühlszuständen, die wir für hochindividuell, ja unverwechselbar halten, stellen wir etwas peinlich berührt fest, dass beim Versuch der Verbalisierung dieser so exklusiven Gefühle fast immer nur bereits Gehörtes oder Gelesenes herauskommt – sodass wir schmerzlich die Differenz zwischen der Stärke unserer Gefühle und der Schwäche ihres sprachlichen Ausdrucks empfinden.
Deshalb ist ein Gespräch über Heimat unter Vermeidung sowohl sentimentaler Klischees als auch reduktionistischer Umfragedaten oder kalter Abstraktion so schwer und so selten – es wird aber trotzdem immer wieder versucht.
Die Skepsis, das Misstrauen gegenüber einer »Analyse« von Heimatgefühlen ist nur allzu verständlich, bedeutet doch Analyse etymologisch nichts anderes als Zergliederung, ja Auflösung eines Begriffs, eines Untersuchungsgegenstandes. Und wer will schon seine intimen und subjektiv einzigartigen Gefühle aufgelöst sehen?
Daher ein bescheidener (zumindest etymologisch begründbarer) Vorschlag: Ein »Nachdenken« über Heimat scheint immerhin möglich. Denn laut Kluges etymologischem Wörterbuch geht es beim Denken um das Wiegen, um das Abwägen mit dem Ziel des »Wissens«. Aus der gleichen Wurzel des »Wiegens« allerdings kommt auch »dünken« im Sinne von: Mir wiegt etwas, mir ist etwas gewichtig …
Nehmen Sie also die folgenden Seiten als mein Nachdenken über Heimat als etwas, das allen (ge)wichtig ist.
I Heimat – die Sicht von außen
Heimat – Was ist das, was soll das sein? Ein Ort? Ein Gefühl?
Was ist Heimat? Kluges »Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache« hilft nur wenig weiter: »Heimat: Die Bedeutung ist ungefähr ›Stammsitz‹, der zweite Bestandteil ist unklar«. Verwiesen wird auch auf »Heim« und dort gehen die Verweise großräumig in die Welt hinaus: »Heim, Erde, Boden, Welt«. Aber auch ins Kleine, Überschaubare: »Wohnung, Siedlung, auch Sicherheit, Ruhe«2.
Eine kurze und politisch neutrale Definition liefert »Meyers Großes Taschenlexikon«: »Heimat: Subjektiv von einzelnen Menschen oder kollektiv von Gruppen, Stämmen, Völkern, Nationen erlebte territoriale Einheit, zu der ein Gefühl besonders enger Verbundenheit besteht.« Weiterverwiesen wird auf Heimatrechte, Menschenrechte, Staatsangehörigkeit.3
Auch hier bekommen wir keine Antwort auf die Frage, warum der Begriff der Heimat im Deutschen emotional so aufgeladen ist wie wahrscheinlich in keiner anderen Sprache. Im Vergleich dazu sind die Worte »Patrie« oder »Patria« im Französischen, Italienischen und Spanischen zwar auch emotional besetzt, aber in ihrem Bedeutungsumfeld großflächiger: Sie sind näher am Begriff der Nation und des Vaterlandes als unser Wort »Heimat«, das einen größeren emotionalen Resonanzraum bezeichnet als den der Familie, aber auch einen deutlich kleineren als den der Nation oder des Vaterlandes. Gustav Seibt4 behauptet sogar, dass Heimat und Nation, speziell Heimat und Nationalismus, eher Gegensätze als Teile einer Ergänzungsreihe sind: Wenig hätte, laut Seibt, so massiv zur Schwächung der vertrauten Heimateinheiten beigetragen wie der moderne Nationalstaat. Dieser ersetzte nämlich die Gesellschaftsformen »auf Sichtweite« durch rationale und zentrale Verwaltungsinstitutionen. Er brach in die idyllischen Lebenswelten der Heimat ein als Steuerstaat und Militärstaat; mit Bürokratie und Wehrpflicht. Erst durch die Staatssymbolik, durch Fahnen, Nationalhymnen, Geschichtsmythen und Ideologien wurde aus einer Dorfgenossenschaft die größere Gemeinschaft der »Mitbürger«. Erst dadurch spaltete sich die davor regional und ständisch verfasste Gemeinschaft in Klassen und Parteien.
Nächster Annäherungsversuch: Unser Wort »Heimat« wird auch übersetzt mit »Casa/Maison/Home« – das würde der älteren deutschen Bedeutung entsprechen, die Heimat primär als einen Wohnort, als Zuhause verstand. Allerdings erfasst auch dies nicht die Besonderheit des deutschen Heimatbegriffs, denn unsere »Heimat« liegt eben in der Mitte zwischen den Bedeutungen von »Casa« und »Patria« der romanischen Sprachen, zwischen dem heimischen Herd und der riesigen Gesamt-Nation.
Heimat bleibt ein Zwischenbereich, eine seltsam vorpolitische Sphäre, emotional aufgeladen mit intensiven Gefühlen und Erinnerungen der Individuen. Wenn diese Emotionen aber politisiert werden, dann können aus der so unschuldigen Wurzel der Heimatgefühle giftige Blüten wachsen. Denn gerade wenn die große Kluft zwischen dem Nahbereich von Familie und Eigenheim und der riesigen Nation durch einen Heimatbegriff überspannt werden soll, wenn die Nation organisch aus der Familie, der Gemeinschaft erwachsen soll – dann wird die Forderung nach Vertrauen, Vertrautheit und Einheitlichkeit von der Dorfgemeinschaft auf das politische Mega-Gebilde der Nation übertragen: Völkisches Denken orientierte sich immer am Modell der kleinen, angeblich geordneten und gesunden Gemeinschaft auf dem Land und als Gegensatz zu den Strukturen der Großstadt. Das Vaterland wird dann zum familiarisierten Land der Väter, ewig, immer gleich und unveränderbar. Schlimmstenfalls führt dies zur Blut-und-Boden-Ideologie und zur Fremdenfeindlichkeit. Wenn nämlich diese Heimat als bedroht erlebt wird, dann folgen schnell der Aufruf zum »Heimatschutz« und die Bildung von »Heimwehren«. Die Exponenten eines solchen Heimatbegriffs als Schutzschild und Abwehr gegen das Fremde insinuieren, dass die Deutschen immer schon ein intensives Liebesverhältnis zu ihrer Heimat gehabt hätten – mehr als andere Völker.
Diese Behauptung aber kann mit einer verblüffend einfachen Form der Objektivierung zumindest teilweise widerlegt werden: Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache kann man Worthäufigkeitszählungen durchführen. Und dabei bemerkt man bis knapp vor dem Jahr 1800 einen relativ seltenen Gebrauch des Wortes »Heimat«. Um 1600 scheint das Wort weniger als dreimal pro Million verwendeter Worte auf. Bis 1740 steigt der Gebrauch nur minimal auf ca. viermal pro Million gebrauchter Worte. Erst unmittelbar nach 1800, also in der Epoche der Napoleonischen Kriege und des romantischen Nationalismus steigt die Frequenz des Wortgebrauchs massiv an und erreicht plötzlich einen Wert von 26-mal »Heimat« auf eine Million von Worten. Im 19. Jahrhundert sehen wir dann einen weiteren starken Anstieg (1840 53-mal pro Million, 1890 dann ein »Allzeithoch« von 70-mal pro Million). Diese »Fieberkurve des Heimatbegriffs«5 folgt eindeutig dem Rhythmus der neueren deutschen Sozialgeschichte: Sie spiegelt den Beginn der industriellen Revolution, die Auswanderungswellen des frühen 19. Jahrhunderts und dann den ersten Höhepunkt von Industrialisierung und Transformation der Gesellschaft durch die Verstädterung vor 1900. All diese dramatischen Veränderungen der Sozialstruktur, diese Beschleunigungserfahrungen, führen zur Hochkonjunktur des Wortes und Begriffs von Heimat.
Im Vergleich dazu beeinflussen die beiden Weltkriege die Häufigkeit des Wortgebrauchs verblüffend wenig. Der jüngste Anstieg (von 58-mal pro Million im Jahr 1990 auf fast 64-mal pro Million seit 2010) dürfte eindeutig auf Globalisierungsängste und Migrationsschübe zurückzuführen sein: Wieder wird die Heimat als bedroht erlebt, wieder fühlen sich die Menschen weder in sich selbst noch in ihrem Wohnort oder in ihrem Land wirklich zuhause – und dadurch wird Heimat wieder von einem kulturellen zu einem hochpolitischen Thema.
Die angeführten statistischen Befunde der Wortfrequenzzählung spiegeln sich auch im Verlauf der deutschen Literaturgeschichte: Der Beginn einer modernen Heimatliteratur mit den Dorfgeschichten ab ca. 1830 ist ebenfalls ein Ausdruck von Beschleunigungs- und Verlusterfahrungen durch die beginnende Industrialisierung und Moderne. Von Anfang an zeigte sich die Schilderung der Dorfidylle als ideologisch anfällig, ungeachtet des so unterschiedlichen Niveaus zwischen Johann Peter Hebel und Adalbert Stifter bis hin zu Ludwig Anzengruber und Ludwig Ganghofer. Aber sowohl bei den heute kanonisierten Klassikern als auch in der Gebrauchsliteratur geht es um die Schilderung einer schon als bedroht empfundenen Lebenswelt. Am Ende des 19. Jahrhunderts waren die populären Heimatromane eindeutig ein ideologischer Konterpart zur Dekadenzdichtung, zum Symbolismus und Naturalismus mit deren düsteren Großstadtschilderungen. Dem sollten Schönheit, Harmonie und ideale Werte entgegengestellt werden, was schon in den Zwanzigerjahren zunehmend völkisch anmutete und dann in der Blut-und-Boden-Literatur des Nationalsozialismus den Tiefpunkt erreichte.
Nach 1945 war für die Hochliteratur das Thema »Heimat« dadurch marginalisiert und wurde meist vermieden. Heimatromane gab es allerdings in großen Auflagen – aber als billige Heftchen und Schundromane. Auch heute wird die aktuelle Renaissance von Heimat- und Dorfgeschichten, wie z. B. »Unterleuten« von Juli Zeh oder »Altes Land« von Dörte Hansen, seitens der Kritik wieder als Ausdruck eines wachsenden Unbehagens am entfremdeten Großstadtleben interpretiert. Seit zweihundert Jahren also hat die Heimat auch in der Literatur speziell dann Konjunktur, wenn sie vom Lesepublikum als bedroht oder fast schon verloren erlebt wird.
Heimat aus Herkunft – Heimat als Ankunft
Heimat aus Herkunft
Bei den Recherchen für dieses Buch habe ich bei mehreren Autoren den schönen Satz »Der Anfang ist unsere Heimat« gefunden. So lautet ein Buchtitel des englischen Psychoanalytikers Donald Winnicott. Es ist eine einfache, aber unmittelbar einleuchtende Antwort auf die Frage, was denn Heimat für uns bedeutet. Da fallen wohl vielen zuerst Bilder des Anfangs ein: Gerüche, Geschmäcker, Melodien aus der frühen Kindheit. Ausgehend von der ersten Beziehung zur Mutter, zur Erfahrung eines Kinderzimmers, eines Hauses, eines Herkunftsortes entfalten sich die konzentrischen Kreise eines allmählich größer werdenden Herkunftsraumes, gefüllt mit Erinnerungen und den damit verbundenen Gefühlen. Diese frühen Bedeutungslandschaften prägen uns ein Leben lang, allerdings selten so eindeutig und widerspruchsfrei wie manche Heimatklischees vorgeben: Wir sind beeinflusst, aber nicht determiniert durch unsere Herkunft. Ich muss nicht alle Menschen aus X lieben, weil ich im Ort X aufgewachsen bin. Ich muss deshalb aber auch nicht alle Bewohner des benachbarten Y verachten. Es wird mir dennoch nicht gelingen, mich von diesen frühen Einflüssen völlig loszusagen und ihnen jegliche Einwirkung auf mein späteres Verhalten und Leben abzusprechen. Aber das muss auch nicht sein.
Niemand kann oder soll auf seine gefühlsgetränkten Erinnerungen an die Orte und Jahre seiner Kindheit und Herkunft verzichten. Aber diese Erinnerungsspuren können nicht und sollten auch nicht als unveränderbare heilige Bilder behandelt werden. Im Laufe eines Lebens müssen wir auch die Erzählungen über unsere frühen Jahre an unsere neuen Erfahrungen adaptieren. Durch eine veränderte Einstellung des Erwachsenen zu seinen Eltern, zur Familie und Herkunftsregion wird auch unsere Frühgeschichte umgeschrieben, wird neu ediert: Unsere Zukunft braucht zwar immer die Herkunft, aber oft auch eine jeweils »neue« Herkunft – letztlich eine neue Vergangenheit, die für unser aktuelles biographisches Narrativ begründend, weil sinngebend, wirken kann.
Dennoch bleibt es für viele Menschen schwer, einen lebbaren Mittelweg zu finden zwischen Idealisierung und Entwertung ihrer Herkunft. Wir alle kennen Freunde, die sehr viel emotionale Energie auf ihre Vergangenheit verwenden, die eine nostalgische Sehnsucht nach den frühen Jahren kultivieren. Demgegenüber stehen die Traditionsverweigerer, die sich nur in konsequenter Opposition gegen die ihnen in der frühen Jugend aufgezwungenen Strukturen definieren wollen.
Noch einmal zurück zu Winnicotts Titel: Das im Deutschen so voll tönende »Der Anfang ist unsere Heimat« lautet im englischen Original kühler und neutraler: »Home is where we start from«. Das scheint mir persönlich sympathischer, weil offener und dadurch realistischer. Das Gefühl einer frühen Heimat ist immer mehr als die Erinnerung an einen Ort – es ist der Abdruck einer komplexen frühen Beziehungslandschaft in unserer Seele. Und es ist eben der Ort »where we start from«. Es ist also ein Ausgangspunkt und markiert die Startlinie für unsere Lebensreise. Schon deswegen ist es aber kein Ort, an dem wir ein Leben lang verharren können. Das wissen wir auch alle auf der Ebene der Vernunft, und daher wünscht sich auch niemand, sein gesamtes Leben im Kinderzimmer zu verbringen – sei es noch so idyllisch gewesen.
»Der Anfang ist unsere Heimat« ist ein Zitat aus einem Gedicht von T.S. Eliot. Der Dichter wurde in den Vereinigten Staaten geboren, hat sich aber nach seiner Auswanderung nach Großbritannien ein Leben lang als Engländer gefühlt, weil er die britische Lebensart die der USA vorzog. Zumindest für ihn blieb also der Anfang nicht die Heimat.
Die Wichtigkeit der Herkunft als Ausgangspunkt für unser Leben beschränkt sich aber nicht auf die schönen oder schrecklichen Erinnerungen an unsere ersten Jahre: Diese Gefühle von Heimat oder aber Heimatlosigkeit bilden die Matrix für alle späteren Heimatgefühle. Sie beeinflussen unsere Chancen, uns in neuen Situationen, Konstellationen und Beziehungen geborgen und heimisch zu fühlen. Die Grundtonart unserer Beziehung zur Welt wird weitgehend geprägt durch solche frühen Erfahrungen als Leitmotive. Können wir mit einem Grundgefühl von Sicherheit und Anerkennung aus der familiären Heimat hinausgehen in die Welt im Vertrauen darauf, dass sie uns freundlich-resonant aufnehmen wird? Oder bleiben wir ängstlich und misstrauisch in der zwar engen und unbehaglichen, aber doch vertrauten Familienhöhle sitzen, weil uns die Welt draußen zu bedrohlich und feindlich erscheint? Der Erlebnisraum eines Kindes erweitert sich in seinen frühen Jahren idealerweise im Wechselspiel zwischen einem Sicherheit gebenden Familienmilieu und der Eroberung der Welt, beginnend mit den Freundschaften in Kindergarten und Schule. In der Pubertät wird dann die Peergroup der Gleichaltrigen immer wichtiger, die Teilnahme an diversen altersspezifischen Subkulturen intensiver, sei dies parallel oder aber im schroffen Gegensatz zu den familiären Vorgaben. Je mehr Anerkennung wir in diesen prägenden Jahren erfahren, desto leichter werden wir dann als junge Erwachsene Gefühle von Zugehörigkeit und Sicherheit auch in neuen Lebenssituationen finden können.
Heimat im Plural: Die Fähigkeit, sich in Beziehungen/Orten/Konstellationen zuhause zu fühlen
Das Grundgefühl des Zuhause-Seins, des Sich-aufgehoben-Fühlens in seinem Lebenszusammenhang entscheidet sich für Erwachsene nicht an einem emotionalen Schauplatz, es ist eher eine Summation von Gefühlen der Sicherheit oder aber Verunsicherung aus verschiedenen Segmenten ihres Beziehungslebens. Denn für alle im Folgenden ausgeführten Aspekte der Heimatfindung gilt: Das positive Gefühl des Dazugehörens, des Aufgehoben-Seins kann sich letztlich nur als Niederschlag geglückter Beziehungen zu Menschen entwickeln. Die allererste Basis dafür ist allerdings ein Grundgefühl des Daheimseins im eigenen Körper. Auch dafür bringen wir die Muster aus unserer Kindheit und Jugend mit. Diese können jedoch durch geglückte oder aber misslungene Beziehungen des jungen Erwachsenen nochmals entscheidend verändert werden. Als Therapeuten hören oder aber erleben wir meist schon im Erstgespräch mit einem neuen Patienten seine »Grundphantasie«. Dieses Leitmotiv eines Lebens prägt unsere Erwartungen und Ängste und damit alle unsere Beziehungen:
a) »Letztlich ist man immer allein«: Eine Kindheit in einer emotional kargen oder dürren Familie mit wenig Möglichkeit zum Gefühlsausdruck führt später beim Erwachsenen oft zu Schwierigkeiten, sich in einer Liebesbeziehung vertrauensvoll zu öffnen, aber auch zu Unsicherheit und Angst in Gruppensituationen.
b) »Du bist mir alles, nur mit dir bin ich glücklich«: Im positiven Fall der glücklichen, weil erwiderten Liebe kann die Realisierung dieser dyadischen Verschmelzungsphantasie Erlebnisse von Sicherheit, ja fast von Erlösung bieten. Im Negativen erleben wir schlimmstenfalls eine häufige Abfolge von Idealisierung und Entwertung, von Anklammern an die idealisierte geliebte Person und deren Entwertung nach ihrer Flucht vor dieser allzu großen Nähe.
c) »Am wohlsten fühle ich mich in der Gruppe«: Während manche Menschen sich in einer Zweiersituation am wohlsten fühlen, leben andere erst wirklich auf im Zusammensein mit mehreren, mit vielen Menschen, sei es in der Großfamilie, am Arbeitsplatz oder im Sportverein.
Die meisten würden ihre eigene Grund-Disposition und Erwartungshaltung wohl als einigermaßen zufriedenheitsträchtige Mischung aus a + b + c beschreiben. Das »Mischungsverhältnis« aber wird unsere Fähigkeit, sich sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Freundschaften als auch später in einer Elternrolle aufgehoben und zuhause zu fühlen, entscheidend beeinflussen.
1. Geographischer Kontext von Heimat
Der Ort ihrer frühesten Kindheit bleibt für die allermeisten Menschen der »Gold-Standard« für Heimatgefühle. Gerade deshalb sind wir später oft so enttäuscht, wenn wir nach Jahren an unseren Geburtsort zurückkehren und fast empört feststellen müssen, dass dieser völlig anders aussieht als in unseren Kinderjahren, in unseren Erinnerungen. Hier erleben wir das Verrinnen von Zeit als Veränderung im Raum: Wir suchen dann einzelne Straßen, Parks oder vertraute Winkel, um uns der Kontinuität zu versichern. Wir wollen spüren, dass noch irgendetwas da ist vom Heimatort, den wir im Gedächtnis tragen.
Aber viele junge Erwachsene müssen ihren Geburtsort verlassen, sei es aus Erfordernissen ihrer Ausbildung oder des Studiums oder weil sie einem neuen Lebenspartner folgen. Durch diese Binnenmigration, oft aus der Kleinstadt oder einem Dorf mitten in die Großstadt, sind sie psychisch gefordert und manchmal überfordert. So überwiegt zwar z. B. in den ersten Semestern am Universitätsstandort oft noch die Freude über die vielen neuen Möglichkeiten und die geglückte Flucht aus der kleinstädtisch-familiären Enge. Bald aber wird auch die Anonymität und Kälte der Großstadt beklagt, wenn nicht schnell genug neue soziale Beziehungen geknüpft werden können, die wieder Zugehörigkeit und Heimatgefühle bieten.
2. Zuhause am Arbeitsplatz?
Für junge Erwachsene ist ein Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit durch soziale Akzeptanz am Arbeitsplatz mitentscheidend für ihre Lebenszufriedenheit. Wer erinnert sich nicht an die Unsicherheit und Entfremdung in den ersten Tagen im ersten Job – und an die große Erleichterung, wenn man allmählich die vielen geschriebenen und noch mehr ungeschriebenen Regeln des neuen Lebensraumes zumindest ansatzweise überblickte und sich dadurch ein bisschen heimisch fühlte. Allerdings re-inszenieren wir speziell in den ersten Jobs oft unsere familiäre Konstellation in der Hoffnung auf eine zweite Chance, auf einen positiven Ausgang: Vielleicht können wir hier endlich vom Chef geschätzt werden, wenn uns schon der Vater nie gelobt hat. Vielleicht können wir jetzt endlich über ältere (dienstältere) Geschwister triumphieren durch bessere Leistung. Oder wir erhoffen ein umfassendes Gefühl der Sicherheit und unbedingten Zugehörigkeit zur »Mutterinstitution«. All diese Hoffnungen und Sehnsüchte aber bleiben über weite Strecken unbewusst und werden gerade deshalb oft massiv ausagiert.
Aber ein Job muss uns mehr bieten als angemessene Bezahlung und die Chance einer Re-Inszenierung unserer Familienkonstellation, um es dort gern und länger auszuhalten. Dazu bedarf es auch einer Struktur, die wir als stabil und Halt gebend genug empfinden, ohne dass sie uns durch allzu viel Kontrolle einschränkt. Das ist schon allein aufgrund der zeitlichen Komponente wichtig. In einem klassischen 40-Stunden-Job verbringen wir im Jahresschnitt mehr Lebenszeit mit den Arbeitskolleginnen als daheim mit dem Partner oder der Familie und danach bemisst sich dann auch die Intensität unseres Gefühls von Zugehörigkeit oder aber Entfremdung und Heimatlosigkeit.
3. Heimisch oder fremd in der sozialen Klasse?
Als Folge der gestiegenen geographischen, aber auch sozialen Mobilität verändert sich für viel mehr Menschen als früher ihr sozio-ökonomischer Status: Sie wechseln ihre Klasse; meistens als Aufsteiger, in vielen Fällen als »Bildungsaufsteiger«. Viele Neuankömmlinge fühlen sich aber im neuen sozialen Umfeld über lange Zeit hindurch nicht heimisch – manche verlieren das Gefühl einer Heimatlosigkeit zwischen den Klassen ihr Leben lang nie ganz. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat das hochkomplexe System von Verhaltensweisen, Regeln, Alltagsritualen – bis hin zu Körperhaltungen und natürlich der dialektalen Färbung der Sprache als »Habitus« bezeichnet:6 Dadurch ist uns die Klassenzugehörigkeit auf den Körper geschrieben, ja in unsere Körper und vor allem in unser Denken und Fühlen eingeschrieben, und konstituiert uns in sehr hohem Maß. Beim Wechsel in eine andere Klasse mit anderen Codes und Distinktionsvorlieben können wir die bisherige Identität nicht einfach abwerfen wie eine Schlange ihre alte Haut. In einem mühsamen Prozess geht es darum, die alte Identität und ihr stützendes System von Regeln und Beziehungen nicht zu verlieren, gleichzeitig aber eine Identität in der neuen Bezugsgruppe zu erwerben: Bourdieu hat das Leiden jener Aufsteiger, die sich ihrer alten Klasse nicht mehr zugehörig fühlen, in der neuen aber nie heimisch wurden, als »gespaltenen Habitus« beschrieben.
4. Politische Heimat
Während manche Jugendliche das Wertesystem ihrer Eltern und somit auch deren politische Ausrichtung für sich als sinnstiftend übernehmen können, ist die Opposition gegen die politischen Positionen der Eltern für viele Adoleszente einer der wichtigsten Schauplätze ihrer inneren Ablösung vom Elternhaus. Oft werden dann aus Opposition gegen die Familie oder im Rahmen neuer Loyalitäten diametral entgegengesetzte Werte vertreten. Mit Abschluss der Adoleszenz erreichen die meisten Menschen so etwas wie eine politische Heimat. Während dies für einige aber nur eine Wahlentscheidung bedeutet, kann es für andere durchaus ein Aspekt von Heimat sein als Ensemble von Zugehörigkeitsgefühlen, von Sicherheit und entspanntem Miteinander im gemeinsamen Handeln mit Gleichgesinnten. Das erleben wir dann als sinnstiftend, wenn wir sowohl die politische Aktivität im Rahmen einer Partei oder Non-Governmental Organisation als sinnvoll im Sinne unseres Wertekanons einschätzen als auch auf Beziehungsebene gern mit den Parteifreunden zusammen sind.
In Österreich boten bis vor wenigen Jahrzehnten die damals noch viel größeren Volksparteien zur Ausweitung dieses politischen Engagements in den Alltag und in die Freizeit der Menschen hinein eine Fülle von »Vorfeldorganisationen«. Da gab es sozialdemokratische Sportvereine bis hin zu den »roten« Briefmarkensammlern, Schachspielern oder Gewichthebern; es gab auch Sparvereine, Autofahrerclubs, Sommerlager für die Kinder und Pensionistenvereine. All das existierte jeweils in zweifacher Ausführung, in einer sozialdemokratischen oder aber konservativen Variante. Dahinter stand explizit der politische Anspruch beider Lager, den Menschen eine politische Heimat auch in ihrem Alltag zu geben. Dementsprechend waren sowohl Zugehörigkeitsgefühle als auch Abgrenzung ein Leben lang vorgegeben – von den »Roten Falken« und ihrem konservativen Pendant der »Christlichen Jungschar« bis hin zu den jeweiligen Pensionistenvereinen waren sie unvermeidlich und sogar erwünscht. Nicht nur das Wahlverhalten, sondern ein zentraler Teil der Identität wurde durch diese Einbettung der Politik ins Privatleben oft über Generationen weitergegeben. In ländlichen Gebieten Österreichs definiert man heute noch eine Familie als »rot« oder »schwarz«. Und durch diese Festlegung der politischen Heimat ist bereits vorgegeben, wer sich dort zugehörig und heimisch fühlen kann oder aber abgelehnt werden wird.
5. Spirituelle Heimat