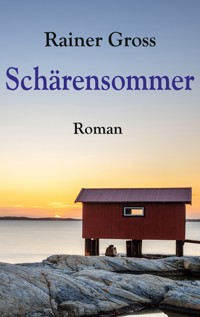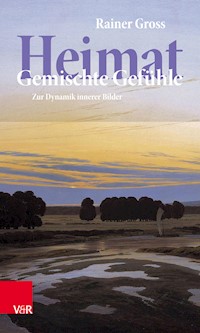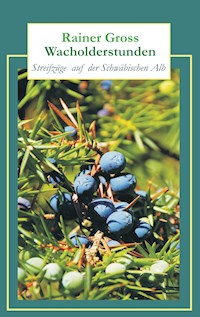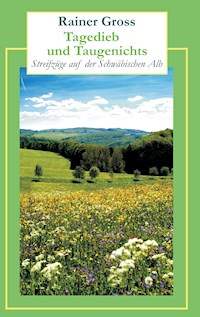Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist eine Frau Ende dreißig, lebt in Hamburg, arbeitet als Arzthelferin in einer Augenpraxis und hat das Gefühl, tief drinnen ein Kind geblieben zu sein. Ein Kind, das sich nach der Geborgenheit sehnt, die sie mit sechs Jahren verloren hat. Sie streift in ihren regenbogenbunten Stiefeln durch die Stadt, verkriecht sich auf dem Sofa mit einer Tasse Kakao und einer Tafel Schokolade, schaut am liebsten amerikanische Liebesfilme und zieht, wenn ihr alles zu viel wird, einfach ihre Lieblingsdecke über den Kopf. Sie lernt Männer kennen, aber Edvard ist und bleibt der zuverlässige Freund an ihrer Seite. Sie durchleidet dunkle Stunden, fürchtet die Leere, wünscht manchmal, es hätte sie nie gegeben. Und dennoch hat sie einen unerschütterlichen Glauben: Einmal wird sie es finden, das Gold am Ende des Regenbogens...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sie ist eine Frau Ende dreißig, lebt in Hamburg, arbeitet als Arzthelferin in einer Augenpraxis und hat das Gefühl, tief drinnen ein Kind geblieben zu sein. Ein Kind, das sich nach der Geborgenheit sehnt, die sie mit sechs Jahren verloren hat. Sie streift in ihren regenbogenbunten Stiefeln durch die Stadt, verkriecht sich auf dem Sofa mit einer Tasse Kakao und einer Tafel Schokolade, schaut am liebsten amerikanische Liebesfilme und zieht, wenn ihr alles zuviel wird, einfach ihre Lieblingsdecke über den Kopf. Sie lernt Männer kennen, aber Edvard ist und bleibt der zuverlässige Freund an ihrer Seite. Sie durchleidet dunkle Stunden, fürchtet die Leere, wünscht manchmal, es hätte sie nie gegeben. Und dennoch hat sie einen unerschütterlichen Glauben: Einmal wird sie es finden, das Gold am Ende des Regenbogens ...
Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller seit 2014 in Reutlingen.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).
Bei BoD u.a. erschienen: Die Welt meiner Schwestern (2014); Das Glücksversprechen (2014); Yūomo (2014); Haus der Stille (2014); Schrödingers Kätzchen (2015); Drei Tage Wicklow (2015); Haut (2015); Halleluja (2015); My sweet Lord (2016); Holiday (2016); Assmanns Inferno (2016); Der letzte Geschichtenerzähler (2016).
The soul would have no rainbow,
had the eyes no tears.
JOHN VANCE CHENEY
Die Dominosteine purzeln durcheinander. Die im Kopf. Einer reißt den andern mit. Das ganze Gerüst aus Wörtern, Gefühlen, Bildern, aus Erinnerungen und Bedeutungen bricht zusammen. Leere im Kopf, ein Knäuel im Bauch. Wut, Tränen vor unterdrückter Wut. Du weißt, dass das immer wieder geschieht. Du kannst nichts dagegen tun.
Nur deine Stiefel anziehen, die bunten Regenbogenstiefel, und deine Jacke, sonnengelb und glänzend mit roten Knöpfen, die knattert und flattert, und hinaus in den Regen treten, in die Frische und Feuchte. Du gehst durch die Straßen und hast keinen Namen mehr. Am Hafen unten saugt es dich in die verhangene Ferne über dem Fluss, zwischen Möwen und Containerschiffen.
Du wirst traurig. Dann wütend, auf eine sanfte Art, mehr nach innen. Besser wütend als traurig, denkst du und weißt nicht, woher du diesen Satz hast. Manchmal bestehst du nur aus Sätzen fremder Leute. Dann spürst du eine Luftigkeit in deinen Lungen, die dich ballonhaft über die Stadt treibt. Bald spürst du nichts mehr.
Nur das Skalpell kannst du noch spüren, das Einmalskalpell, das du in der Apotheke gekauft hast, auf deiner Haut. Sacht ritzt du ein, bis es rot wird und tropft. Ein fernes Weh, dumpf und wattig. Es tut nicht weh, das Weh. Es erleichtert. Ich bin nicht ganz bei mir, denkst du, während dein Arm die Stigmata zeigt, stille Muster aus Verzweiflung. Aber das willst du sein: bei dir.
Die Regenbogenstiefel sind aus Gummi, Naturkautschuk mit verstellbarer Wadenweite. Du könntest sie also enger machen, aber du magst es, wenn der Schaft um deine Waden flabbelt. Die Stiefel haben grobe Sohlen in Rot und einen Gummistreifen über die Sohlennaht geklebt in Blau mit einer Linie in Flieder. Die Farben der Regenbogenstreifen wiederholen sich: Flieder, Blau, Hellblau, Grasgrün, Gelb, Rot, Orange, Violett und dann von Neuem. Dreimal. Ein geringelter Stiefel. Mit einem aufgeklebten Schild, das das Label des Herstellers trägt. Sie kommen aus England.
Du nimmst sie zur Hand, das saubere Paar, nebeneinander wirken sie wie Geschwister, denen du vertraust. Du schlüpfst hinein, erst in den einen, dann in den anderen. Du brauchst keine dicke Socken, es ist warm geworden, jetzt im Frühsommer. Du krümmst und streckst die Zehen, prüfst mit dem Spann und der Ferse das Spiel unten im Hohlraum, spürst den Schaft an deinen Waden und wie der Saum sich bewegt mit den ersten Schritten.
Gummistiefel hast du schon als Kind geliebt. Damit warst du sicher vor allem, gewappnet gegen alles, was kommen mochte: Pfützen, tiefe Bäche, Schlamm, feuchter Sand, Brennnesseln, Kuhfladen, Wespen, die am Fallobst fraßen. Du bist auf dem Land groß geworden, in der Holsteinischen Schweiz. In einer kleinen Stadt. Nicht dass deine Eltern Bauern gewesen wären; aber Oma und Opa waren es, jetzt im Ruhestand, ein paar Tiere hatten sie noch und selbst vor den pickenden Hühnerschnäbeln schützten dich deine Stiefel.
Vielleicht hast du da auch deinen ersten Regenbogen gesehen. Er war nicht so schön bunt wie im Fernsehen. Er war blass und seltsam verdoppelt, und die dunkle Wolkenwand dahinter sah drohend aus. Opa erklärte dir, dass die Sonne auf den fallenden Regen scheinen muss, damit es einen Regenbogen gibt, aber dir war das egal. Im Physikunterricht hast du vom Prisma gehört und von Newton, aber das war dir auch egal.
Erst später, mit sechzehn, fandest du das Wort dafür: Freiheit.
Mit Vater hast du nie über so etwas geredet. Du hast ihn in der Ruhe gelassen, in der er gelassen werden wollte. Oft kamst du zu ihm und wolltest auf seinen Schoß. Er war stumm und verlegen. Er hatte keine Zeit für dich. Früher hatte er mit dir geliebelt und gescherzt, du hast dich an seinen behaarten Armen festgehalten. Dann nicht mehr. Du wusstest nicht warum. Manchmal schloss er das Schreibzimmer ab, in dem er nach Feierabend arbeitete. Mutter erklärte dir dann, dass es ihm nicht gut gehe und er Ruhe brauche. Du hast ihn geliebt, aber ob er dich liebte, weißt du nicht.
Bis heute nicht.
„Wie heißt du?“
„Jule.“
„Welches Sternzeichen hast du?“
„Ich halte nichts von Sternzeichen.“
„Bist du gebürtige oder geborene Hamburgerin?“
„Was ist das für eine Frage? Ich bin Hamburgerin.“
„Du bist also nach Hamburg zugezogen. Wann war das?“
„Als ich elf war.“
„Wo bist du geboren?“
„Auf dem platten Land. Mehr sag ich nicht.“
„Und wie alt bist du?“
„Ist das wichtig für dich?“
„Du kannst nachher fragen. Jetzt bin ich dran. Drei Minuten. Also: Wie alt bist du?“
„Bald vierzig. Und du?“
„Einunddreißig.“
„Und?“
„Nichts und. Was arbeitest du?“
„Ich bin Praxishelferin bei einem Augenarzt.“
„Was ist deine Lieblingsfarbe?“
„Bunt. Wie der Regenbogen.“
Du bist hingegangen aus Spaß. Um es einmal auszuprobieren. Ein ganz schöner Stress, deshalb heißt es Speed Dating. Zehn Männern hintereinander gegenüber sitzen, in drei Minuten Fragen stellen, um sich ein Bild zu machen, hinterher haben dir drei ihre Adresszettel in den Kasten geworfen. Du hast deine Adresse niemandem gegeben.
Nie wieder, hast du dir geschworen.
Du hast eine Lieblingsdecke. Einen Quilt, den deine Oma genäht hat. Eine Flickendecke, mit Spitze eingesäumt, lauter Quadrate aus Leinen, Baumwolle, Seide, Wolle, mit Blumen, Punkten, Streifen, Paisleymuster, eine bunte Decke, natürlich. Eine, die Heimeligkeit und Sicherheit vermittelt, schon als Kind.
Du hast dich manchmal aufs Bett gesetzt und die Decke über dich gezogen, über den Kopf, sodass dich niemand mehr finden konnte. Ein Versteck. Ein Platz, wo du allein sein kannst, unsichtbar, wo nichts mehr dich erreichen kann. Du hast gekichert und gesungen, dir die Ohren zugehalten, gebetet, mit deinen Fingern gespielt im Zwielicht unter der Decke. Du hast die dumpfe Luft gespürt, die allmählich entstand, du hast sie gern geatmet, sie hat dich ruhig gemacht. Es war warm unter der Decke und dämmrig. Manchmal hast du das gebraucht.
Wenn Vater dich nicht angehört hat. Wenn du nicht mit ihm sprechen duftest. Wenn er auf dem Sofa saß und vor sich hin grübelte, unantastbar. Wenn die Eltern sich stritten, über jenen Mann damals, mit dem Mutter sich eingelassen hat, der Mann war dir egal, Vaters Kränkung und Wut auch, warum und worüber sie streiten, ist dir egal – du hast nur eines verstanden: Sie sind sich wichtiger als du.
Wenn du schon ausgeschlossen bist, wenn schon dein Zuhause kein Heim mehr war, dann wolltest du das richtig machen. Ausgeschlossen. Zurückgezogen. Aus der Welt. Daheim sein bei dir selbst. Oder bei Gott, wenn du unter der Decke mit ihm gesprochen hast, ihm alles erzählt, was dir weh tut und dich traurig macht.
Das hat geholfen.
Den Quilt hast du noch. Mitgenommen beim Umzug. Mitgenommen, als du dir eine eigene Wohnung gesucht hast. Es wundert dich nicht, dass du das heute noch tust: unter der Decke sitzen.
Du tust es, wenn dir alles zuviel wird. Wenn sich die Lage nicht mehr überblicken lässt. Wenn zu viele Gefühle und Forderungen und Sehnsüchte in dir streiten, wenn du es den Anderen und dir zugleich recht machen willst, wenn du nicht mehr weißt, was wichtig ist und was nicht.
Dann ist es wie ein Fadenknäuel, hoffnungslos verknotet. Egal, an welchem losen Ende du ziehst: Das Knäuel schnürt sich nur enger. Das kannst du nicht aushalten. Um nicht zu schreien, um nicht mit den Fäusten gegen die Wände zu trommeln, um nicht weglaufen zu müssen, ziehst du die Decke über dich und verschwindest.
Unter dem Quilt geht es dir gut. Es riecht wohlig nach Stoff und sonntäglicher Stube. Ein Großmuttergeruch. Nach selbst gekochtem Grießbrei, Omas Tosca und Opas Zigarren. Du sitzt eine Weile, kommst zur Ruhe. Die Angst lässt nach, die Enge, das Aus-der-Haut-fahren-Wollen. Dein Atem wird ruhiger. Du sprichst leise mit dir. Du weißt, dass du jetzt wieder ein kleines Mädchen bist. Der Trost von damals wiederholt sich, aber auch die Verlassenheit. Hauptsache, es hilft. Du kennst keinen anderen Weg.
In der Praxis wissen sie Bescheid. Manchmal verschwindest du in einem leeren Behandlungszimmer und ziehst die Decke über den Kopf. Dort lässt man dich sitzen. Sie tolerieren es. Sind ja nur ein paar Minuten, bis es wieder geht. Du hast die Decke immer dabei.
Auch deine Freunde wissen, was mit dir los ist, wenn du die Decke brauchst. Mitten im Gespräch kann das sein: Du stehst plötzlich auf, mit verkniffenem Mund, verschwindest aus der Tür, sitzt im Schlafzimmer auf dem Bett, eine verhüllte Statue, die auf Entdeckung wartet. Aber niemand darf dich stören. Sie lassen dich sitzen und reden weiter, lachen, trinken, und wenn alle gehen und du noch nicht zurück bist, schließt der Letzte die Tür.
Was sie über dich denken, weißt du nicht. Du willst, dass es dir egal ist, aber es ist dir nicht egal. Du hast Angst, dass du ihnen eine Zumutung bist und sie wegbleiben. Du hast Angst, dass sich eine Arbeitnehmerin so nicht benimmt und du gekündigt wirst.
Du weißt es ja: Es ist kindisch. Du willst ein reifer Mensch sein. Eine erwachsene Frau. Das bist du auch, sagen dir deine Freunde und sagst du dir selbst.
Nur eben manchmal ...
„Wie heißt du?“
„Jule.“
„Jule, hast du eine glückliche Kindheit gehabt?“
„Wieso willst du das wissen?“
„Ich finde, man sollte sich das Kindsein bewahren. Es sollte einen Winkel in der Seele geben, wo man von der Erwachsenenwelt unberührt geblieben ist.“
„Warum?“
„Ich finde, wir verlieren viel, wenn wir ‚vernünftig’ und ‚reif’ werden. Mit Tüttelchen. Wir sollten Träumer bleiben. Wir sollten noch staunen können, dankbar sein, offen sein für das Wunder des Lebens.“
„Ist das eine Frage?“
„Nein. Ich möchte nur wissen, wie du darüber denkst.“
„Du hast noch eine Minute.“
Hafengeburtstag. Im Hafen liegt die Mir. Heiko entert mit dir, ihr bezahlt jeder einen Euro. Er erklärt dir das Schiff, keine Ahnung hast du, woher er das alles weiß. Ist er ein Skipper? Du trägst deine Regenbogenstiefel und deine gelbe Jacke. Dir ist leichtmütig, du machst Tanzschritte und singst ironisch Am Sonntag will mein Süßer.
Er versteht die Ironie nicht. Er sei einmal als Trainee mit der Mir nach Riga gefahren, erzählt er. Er erklärt die Aufbauten, die Motoren, die Takelage. Studenten der Nautik nehme sie an Bord und bis zu hundertfünfzig Kadetten, erzählt er. Mit neunzehn Komma vier Knoten gilt sie als der schnellste Großsegler, erzählt er.
Du sagst nichts. Es gefällt dir nicht, dass er mit seinem Wissen angibt. Wer, denkt er, bist du? Du schaust dir alles an, das Maritime macht dich fröhlich, du liebst auf einmal den leichten Niesel, den grauen Hafen, die Männer in Uniform. Die dicken, harten Taue. Die Kompassanlage. Du stellst dir vor, wie es wäre, mit so einem Schiff in die Welt hinaus zu segeln, zu fernen Ländern und fremden Küsten. Ein Leben führen, unvorstellbar.
Einmal im Heck umarmst du ihn von hinten, deine Jacke knittert und drückt ihn, er duldet es eine Zeit lang, dann macht er sich frei.
Er schaut dir in die Augen. Du schaust zurück, mit dem, was du fühlst. Aber was fühlst du?
Am Schluss willst du ein Andenken, du kaufst für ein paar Euro einen Anstecker, den pinnst du dir an die gestreifte Bluse.
„Hat es dir gefallen?“, fragt Heiko auf dem Kai.
„Ja, sehr.“
Du schaust ihn wieder an, und diesmal versteht er. Er versteht, dass es nicht um ihn geht. Dass du allein bist und allein bleiben musst. Dass du Sehnsucht hast, dass das eines Tages aufgelöst wird. Große Sehnsucht. Deshalb sagst du noch: „Mit dir!“ Aber das kann er nur falsch verstehen.
Immerhin: Du hast ihn gewarnt. Du hast gemerkt, dass er diesen Blick kennt. Von anderen Frauen. Auf dem Weg zur U-Bahn schweigt er. Er berührt dich nicht.
Die Rolltreppen hinunter in den warmen Bahnhof, wo es nach Naphthalin und Asbest riecht. Tausend Leute. Am Bahnsteig lässt er dich stehen.
„Tschüs“, sagt er. „Vielleicht sehen wir uns mal.“
Als die U-Bahn einfährt, weißt du nicht, ob du erleichtert oder enttäuscht sein sollst. Du drückst das Kinn gegen die Brust und schaust dir deinen Anstecker an.
So wie mit Heiko geht es dir oft.
Du hast ein kindliches Bedürfnis nach Geborgenheit. Die Betonung liegt auf kindlich. Das hat deine Therapeutin gesagt, seinerzeit, als du dich endlich durchgerungen hast.