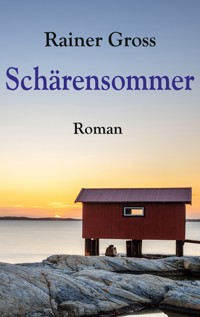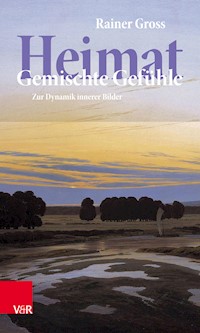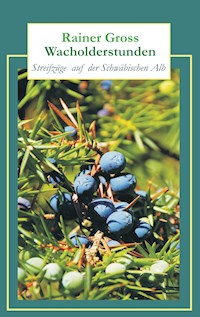Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann macht sich auf die Suche nach dem einen wahrhaftigen Menschen. Es geht auf Weihnachten zu, und seine Suche ist nicht sentimental begründet, sondern radikal, bedingungslos, verzweifelt. Er will keinen fernen Gottessohn im Himmel, keinen Heiland der Kirche: Er will ihn in Fleisch und Blut, von Angesicht zu Angesicht. Er sucht in den regnerischen Straßen seiner Stadt, bei den Obdachlosen, im Supermarkt, im Fernsehen, beim Pfarrer, in der Meditation, doch Weihnachten rückt näher, und er hat ihn immer noch nicht gefunden. Wo ist er?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Mann macht sich auf die Suche nach dem einen wahrhaftigen Menschen. Es geht auf Weihnachten zu, und seine Suche ist nicht sentimental begründet, sondern radikal, bedingungslos, verzweifelt. Er will keinen fernen Gottessohn im Himmel, keinen Heiland der Kirche: Er will ihn in Fleisch und Blut, von Angesicht zu Angesicht. Er sucht in den regnerischen Straßen seiner Stadt, bei den Obdachlosen, im Supermarkt, im Fernsehen, beim Pfarrer, in der Meditation, doch Weihnachten rückt näher, und er hat ihn immer noch nicht gefunden. Wo ist er?
Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller in Reutlingen.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).
Bei BoD u.a. erschienen:
Ein Sommerhaus im Languedoc
Die Welt meiner Schwestern
Das Glücksversprechen
Yŭomo
Haus der Stille
Er zündete bei Tage ein Licht an und
sagte: „Ich suche einen Menschen!“
ÜBER DIOGENES LAERTIOS
Inhalt
Kpaitel I
Kpaitel II
Kpaitel III
Kpaitel IV
Kpaitel V
Kpaitel VI
Kpaitel VII
Kpaitel VIII
Kpaitel IX
Kpaitel X
Kpaitel XI
Kpaitel XII
Rainer Gross
I
Ich suche einen Menschen.
Einen Menschen, wie es ihn nur einmal gab.
Einen wahren Menschen.
Ihn.
Wer ist er?
Ich weiß es nicht.
Ich gehe im Regen durch die Stadt. Glänzender Asphalt, Lichtinseln spiegeln darin, ich trete auf Wasser und Licht.
Hunderttausende Menschen leben hier. Eine Million Menschen. Zwei Millionen. Acht Milliarden Menschen leben auf der Erde. Zehn Milliarden. Zwölf Milliarden – Die Stadt.
Mit regennassen Haaren stehe ich vor einem Schaufenster. Ich sehe die Auslagen nicht. Ich sehe das Licht, den Glanz, den Schein. Die Vertrauenswürdigkeit der Preisschilder. Das alles hat mit ihm nichts zu tun. Alles hat mit ihm zu tun.
Wie soll ich mit ihm umgehen?
Eine sanfte Hand, die sich
auf den geneigten Kopf legt. Ein Lächeln den Kindern, die zu ihm kommen. Durchbohrte, blutende Hände. In Leinenbinden gewickelt sein Leib,
duftend von Balsam.
Die Wände schwirren, wenn er hindurchgeht, er steigt in die Wolken und gibt Toten das Leben.
Ich stehe mit regennassen Haaren
vor einem Schaufenster.
Alles hat mit ihm zu tun.
Ich erreiche ihn nicht. Wo ist er?
Ich habe Rechnungen zu bezahlen.
Ich habe zwei Kinder, eine Frau.
Ich habe eine Wohnung.
Ich habe ein Leben. Ein einziges.
Das ist es, was ich will: leben.
Ich habe einen Traum.
Jeder hat einen Traum.
Jeder weiß, wie es besser sein sollte.
Jeder weiß, dass dieses Leben nicht genügt.
Jeder weiß, dass da ein gigantischer Fehlbetrag in der Welt herrscht.
Jeder zahlt, was er kann, aber es reicht nicht.
Das gehört alles zum Leben. Das sollte alles nicht zum Leben gehören.
Aber was will man machen?
Was will ich machen?
Ich suche ihn.
Ich suche ihn, weil es von ihm heißt, er sei das Leben. Das LEBEN!
Ich suche ihn, weil es heißt, er gebe das Leben in Hülle und Fülle, eine sprudelnde Quelle im heißen Staub, Oasenschatten, gefächert von den Wedeln der Palmen, süße Datteln und Feigen, ein brausender Sturzbach aus trockenem Stein hervor, ein Garten voller Vögel und Schmetterlinge, ein Hain voller Früchte und Nüsse, ein Teich, ein Fluss, ein Meer aus kristallenem süßen Wasser.
Ich habe nichts als Bilder.
Vielleicht bin ich selbst ein Bild.
Ein Gleichnis. Irgendwer muss mich entschlüsseln.
Es gehört zu diesem Leben, dass ich das selbst tun muss. Wir müssen uns selbst entschlüsseln und uns den Weg zum Leben selbst weisen. Das ist der grundlegende Fehl in unserem Leben –
Ach, Leben!
Ich will doch nur leben.
Ich suche ihn, damit er mich entschlüsselt. Der Code dafür steckt in der DNS dieser Welt. Ich weiß es.
Es liegt alles vor meinen Augen,
es ist zum Verzweifeln.
Ich sehe nur den Kaffeebecher am Morgen, den Toaster, die Gesichter der Kinder, das mürrische Gesicht meiner Frau, verhaftet im Selbstgespräch. Ich sehe Schulranzen, Autoschlüssel, Brotkörbe, Fenstersimse, kahle Bäume, Krähen, Straßenlaternen, Bürotüren, Aschenbecher, Gläser halbvoll mit Saft, gebrauchte Teebeutel, abgebrannte Kerzen, Computertastaturen, Linoleumflure, Neonleuchten, Kugelschreiber, Armbanduhren, schlecht geschminkte Lippen, Krawatten, Wintermäntel, und wenn ich aufblicke zum Himmel, sehe ich Bleigrau.
Wirklichkeit blendet.
Sonst könnte ich ihn sehen.
II
Geschichten erzählen. Das sollte man. Gleichnisse vielleicht. Wofür?
Es gibt nur drei Geschichten: seine, meine und die der Anderen.
Seine ist leicht erzählt. Überall kann man sie nachlesen.
Meine, das ist meine Aufgabe.
Die der Anderen, das bedeutet Mannigfaltigkeit und Wiederkehr des Gleichen.
Meine Geschichte ist klein, aber einzigartig für mich. Meine Geschichte ist nicht ich, sonst würde ich kein Wort herausbringen. Sie besteht zum Beispiel in einigen Fotos. Ein Kleinkind mit verstruwwelten Haaren und großen Augen. Im Kinderbett. Im Kinderwagen. Eine Stoffgiraffe im Mund. Ein kleiner Junge beim Spielen am Bach. Weinend. An Vaters Hand. Auf Mutters Schoß. Mit der Schultüte in der Hand, deren Farbe man auf dem Schwarzweißfoto nicht erkennen kann. Sie hatte ein glänzendes Tannengrün mit weißer Borte.
Geboren, großgeworden, irgendwie, wie alle, und doch einzigartig.
Kindergarten, Schule, Gymnasium, Ausbildung, Beruf. Familie. Erstes Auto. Erste Wohnung. Die Stadt.
Siebenunddreißigeinhalb Wochenstunden. Ausflug am Wochenende. Drei Wochen Urlaub. Uns geht es gut. Solange man jeden Tag aufstehen kann. Solange man jeden Tag bewältigen kann. Das ist die Zeit:
Tag für Tag.
Was ist die Zeit? Das sollte ich wissen. Gewinne ich mit jedem Tag? Oder verliere ich? Oder entscheidet es sich jeden Tag neu?
Wer auf der Suche ist, hat
seine eigene Zeit –
Meine Geschichte.
Die will niemand wissen. Nur ich.
Und er.
Er kennt sie.
Er war ja von Anfang an dabei.
Vielleicht sollte ich nicht erzählen, sondern sie mir erzählen lassen. Von ihm.
Er ist ein Mensch.
Ein wirklicher, ein wahrer. Vielleicht
kennt er sich aus mit Geschichten.
Das wäre schön: Wenn er neben mir stünde, beim Heraustreten aus dem Bürogebäude, beim Verlassen der Baustelle, beim Schließen des Ladens. Ein Blick in den dämmrigen Himmel, der Wind wortlos und weich, und er würde mich zu einem Bier einladen. In die Kneipe. Oder zu einem heißen Tee bei sich zuhause. Wenn er eine Wohnung hätte, könnte ich später wiederkommen. Wir säßen und redeten.
Ich erzähle dir deine Geschichte, sagte er. Was hat meine Geschichte mit seiner zu tun?, fragte ich mich. Kann er mir das auch erzählen? Aber ich wäre viel zu froh, ihn gefunden zu haben.
Ein beeindruckender Mensch.
Er kennt die Menschen und ihre Geschichten. Alle. Acht Milliarden plus die, die gestorben sind in zweitausend Jahren und mehr. Dass er sich Zeit nähme für mich, nähme mich Wunder –
Meine Geschichte.
Vierzig Jahre, vierzehntausendsechshundert Tage. Und dann wird es zur Suche. Und dann entdeckt, dass es vierzig Jahre Suche waren. Nicht etwas Gehabtes verloren, kein versunkenes Zeitalter, kein Kindheitsidyll. Etwas nie gehabt, immer geglaubt, es zu haben oder zu bekommen, und dann der totale Bankrott. Wodurch?
Ich weiß es nicht.
Durch ihn.
Wie er gelebt hat. Was er gesagt und getan hat. Die Wahrheit, die sich in seiner Person ballt wie eine Faust.
Sanftmut, Entschlossenheit, Hingabe, Erfüllung.
Das hat mich überzeugt davon, dass ich ihn nicht habe.
Ich sollte ihn aber haben.
Ich muss ihn haben.
Ich rede mit ihm. Oder eigentlich nicht.
Ich streue meine Worte in den Novemberwind. Der stürmt um Ecken und Türme.
Wie die Tibeter mit ihren Gebetsfahnen.
Es erreicht ihn wohl alles, aber es kommt kein Wort zurück.
So rede ich vor mich hin, ein lebenslanger Monolog. Sein oder Nichtsein, Leben oder Nichtleben.
Wer ihn hat, der hat das Leben, heißt es von ihm. Wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht.
Ich habe das Leben nicht.
Ich rede mit allen möglichen Menschen. Manche kennen ihn, manche nicht. Beides nützt mir nichts. Ich muss selbst mit ihm reden, eine Audienz, eine Anhörung, ein Dialog. Aber das gibt es nicht. Ich habe keine Hoffnung.
Er ist in einem Elendsquartier geboren. Unterwegs. Zeigte früh religiöse Neigungen. Wurde Handwerker und baute Häuser. Führte ein bescheidenes, rechtschaffenes Leben. Bis er plötzlich wusste, wer er war, und nichts mehr lassen konnte, wie es dreißig Jahre lang gewesen war.
Bis er entdeckte,
wer er wirklich war.
Er war klein. Ein Geringer, vielleicht war er hässlich.
Auffallend, wie er sich zu den Geringen hielt, wie er ihre Sorgen und Leiden kannte, wie er alles tat, um ihnen zu helfen. Caritas, Humanitas, und mehr.
Wie er die Geringen seine Brüder und Schwestern nannte. Wie er sagte, dass er als Richter wiederkomme und genau dies, die Geschwisterschaft der Geringen, zum Urteil machen werde.
Vielleicht sollte ich zu den Geringen gehen. Vielleicht ist er dort.
Wer sind die Geringen? Ich sehe sie in den Fernsehnachrichten, dort sind sie heute zu finden. Millionenfach.