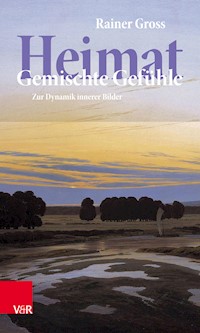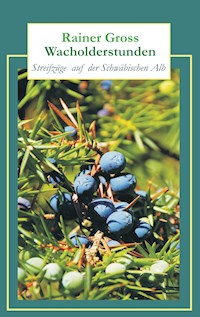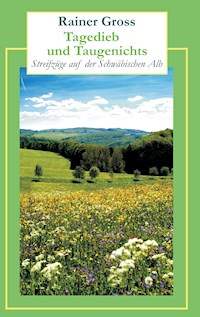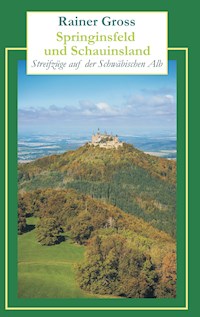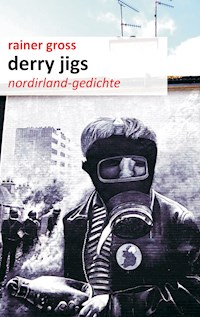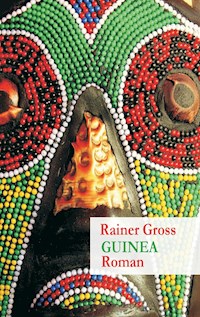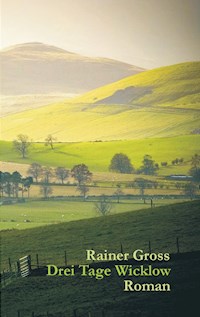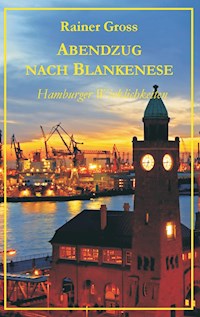19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Wandel im Jahr des Fuchses ist unaufhaltsam. Manche können ihn spüren, im Wasser, in der Erde, in der Luft. Der ewige Sommer neigt sich dem Ende zu; Wundergegenden entstehen, in denen Blumen in den Himmel wachsen und Menschen fliegen können. Es heißt, die Rückkehr des Königs stehe bevor. Viele brechen auf, ziehen in Gruppen die Große Straße entlang nach Westen, mancher verlässt sein Heim und seinen Alltag und wagt den Aufbruch. Auch der Minstrel ohne Namen macht sich bereit. Immer mehr verbreitet er auf seinen Streifzügen durch das Land die Nachricht von der Rückkehr des Königs und fordert die Leute auf, dem König entgegen zu gehen. Das ruft Gegenkräfte auf den Plan: Das Gelichter versucht, ihn von seinem Tun abzuhalten. Da taucht ein Name in den umlaufenden Gerüchten immer wieder auf, ein Ort, ein Zeichen. Und der Minstrel macht sich auf den hindernisreichen Weg ... Der würdige Abschluss eines bewegenden Epos. Ein Picaroroman, ein Endzeitroman, ein fantastisches Coming home in einer zauberhaften Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Wandel im Jahr des Fuchses ist unaufhaltsam. Manche können ihn spüren, im Wasser, in der Erde, in der Luft. Der ewige Sommer neigt sich dem Ende zu; Wundergegenden entstehen, in denen Blumen in den Himmel wachsen und Menschen fliegen können. Es heißt, die Rückkehr des Königs stehe bevor. Viele brechen auf, ziehen in Gruppen die Große Straße entlang nach Westen, mancher verlässt sein Heim und seinen Alltag und wagt den Aufbruch.
Auch der Minstrel ohne Namen macht sich bereit. Immer mehr verbreitet er auf seinen Streifzügen durch das Land die Nachricht von der Rückkehr des Königs und fordert die Leute auf, dem König entgegen zu gehen.
Das ruft Gegenkräfte auf den Plan: Das Gelichter versucht, ihn von seinem Tun abzuhalten. Da taucht ein Name in den umlaufenden Gerüchten immer wieder auf, ein Ort, ein Zeichen. Und der Minstrel macht sich auf den hindernisreichen Weg dorthin …
Der würdige Abschluss eines bewegenden Epos. Ein Picaroroman, ein Endzeitroman, ein fantastisches Coming home in einer zauberhaften Welt.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen, studierte Philosophie, Literatur und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er erhielt 2008 den Friedrich-Glauser-Debütpreis.
Von Rainer Gross bisher erschienene Fantasy: Tempel des Königs (2016); Das Jahr des Fuchses (2025); Der Minstrel und der Fuchs (2025)
Für meinen Bruder, der so gerne
Fantasy liest und den König kennt.
Ich aber, ich will satt werden, wenn
ich erwache, an deinem Bilde.
PSALM 17,15
Inhalt:
Das Kirschblütenwunder
Im Kräuter
Der Aschenputtelmann
Wie stark ist der Schild?
Die Tanzlinde
Am Spaßmacherbaum
Schlüssellein
Die Große Straße
Am Kanal
Die Sint
In der alten Mühle
Unverhofftes Wiedersehen
Der Bienenbaum
Makabrium
Das Frollein
Die hermetische Kammer
Das Rosengärtlein
Wegzoll
Findhorn
Fuchsnachmittag
Lady Edvardiana
Das Pflänzchen Rühr-dich-nicht
Bittlingmayrs Rammler
Ich wünschte du wärst hier
Waldeinsamkeit
Die Drei von der Landstraße
Ein Gruß aus Arkadien
Das Fest auf der Veste
Eine Muse kommt selten allein
Im Heckengäu
Der Bluthund
Imago
Mummenschanz
Das bodenlose Loch
Abschied
Der Schattenmann
Alte Freunde
Der Puppenspieler
Drachenfutter
Sternfall
Die Rückkehr des Königs
Sternfall
1
Das Kirschblütenwunder
Es war eine herrliche Zeit. Unbekümmert wanderte er umher, sang seine Lieder dem, der sie hören wollte, begegnete Menschen und wunderlichen Gestalten, erlebte manches Kuriosum und ließ sich die Sonne auf den Pelz brennen, wann immer es ging.
Er wusste nun, dass der König kommen würde, und das nicht in ferner Zeit, sondern bald. Wie bald, das wusste er allerdings nicht. Er freute sich darauf, es gab ihm Langmut, manches Übel zu ertragen, er schüttelte den Kopf über die Menschen und das Gelichter, die ihren Beschäftigungen nachgingen, als würde alles ewig so weitergehen, und blickte zuversichtlich voraus. Dass etwas am Kommen war, spürten die Leute wohl. Wenigstens die Empfindsamen und Feinnervigen. Wer Sinne hatte, fühlte es auch in der Luft, im Wasser, in der Erde. Manche munkelten hinter vorgehaltener Hand von einem Kommenden, das alles verändern würde, sagten aber weiter nichts. Mancher hatte etwas läuten hören, wusste aber nicht, wo die Glocke hing.
Er wusste es. Wer ihn fragte, bekam Antwort. Aber er wollte sich nicht aufdrängen. Wozu auch? Wenn der König käme, läge sowieso alles am Tag.
Aber es gab Zeichen.
Das Jahr des Fuchses war im Wandel.
Die Zeichen waren für ihn deutlich sichtbar. Immer öfter kam er durch abgelegene Gegenden – ein stilles Wiesental etwa oder einen Hochwald oder durch ein verwunschenes Hügelland –, die verwandelt worden waren. Vielleicht wäre niemandem sonst die Veränderung aufgefallen; aber er fühlte es sofort.
Die Luft schmeckte wie Wein. Das Wasser war klar und süß und hatte Kraft. Das Kraut, die Blumen, die Bäume flirrten vor Lebendigkeit, alles um ihn her war voller Leben, wie er es noch nie gefühlt hatte, alle Dinge waren wie befreit von Fesseln. Die Wirklichkeit prickelte auf der Haut, die Immen sangen mit ihrem Flug, die mannshohen Glockenblumen läuteten, die Himbeeren waren so groß wie Melonen, die Pilze sprossen feist und dufteten, die Kräuter heilten jedes Gebrechen, und selbst der Himmel strahlte in einem Blau, wie er es noch nie gesehen hatte.
Solche verwandelten Gegenden fand er immer öfter. Er fragte sich, was die Leute dazu sagen würden, wenn sie es sähen. Wenn so ein Wunder einmal in besiedelten Gegenden geschehen würde.
Er ging am Rand eines Tales entlang und schaute aus nach einer Lücke im Wald, durch die er würde hinab blicken können. Er witterte in die Luft und spürte etwas Ähnliches wie in den verwandelten Gegenden.
Was er spürte, war ein Aufbrechen der Natur. Wie im Frühling, aber den gab es nicht im Jahr des Fuchses.
Was er spürte, war ein Leichtmut und eine Heiterkeit in der Luft. Die Wege waren bequem und die Gebüsche licht. Eine Freude prickelte in den Gliedern, die Lust auf Entdeckungen und Überraschungen machte. So ging er oben am Talrand und fand endlich eine Lücke zwischen den Bäumen. Er trat an den Talhang heran und schaute hinab.
Das Tal war licht und hell. Eine Helle lag darüber, die schimmerte und die den Dingen eine goldene Aura verlieh. Das Tal war grün und fruchtbar, und die Bäume, die dicht dort standen, trugen Wolken aus Schnee.
So sah es zumindest aus. Er aber kannte Schnee, aus den Schneebergen im Osten, und er wusste: Das ist kein Schnee. Das sind Blüten!
Die Bäume waren über und über voll mit weißen Kirschblüten. Das ganze Tal, hinauf und hinunter, blühte es in Wolken. Ein Anblick, der ihn tief berührte.
Er suchte einen Pfad und stieg hinab. Das Tal war weit, sanft, und um manchen Weidenpfahl flitterte das Licht. Unten bei den Bäumen sah er, dass die Blüten unzählbar waren, dicht an dicht an den Zweigen, ein reinstes Weiß, rosa überlaufen, mit dem gelben Stempel in der Mitte, wie sich’s gehörte. Was sich nicht gehörte, war die Menge: So volle Kirschbäume hatte er noch nie gesehen. Er wusste nicht, dass das Tal für seine Kirschen berühmt war und dass erst vor einer Woche die Kirschernte zu Ende gegangen war. Diese zweite Blüte kam für alle völlig überraschend und war ein Wunder.
Als er in ein Dorf kam, waren die Gassen leer. Aus den Fenstern hing Bettzeug zum Lüften, die Katzen lagen faul auf den Trittsteinen, und niemand kam gegangen, nicht einmal ein Kind.
Er wunderte sich und suchte nach den Bewohnern. Er ging aus dem Dorf hinaus und weiter das Tal aufwärts. Und da sah er sie alle unter den blühenden Bäumen sitzen, auf Tüchern und Mänteln, sah sie plaudern und Lieder singen, lachen und scherzen, schmausen und trinken. Ein paar tanzten einen Reigen, und alles war fröhlich und ausgelassen.
Hier lässt sich gut leben, dachte er und ging hinüber.
Von den Sitzenden wurde er mit großem Hallo begrüßt und eingeladen, er dankte und lächelte und ging weiter, und dann fand er eine Gruppe von alten Männern auf einem Laken sitzen und palavern. Das waren sicher die Dorfältesten.
Er ging hin, wurde wieder eingeladen, setzte sich diesmal dazu und versuchte heraus zu bekommen, worum es ging. Die Männer sprachen den Krügen Most zu, in die ab und zu ein Blütenblatt rieselte, und über ihm war der Himmel schneeweiß.
Er hatte noch nie aus Zeitvertreib einfach unter Kirschblüten gesessen. Es war ein heiteres, aber auch andächtiges Sitzen und Schauen. Im Grunde brauchte es die ganze lärmige Fröhlichkeit nicht, dachte er. Einfach sitzen und schauen genügte.
Indes hatten die Menschen hier etwas zu feiern. Die Männer um ihn her staunten wie er. Mit Worten. Es ging in ihrem Gespräch darum, was nun mit dem Wunder zu geschehen habe. So wie es aussah und wie rasch es blühte, würden bald wieder die ersten Früchte wachsen. Die Immen kamen mit dem Bestäuben kaum hinterher. Und so zahlreich die Blüten waren, ließen sie eine doppelt so große Ernte erhoffen wie sonst.
Sie hielten sich nicht mit der Frage nach dem Warum auf. Sie blickten bereits voraus auf das, was das Wunder für sie bedeutete. Männer der Voraussicht waren sie. Kluge, weise Männer, wenn es darum ging, die Belange des Dorfes im Blick zu haben. Aber dumme Toren, dachte er, als er so zuhörte, die nicht sahen, was vor ihren Augen vorging.
Sie überlegten, neue Scheuern zu bauen, um die vielen Früchte lagern zu können; sie überlegten, die ganzen abgefallenen Blüten zu sammeln und Likör daraus zu machen; sie dachten darüber nach, wo man Helfer dingen konnte bei der gewiss bald anstehenden Lese. Sie redeten von Kirschwasser und Kirschmarmelade und eingekochten Kirschen.
Tüchtige Männer,! dachte er sarkastisch. Aber dass niemand sich fragte, woher das alles kam! Wieso jetzt? Wieso überhaupt? Hatte es so etwas im Jahr des Fuchses, in dem zwar alles gedieh und fruchtete, je in solchen Maße gegeben?
Er hörte noch eine Weile zu und merkte, dass sich da nichts weiter ergab. Die Ältesten waren dabei, den versprochenen Reichtum zu verteilen. Für Fragen nach dem Wandel, der vorging, war kein Platz.
Bekümmert stand er auf, nickte höflich und ging weiter. Er kam zu einer Gruppe aus einfachen Menschen, Frauen und Kindern und Knechten, und setzte sich zu ihnen. Sie lachten und erzählten einander, und immer wieder hoben sie ihre staunenden Blicke in die Bäume.
»Das ist ein Wunder, was?«, sagte einer und stieß ihn an.
»Und dabei haben wir die Kirschernte schon gehabt. Vor zwei Wochen erst. Und jetzt das!«
»Hat es das bei euch noch nie gegeben?«, fragte er.
»Noch nie. Wie gesagt: ein Wunder!«
»Aber woher kommt das Wunder?«, fragte er nach.
»Wie meinst du das?«
»Na, wer ist dafür verantwortlich?«, sagte er. »Wer hat das gemacht?«
»Wieso soll das jemand gemacht haben?«, fragte der Mann zurück. Und eine Frau meinte: »Wer sollte sowas machen können? Es ist das Jahr des Fuchses, das ist alles!«
»Es geschehen im Jahr des Fuchses doch immer wieder Wunder«, ließ sich ein Jüngling vernehmen. »Wir haben oft davon gehört. Und nun erleben wir auch mal eins.«
»Ihr habt von solchen Wunder gehört?«
»Ja, in letzter Zeit hört man immer wieder von solchen Absonderlichkeiten. Nicht weit weg von hier wächst der Weizen armdick, und die Scheunen können die Ernte gar nicht fassen.«
»Und von einem Fischteich in der Nähe habe ich gehört, da werden die Karpfen so groß wie Kälber. Sie brauchen dort drei Männer, um sie aus dem Wasser zu ziehen.«
»Ja, ja. Immer wieder haben wir davon gehört. Und jetzt hat es uns auch erwischt.«
»Aber diese vielen Wunder – gibt euch das nicht zu denken?«, hakte er nach. »Ich meine, vielleicht bedeuten sie ja etwas.«,
»Was sollen Wunder anderes bedeuten als Wunder?«, sagte die Frau verständnislos. »Sie bedeuten, dass wir so viele Kirschen haben werden, dass wir alles auf dem Markt im Flecken verkaufen können und reich werden!« Sie lachte.
»Na ja, aber vielleicht sind es mehr als nur Wunder«, ließ er nicht locker.
»Mehr als Wunder? Wie könnte das sein?«
»Sie könnten Zeichen sein.«
»Zeichen?«, fragte ein junger Knecht. »Wofür?«
»Dass noch mehr kommt.«
»Das wäre ja herrlich! Noch mehr. Ja, warum nicht? Wir lassen uns gern beschenken.«
»Aber sag«, meinte der Bauer unter ihnen, »bist du ein Harnprophet oder ein Kaldaunenleser, dass du von Zeichen redest? Kannst du das Wunder deuten?«
»Ein Prophet bin ich nicht«, sagte er lächelnd, »ich bin nur ein wandernder Minstrel im Jahr des Fuchses. Aber ich weiß, dass etwas im Kommen ist. Dass eine große Veränderung bevorsteht.«
»Ach, das meinst du«, warf der Mann vom Anfang ein. »Dieses Gerücht vom Wandel im Jahr des Fuchses. Diese dumme Prophezeiung, dass das Jahr des Fuchses enden wird.«
»Glaub mir«, sagte der Bauer und legte ihm die Hand auf die Schulter, »da wird sich nichts ändern. Das bleibt alles, wie es ist. Brauchst dir keinen Kopf zu machen. Und solange es solche Wunder wie diese Blütenpracht gibt, braucht sich auch nichts zu ändern.«
»Oder bist du gar einer von denen, die vom König faseln?«, argwöhnte die Frau. »Die von der Rückkehr des Königs sprechen? Wie so ein Phantast und Windbeutel siehst du gar nicht aus.«
»Welchen König meint ihr denn?«, fragte der junge Knecht.
»Na«, sagte der Bauer, »den König aus dem alten Lied, das man jetzt überall zu hören kriegt.«
»Aber das ist doch eine Sagengestalt!«, rief der Jüngling. »Das hat mir meine Mutter am Kindsbett gesungen. Wieso sollte der kommen?«
»Nein nein, mein Freund«, sagte der Bauer. »Das Jahr des Fuchses dauert ewig. Da kannst du dich darauf verlassen. Nein, mein Freund, es ist ein Wunder. Wir nehmen’s, wie’s kommt.«
Zufrieden schaute er ihn an, und sie sprachen nun über den heutigen Abend, an dem es ein Fest für alle Bewohner des Tales geben sollte. Fackeln keine, damit die Blüten nicht gefährdet würden, aber Laternen und Lampions. Tanz natürlich und Musica.
Da sahen sie den Knickhals seiner Laute aus dem Felleisen ragen. Ob er denn, so wie die Dinge lägen, seine Sangeskunst zum Besten geben würde, fragten sie ihn. Und als er bejahte, wurde ihm vorgeschlagen, heute Abend ein Kirschblütenlied zu singen, möglichst fröhlich und zum Mitsingen.
Er lächelte auf dieses Angebot hin. Ja, dachte er, warum nicht? Er ließ sich nicht gerne vorschreiben, was für Lieder er singen sollte, aber gedachte sowieso, es auf seine Art zu tun.
Dann boten sie ihm eine Schale mit heißem Wasser an. Kirschblüten schwammen darin.
»Schmeckt das denn?«, fragte er.
»Aber ja. Der zarteste Kirschblütengeschmack, den du dir denken kannst.«
Er kostete und fand es überraschend süß. Die Kirschblüten gaben in dem heißen Wasser ihr Aroma ab, und der Trank duftete auf der Zunge.
Er blieb eine Weile bei den Leuten, freute sich mit ihnen, fand es nur schade, dass sie das Wunder so gedankenlos hinnahmen.
Dann wurde er müde und verabschiedete sich. Er wanderte den Weg weiter talaufwärts und ließ die unbefangen Feiernden hinter sich.
Er kam an keinen Weiler mehr. Im Talschluss standen noch einmal etliche Bäume im Gras, er setzte sich unter einen von ihnen und ließ sich vom Blütenschnee beträufeln.
Hier war es still. Hier konnte er in aller Stille in das flirrende Weiß hinauf schauen, das Lächeln des Himmels dazwischen, und sich in Ruhe diesem Wunder öffnen.
Er war sicher, dass es ein Zeichen war. Ein Anzeichen. Ein Vorbote. Mochten die Leute darüber denken, was sie wollten. Ja, dachte er und seufzte im Stillen, es braucht tatsächlich mehr als Zeichen und Wunder, um die Menschen zum Nachdenken zu bewegen.
Und als er zur Ruhe gekommen war und andächtig unter den Blütenwolken saß, kam ihm das Lied in den Sinn, das er am Abend singen würde. Er sang es leise, damit es niemand hörte, ganz für sich allein.
Voll Schnee ist hier der Baum,
im Blau wie nur ein Traum.
Und wenn ein leiser Wind sich regt
und Luft unter die Blüten hebt,
dann schneit es gar in Flocken
wie Seide von den Rocken.
Da stand plötzlich ein kleiner Junge vor ihm im Gras. Er erkannte ihn wieder: Es war einer der Kleinen, die bei der Gruppe gewesen waren, mit der er sich unterhalten hatte.
Er musste ihm nachgegangen sein. Sieh da, dachte er. Vielleicht hat er eine Frage.
»Bist du mir nachgegangen? Was willst du denn von mir? Wie heißt du denn?«, fragte er freundlich.
Der Junge schaute ihn groß an.
»Willst du etwas über den König wissen?«, fragte er und schöpfte Hoffnung, dass doch nicht alle so begriffsstutzig waren.
Der Junge streckte nur seine Hand aus. Der kleine Finger, der sich bog, zeigte auf sein Felleisen.
»Hast du sie da drin?«, fragte der Junge.
»Was?«
»Deine Harfe.«
»Du meinst meine Laute?«
Er nickte heftig.
»Ja, sie ist da drin. Willst du sie sehen?«
Heftiges Kopfnicken. Die Augen des Jungen strahlten, als der Minstrel sie auspackte und in den Händen hielt. Der Junge näherte sich ehrfürchtig und streckte wieder seine Hand aus.
»Nur zu«, sagte er.
Der Junge legte vorsichtig seinen Finger auf eine der Saiten und zupfte. Ein Ton erklang. Er lachte. Er probierte es noch einmal und lachte wieder.
»Wirst du heute Abend darauf spielen?«, fragte der Junge hoffnungsvoll.
»Ja, werde ich. Und ein Lied dazu singen. Willst du es vielleicht schon hören?«
Der Junge schaute ihn groß an. Dann schüttelte er den Kopf. Sein Mut war aufgebraucht, er drehte sich um und rannte übers Gras auf den Weg zurück. Er verschwand um die Biegung, ohne sich noch einmal umzusehen.
Er seufzte.
Das war es also, was den Jungen dazu getrieben hatte, ihm den ganzen Weg zu folgen. Seine Laute.
Nun denn, sagte er sich, war zufrieden mit dem Liedchen, das er gedichtet hatte, und streckte sich im Gras aus für ein Nickerchen.
Es würde ein langer, lärmender Abend werden.
2
Im Kräuter
An einem warmen Mittag stieg er in die Hügel. Bucklichte Welt hieß der Bergrücken, der sich durch ein Land aus Wäldern und Feldflur zog. Droben gediehen Buchen in lichten Sälen, Ahorn und Ulmen und einige Tannen, die dunklen Forst bildeten. Der Weg war steil und kurz und ging in Kehren, aber er brauchte nicht lange und hatte bald den Blick von oben ins Land hinaus. Ins dunstige Land. In den Zweigen spielte eine leise Brise wie eine ferne Melodie, und die Weidenröschen nickten dazu.
Oben wanderte er von Hügel zu Hügel. Der Boden war trocken und kalkig, und in den Rinnen zwischen den Bühlen rannen kleine Wässerchen, umwachsen von Dickicht. Allenthalben sah er auf den Kuppen kleine Schopfe und Hütten stehen. Die Bewohner bestellten da wohl ihre Laubengärtchen und hatten einen heißen, arbeitsamen Mittag. Der Hügel, auf dem er gerade durch den Wald ging, machte keine Ausnahme. Unter ein Fichtenwäldchen geduckt, aufsteigend am Hang, entdeckte er einen kleinen Garten, wild und abgelegen, ein windschiefer Zaun grenzte ihn ab gegen den Weg, den er kam. Ein paar Handbreite Beete, überwuchert von Wildblumen, Disteln und Himbeeren, eine kleine Staffel aus schiefen Steinen, die hinauf führte, und ein Tor aus Holzlatten, das lose in den Angeln hing und mit Draht gesichert war. Ein kleines Blechschild verkündete den Gewannnamen: Im Kräuter IV/7.
Der Ort lag still da, traulich und abgeschieden. Irgendwer hatte dort seine Zuflucht angelegt. Ackerte und rupfte und zog die Pflänzchen, gebeugt ins wilde Gras, ein wenig schlampig alles und unbekümmert, und der Nachmittag verschlief hinterm Zaun die Stunden.
Er wurde neugierig und ging hinüber. Er stieg das Stäffelchen hoch, der Stein war warm und trocken, er lüpfte die Drahtschlinge, schwang das Törchen auf und tat den Schritt über die Schwelle.
Er blieb stehen und schaute. Da waren viele Blumen, die er nicht kannte. Akelei entdeckte er und Fingerhut, den Wermut und Erdbeerblätter, aber sonst war es wild und durcheinander, und es war gar nicht sicher, ob das nun ein Gärtchen war oder ein abgestecktes Feld aus Wildnis.
Es roch nach trockener Erde und lauem Gießwasser, nach der Herbe des Krauts und dem süßen Nektar der Blüten. Es war still. In den Himbeeren säuselten die Immen. Er tat noch einen Schritt, und plötzlich tauchte aus einem Beet ein runzliger Kopf mit langen grauen Haaren auf.
»Was willst du denn hier?«
Ein altes Weiblein mit dicken Zöpfen und einem braunem Kittel, das kopfüber in der Erde jätete. Es richtete sich auf, drehte sich halb und schaute ihn an. In den Augen funkelte es, und er war sich sicher, dass er Gelichter vor sich hatte.
»Kennst du mich denn?«, fragte er.
»Ich? Dich kennen? Woher denn? Aber wer hier herauf findet und noch dazu mein Gärtchen betritt, muss ein ganz besonderer Sonderling sein. So.«
Sie stemmte die Hände in die Hüften und wartete auf eine Erwiderung.
»Je nun«, sagte er, »ich wandere umher, bin mal hier, mal dort ...«
»Bah, willst du mich kirren? Da schaut ja noch der Lautenhals aus deinem Felleisen. Du bist ein Fahrender Sänger, ein Minstrel, wenn ich nicht irre. So ist das.«
»Wenn du’s weißt, warum fragst du dann?«
»Und wenn du der bist, der ich meine, dass du bist, dann habe ich von dir gehört.«
»Ach was?«
»Tu nicht so. Du bist der Namenlose, stimmt’s? Du ziehst herum und singst Lieder vom König.«
»Und? Kennst du ihn?«
»Und fragst die Leute, ob sie den König kennen. Das nervt.« Sie schaute ihn herausfordernd an.
»Und du kannst mir auch nichts vormachen«, erwiderte er. »Was bist du denn? Wie heißt du?«
»Ich bin Ga. Oder Gä. Wie du willst. Ich bin nur ein Erdmütterchen, das auf diesen Fleck die Fuchsgunst ausnutzt und sein Gärtchen baut.«
»Hör zu, Ga oder Gä. Ich weiß wie du, dass du ein Gelichter bist. Eine Erdnymphe, vermute ich.«
»Wenn du’s weißt, warum fragst du dann?«
»Ich frag ja gar nicht. Ich habe nur schon lang kein Gelichter mehr getroffen und wollte fragen, wie’s so geht. Ob ihr auch den Wandel spürt, der im Jahr des Fuchses eingetreten ist.«
»Hör zu, Freundchen«, sagte der muskulöse junge Recke, der plötzlich da stand und sein Schwert zückte. »Ich mag keine aufdringlichen Fragen! Verschwinde, sonst mach ich dir Beine!«
Er lächelte nur. »Du kannst mich nicht täuschen, Gestaltwandlerin. Du tauschst deine äußere Form, aber du bist kein Kämpfer. Und außerdem hättest du gegen Schwert«, und nun zog er blank, dass Schwert im Mittag sirrte und zischte, »sowieso keine Chance.«
»Nun, nun, warum so hitzig«, sagte das junge Mädchen, das vor ihm stand. Sie hatte langes braunes Haar und dunkle Augen, und ihre Lippen nahmen den Himbeeren das Rot ab. Sie legte den reizenden Kopf schräg und meinte: »An so einem Mittag lässt sich doch sicherlich Netteres anfangen als ein Streit, oder?«
»Tandaradei. Als Erdmütterchen hast du mir besser gefallen, Gä. Du kannst mir nichts vormachen. Bei mir verfängt kein Gaukel.«
Da stand wieder das alte Weiblein und klappte verärgert die Unterlippe herunter.
»Was bist du für einer? Was willst du von mir?«
»Eigentlich nichts. Nur, wie gesagt, würde ich mich gerne mit dir ein wenig unterhalten. Wie wär’s, wenn du mal Pause machst?«
Das Weiblein seufzte und setzte sich umständlich in die Erde des Beetes, stützte sich auf den Hackenstiel und schaute ihn an.
»Pause ist gut. Ich mach uns einen schönen Kräutertee, und dann setzen wir uns vors Häuschen und plaudern ein bisschen. Guter Vorschlag.«
Er half ihr aufstehen und merkte, dass sie durchaus nicht so gebrechlich war, wie es den Anschein hatte. Sie ging zu ihrem Koben, verfügte sich nach drinnen und kam wenig später mit zwei Bechern dampfenden Kräutertees wieder heraus.
Sie setzten sich auf das Bänkchen neben der Tür, er nahm vorsichtig seinen Becher, und die Alte sagte: »Wohl bekomm’s!«
Er kostete und erinnerte sich an Allebains Kräutersud. Der hier war gehaltvoller und schmeckte sehr wild.
»Was baust du an?«, fragte er. »Ich sehe weder Kohlbeete noch Bohnenstangen noch Salatköpfe.«
»Ich baue Kräuter an. Ich halte mich an den Gewannnamen. Ich hab Ringelblumen und Bingelkraut, Feldthymian und Dost, Borretsch und Liebstöckel, Bärlauch da drüben im Wäldchen und Löwenzahn, Sauerampfer und Hirtentäschel, Gundermann und Johanniskraut, Salbei und Schafgarbe, Spitzwegerich und Giersch und noch einige mehr. Ich lebe von Kräutern.«
»Der Tee schmeckt gut. Wenn du mich nicht in Zwerg Nase verwandelst …!«
»Keine Sorge. Deine Nase wächst nur, wenn du lügst.«
Sie lachten beide.
»Du hast recht, Namenloser«, sagte die Alte da und schaute ihn listig an. »Wir haben dich im Auge, wir Gelichter. Wir verfolgen deinen Weg, seit du hier die Augen aufgemacht hast.«
»Ich weiß«, erwiderte er und nahm einen Schluck.
»Du bist etwas Außergewöhnliches im Jahr des Fuchses. Du bist kein Mensch wie alle, aber du bist auch kein Gelichter. Wir wissen nicht, wohin dein Weg führt. Das weißt du allein, oder auch nicht. Aber mit dir ist etwas ins Jahr des Fuchses gekommen, das es vorher nicht gab.«
»Und was ist das?«
»Veränderung. Willen. Du kannst dich wandeln. Du machst eine Entwicklung durch. Du bist nicht einfach der, der du bist. Und du fragst dich, wer du denn überhaupt bist. Das ist alles sehr außerordentlich.«
»Findet ihr, dass von mir eine Gefahr für euch ausgeht?«
»Bewahre! Wir beobachten dich nur und tauschen Erfahrungen aus. Wir versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben.«
»Und was haltet ihr von dem Wandel, der durch das Jahr des Fuchses geht? Ihr spürt ihn auch, das weiß ich.«
»Weißt du«, sagte sie, »ich lebe ziemlich allein. Was die Anderen tun, weiß ich nicht und will ich auch nicht wissen. Aber wenn so ein Fahrender Sänger mir ein Liedchen spielen wollte, so hingeträllert in die Sonne, ein Lied wie ein Schmetterling – dann wäre ich geneigt, deine Frage zu beantworten.« Sie zwinkerte ihm zu.
Er lächelte. »Wenn ich sonst nichts für dich tun kann ... «, sagte er und griff nach seinem Felleisen. »Aber lass mir etwas Zeit, ich muss es erst machen.«
»Das Lied? Extra für mich?« Sie blinzelte kokett und tat verlegen.
Sie saßen schweigend und tranken ihren Tee. Die Immen und Hummeln summten um die Hütte, das Holz roch in der Sonne, die Kräuter dufteten. Es war ein idyllisches Fleckchen hier.
»Und du hast die Fuchsgunst genutzt und dir dieses kleine Reich geschaffen?«
»Ja, ich habe einen Segen darauf gelegt. Einen Segen im Namen des Fuchsjahrs.«
»So etwas kannst du?«
»Ja. Weil ich die bin, die ich bin.«
Er seufzte und trank den Becher leer. »Das ist einfach«, sagte er. »Ich wünschte, ich könnte das auch von mir sagen.«
»Und was ist jetzt mit dem Lied?«
»Augenblick!«
Er holte seine Laute aus dem Felleisen, stimmte sie, zupfte ein paar Takte und begann dann zu einer fröhlichen Weise zu singen:
Am steilen Hang, am Berg,
liegt offen das gute Werk,
die Sonne schenkt ihr Licht
der Blüte ins Gesicht.
Der Guckigauch ruft fern,
und manche Stunde gern
sitz ich in deiner Gunst
und koste deine Kunst.
Laue Wasser rinnen,
Netze baun die Spinnen,
Schnecken kriechen übern Stein,
es ist nichts dein, nichts dein.
Sie grinste und wiegte den Kopf hin und her.
»Ein Schmetterling war’s vielleicht nicht, aber für ein Stegreiflied in meinem Gärtchen will ich’s gelten lassen. Danke schön.«
»Gern geschehen«, sagte er.
»Und ich frage dich jetzt nicht, wieso nichts mein sein soll. Ich bin der gleichen Ansicht.«
»Ach ja?«
»Natürlich. Es ist uns alles geschenkt. Es ist alles Gabe und Gunst. Wir sind dankbar dafür.«
»Das ist schön. Aber da erhebt sich die Frage: Wem seid ihr dankbar?«
Sie lachte.
»Junger Freund«, sagte sie und lächelte nachsichtig, »wenn du mich in ein Gespräch über den König oder sein Kommen oder was weiß ich verwickeln willst – spar dir den Atem! Ich habe meine eigene Ansicht dazu.«
»Die würde mich brennend interessieren.«
Sie schaute ihn ernst an. »Wieso willst du das wissen?«
»Weil ich das Gelichter gern habe. Weil mich interessiert, was aus dem Gelichter wird, wenn sich alles verändert.«
»Lieber Anonymus, überlass das ruhig uns! Wir werden mit dem König schon ins Reine kommen. Das entscheidet jeder selbst.«
»Und welche Meinungen gibt es unter dem Gelichter?«
»Solche und solche. Die Einen bereiten sich vor und sehen unseren Auftrag seit jeher erfüllt. Die Anderen kümmern sich nicht um den Wandel und ignorieren ihn. Und die Dritten schließlich wehren sich gegen den Wandel und versuchen, ihn aufzuhalten.«
»Ich frage durchaus aus persönlichem Interesse, weißt du. Ich will wissen, ob ich von dem Gelichter etwas zu befürchten habe.«
»Was die Anderen tun, geht mich nichts an. Aber, ich sage mal so: Wenn einer das Kommen des Königs so hartnäckig verkündet, der ist von manchen nicht gern gesehen.«
»Aha.«
»Und ich«, sagte sie, »habe jetzt Lust auf die süßen Schätze in meinem Gärtchen.«
»Wie ich sehe, hast du Erdbeeren.«
»Ja, die kleinen Knackelbeeren. Die kommen, wo sie wollen. Weide sie, mein Hirsch, wenn du herab steigst von den Weihrauchbergen.«
»Oho, was für Verse! Aus dem Hochzeitslied für Samalkena und Schofa. Im Land der Weihrauchberge. Woher kennst du das denn?«
»Oh, wir wissen mehr, als du denkst.«
»Wir? Ich ahne, du hast mir nicht alles gesagt. Was verbirgst du mir, du Mutter der Erde?«
»Nichts, was du zu wissen brauchst. Nur eines: Sei auf Hinterhalte gefasst! Lass nicht nach in deiner Hut!«
»Liebe Gä, ich danke dir für deine Ehrlichkeit!«
Und sie gingen zu den Erdbeeren, die rot leuchteten in ihrem Dickicht aus dreilappigen Blättchen, und schmausten die Früchte von den Stielen. Sie waren warm von der Sonne und zuckersüß.
3
Der Aschenputtelmann
Die Allee führte vom Wirtshaus zum Bauerngehöft. Weite Weiden hatten sie hier und Kornfelder, die räkelten sich in der Sonne. Im Schatten der Ulmen war gut gehen, der Waldrand zur Linken verbarg das Getier, und geradeaus führten alle Wege zu freundlichen Orten.
Er ging, gesättigt vom Mittagsmahl und dem Gehalt Most, das er sich einverleibt hatte. Da sah er zur Linken auf einer Bank am Waldrand einen Mann sitzen. Er hing erschöpft in der Lehne und rührte sich nicht.
»Hallo!«, rief er hinüber, weil er Lust auf ein bisschen Gesellschaft hatte. Dass dieser Gesell alles andere als lustige Gesellschaft zu bieten hatte, konnte er nicht ahnen.
Der Mann auf der Bank hob den Kopf, blinzelte unter seinem Hut hervor und döste weiter.
Was ist denn das für ein munteres Kerlchen?, dachte er und ging kurz entschlossen hinüber. Als er vor der Bank stand, rührte sich der Mann immer noch nicht. Er trug abgetragene Kleider, der Hut war zerbeult und die Schuhe staubbedeckt.
»He du«, sagte er, »was bist du für einer, der nicht einmal zurück grüßt? Du siehst fertig aus, Alter! Was macht dich so müde?«
Mühsam hob der Mann mit einem Finger seinen Hut und schaute ihn mit verkniffenen Augen an.
»Ich bin es zwar gar nicht wert, gefragt zu werden, aber wenn du schon dein Wort an mich richtest: Ich bin fertig von der Arbeit, die hinter mir liegt.«
»Aha«, sagte er und zwängte sich neben den Kerl auf die Bank.
»War wohl eine erschöpfende Arbeit, was? Hat sie sich wenigstens gelohnt?«
»Ich habe Menschen in der Not geholfen«, knurrte der Mann. »Das ist Lohns genug.«
»Oh, nobel nobel! Kommst du von dem Gehöft dahinten, am Ende der Allee?« Die Allee machte einen Bogen um den Wald, sodass man das Gehöft noch nicht sehen konnte.
»Du sagst es.«
»Je nun, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen! Wem hast du dort geholfen? Welche Not hast du gewendet? Und vor allem: warum?«
»Du bist eine Nervensäge«, sagte der Mann und rappelte sich auf, setzte sich, soweit er konnte, gerade hin, streckte die Beine und stöhnte. »Du gibst wohl keine Ruhe, bis du alles heraus gefunden hast, wie?«
»Genau.«
»Hör zu! Ich bin der Aschenputtelmann, und ich bin der Geringste unter allen Menschen. Ich bin jedermanns Diener. Ich bin so demütig, dass ich jedem helfe, der in Not ist. So demütig und hilfsbereit bin ich, dass ich keinerlei Lohn dafür verlange. Ich tue es aus gutem Herzen.«
»Aha«, sagte er und wusste einmal nicht, was er erwidern sollte.
»Und nun bin ich fertig und nehme eine wohlverdiente Ruhepause, wenn’s recht ist.«
»Wie lange hast du denn dort auf dem Gehöft gearbeitet?«
»Drei Tage. Von morgens bis abends, und oft auch in der Nacht.«
»Die Ernte eingebracht?«
»Die Ernte eingebracht, das Vieh versorgt, die Ställe geputzt, die Küche in Ordnung gebracht ... ich habe alles gemacht.«
»Und was haben die Leute vom Gehöft gemacht?«
»Die haben die Ernte fertig gemacht für den Weg zur Mühle, um sie dort verkaufen zu können.«
»So. Aha. Und sie schafften es nicht allein, oder was?«
Unwillig rückte der Mann auf der Bank hin und her. Sein Rücken schmerzte, er hielt sich das Kreuz. »Sie hätten es nicht rechtzeitig geschafft ohne meine Hilfe.«
»Rechtzeitig. Ach was. Und da haben sie dich um Hilfe gebeten?«
»Nein. Ich habe mich angeboten. Ich sah ihre Not und habe geholfen.«
»Und du hast nichts dafür verlangt?«
»Ein Bett und Essen.«
»Und wo hast du geschlafen?«
»In der Scheune.«
»Und was hast du gegessen?«
»Haferbrei.«
»Soll ich dir was sagen, Aschenputtelmann? Du bist ein rechter Idiot!«
»Natürlich verstehst du das nicht. Keiner versteht das. Ein gutes Herz gibt und fragt nicht nach Entgelt.«
»Das meine ich nicht, du Moralapostel. Ich meine die angebliche Not der Leute. Dann hätten sie einen oder zwei Tage länger gebraucht. Dann hätten sie vielleicht einen Knecht zusätzlich gedungen. Oder sonstwas. Aber da kommst du gelaufen mit deinem ach so guten Herz und bietest kostenlos deine Arbeitskraft an. Sie haben dich ausgenutzt, Mann! Sie haben sich gedacht: Wenn dieser Volltrottel uns das anbietet, dann nehmen wir das gern an. Schön blöd, der Typ! Und du bildest dir noch sittliche Verdienste dafür ein!«
»Hör zu, du Wanderer! Dass du meine Geisteshaltung nicht verstehst, ist mir nichts Neues. Aber in Schmutz zu ziehen brauchst du meine Person auch nicht. Unter Menschen ist zwar Undank mein Lohn, aber eine gewisse Würde habe ich als Gutmensch doch.«
»Ein guter Mensch bist du also?«
»Der guteste, den es gibt, wenn du diese Steigerung erlaubst.«
»Ich erlaube gar nichts«, sagte er brüsk und streckte nun auch die Beine aus. »Das Jahr des Fuchses ist in dieser Frage klar und einfach. Das Gute belohnt sich selbst, und das Böse bestraft sich selbst. Da gibt es keine Art von Belohnung oder Strafe«, meinte er lässig.
»Belohnung? Wieso sprichst du von Belohnung?« Der Aschenputtelmann richtete sich auf, soweit er das konnte.
»Sag«, fuhr er fort, »was hast du davon, dass du dich von anderen demütigen lässt? Bist du vielleicht selbstquälerisch veranlagt?«
»Das hat mit Qual nichts zu tun«, erwiderte der Mann und gähnte. »Das ist eine Frage der Gesinnung. Wo andere nur auf sich selbst schauen und den Nutzen für sich suchen, schaffe ich kleine Inseln aus Mitgefühl und Nächstenliebe und mache so das Jahr des Fuchses ein bisschen besser.«
Zufrieden lehnte sich der Aschenputtelmann zurück und schloss die Augen.
Der Minstrel pfiff durch die Zähne. »So einer also bist du«, sagte er.
»Ja, so einer bin ich«, murmelte der Mann, zog die Hutkante herunter und döste vor sich hin.
Auch er lehnte sich zurück und zündete ein Ziegerlein an. »Hast du Hunger?«, fragte er den Mann. »Nach drei Tagen Haferbrei hast du sicher Hunger! Komm, ich lade dich ein in das Wirtshaus dort drüben. Eine gebratene Schweinerippe mit Sauerkraut, wie wäre das? Dass endlich du mal etwas Gutes hast und nicht immer die Anderen.«
»Das geht nicht«, brummelte der Mann.
»Warum nicht?«
»Weil ich derjenige bin, der hier Gutes tut. Nicht du.«
Eine Zeitlang ließ er ihn liegen. Er muss sich ausruhen, dachte er. Aber wie er so in der Bank fläzte und sein Ziegerlein paffte, rückten seine Gedanken aus und gingen auf Wanderschaft. Er dachte über das Jahr des Fuchses nach und das, was er darüber gesagt hatte. Er dachte über Moral und Belohnung nach, übers Gutsein, über Menschen mit Herz und Mitgefühl und das alles und fragte sich, was das mit der Minne zu tun hatte.
Es war heiß, Schweiß sammelte sich auf seiner Stirn, seine Gedanken waren träge und bockig und liefen, wohin sie wollten.
Er sann eine Weile, rauchte sein Ziegerlein zu Ende, drückte es auf dem Holz der Bank aus und schaute einem Käfer zu, der ins Laub brummte. Dort feierten sie wahrscheinlich eine Hochzeit, eine verborgene Käferhochzeit.
Käferhochzeiten, dachte er dösend. Gezieferfeste. Die Vermählung des Unscheinbaren mit dem Wunderbaren. Ich wünschte, du wärst hier. Wer? Alissia? Der König? Ich selbst? Möglichkeitsform der Sehnsucht: wenn es einen Sinn hätte zu wünschen. Einst sitzen an Lichtfeuern und eingefügt sein ins Große, ins Ganze, dachte er. Im Jahr des Königs. Die Milch des Paradieses trinken und das Morgenbrot auf lauter Honigtau brechen. Das Leben einfach und frei genießen. Freiheit als ein Vergessen, das Frieden bringt, ein Lassen, das Ketten löst. Der Abend duftet am Waldrand süß nach Kraut und frisch das Heu auf den Wiesen. Unter den Bäumen blickte sie zu mir zurück. Das Wunder: die Abendfrau, das Waldkind, die Baumfee, die auf heimlichen Festen mit Musik und Tanz und dem blau schäumenden Dandelionwein zum Prinzen macht, zum Gleichgesinnten, zum Heimgekehrten. Der Prinz kehrt heim, ja. Alles kehrt heim. Der König kommt, es wird alles gut. An einem der langen Abende vor Mittsommer. Erdbeerfreude. Der leise Kitzel des Leichtmuts. Heiterkeit, mit der süßen Kostung des Leichtsinns, das Arom arkadischer Früchte, die in den Gärten der Hoffnung wachsen. Pflück mich, dachte er ungenau und weh, pflück mich, ich warte am Strauch und werde süß! Käferhochzeiten. Diese erschütternde und zugleich friedsame Zustimmung in allem, ein Jubelwort, ein Dankeslied, ein gehauchte Willkomm, in das einer einfallen will. Käferhochzeiten, dachte er dösig: Ja, ich will!
Und mit diesem Bekenntnis war es Zeit, den schlafenden Gutmenschen zu wecken und ihm etwas Gutes zu tun. Auch wenn er das nicht wollte. Es war zwar unsinnige, Blödheit noch zu belohnen, aber irgendwie tat ihm der Mann leid. Vielleicht können wir für den Abend ein Feuerchen machen, dachte er, und ich singe ihm ein paar aufmunternde Lieder.
Indes war der Mann nicht zu wecken. Er rüttelte an seiner Schulter, rief ihm ins Gesicht, nahm ihm seinen Hut ab, aber der Aschenputtelmann schlief tief und fest.
Lass ihn!, sagte er sich schließlich. Der muss jetzt schlafen, nach der Heidenarbeit. Das wird ihm gut tun. Und wenn er ausgeschlafen hat, dann freunden wir uns an, und unter vier Augen reden wir noch mal übers Gutsein.
Ja, dachte er, so wollte er es machen.
Und er streckte sich wieder lang auf die Bank, schob seinen Hut vors Gesicht und döste ebenfalls ein.
Als er mit dem Sinken der Sonne erwachte, war der Platz neben ihm leer. Der Aschenputtelmann war verschwunden.
So was, dachte er verwirrt. Jetzt konnte ich ihm gar kein Liedchen trällern.
Er wusste nicht, ob er traurig oder erleichtert sein sollte. Erleichtert, weil es nun nicht er war, der dem Mann auf den rechten Weg zu helfen hatte, und traurig, weil der nun weiter durchs Land zog, mit seiner Demut hausieren ging und nicht wusste, wie einfach das Leben in Wirklichkeit war.
Er zuckte die Schultern, reckte und streckte sich noch einmal und machte sich dann auf den Weg ans Ende der Allee, wo das Gehöft wartete. Er trug sich mit dem Gedanken an ein gutes Mahl und einen ruhigen Schlafplatz, er war nicht bereit, dafür mehr herzugeben als ein paar Sangesstücke oder eine Geschichte, und er fand, dass seine Art von Demut durchaus genügte.
4
Wie stark ist der Schild?
Ein idyllisches Häuschen. Fachwerk und weiß gekalkt, ein Strohdach mit Gaupen, ein gut gemauerter Kamin; Garten drum herum, ein paar Obstbäume, eine Quelle nahebei. Ein Schmuckstück. Er sah es auf dem Hügel nahe am Waldrand stehen und dachte sich: Das ist sicher einen Besuch wert! Nette Leute kennen lernen. Mal wieder ein bisschen Unterhaltung. Und er nahm den Schotterweg unter die Füße, der hinauf führte.
Als er näher kam und vielleicht einen Steinwurf von dem Anwesen entfernt war, spürte er ein leichtes Kribbeln auf der Haut, und an seinen Händen zeigte sich ein blauer Schimmer. Als er weiter ging, war es vorbei.
Er machte sich keine Gedanken und klopfte an die Haustür. Ein Kind stand im Garten, warf einen Ball gegen die Hauswand, erstarrte und glotzte ihn an.
Der Hausherr, der öffnete, war nicht weniger fassungslos. »Wie ... wie kommt Ihr hier herein?«
Er guckte verwundert und meinte: »Bis jetzt bin ich noch nirgends drin, und wenn Ihr den Weg meint, der führt gerade hier herauf.«
»Nein, ich meine ... ach, egal! Wer seid Ihr und was wollt Ihr?«, fragte er barsch.
»Euch einen Besuch abstatten. Ich war gerade nicht in der Gegend und dachte mir, schaust einmal bei dieser netten Familie herein. Darf ich eintreten?«
»Lieber nicht«, meinte der Mann zögernd. »Lasst uns doch im Garten sitzen! Da ist es ungef ... ich meine luftiger.«
Schade, dachte er. Die scheinen hier ein wenig wunderlich zu sein. Sah von außen so nett aus. Er ließ sich auf eine Bank auf der Terrasse nötigen, trank aus dem Becher Himbeerbrause, die ihm eingeschenkt wurde, und saß dann den beiden Eheleuten gegenüber, die ihn misstrauisch und verängstigt anstarrten. Hinterm Hauseck lugten die Kinder hervor, drei Orgelpfeifen, die ihn nicht weniger entgeistert anschauten.
Was ist hier nur los?, dachte er. Hier stimmt doch etwas nicht.
Er wollte eine Plauderei beginnen, woher und wohin und seit wann und wie denn die Kinder hießen, aber das ließ sich an wie ein Schneckenrennen, und langsam verlor er die Geduld.
»Soll ich euch beiden Hübschen ein Liedchen singen?«, fragte er hoffnungsvoll. »Ich bin Minstrel, müsst ihr wissen, und ich habe lustige Lieder im Gepäck.«
Sie schüttelten beide die Köpfe. Nur eines der Kinder rief leise: »Au ja!«
»Und wie wär’s mit einer Geschichte?«, fragte er auch in Richtung der Kleinen. Zwei nickten, die Mutter sagte: »Im Moment passt es nicht recht. Wir ... haben dringende Arbeit zu erledigen.«
Er nahm’s hin und sich vor, demnächst mit dem Manne ein paar Worte unter Brüdern zu wechseln.
Die Frau machte sich mit den Kindern aus dem Staub, der Mann blieb etwas verloren hocken, und er beugte sich vor und sagte augenzwinkernd: »Was ist denn los bei euch? Ihr tut ja so, als wäre ich der leibhaftige Nachtgrapp.«
»Mit solchen Dingen scherzt man nicht!«, sagte der Mann und schaute sich ängstlich um.
Da wurde ihm klar: Die Menschen hier hatten vor etwas Angst.
»Wovor habt ihr denn Angst im Jahr des Fuchses? Sag mal? Es kann euch doch nichts geschehen.«
»Das dachten wir auch, bis du kamst«, meinte der Mann und holte aus der Klappbank, auf der er saß, etwas Stärkeres als Himbeerbrause.
»Aha«, sagte er, »Butter bei die Fische. Na endlich.«
»Selbstgebrannt«, sagte der Mann. »Aus den Johannisbeeren da hinten.«
»Zeig mir doch mal das Ganze«, bat er.
Der Mann seufzte, kippte seinen Schnaps, nahm die Buddel mit und stand auf. Er führte ihn durch den Garten, zeigte die Beerensträucher, die Obstbäume, das Gemüsebeet. Dann lotste er ihn durch die Hinterpforte ins Haus, und hier war alles schön ordentlich und rechtwinklig, die Stube getäfelt, natürlich selbstgemacht, die Stiege führte hinauf in den ersten Stock, die Zimmer der Kinder, die Dachzimmer, der Speicher, alles wunderbar adrett und sauber.
»Na, da kannst du doch nicht klagen«, meinte er jovial. »Was habt ihr dann für eine Angst?«
»Es geht das Gerücht, dass etwas kommt«, flüsterte der Mann, der etwas gesprächiger wurde, seit seine Frau und Kinder weg waren. Und seit die Buddel in seiner Hand sich leerte. Immer wieder setzte er die Flasche an und kippte einen.
»Ja, das ist durchaus richtig. Der König kommt.«
»Es ist mir egal, wer oder was kommt. Von mir aus kann der Pferdeknecht kommen. Aber ohne mich.«
»Aber da ist ein Wandel in der Welt«, sagte er. »Wie willst du dem entkommen?«
»Ja, davon habe ich gehört. Es soll ja alles anders werden dadurch«, meinte der Mann düster. »Alles umgekrempelt. Das Jahr des Fuchses auf den Kopf gestellt. Das will ich nicht. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist.«
»Dem Kommenden wirst du nicht ausweichen können«, sagte er und wiegte den Kopf bedenklich.
»Die Leute reden viel davon. Einer will sogar wissen, wo das kommt, was kommt.«
»Ach ja? Wo denn?«
»An einem Ort in der Mitte. Von hier aus allerdings im Westen. Keinen Namen. Mehr weiß ich nicht.«
»Ort der Mitte«, sagte er nachdenklich. »Davon habe ich gelesen. Eine große Ebene, umgeben von einem Hügeldamm. Kreisrund. Ein magischer Ort, heißt es.«
»Mir wurscht«, sagte der Mann brüsk und lallte schon ein wenig. »Wir, ich und meine Familie, wollen nicht, dass irgendetwas sich verändert. Wir werden uns gegen den Wandel und den ganzen Spuk wehren. Ja ja, wir sind schlau«, sagte der Mann und hob pfiffig den Zeigefinger.
»Ich weiß nicht, ob da Schlauheit hilft«, sagte er behutsam, »und ich weiß auch nicht, ob es schlau ist, sich dagegen zu wehren.«
»Sooo? Gehörst du etwa zu denen?«
»Zu wenen?«
»Die das Neue willkommen heißen und das Ende des Fuchsjahrs begrüßen? Die alles mit Füßen treten, was bisher gewesen ist?«
»Ich glaube kaum, dass ich zu denen gehöre. Denkst du nicht, du solltest dich erst einmal genauer erkundigen, worum es eigentlich geht? Nachher steckt etwas ungeheuer Freundliches hinter allem, und du verschanzt dich hier in deinem Eigenheim und wirst von dem Wandel überrollt.«
»Verschanzt, genau. Das ist das Stichwort.«
Er machte den Zeigefinger krumm zum Zeichen, dass er ihm folgen solle. Diesmal ging es hinab in den Keller, den er mit Steingewölben ausgebaut hatte. Ein fleißiger Mann, das musste man ihm lassen.
Unten öffnete er eine Holztür mit einem großen Schlüssel, und als sie eintraten, war das Gelass erfüllt von einem Duft nach Blättern. Mitten in den Bodenkacheln steckte eine Fassung, und in der Fassung steckte ein Bäumchen. Ein adrettes, vollkommenes Bäumchen, wie sich’s gehört, nur eben gerade mal hüfthoch. Es breitete seine Schirmkrone und leuchtete grüngolden. Darum herum war ein Kreidekreis gezogen und Ziffern und Symbole aufgemalt, die er nicht kannte. Wild und heidnisch, und er ahnte, dass er hier vor einem waschechten Gaukel des Fuchsjahres stand.
»Das ist unsere Verschanzung!«, sagte der Mann stolz. Offenbar überwog der Wunsch, sein Geheimnis zu lüften, seine Vorsicht.
»Ein Zauber?«
»Ein Schutzschild! Rings ums Haus. Zweihundert Schritt weit. Nichts kommt durch den Schild. Außer dir ...«
Und hier wich er ängstlich zurück, als sei ihm sein Schrecken wieder eingefallen.
Nun verstand er endlich. »Ach, deshalb habt ihr mich angestarrt wie einen Alb! Weil ich einfach durch den Schutzschild gegangen bin!« Und er musste lachen.
»Was gibt es da zu lachen?«, sagte der Mann und riss die Augen auf.
Er hatte nur ein Kribbeln gespürt, weil ja bei ihm kein Gaukel im Jahr des Fuchses verfing, und nun zweifelten die Leute an der Wirksamkeit ihres Schutzes.
»Ach«, sagte er, »sagt das doch gleich! Ich kann euch beruhigen: Ich bin nur durch euren Schild gekommen, weil ich gegen jeden Zauber immun bin. Verstehst du? Das wirkt bei mir nicht. Ich bin überzeugt, gegen jeden und jedes andere im Jahr des Fuchses steht euer Schild stark und sicher!«
Der Mann wiegte den Kopf. »Meinst du? Und warum wirkt bei dir kein Gaukel? Wer bist du?«
Was sollte er darauf antworten? Ein umherziehender Minstrel? Einer, der den König im Geiste geschaut hatte? Einer, der keinen Namen trug? Da fiel ihm etwas ein.
»Ich bin der Ausgezeichnete des Fuchses«, sagte er und zeigte die Fuchsfibel, die ihm das Wams zusammenhielt.
»Oha!«, meinte der Mann und war beeindruckt. Dann schaute er wieder bedenklich und brummte: »Aber wer weiß, wie viele es von diesen Ausgezeichneten noch gibt.«
Er schaute den Mann an. Er war so dumm wie borniert. Sollte er es ihm sagen? Sollte er ihm ins Gesicht sagen, dass der Wandel, das Ende des Fuchsjahrs über ihn hinweg gehen würde wie eine Flut? Dass nichts und niemand und schon gar kein Gaukel den Wandel aufhalten konnte?
Er sagte es ihm nicht. Das war nicht seine Angelegenheit.
Sie gingen wieder hinauf ins Licht, bezogen erneut auf der Terrasse Stellung, und nun plauderte der Mann drauflos und erzählte seine Geschichte. Maurerhandwerk, Lehrlingsjahre, die Frau kennen gelernt, Familie, Auszug ins Grüne, Glück mit den Kindern, und dann die Gerüchte und die Sorge um die Sicherheit und die Dienstleistung eines wandernden Magiers. So kam eins zum Andern.
»Hat mich eine Stange Geld gekostet«, meinte der Mann. »Hundert Gulden für den Baum und noch einmal fünfzig für den Ritus. Und dann kommst du daher ... «
»Ich hab’s dir doch erklärt«, fing er an.
»Ja, schon recht. Aber weißt du, so ein Haus, so ein Leben, das ist ohne Schutz nicht zu haben. Und nicht ohne Angst. Bei allem, was wir tun, bei allem Glück und bei allem Vertrauen, bleibt die Frage: Wie stark ist der Schild?«
Er nickte mitfühlend. Im Grunde ein erbärmliches Dasein, dachte er. Aber sie wollen es selbst so.
»Das werdet ihr wohl erst heraus finden, wenn es soweit ist.«
Der Mann kniff die Lippen zusammen und nickte.
»Und jetzt muss ich weitermachen. Wir bauen gerade den Speicher aus. Und«, sagte er noch und hob verschwörerisch den Finger an die Lippen, »kein Sterbenswörtchen zu irgendwem!«
»Wirkt der Schutz eigentlich auch unter der Erde? Ich meine, da könnte ja einer kommen und sich einen Tunnel – «
»Zweihundert Schritt. In jede Richtung.«
Er lachte und erhob sich. »Na, dann viel Glück und eine gute Zeit wünsche ich!«, sagte er und empfahl sich. Er grüßte zu der Frau und den Kindern hinüber, die am Gemüsebeet zugange waren, und trabte den Hügel hinab. Nach zweihundert Schritt spürte er nichts. Der Schutz galt wohl nur in eine Richtung.
5
Die Tanzlinde
Hunderte von Sommern stand sie in der Mitte des Dorfes. Hunderte von Sommern war sie gewachsen, hatte Ableger und Ausläufer gebildet, bis sie zu jener vielstämmigen, breitkronigen Prachtlinde wurde, die sich nun vor ihm erhob.
Ringsum gingen die Leute ihrem Tagwerk nach. Die Äste der Linde waren abgestützt, und in ihr Geäst zwei Mannshöhen über der Erde ein Tanzboden gebaut. Der Stieg führte wie eine Leiter hinauf in den luftigen Laubsaal, und die Kinder machten sich ein Vergnügen daraus, in ihrem Gezweig Verstecken zu spielen.
Er neigte den Kopf und grüßte im Stillen den Baum. Alte Bäume waren besondere Wesen, das wusste er. Es wohnte eine Kraft und ein Wissen in ihnen, die tief hinabreichten in die Wurzeln der Welt. Das herzförmige Laub spielte im leisen Wind, und die Sonne zwinkerte schalkhaft hindurch. Der ganze Baum summte von Bienen, die den süßen Nektar suchten, und ihr Anblick war selbst schon ein Fest.
Nun sollte aber am Nachmittag ein eigenes Fest gefeiert werden. Mit Tanz und Musica. Er hatte davon gehört und war gebeten worden, den Menschen hier zum Tanz aufzuspielen oder sie mit ein paar Bänkelliedern zu unterhalten. Musikanten hatten sie sicher selbst, aber die Dienste eines Fahrenden Sängers wurden immer gern in Anspruch genommen.
Er kletterte die Stiege hinauf und betrat den Tanzboden. Er war groß und rechteckig, starke Dielen, ein lichter Halbschatten, auf dem Sonnenflecken tanzten. Die Kinder kletterten aus dem Baum herunter und stellten sich vor ihm auf, starrten ihn an.
»Wer bist du denn?«, fragte die Keckste unter ihnen.
»Ich werde euch heute Mittag den Marsch blasen«, sagte er neckend, »und ihr werdet nach meiner Pfeife tanzen. Oder genauer: nach meiner Laute.«
Und er holte aus seinem Felleisen das Instrument hervor und stimmte es.
»Du bist ein Musikant«, jauchzten sie. »Au ja! Au ja! Spiel uns was vor!«
»Pssst«, machte er. »Erst heute Nachmittag. Ich bin mehr als ein Musikant. Ich bin ein Fahrender Sänger. Ein Minstrel.«
Oh und Ah. Die Kinder staunten ihn an.
»Woher kommst du?«, fragte ein Knilch, der größer war als die Anderen.
»Von da«, sagte er und deutete mit dem Finger.
»Und wohin willst du?«
»Nach da«, sagte er und deutete wieder.
»Du gibst gar keine richtigen Antworten«, beklagte sich der Junge.
»Dafür würde ich von euch gerne wissen, was ihr denn heute Nachmittag feiert.«
»Wenn wir dir das sagen, spielst du uns dann ein Lied?«
»Hm«, sagte er, »also schön. Aber ein kurzes.«
Er zupfelte ein bisschen herum, fand eine lustige Melodie und sang den Kindern vor:
Am Gartenzaun, am Gartenzaun
begegnet ihr Filou und Faun.
Ihr haltet gern ein Schwätzchen,
es ist ein lindes Plätzchen,
in Beeten wächst das Kraut,
der Brunnen läuft vertraut,
und jeder zieht dann weiter,
nur ihr bleibt hier und heiter:
Ihr seid ja hier zuhaus.
Die Kinder lachten und klatschten in die Hände.
»Ja, das stimmt!«, riefen sie. »Wir sind hier zuhaus!«
»Was ist ein Filou?«
»Woher kennst du unseren Brunnen?«
»Und wo bist du zuhaus?«
»Tja«, sagte er und lächelte versonnen. »Nirgends und überall. Mein Zuhause kommt noch. Ich gehe ihm entgegen, wisst ihr?«
»Ist das noch weit bis zu dir nach Hause?«
»Was stellst du dir denn vor, wo ich zuhause bin?«, fragte er den Kleinen mit den Sommersprossen.
»In einem Baum«, krähten zwei.
»In so einer Linde wie der unseren.«
»Du schläfst in den Ästen und deckst dich mit dem Laub zu.«
»Und du leckst den Nektar auf wie die Bienen.«
»Und wenn man ein Lied von dir will, muss man an einem Zweig rütteln«, sagte ein Mädchen. »So.« Und sie machte es vor.
»Und morgens weckt dich der Zaunkönig.«
»Und abends erzählst du den Kindern Geschichten.«
»Au ja. Und dann gehen wir müde und satt nach Hause.«
»Stimmt das?«, fragten sie. »Ist das dein Zuhause?«
»Nun«, sagte er, »warum nicht? Wer weiß?«
»Und jetzt sagen wir dir, was wir heute Nachmittag feiern«, meinte der Größere. »Wir feiern nämlich nur so, weil es uns gefällt.«
»Stimmt gar nicht!«, rief ein Mädchen, das fast so groß war wie der Junge. »Wir feiern den Sommer.«
»Wir feiern das Jahr des Fuchses!«
»Wir feiern, weil wir uns so freuen!«
»Und weshalb freut ihr euch so?«, fragte er neugierig.
»Weil es bei uns so schön ist.«
»Ja, das ist es«, sagte er und erhob sich. Er steckte seine Laute wieder ein und freute sich nun selbst auf das Tanzfest. Unter diesen Menschen hier aufzuspielen, musste ein reines Vergnügen sein.
»Heda!«, rief es von unten. »Wer ist da oben?«
»Der Minstrel«, rief er zurück.
»Kommt herunter! Wir brauchen Euch. Wir müssen die Lieder besprechen.«
Er trat an den Aufgang und schaute auf einen kleinen Mann hinab, der eine Lederschürze um den Bauch trug. Er hatte starke Arme und war offensichtlich der Schmied.
»Lieder bespricht man nicht«, sagte er und schickte sich an, die Stiege hinunter zu klettern. »Lieder spielt und singt man.«
Als er unten stand, lächelte er den Mann an. »Im Ernst, Gevatter. Da gibt es nichts zu besprechen. Ich spiele, was sich anbietet. Was zum Augenblick und zur Stimmung passt.«
»Könnt Ihr auch Tänze?«
»Ich kenne genug kleine Melodien, auf die ihr werdet tanzen können, keine Sorge!«
»Weil es ist nämlich so: Der Geiger hat sich just den Arm gebrochen. Wir haben noch den Pfeifer und den Trommler. Werdet Ihr mit denen zusammen können?«
»Das wird sich finden. Ist denn für den Rest gesorgt?«
»Wohl, wohl! Wir haben ein Fass Brombeerwein und ein Fass Gofender, wir haben einen Ochsen am Spieß, wir haben Brot und Schinken und Käse – «
»Und habt ihr auch Freude?«
Der Schmied stutzte kurz, dann lachte er: »Und wie wir Freude haben! Deshalb feiern wir ja!«
»Ihr Glücklichen!«, seufzte er. »Dann bis heute Nachmittag!«
Und er spazierte über den Anger und suchte sich ein ruhiges Plätzchen, um für das Fest in Stimmung zu kommen.
An einer Hausecke stand eine Gestalt und beobachtete ihn. Eine Gestalt in einem weiten Cape und mit Stiefeln bis über die Knie. Sie schaute ihm nach. Dann wandte sie sich um und verschwand.
Am Nachmittag ging es festlich zu. Auf dem Anger hatten sie ein Feuer entzündet, über dessen kleiner Flamme sich der Ochs am Spieß drehte. Die Fässer waren aufgestellt worden, und schon gingen die Ersten mit Krügen umher. Eine Tafel war aufgebaut und bog sich vor leckeren Speisen. Alle hatten sich heraus geputzt, in einer schönen, gediegenen Tracht, in der die Männer verlässlich, die Frauen ehrsam, die Burschen verwegen und die Mädchen wie Bräute aussahen. In Gruppen stand man beieinander und ratschte, bis auf dem Tanzboden die ersten Saitenklänge ertönten und alle Tanzwilligen die enge Stiege hinauf drängten.
Das Zusammenspiel mit den beiden Musikanten gelang vorzüglich, der Trommler wirbelte den Takt, der in die Beine ging, der Pfeifer blies dudelnd und wehmütig seine Schalmeienweisen, und er zupfte und sang, was das Zeug hielt, und kramte alle Weisen hervor, auf die sich irgend tanzen ließ. Meist war es die Jugend, die in Paaren hüpfte und trappelte, aber einmal fanden sich auch Ältere zu einem Kreis mit den Jungen zusammen und tanzten einen Reigen zu einem alten Lied, das im Volk gebräuchlich war und das er, wie vieles, in seinem Repertoire hatte.
Er spielte mit großer Freude. Er spielte für lau und wollte keinen Lohn. Er brauchte nichts, er hatte alles, und an diesem Nachmittag aus lauter Freude und Vergnügen seinen Anteil zu haben genügte ihm.
Das Volk auf dem Tanzboden wechselte, Erschöpfte und Durstige stiegen hinab und machten Platz für neue Vergnügungssuchende. Manchmal spielte er allein, wenn das Publikum etwas ruhiger geworden war, und hatte nun Zeit für besinnlichere Weisen, für Lieder, die bei manchem einen stillen Widerklang fanden.
Auf den Bänken, die überall Platz boten, saßen die Älteren und schauten hinauf in die Linde, hörten die Musik und genossen das Zusammensein. Irgendwann musste auch er eine Pause machen und nahm einen Trunk zu sich, aß ein Stück vom Grillochsen und plauderte mit diesem und jenem. Er wusste, dass er keinen Anlass hatte, nach dem Grund des Festes zu fragen. Das Fest sprach für sich, und die Gelassenheit der Leute ebenso. Aber es erstaunte ihn doch. Das war keines der üblichen Sommerfeste, und ein wenig lag auch ein Weh in ihm, als wäre es das letzte seiner Art.
»Habt ihr auch das Gerücht gehört, dass etwas kommen soll?«, stellte er seine Testfrage.
»Aber natürlich«, sagte der Mann, der neben ihm saß und seine Frau im Arm hielt. Er schaute seinen beiden Töchtern zu, die mit einem kleinen Hündchen spielten.
»Und?«
»Was und? Es kommt, was kommt. Es kann nur Gutes sein.«
»Woher weißt du das?«
»Ich sehe es am Jahr des Fuchses. Das Gute, das in ihm wirkt. Wenn etwas Neues an seine Stelle tritt, kann es nur noch besser sein.«
»Eine erstaunliche Zuversicht«, bemerkte er. »Machst du dir gar keine Sorge um den Wandel, der sich überall bemerkbar macht?«
»Nun«, sagte seine Frau und beugte sich her. »Wir wissen längst, dass das Jahr des Fuchses irgendwann zu Ende geht. Wir haben ihn gesehen, den weißen Fuchs. Sein Pelz ist fast ganz aus Silber. Vielleicht ist es deshalb heute auch ein Abschiedsfest. Mir ist ein wenig wehmütig. Geht es Euch auch so?«
»Ja, du hast recht.«
»Wir haben hier immer alles gehabt, was wir brauchten«, sagte der Mann nachdenklich. »Wir machen uns keine Sorgen.«
»Ja, habt ihr denn eine Ahnung, was kommen wird?«
»Eine Ahnung wohl«, sagte die Frau und lächelte ihrem Kind zu, das gerade dem Hund ein Kunststück beigebracht hatte.
Er wusste nicht, worauf sich die Zuversicht der Leute hier gründete. Vielleicht gründete sie sich auf nichts anderes als das Leben selbst.
Er schwieg.
»Ist das nicht ein herrlicher Baum?«, fragte der Mann stolz. »Es ist eine Friedenslinde, wisst Ihr?«
»Ja«, sagte er lächelnd. »Es ist ganz gewiss ein Baum des Friedens.«
Und dann war die Pause vorbei, und er stieg wieder unters Dach der Linde und spielte weiter.
Langsam kam der Abend. Die Schatten längten sich, und als die Sonne hinter den Wald sank, wurde es blau auf dem Festplatz. Lampen leuchteten auf den Tischen und Bänken, in der Linde hatte das Tanzen aufgehört, jedoch nicht die Musik. Der Pfeifer war noch da und blies seine wehmütigen Melodien im Schein einer Laterne, und schwermütige Geister hockten bei ihm und lauschten.
Er saß auf einer der Bänke, die rings um die Linde standen, und lehnte sich gegen den mächtigen Stamm. Es roch nach Rauch und geröstetem Fleisch, nach Gras und Wald. Er hatte sich eins der Mädchen ausgesucht, die auf dem Tanzboden getanzt hatten, das schönste, wie er fand. Sie hatte ein stilles, feines Gesicht, schön nicht auf die übliche Weise, und sie wusste, was sie wollte. Sie wolle nichts weiter von ihm, hatte sie gesagt, nur ein bisschen sitzen und im Arm gehalten werden, ein bisschen träumen und es gut haben.
So saß er da, das Mädchen im Arm, ihren Kopf an seine Brust gelehnt, und schaute in den Abend hinaus. Links neben ihm saß ein alter Greis, der fast ebenso viele Sommer auf dem Buckel zu haben schien wie die Linde.
Das Mädchen schnupperte.
»Du riechst gut«, sagte sie.
»Das kann nicht sein«, lachte er. »Ich habe mich seit Tagen nicht gewaschen.«
»Doch, du riechst gut«, beharrte sie. »Du riechst nach Frieden. Du riechst wie einer, der weiß, dass alles gut werden wird.«
»Es wird am Ende alles gut werden«, sagte er. »Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende.«
»Ja, so soll es sein.«
Der Alte neben ihm grunzte zustimmend.
»Und wovon träumst du jetzt?«, flüsterte er dem Mädchen ins Ohr. »Von deinem Liebsten?«
»Oh«, sagte sie, »ich habe keinen Liebsten. Er wird erst noch kommen. Es wird alles erst noch kommen.«
Er stutzte. »Wer wird denn dein Liebster sein?«