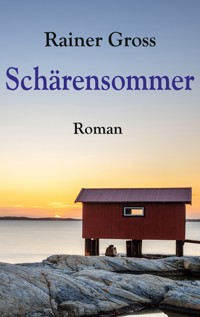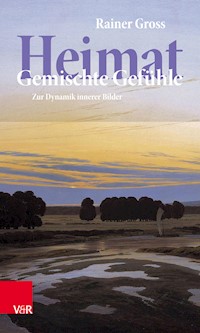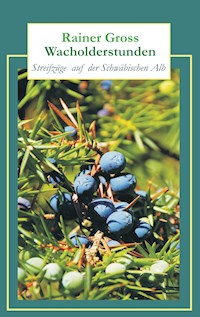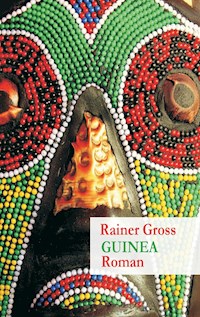
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Siegfried Aschenbach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Geografischen Institut. Seit Langem empfindet er sein Leben dort als würdelos. Er leidet unter der Impertinenz des Personals, der übertriebenen Fürsoge des Institutsleiters Professor Kühne, dem Banausentum seiner Kollegen, den heimlichen Verleumdungen, denen er ausgesetzt ist. Nur sein Gelehrtenfreund Thelonious, mit dem er lange Nachmittage in dessen Kabinett verbringt, versteht ihn. Eines Tages fasst Aschenbach den Entschluss, nach Guinea auszuwandern. Das westafrikanische Land ist für ihn der Inbegriff eines Lebens in Freiheit und Würde. Doch auf einmal zeigen sich Ungereimtheiten im Institutsleben. Räume verändern sich auf seltsame Weise, unerklärliche Dinge geschehen, sein Freund verschwindet spurlos, und Aschenbach muss erkennen, dass seine Welt nicht das ist, was sie zu sein scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siegfried Aschenbach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Geografischen Institut. Seit Langem empfindet er sein Leben dort als würdelos. Er leidet unter der Impertinenz des Personals, der übertriebenen Fürsoge des Institutsleiters Professor Kühne, dem Banausentum seiner Kollegen, den heimlichen Verleumdungen, denen er ausgesetzt ist. Nur sein Gelehrtenfreund Thelonious, mit dem er lange Nachmittage in dessen Kabinett verbringt, versteht ihn.
Eines Tages fasst Aschenbach den Entschluss, nach Guinea auszuwandern. Das westafrikanische Land ist für ihn der Inbegriff eines Lebens in Freiheit und Würde.
Doch auf einmal zeigen sich Ungereimtheiten im Institutsleben. Räume verändern sich auf seltsame Weise, unerklärliche Dinge geschehen, sein Freund verschwindet spurlos, und Aschenbach muss erkennen, dass seine Welt nicht das ist, was sie zu sein scheint.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller in Reutlingen.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).
Bei BoD erschienene Romane:
Die Welt meiner Schwestern
Das Glücksversprechen
Yūomo
Haus der Stille
Schrödingers Kätzchen
Drei Tage Wicklow
(...) I have heard the key
Turn in the door once and turn once only
We think of the key, each in his prison
Thinking of the key, each confirms a prison
Only at nightfall, aetherial rumours
Revive for a moment a broken Coriolanus
T.S. ELIOT, THE WASTE LAND
Im Fernsehen habe ich einen Bericht gesehen. Oder Thelonious hat mir davon erzählt. Um Guineen ist es gegangen, die englischen Goldmünzen, in denen manche noch heute abrechnen. Sie wurden nach Guinea benannt, dem Land in Westafrika, aus dem das Münzgold stammte. Das ist mir im Gedächtnis geblieben: Guinea.
Ich habe im Internet recherchiert. Ich bin noch nicht dement, auch wenn ich der Älteste hier am Geografischen Institut bin. Über die Geschichte ist wenig zu erfahren. Ein portugiesischer Seefahrer, ein Antonio Fernandes, hat die Küste dort unten erkundet. Auf den Inseln davor wurde ein Handelsstützpunkt errichtet. Später war es französische Kolonie. Ich stelle mir vor: Tropenhölzer, Elfenbein, Sklaven. Und Gold, jede Menge Gold.
Da würde ich gerne hin. Mit dem Flugzeug anfliegen, ein Hotelzimmer nehmen, die Reise in die Berge und in den Regenwald organisieren. Armut ringsherum. Bettelnde Kinder, geschwollene Bäuche, Militärdiktatur. Aber ich stelle mir das anders vor.
Ich würde mir im Regenwald eine Hütte bauen. Mangos pflanzen. Meinen Frieden finden. Eine Einheimische heiraten. Guinea. Das ist mein Traum.
Dort könnte ich frei und selbstbestimmt leben. Niemand würde mir dazwischenreden, mich bevormunden, entscheiden, was gut oder schlecht für mich ist. Ich würde aufatmen. Ich würde meine Tage in Würde und Anstand verbringen. Mein Leben hätte wieder einen Sinn.
Ich würde mir mein Essen selbst kochen, ja, würde es selbst ziehen und erbeuten. Vielleicht mit dem Jeep kleine Besorgungsfahrten in die nächste Stadt unternehmen. Ich weiß nicht.
Natürlich darf ich niemandem von meinen Plänen erzählen. Die halten mich eh für verrückt hier. Wasser auf ihre Mühlen, aber nicht mit mir.
Dass ich Interesse an Westafrika zeige, kümmert niemanden. Ich leihe mir Bücher aus, lese sie im Park auf einer der Bänke, mache mir Notizen am Rechner. Die Dateien sind mit einem Passwort gesichert, ich bin noch nicht dement.
Thelonious weiß viel über Westafrika und Guinea. Er erzählt, wie es früher war, bei den Portugiesen. Die Goldexpeditionen, die im Dschungel auf Monster stießen, die sie noch nie gesehen hatten. Riesige zähnefletschende Affen, Elefanten mit mächtigen Stoßzähnen, wilde Rhinozerosse, die durchs Gebüsch brachen, Wesen mit Hälsen so hoch wie ein Schiffsmast. Die Mücken machten sie verrückt, und viele starben an unbekannten Krankheiten und an den Parasiten, die in den Wasserlöchern wimmelten.
In seinem Kabinett sitzen wir oft und trinken indischen Tee. Er lässt sich eine Kiste anliefern, wenn sie frisch mit dem Teeclipper eingetroffen ist, und dann sitzen wir in unseren Fauteuils und plaudern angeregt. Es ist gut, dass Thelonious hier ist. Ohne ihn würde ich es nicht aushalten. Der einzige vernünftige Mensch, außer mir. Auch ihn halten sie für verrückt, oder vielmehr mich, wenn ich von ihm erzähle. Deshalb erzähle ich nichts mehr. Überhaupt erzähle ich kaum noch etwas. Zu oft musste ich erleben, dass ich nicht ernst genommen werde. Da sitze ich lieber bei Thelonious und genieße unsere geistvollen Gespräche.
Thelonious weiß überhaupt viel. Er ist ein richtiger Gelehrter, wie man sie heute nicht mehr findet. Er scheint alles an Fächern studiert zu haben, was es gibt, zumindest im Rahmen einer klassischen geisteswissenschaftlichen Ausbildung. Von den Naturwissenschaften kennt er die Geschichte und die Geschichte ihrer Voraussetzungen, deshalb hält er nicht so viel von ihr wie die meisten um uns herum. Mit ihm allein kann ich darüber sprechen, dass die naturwissenschaftliche Wirklichkeit, insbesondere die naturwissenschaftlich geprägte Psychologie, durchaus in vernünftigen Zweifel zu ziehen ist. Es gibt andere Standpunkte, die man einnehmen kann, und auch ihre Axiome sind nicht unhinterfragbar.
Da sitzen wir dann oft und fachsimpeln über Quantentheorie und Empirismus und die Intelligibilität der Wirklichkeit. Ab und zu öffnet sich die Tür und jemand schaut herein, einer der Banausen, die hier umgehen, und der zieht dann ein Gesicht, wenn er uns sprechen hört, und verschwindet rasch wieder.
Dann lachen wir beide, Thelonious und ich, uns ins Fäustchen.
Einer der Professoren hier am Institut, Herr Professor Kühne, Mitglied der Royal Geographical Society wie ich, bittet mich um ein Gespräch. Ab und an werde ich geholt, wenn es um Vorträge oder Gutachten oder Berichte geht, die ich halten oder schreiben soll. Ich denke nicht, dass sie meine Mithilfe wirklich nötig haben, aber ich würdige den Respekt und die Wertschätzung, die in solchen Gesten liegt.
Der Professor begrüßt mich, als ich eintrete. Er steht auf und bietet mir die Hand. Er hat britisches Blut in den Adern, ist aber in Deutschland geboren. Ein netter, gebildeter Mensch mit einer Neugier für abenteuerliche Wissensgebiete, auch wenn sein britischer Dünkel manchmal etwas störend wirkt. Als ob nicht die Deutschen auch ihren Teil zur Geschichte der geografischen Wissenschaft beigetragen hätten. Martin Behaim mit seinem Globus etwa oder Alfred Wegener mit seiner Kontinentaldrifttheorie. Der Professor ist recht jung für seine Qualifikation, er nimmt in seinem Maßanzug und seiner Krawatte hinter dem Schreibtisch Platz und schaut mich freundlich an.
„Nun, wie geht es Ihnen, Herr Aschenbach?“
„Danke, gut, Herr Professor“, antworte ich.
„Sind Sie mit allem zufrieden hier am Institut?“
„So weit ja“, erwidere ich. Womit ich tatsächlich unzufrieden bin, brauche ich ihm nicht zu sagen. Er weiß, dass ich meinen Ruf als verrückter Gelehrter weg habe. Manchmal nimmt er mich dafür auf die Schippe, zwinkert mir zu, aber ich kann einen Scherz vertragen.
Anschließend fragt er mich nach meinem Schlaf, meinen täglichen Aktivitäten, ob ich Schmerzen hätte. Diese Art Fürsorge für seine Mitarbeiter finde ich nun ein wenig übertrieben, auch wenn ich die Wertschätzung, die darin liegt, lobenswert finde.
„Haben Sie in nächster Zeit vor, wieder eine Reise zu unternehmen?“
Zuerst bin ich verblüfft. Kann er von meinem Guinea-Traum wissen? Ich habe nur Thelonious davon erzählt, und dessen Verschwiegenheit ist mir sicher. Dann erinnere ich mich, dass ich schließlich an einem Geografischen Institut bin und Reisen in die Welt nichts Fernliegendes sind.
Soll ich ihm von Guinea erzählen? Vielleicht wird er bald sowieso Bescheid wissen, wenn sich meine neueste Lektüre herumspricht.
„Nun, ich weiß nicht“, antworte ich ausweichend. „Es gibt da ein westafrikanisches Land, das meine Neugier geweckt hat…“
„Ah ja?“
„Guinea, wenn Ihnen das etwas sagt.“
Er schaut mich lächelnd an und wartet, dass ich weiterspreche. Aber seinem Schweigen entnehme ich, dass ihm der Name nichts sagt. Das enttäuscht mich. Als Professor an einem Geografischen Institut sollte er auf der Erde Bescheid wissen, auch wenn sein Spezialgebiet die Neue Welt ist, wie ich gehört habe. Er hat über die indigenen Völker im Amazonasgebiet promoviert.
„Das würde ich gerne einmal kennenlernen“, fahre ich fort. „Besonders die historischen Verhältnisse dort, Sie wissen ja, das Dreieck des Sklavenhandels, Elfenbein, Gold.“
„Gold interessiert Sie?“
„Nun ja, nicht des Wertes oder des Metalles wegen. Aber es ist doch von jeher ein Inbegriff für Reichtum, Pracht und Lebensfülle…“
„Sieh an. Da haben Sie recht.“
„Und ich interessiere mich auch für die Menschen dort. Die einheimische Bevölkerung muss doch sehr unter den Gewaltstrukturen des Sklavenhandels gelitten haben.“
Gerne würde ich mit ihm das moralische Pro und Contra des Sklavenhandels und die Bestrebungen zu dessen Abschaffung besprechen, aber daran hat er sichtlich kein Interesse.
„Wann wollen Sie denn los?“, fragt er.
„Ach, wissen Sie, so einfach ist das nicht, wie Sie es sich vorstellen. Es werden keine Visa ausgestellt. Dort herrscht Bürgerkrieg seit einigen Jahren“, antworte ich. „Die Militärdiktatur lässt keine Touristen ins Land.“
„Aha.“ Er schmunzelt. „Und wie wollen Sie dann hineinkommen?“
„Sehen Sie, das erfordert eben eine längerfristige Planung. Der Zeitpunkt meiner Abreise ist noch nicht absehbar.“
„Dann bin ich ja beruhigt“, sagt er und lehnt sich zurück.
„Weshalb?“
„Wir brauchen Sie hier, Herr Aschenbach. Wir brauchen Gelehrte Ihres Kalibers. Jetzt zum Beispiel hat mich ein Kollege gebeten, ich solle ihm ein Dossier über Westafrika zukommen lassen. Das neueste Dossier, das hier in unserem Hause angelegt wurde, ist fast zwanzig Jahre alt. Wäre das nicht eine Aufgabe für Sie? Jetzt, wo Sie sich in Guinea eingearbeitet haben?“
„Sehr schmeichelhaft…“, wehre ich ab.
„Was wollen Sie denn in Guinea? Feldforschung betreiben?“
„Nein“, sage ich. „Von Haus aus bin ich ja kein Ethnologe, sondern Geograf. Von daher bedürfte es einer eigenen Expedition, um dort Feldforschung zu betreiben.“
„Was suchen Sie denn dort?“
Ich überlege lange, ob ich es ihm sagen soll: Freiheit. Eine eigenes Leben. Weit entfernt vom Institut. Flüchten will ich, mir eine neue Existenz aufbauen. Endlich so leben, wie ich es will. Dann entscheide ich mich dagegen und antworte: „Ich habe keine anderen als berufliche Motive.“
„Nun gut“, sagt er. „Aber, für den Fall, dass Sie doch… unerwarteterweise aufbrechen wollen, müssen wir natürlich eine Malaria-Prophylaxe durchführen. Es ist zu Ihrem eigenen Besten.“
„Das klingt einleuchtend.“
„Ich lasse die Medizin durch unser Hauspersonal überbringen, jeden Morgen und jeden Abend, und bitte Sie, die Tabletten mit einem Glas Wasser zu schlucken. So, wie wir es bisher auch gehandhabt haben.“
„Verzeihung?“
„Mit den Vitamintabletten und dem Aufbaupräparat.“
„Ach, richtig.“
„Gibt es sonst noch irgendetwas, das Sie loswerden möchten?“
„Dieses Dossier“, sage ich, „ich könnte es mir ja noch einmal überlegen. Bis wann brauchen Sie es denn?“
„Oh, es eilt nicht. Sie können sich Zeit lassen!“
„Und… äh… welchen Umfang haben Sie sich vorgestellt?“
„Schreiben Sie alles, was Sie wissen. Auch das, was Sie sich darunter vorstellen, unter Guinea, damit wir hinterher einen… äh… empirischen Abgleich machen können.“
„Verstehe. Nun gut, ich überlege es mir.“
Er erhebt sich, ganz Gentleman, bringt mich zur Tür, öffnet sie und verabschiedet mich mit Handschlag.
Als ich durch die leeren Flure mit den holzgetäfelten Wänden zurückgehe in mein Studierzimmer, freue ich mich. Es tut gut, soviel Respekt entgegengebracht zu bekommen. Ein feiner Mensch, der Herr Professor.
Wir sitzen in seinem Kabinett, Thelonious und ich, bei einer Tasse blumig duftenden Darjeelings, und pflegen unsere Freundschaft.
Thelonious’ Kabinett ist ein Refugium für mich hier am Institut. Es befindet sich in einem abgelegenen Seitenflügel des Gebäudes, wo wenig Menschen hinkommen. Besonders das lästige Hauspersonal, das die Gänge bevölkert mit seiner unermüdlichen Betriebsamkeit, tritt hier seltener auf. Thelonious hat in seinem Kabinett ein einfaches Feldbett aufgeschlagen mit einer wollenen Decke, mehr braucht er nicht, sagt er.
An den getäfelten Wänden Regale voller Bücher, eine wahre Bibliothek. Hier finde ich fast alles, was mich interessiert. Daneben steht mitten im Raum ein großer, alter Globus, Seekarten und Auszüge aus Westermanns Kolonialatlas zieren die Wände, das Modell einer spanischen Galeone thront mitten darin, ein wenig staubbeflaumt und spinnwebverhangen, aber mir macht das nichts. Und dann die vielen Andenken und Kulturgegenstände, die Thelonious von seinen Reisen mitgebracht hat: asiatische Statuen, afrikanische Fetische, Masken aus Neuguinea, Speere, Bumerangs, Trommeln, ein Traumfänger aus Peru, Ketten und Amulette und Totems der Maori, es ist eine wahre Pracht!
Hier fühle ich mich wohl. Das ist eine Luft der Weltläufigkeit und Weltoffenheit, die ich gerne atme.
Wir unterhalten uns über Darwin und dessen Ursprung der Arten und die Wirkung, die das Buch seinerzeit hatte.
„Darwin war ein durchaus gottesfürchtiger Mann“, erzählt Thelonious. „Nichts lag ihm ferner, als den Glauben an die Bibel zu beschädigen durch seine Theorien. Vielmehr hat er sich auf seine Weltreise gemacht mit der Beagle, um Gottes Spuren in der Schöpfung zu entdecken. Nur so nebenhin ist er dann auf die Evolution der Spezies gestoßen.“
„Ja, ich weiß. Und wie ist sein Buch damals aufgenommen worden?“
„Nun, er hat die theologische Tragweite seiner Untersuchung sicher nicht absehen können und auch in keiner Weise gewollt. Die theologischen Rückschlüsse haben andere gezogen, und Darwin hat unter den Anwürfen immer sehr gelitten. Es hat übrigens seinen Glauben nicht weiter in Frage gestellt. Es ging damals ja hauptsächlich um die Anschauung der unmittelbaren Erschaffung der Arten und dabei um die zeitliche Einordnung. Dass man für die Evolution, wie Darwin sie nachgewiesen hat, Jahrmillionen veranschlagen musste, drang damals noch gar nicht ins Bewusstsein.“
„Bist du ein gottesfürchtiger Mann?“, frage ich ihn. Private Themen sind bei unseren Gesprächen zwar nicht tabu, aber ungewöhnlich. Heute verlangt es mich danach, mehr von Thelonious zu wissen, eine Seite an ihm zu entdecken, die ich bisher nicht kannte.
„Nun, ich bin nicht sehr religiös“, gesteht Thelonious ein. „Aber den Gedanken, dass es einen Gott und Weltenschöpfer gibt, finde ich durchaus einleuchtend. Wenn auch die konkreten Schlussfolgerungen daraus mich noch immer abschrecken.“
Er legt die Fingerspitzen aneinander und schaut mich an.
„Und du, lieber Kollege? Wie steht es mit dir in dieser Hinsicht?“
„Mir geht es ähnlich wie dir“, sage ich offen. „Ich glaube nicht nur, was ich sehe. Ich bin überzeugt, es gibt eine Art geistiger Welt, die der physischen immanent ist. Gott erscheint mir ein logisches Konstrukt, über dessen Evidenz ich allerdings nichts sagen kann. Aber sicherlich ist die ethische Dimension des Glaubens nicht zu verleugnen.“
„Aber es ist doch merkwürdig, wie die Dinge sich umkehren oder in einem ganz anderen Licht erscheinen, wenn man den Standpunkt wechselt“, sagt er.
„Wie meinst du das?“
„Nun, wie Darwins Buch zum Beispiel. Es räumte auf mit der alten Vorstellung, die Welt sei vor viertausend Jahren entstanden und alles sei so wie am ersten Tag der Schöpfung. Das war doch ein Irrglaube. Und plötzlich, wenn man nur die Perspektive ändert, tauchen Fakten und Sachverhalte auf, die nie zuvor ins Blickfeld geraten sind.“
„Ich verstehe“, sage ich und greife nach meiner Tasse, die auf dem Teetisch steht. Der Tee ist noch warm, ich nehme einen Schluck. Der Geruch der Bücher steigt mir in die Nase und ein Gefühl großer Behaglichkeit überkommt mich.
„Oder der Gedanke, dass es einen Gott geben könnte, der persönlich unser Leben lenkt. Dieser Standpunkt ändert die vielen Ereignisse und ihre Bedeutung völlig.“
„Ihre Interpretation“, betone ich. „Das ist zweifellos richtig.“
„Wenn du zum Beispiel annehmen würdest, dass es einen Gott gibt, der auf dich aufpasst, dann könntest du davon ausgehen, dass er dich Guinea eines Tages erreichen lässt.“
„So habe ich das noch gar nicht gesehen.“
„Siehst du?“
„Interessanter Gedanke. Aber lähmt das nicht meine Tatkraft und meine Verantwortlichkeit?“
„Nicht unbedingt. Denn du weißt ja nicht, wie dieser Gott das bewerkstelligen würde. Du müsstest dich darum bemühen, als gäbe es keinen Gott, und doch könntest du dir gewiss sein, dein Ziel zu erreichen, als ob alle eigene Anstrengung nichts nützen würde.“
Ich denke über diese Worte lange nach. Thelonious ist ein wahrer Freund. Er versteht mich, und immer gelingt es ihm, mich zu motivieren und zu ermutigen. Die Gedankenanstöße, die er mir liefert, haben mich in den letzten Jahren, seit ich am Institut bin, enorm weitergebracht.
„Aber würde es denn mein Handeln ändern, wenn ich an diesen Gott glaubte?“, frage ich.
„Nein“, antwortet Thelonious. „Und das ist keine theologische Frage. Das ist eine Frage der Vernunft. Du handelst, wie du als freier, gewissenhafter und verantwortlicher Mensch handeln würdest, und nur im tiefsten Innern hättest du eine Gewissheit, die durch keine äußeren Rückschläge zu erschüttern wäre.“
„Ich denke“, sage ich, „das ist schon der Fall. Weißt du, Thelonious, in meinem tiefsten Innern weiß ich, dass ich eines Tages Guinea erreichen werde. Ein Leben in Freiheit und Würde ist möglich. Ob ich das nun Gott nenne oder anders, spielt keine Rolle. Aber ich weiß, da gibt es am Grund meiner Seele eine Kraft, die mich zum Licht trägt. Ein Ja zum Leben. Eine Freude und eine Hoffnung, die ich nie aufgegeben habe.
Wenn ich es recht bedenke, gibt mir dies die Kraft, Tag für Tag weiterzuleben und die Einschränkungen hier am Institut zu ertragen.“
„Du hast einen Traum, Siegfried.“
„Ja, den habe ich.“
„Wie jener amerikanische Baptistenprediger, den sie erschossen haben.“
„Einen Traum von Freiheit. Von der Abschaffung aller Trennungen und Mauern. Von der Abschaffung aller Sklaverei.“
„Menschen sind in so vielen Ketten gefangen, in selbstgemachten, von anderen gemachten, in kollektiven und in ganz individuellen.“
Wenn Thelonious so redet, geht es mir ans Herz. Ich habe Tränen in den Augen. Von den Kollegen am Institut versteht das niemand. Niemand erkennt, was für ein wertvoller Mensch Thelonious ist. Ohne ihn würde ich es hier nicht aushalten.
Als es Zeit fürs Abendessen wird, verabschiede ich mich. Zwei Stunden haben wir geredet. Ich drücke ihm wortlos die Hand. Draußen auf dem Flur begegnet mir eine dieser penetranten Hausdienerinnen und lächelt mir zu.
„Na, hatten Sie wieder Ihren Teenachmittag, Herr Aschenbach?“
„Herr Professor Aschenbach“, weise ich sie zurecht. „Soviel Anstand muss sein.“
Aber sie lacht nur und eilt den Gang entlang, die Gummisohlen ihrer Schuhe quietschen.
Wie ich dieses Geräusch hasse!
Guinea. Ein reiches Land. Elfenbeinküste, Goldküste, Sklavenküste. Es gibt keinen europäischen Handelsposten; die Schiffe geben Signal, wenn sie mit den Einheimischen Handel treiben wollen. Oft werden Einheimische, die an Bord kommen, verschleppt oder nur gegen Lösegeld freigelassen. Die Einheimischen sind misstrauisch geworden und scheu. Aber das Land ist reich: die Erde fruchtbar, es gedeihen Reis und Wurzeln und Knollen, Indigo und Baumwolle, und baute man Tabak an, wäre er exquisit. Fisch gibt es in Überfülle, die Herden wachsen ständig, die Bäume sind schwer behangen von Früchten. Sie fertigen dort ein Baumwolltuch, das an der ganzen Küste gefragt ist. Die Einheimischen sind ein friedliches Volk, das selten Krieg gegeneinander führt. Sie sind freundlich, empfindsam, mutig und als faire Händler bekannt. Der Sklavenhandel und die Überfälle der Europäer beginnen jedoch, ihren Charakter zu verändern. Besonders die Gier nach Gold bringt Unheil über diese fruchtbare Küste.