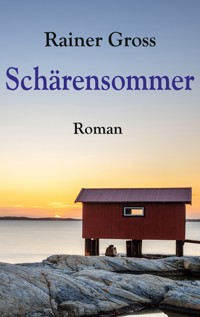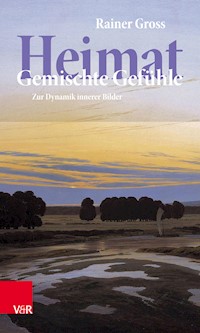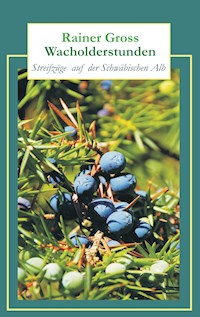Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jo, Benni und Löffel wachsen in einer schwäbischen Stadt am Ende der siebziger Jahre auf. Als sie durch den Kauf ihrer Mopeds endlich mobil sind, schweißen die gemeinsamen Ausflüge auf die nahe Schwäbische Alb sie noch enger zusammen. An den Abenden in Bennis Zimmer bei Pink Floyd, Lotostee und Räucherstäbchen träumen sie von Mädchen und Motorrädern und besprechen ihre ersten erotischen Erfahrungen in der Jugenddisco. Sie wollen sich nicht anpassen, wollen es in ihrem Leben anders machen als alle. Die Songs, die sie hören, die kritischen Filme, die sie im Jugendfilmclub sehen, und die politischen Bewegungen ihrer Zeit prägen ihr Bild von der Welt, die da auf sie zukommt. Als schließlich Jo auf dem Abi-Ausflug Kirsten näher kennen lernt, verändert das die gesamte Situation, und jene schicksalshaften Ereignisse kommen ins Rollen, die schließlich zum Bruch der Freundschaft führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jo, Benni und Löffel wachsen in einer schwäbischen Stadt am Ende der siebziger Jahre auf. Als sie durch den Kauf ihrer Mopeds endlich mobil sind, schweißen die gemeinsamen Ausflüge auf die nahe Schwäbische Alb sie noch enger zusammen. An den Abenden in Bennis Zimmer bei Pink Floyd, Lotostee und Räucherstäbchen träumen sie von Mädchen und Motorrädern und besprechen ihre ersten erotischen Erfahrungen in der Jugenddisco.
Sie wollen sich nicht anpassen, wollen es in ihrem Leben anders machen als alle. Die Songs, die sie hören, die kritischen Filme, die sie im Jugendfilmclub sehen, und die politischen Bewegungen ihrer Zeit prägen ihr Bild von der Welt, die da auf sie zukommt.
Als schließlich Jo auf dem Abi-Ausflug Kirsten näher kennen lernt, verändert das die gesamte Situation, und jene schicksalshaften Ereignisse kommen ins Rollen, die schließlich zum Bruch der Freundschaft führen.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen. Studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller seit 2014 wieder in Reutlingen.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012). Bei BoD u.a. erschienen: Die Welt meiner Schwestern (2014); Yûomo (2014); Haus der Stille (2014); Schrödingers Kätzchen (2015); Haut (2015); My sweet Lord (2016); Holiday (2016); Am Ende des Regenbogens (2016); Scheherazade (2017); Die sechzigste Ansicht des Berges Fuji (2017); Der Sommer der Glühwürmchen (2017); In der fernen Stadt (2017).
When I was young it seemed
that life was so wonderful, a miracle,
oh it was beautiful, magical.
SUPERTRAMP, THE LOGICAL SONG
Für alle Losers und Knibies
Eigentlich will ich diese Geschichte gar nicht erzählen. Es ist ja meine Geschichte, aber trotzdem. Oder gerade deswegen. Ich habe mir neulich den Fänger im Roggen gekauft und in einem Rutsch durchgelesen, das hat mich darauf gebracht. Der Gedanke: Du solltest auch einmal dein Leben aufschreiben. So, wie’s war und wie alles gekommen ist. Das ist gar nicht so einfach.
Wo soll man da anfangen? Angefangen hat alles wahrscheinlich mit vierzehn, als ich lauter Zeug über Parapsychologie und Atlantis und das Bermuda-Dreieck las. Ich weiß nicht, was mich daran so faszinierte. Es gibt viel mehr Dinge, als wir uns träumen lassen, und hinter der alltäglichen Wirklichkeit, dachte ich mir, liegen ganz andere Welten verborgen.
Ich hörte mir Atlantis von Donovan an. Ich habe heute noch das Knistern und Knacken der abgenudelten Single im Ohr, die mir mein Vetter Micha überlassen hatte. Atlantis liegt jetzt auf dem Meeresgrund, weil es bei einem Erdbeben untergegangen ist. Alle Mythen der Völker berichten davon. Wenn Donovan sein Hail Atlantis! hauchte, bekam ich eine Gänsehaut.
Eine Rolle spielte sicher auch die Konfi- Freizeit. Im Konfi-Unterricht war mir sterbenslangweilig. Manchmal bekam ich einen Gähnkrampf und musste mein Gesicht hinter den Händen verstecken. Manchmal stellte auch der Pfarrer eine seiner ernsten Fragen, und in die Stille hinein musste ich loskichern, weil ich es nicht aushielt. Ich malte Superhelden und Muskelmänner an die Tafel, die im Gruppenraum hing, und verarbeitete die Superheldencomics, die ich damals las.
Mike war mein Jahrgang und wurde mit mir konfirmiert. Benni von den Pfadis war ein Jahr jünger, und Löffel kannte ich noch nicht. Die Konfirmation machte ich mit wegen der Geschenke und weil sich das so gehörte. Später dann brachte ich dem Pfarrer meine Bibel zurück und sagte ihm, dass ich Atheist geworden war.
Die Freizeit fand zum Abschluss des Unterrichts statt. Ich konnte das schon damals nicht ab: mit so vielen Leuten auf einem Haufen. Am letzten Abend gab es ein Fest, eine Party mit Lichteffekten und Discomucke und allem. Der Pfarrer war sehr entspannt und ließ viel durchgehen.
Mädels hatte ich bis dato nicht gekannt. Kniestrümpfe und Gekicher, Zahnspangengegrinse und Zickenalarm, mehr nicht. Aber an diesem Abend ... meine Herrn!
Vierzehn waren sie alle, aber manche waren eindeutig frühreif. Kurze Lederröcke und Feinstrumpfhosen, hochhackige Schuhe, Parfüm. Wild wurde getanzt zu den neuesten Hits, ohne Jungs. Die standen verdattert herum und verzogen sich dann nach draußen, um heimlich eine zu rauchen.
Ich glaube, damals begriff ich zum ersten Mal, dass meine Kindheit vorbei war. Etwas, auf das ich zurück blicken konnte, ein Kapitel meines Lebens. Kribbeln im Bauch und die Lust. Ich wollte diese fremdartigen Wesen anfassen, ihr Parfüm schnuppern, über die glatten Strümpfe streichen, die bemalten Lippen küssen. Aber ich hatte viel zuviel Muffe. Die schauen dich nicht mal an, dachte ich.
Nach der Freizeit war ich am Boden zerstört. Ich hätte einen Entschluss fassen und etwas in meinem Leben ändern sollen. Aber ich traute mir nichts zu. Ich war noch nicht soweit.
Zwei Jahre später war Mike in allen möglichen Tanzschuppen zugange, besonders im Tanzcenter Schwarzweiß draußen im Laisen. Ich hatte mich breit schlagen lassen und machte mit ihm einen Tanzkurs. Wenn man einen Kurs machte, bekam man einen Clubausweis, mit dem man samstagabends in die Jugenddisco des Schwarzweiß durfte.
Das machte mich anfangs gar nicht an. Mike schon. Samstagnachmittag, wenn wir hinterm Stadion bolzten, kam er angeradelt und erzählte von seinen Eskapaden. Ein richtiger Aufreißer war er geworden, fand ich: frisierte sich eine Tolle, eigentlich sah er zum Schreien aus, und jedesmal fielen andere Mädchennamen. Anfangs kotzte mich das ziemlich an, aber eines Tages ließ er mich seine aufgenommenen Kassetten hören, die Hits, die im Schwarzweiß liefen.
Mit Discomucke hatte ich bis dato nichts am Hut. Ich hörte Musik aus den Sechzigern, alte Rockgrößen wie Hendrix und Deep Purple, mein Vetter hatte die Platten und machte mir Tapes davon, auf exzellente Chrom-Kassetten, das Feinste vom Feinen. Meine ersten LPs, die ich vom Taschengeld kaufte, waren von einer Band, die damals gerade von sich hören machte: den Scorpions.
Die Mucke gefiel mir gar nicht so schlecht. Am nächsten Samstag schwang ich mich aufs Rad und fuhr auch in den Laisen. So fing’s an.
Was mich besonders lockte – ehrlich gesagt, war das der Hauptgrund – war die Bluesrunde.
Mike erklärte mir, wie man das machte, und im Gegensatz zur Konfi-Party schaffte ich es ein paar Wochen später, ein Mädchen aufzufordern.
Im Grunde war es wie auf dem Fleischmarkt. Wenn es dunkel wurde und langsame Musik begann, reihten sich die Mädels am Ende des Saals auf und warteten. Ein bisschen Licht fiel darauf, sodass man keinen Blindflug veranstaltete. Sie waren noch jung, die Mädels. Wohlerzogene Töchter, die bis zehn bleiben durften. Schüchterne Mädels, aber im Gegensatz zum Tanzkurs waren sie nicht auf Chachacha aus.
Das merkte ich bei der Ersten. Ging mir gerade bis zur Brust. Sie schlüpfte bereitwillig in meine Arme und kuschelte ihr Gesicht in meine Halsbeuge. Wusste gar nicht, wie mir geschah. Der Geruch ihrer Haut, der Erdbeerduft vom Lippenbalsam, ihr Becken, das gegen meinen Schniedelwutz drückte. Der helle Wahnsinn. Ungeküsst ging ich nicht mehr nach Hause.
Das hatte ich mir oft vorgestellt: Mit deinem Mädel eng umschlungen zu den Lieblingsliedern tanzen. Zupfen an der Bluse, irgendwann die nackte Haut. Meine Hand, die auf Pirsch ging. Am Büstenhalter war Schluss.
Mit der Zeit war es egal, was für eine ich abbekam. Riechen musste sie gut, und zärtlich sein. Manchmal blieb man nach dem Blues noch zusammen, aber meistens trennte man sich.
Ich weiß nicht, warum die Mädels so abgebrüht waren. Nur eine, die mir den ersten Zungenkuss meines Lebens gab, wollte mehr von mir. Aber sonst: stillschweigende Übereinkunft. Ich wurde süchtig danach. Niederschmetternd, wenn man keine abbekam, wenn die Bluesrunde zu Ende ging und man hatte nur herumgestanden. Götterfunkenfreude, wenn der Abend gerettet war und man hatte wieder diese weichen, schmiegsamen Lippen geküsst – das entspannte ungeheuer.
Mike ging seiner Wege, er hatte mittlerweile eine eigene Clique, und ich streunte durch den Abend, blieb bis zwölf, wartete auf eine zweite Bluesrunde, träumte von der Traumfrau, die ich einmal treffen würde.
In der Zeit war ich öfter mit Benni zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie das kam. Benni machte auch den Tanzkurs, hatte seinen Abschlussball mit Susi, und nach einer Weile konnte ich ihn überreden, mit zur Disco zu gehen. Wahrscheinlich deshalb, weil sich das mit Susi nicht recht entwickelte.
Benni ging auf die Realschule, sodass wir uns erst nach dem Unterricht sahen. Irgendwann kam Löffel dazu, weil er mit Benni bei den Pfadis war.
Warum nennen die dich eigentlich Löffel?, fragte ich ihn.
Siehst du das nicht? Wegen meiner abstehenden Ohren.
Ach, Quatsch!, sagte ich. Du hast keine abstehenden Ohren.
Danke, sagte er säuerlich, und ich fand die Spitznamenmanie bei den Pfadis ziemlich bescheuert.
Ich kannte ja den Laden, war ja selbst mal dabei gewesen. Einen, der von Zeppelin abstammte, nannten sie das Gräfchen, und einen, der Hummel hieß, Wespl. Ich kannte auch die Lager, die sie veranstalteten, damals ging einiges schief, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls hatte ich mit den Pfadis nichts am Hut, und mit dem Christlichen sowieso nicht.
Löffel war noch mit dem Fahrrad unterwegs, da dachten wir schon an einem motorisierten Untersatz herum. Benni verdiente sich das Geld beim Gärtner, und ich verbrachte die Sommerferien bei der Materialverwaltung der Bank, wo mein Vetter arbeitete. Nebenher machten wir den Vierer, das war einfach. Nur die Theoretische an einem Morgen, Auswendiglernen fiel mir immer leicht. Bei der Sehprüfung stellte sich allerdings heraus, dass ich eine Brille brauchte, weil ich auf einem Auge extrem kurzsichtig war. Das war mir nie aufgefallen. Nun kam der blöde Muss-geeignete-Augengläser-tragen-Stempel in meinen Pappdeckel, und ich schleppte immer eine Brille mit mir herum, falls ich in eine Kontrolle käme.
An einem Nachmittag auf dem Sportplatz ließ Mike Benni auf seiner Dax fahren, die er seit einem Jahr hatte, und Benni war begeistert. Er kaufte sie ihm ab. Mike hatte schon ein Kreidler im Auge, Zweitakter, Mordsabzug und so. Die Dax war ein solider Viertakter und schaffte ihre sechzig, weil Mike was an der Fliehkraftdrossel gedreht hatte. Auch wenn sie aussah, als könnte man sie beim Fahrrad auf den Gepäckträger klemmen, und auch wenn man nur zwei Liter auf einmal tanken konnte, war sie ein echter Feger. Wenigstens musste man an der Tanke nicht dauernd das Benzin panschen.
Ich ließ nicht lange auf mich warten. Von einem Klassenkameraden bekam ich mal sein Mofa geliehen und fuhr hinterm Hohbuch in den Laubengärten spazieren – ein Traum! Einfach am Gas drehen, und das Ding trug einen selbständig jeden Buckel hinauf. Kein Treten, kein Geschnaufe, kein Muskelkater.
Mein Alter vermittelte mir von der Tochter eines Arbeitskollegen eine CB Fünfzig, ein Minimotorrad mit dem üblichen Schnapsglaszylinder. Neunhundert Mark löhnte ich dafür, das ging an. Sie hatte Scheibenbremsen vorn und einen Zehnlitertank und allen Komfort und zurück. Ein Kumpel von Mike, der später mit mir im Deutsch-Leistungskurs war, zeigte mir, wie man die Zündkontakte aufbiegen und das Ding auf Schwindel erregende Drehzahlen bringen konnte. Am Ende schaffte sie ihre siebzig in der Ebene.
Den Helm vererbte mir mein Vetter, tomatenrot. Benni spritzte ihn im Keller weiß, und ich schnibbelte mir aus DC-fix ein Sternenbanner-Dekor und klebte es darauf. Easy Rider lässt grüßen.
Den Film hatten wir im Jufi Reutlingen zusammen angeschaut. Fanden ihn echt krass. Nix von Freiheitsfeeling und Motorräderromantik! Mich erschütterte vor allem das Ende und die Szene, wo die Leute aus dem Ort nachts Jack Nicholson totprügelten, und die verkniffenen Sackgesichter der Spießer in diesem Kaff. Ob so was auch bei uns möglich wäre? Jedenfalls hatte ich nun einen Amerikahelm in memoriam.
Anfangs hatte mich Benni noch hintendrauf mitgenommen, samstags zum Schwarzweiß zum Bleistift. War komisch, sich so an seinen Körper zu klammern. Irgendwie roch er immer ein bisschen nach Pisse. Deshalb war ich froh, als wir endlich beide motorisiert hinaus fuhren, die Kisten abstellten, unsere Bügelschlösser klicken ließen und beim Weggehen den Helm an den Arm hängten. Der Laden gehörte uns!
Es ist komisch: Ich kann das alles so herunter erzählen, als wär’s nix, und trotzdem fühlte sich das damals viel verwickelter und verfilzter an. Ob es da einen roten Faden gibt, ob es da schon Anzeichen gibt für das, was später folgte, kann ich nicht sagen. Vielleicht nehme ich mir diese Zeilen später mit meinem Enkel auf dem Schoß noch einmal vor und kapiere dann endlich, was das alles zu bedeuten hatte.
Als es Winter wurde, konnten wir nicht mehr mit Turnschuhen herumfahren. Ich leierte meiner Mutter einen Hunderter aus dem Kreuz, und Benni und ich fuhren nach Pfullingen, um uns Fallschirmspringerstiefel aus Armeebeständen zu kaufen. Da gab es einen extra Laden, der hatte noch viel mehr von dem Zeug, Klappspaten, Schlafsäcke, Messer, Feldjacken, Essgeschirre, Helme, Gasmasken und all sowas. Würden wir einmal unsere Dschungelexpedition in den Amazonas machen, konnten wir uns hier eindecken. Siebzig Mark kosteten die Stiefel, geschraubte Profilsohle, Zwölflochschnürung, aus Leder und total robust, die Dinger. Damit kannst du aus tausend Metern aus dem Flugzeug springen, sagte Benni, ohne Fallschirm, und die gehen nicht kaputt.
Feldjacken waren schon länger unsere Lieblingsklamotten. Die passten einfach überall. Im Winter einen dicken Pulli drunter, eine lange Unterhose unter die Jeans, und fertig war die Polarausrüstung.
Unsere ersten motorisierten Ausflüge auf die Alb unternahmen wir in der Umgebung. Schönbergturm, Lichtenstein, Greifenstein, die Felsen beim Traifelberg. Wir entdeckten eine Höhle und erforschten sie mit der Taschenlampe. Saßen auf den Felszinnen, gegenüber die Silhouette des Schlosses im Gegenlicht. Unten in Honau krochen die Blechkäfer auf der Straße, ein Schwimmbecken blaute, und das Tal entlang ging der Blick hinaus ins Vorland.
Später suchten wir Feuerstellen, sammelten Holz, legten es im Betonring zusammen, und Benni zeigte mir nach Pfadfindermanier, wie man ohne Papier, nur mit einem Streichholz, ein Feuer anmachte. Da saßen wir dann, zogen ein Bierchen – manchmal war Löffel mit dabei, obwohl er nicht gerne hintendrauf mitfuhr –, bis es dunkel und heimelig wurde. Wir flaxten herum, spielten Amazonas und fielen nacheinander, von Indianerpfeilen getroffen, ins Gras, redeten über Mädchen und bekamen Hunger.
Im Winter dann probierten wir das mit dem Feuer auch. Aber das funktionierte nicht. Vorne wurde man geröstet, und hinten blieb man ein Eiszapfen. Nach dem Überwinden der Steige, meist im ersten Gang mit Schrittgeschwindigkeit, legten wir die Handschuhe auf den Zylinder, um sie zu wärmen. Meist kurvten wir in der Gegend herum, kamen durch Albdörfer, in denen es nach Holzrauch roch und Bäuerinnen in Kittelschürzen den Mülleimer an die Straße stellten. Wir spielten Speedwayfahren im Schnee, sanken in Dolinentrichtern bis zur Hüfte ein und erkundeten eine der vielen Burgruinen, die es auf der Alb gab.
Durchgefroren kamen wir zurück. Meist war es Sonntag, und zur TopTen im Radio wollten wir zuhause sein. Wir trafen uns alle drei in Bennis Zimmer.
Benni wohnte mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester in einem Wohnblock aus den Fünfzigern. Früher hatte ich da gegenüber gewohnt, ich kannte Benni seit dem Sandkasten. Inzwischen wohnten meine Alten im Hohbuch in einer GWG-Wohnung, mein Zimmer war genau so groß wie Bennis, aber es lag gleich neben dem Schlafzimmer, da war Musikhören am Abend nicht drin. Bennis Zimmer lag gleich neben der Wohnungstür rechts, man konnte ungesehen hinein schlüpfen, wenn man wollte, und Bennis Mutter war echt nett. Löffel wohnte in einem Reihenhaus im Geranienweg.
Unsere Treffen in Bennis Zimmer waren Kult. Das sagte man damals noch nicht, man sagte echt stark oder ätzend oder geil. Aber es stimmte: Mit der Zeit wurde Bennis Zimmer zum festen Anlaufpunkt für uns drei.
Manchmal machte uns Bennis Mutter einen Teller Brote, Hunger hatten wir ja immer. Ich zierte mich ein bisschen, weil ich niemandem etwas wegessen wollte, aber Benni sagte, das ginge schon in Ordnung. Es gab Wurstsorten, die ich sonst nicht mochte, auch Leberwurst mit Butter darunter, aber wenn ich bei Benni war, aß ich alles.
Mensch, Mama, sagte Benni, wieder kein Kaviar dabei! Und dann, zu mir gewandt: Es wird immer schwieriger, gutes Personal zu kriegen.
Och, Bönni, sagte seine Mutter und wurde rot.
Witzig fand ich, dass sie ihn auch Benni nannte und nicht Bernhard, wie er wirklich hieß.
Bennis Zimmer hatte ein Fenster zum Hof. Manchmal hupte Mike mit seiner Tröte aus SSV-Zeiten, und dann unterhielten wir uns von Balkon zu Fenster. Unterm Fenster stand ein Tuchsessel, den ich mir meistens schnappte. Benni lag auf der Bettcouch, unter der er das Bettzeug und seine Platten hatte. Ein Schrank, ein Möbel mit Klapplade zum Hausaufgabenmachen, ein Wandregal und eine Anrichte, alles Resopal aus Kinderzeiten.
In der Ecke hinter der Tür stand Bennis Hausleiche, die musste er regelmäßig kalken, und an der Wand neben der Tür seine Anlage, ein billige Versandhauskombi mit Plattenspieler, Rekorder, Radio und Boxen.
Löffel saß meistens am Fuß der Bettcouch auf dem Boden, und ebenfalls dort stand die umgedrehte Obstkiste mit dem Teeservice. Eine Apfelkerze brannte, das Licht vom Stövchen, und bald nachdem wir durchgefroren herein gekommen waren, wärmten wir unsere Hände an den heißen Teebechern. Einen Schuss Strohrum hinein, von Bennis Opa, und wir fühlten uns sauwohl.
Wir hörten die TopTen von SWF 3 und nahmen, wenn der blöde Moderator nicht dazwischen quatschte, die Hits auf, die uns noch fehlten. Peter Gabriel, ELO, Queen, einmal war sogar ein Pink-Floyd-Song dabei.
Das hörten wir oft. Die drei Klassiker, Dark side, Wish you were here und Meddle. The Wall kam erst später heraus. Dazu Bennis Barclay-Platten, Supertramp und meine Scorpions, die ich ab und an auf Kassette mitbrachte. Und natürlich die Blueskassetten, die wir aufgenommen hatten, teils mit den Liedern aus dem Schwarzweiß wie Hiroshima, Carpet Crawlers oder Samba Pa Ti, teils mit unseren Lieblingen, auf die wir gern mal mit einem Mädel getanzt hätten.
Rainbow kannte ich, seit Blackmore Deep Purple verlassen hatte. Wir hörten zwar immer noch Child in time und schnitten uns eine Version für den Blues zurecht, aber die bisher erschienenen Rainbow-LPs standen hoch im Kurs.
Wir lehnten uns zurück, bliesen auf den Tee, hörten das Intro von Crazy diamond, der eingeblendete Synthesizer, die Glasharfe im Hintergrund und der Minimoog von Richard Wright, dann das bluesige Gitarrensolo von Gilmour. Wir entspannten uns, schlossen vielleicht die Augen, die Lichtorgel flackerte sacht, und wieder einmal dachten wir, dass es die Welt, aus der solche Musik kam, dringend geben müsste.
Nachdem er die Platte umgedreht hatte, schnappte sich Benni seine E-Gitarre, schwarzweiß, der berühmten Stratocaster von Blackmore nachempfunden, und ließ Löffel oder mich am Radioknopf drehen. Er spielte die ersten Takte von Wish you were here so original, dass wir uns krummlachten. Nachher, als wir den Song richtig hörten, beglückwünschten wir uns zu unserer Imitation.
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl. Manchmal sangen wir mit, leise, zu dritt, und jeder stellte sich dabei seine Traumfrau vor, wie wir mit ihr auf unseren Harleys auf der Route Sixty-Six in den kalifornischen Sonnenuntergang fuhren. Darunter machten wir es nicht.
Löffel musste um zehn zuhause sein. Er war erst fünfzehn. Zu zweit guckten Benni und ich oft noch einen Spätfilm auf seinem tragbaren Fernseher, bei dem er immer die Zimmerantenne einstellen musste. Da sahen wir uns die ganzen Klassiker an – Pink Panther, Ballad of Cable Hogue, Hatari, Mach’s noch einmal, Sam, Ein Goldfisch an der Leine, Frühstück bei Tiffany, Catch 22 und so –, litten mit den Helden, seufzten über unerfüllte Liebe oder die hübschen Schauspielerinnen und merkten uns die flottesten Sprüche.
Wir schauten Reifeprüfung mit dem blutjungen Dustin Hofmann, bollerten gegen das Glas und schrien: Elaiiine! Wir stellten uns vor, wie das wäre, von einer reifen Frau verführt zu werden und nackt mit ihr im Bett zu landen. Obwohl ich die entsprechenden Szenen im Film widerlich fand. Coo-coo ca-choo, Mrs. Robinson!
Wir schauten Stella Stevens beim Baden im Holzzuber zu, den Cable Hogue mit dem Wasser aus seiner Quelle speiste. Ihre blonden Haare, ihre Stupsnase und der Blick der meerblauen Augen, der mir sagte: Komm zu mir, Kleiner! Nimm nicht alles so ernst! Schmetterlingsmorgen. Wildblumenmittage.
Catch me there!
Als ich unten im Hof meine Honda anwarf und breitbeinig durch Schnee und Eis crosste zur Straße, fühlte ich mich immer sehr einsam.
Ich glaube, ich muss mal Pause machen. Seit Stunden sitze ich und tippe in den Rechner. Am besten, ich mache mir einen Tee.
Das Teetrinken habe ich beibehalten. Eigentlich komisch.