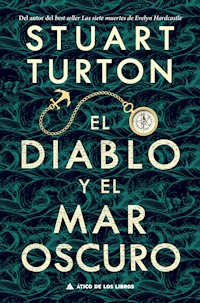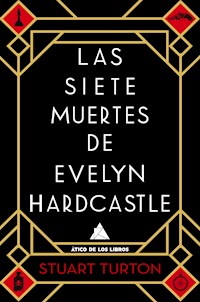19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
122 Überlebende, 1 Mörder, 107 Stunden bis zum Ende der Welt In limitierter Erstauflage mit wunderschön gestaltetem Farbschnitt Die letzte bewohnte Insel der Welt. Eine Idylle. Hier leben Dorfbewohner und eine Handvoll Wissenschaftler friedlich zusammen. Doch dann geschieht das Undenkbare: Eines Morgens wird die Leiche einer brutal ermordeten Wissenschaftlerin gefunden. Sie sorgte für Sicherheit auf der Insel. Wird ihr Mörder nicht rechtzeitig gefunden, steht das Überleben der Menschheit auf dem Spiel. Die Welt wurde durch einen giftigen Nebel zerstört, nur auf einer kleinen Insel im Mittelmeer existieren dank eines komplizierten Abwehrsystems letzte Überlebende. Wissenschaftler sorgen für ein friedliches Leben, sie überwachen die Landwirtschaft, die nächtliche Sperrstunde und sogar die Gedanken der Dorfbewohner. Die wiederum stellen keine Fragen – bis eine der Wissenschaftlerinnen eines Morgens ermordet aufgefunden wird. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Mord das Abwehrsystem der Insel heruntergefahren hat. Wird der Mörder nicht innerhalb der nächsten 107 Stunden gefunden, wird die Insel von dem Nebel verschluckt. Und auch die letzten Menschen auf Erden werden aussterben. Das Problem: Niemand erinnert sich daran, was in der vergangenen Nacht geschehen ist. »Ein ausgeklügelter, fesselnder Thriller, in dem nichts so ist, wie es scheint.« The Guardian »Stuart Turton beweist wieder einmal, was für ein hervorragender Thrillerautor er ist.« Independent
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stuart Turton
Der letzte Mord am Ende der Welt
Kriminalroman
Aus dem Englischenvon Dorothee Merkel
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Last Murder at the End of the World« im Verlag Raven Books,
an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, London
© 2024 by Stuart Turton
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung der Daten des Originalumschlags
Vorsätze und Illustration auf Seite 6: © Emily Faccini, 2024
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50261-9
E-Book ISBN 978-3-608-12390-6
Für Resa,
dafür, dass Dein Herz doppelt so groß ist wie das aller anderen Menschen. Dafür, dass Du Witze reißt, selbst wenn Du griesgrämig bist. Dafür, dass Du zuhörst. Dafür, dass ich Dir etwas bedeute. Und für die vielen Tassen Tee. Dafür, dass Du lächelst, wenn ich den Raum betrete. Für die Lebenskraft, die Du verströmst wie Sonnenlicht. Dass Du bei mir bleibst, selbst dann, wenn Dir das nicht leichtfällt. Du bist meine beste Freundin. Du bist der Mensch, den ich auf der ganzen Welt am meisten liebe. Wenn Du mich das nächste Mal dabei ertappst, wie ich Dich ansehe, und Du mich fragst, woran ich gerade denke, dann ist es genau das. Es ist immer genau das.
Wie gewünscht habe ich eine Liste von Personen zusammengestellt, deren Leben – oder Tod – für die Verwirklichung Deines Plans vonnöten sein wird. Beobachte diese Leute genau. Sie alle werden im Folgenden eine wichtige Rolle spielen.
Die Ermittler
Emory & ihre Tochter Clara
Die Familie der Ermittler
Matis (Emorys Großvater)
Seth (Emorys Vater)
Jack (Emorys verstorbener Ehemann)
Judith (Emorys verstorbene Mutter)
Die Wissenschaftler
Niema Mandripilias
Hephaistos Mandripilias
Thea Sinclair
Einige wichtige Dorfbewohner
Hui (Claras beste Freundin)
Magdalene (Emorys beste Freundin)
Ben (der neueste Zuwachs der Dorfgemeinschaft)
Adil (Magdalenes Großvater)
Prolog
»Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit?«, fragt Niema Mandripilias entsetzt. Sie stellt ihre Frage laut in den leeren Raum.
Sie hat olivfarbene Haut, einen Tintenfleck auf ihrer kleinen Nase, leuchtende, auffallend blaue Augen mit grünen Sprenkeln und lange graue Haare. Sie sieht aus, als wäre sie etwa fünfzig Jahre alt, doch genau so hat sie bereits während der letzten vierzig Jahre ausgesehen. Sie sitzt über ihren Schreibtisch gebeugt, der von einer einzigen Kerze beleuchtet wird, und hält einen Kugelschreiber in ihrer zitternden Hand. Vor ihr liegt ein Geständnis. Seit einer Stunde bemüht sie sich vergeblich, es zu Ende zu schreiben.
»Ich sehe keine andere Möglichkeit«, antworte ich in ihren Gedanken. »Es muss jemand sterben, damit dieser Plan funktioniert.«
Niema hat plötzlich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie hastet durch ihr Zimmer, zerrt das Laken beiseite, das als provisorische Tür dient, und tritt in die schwülwarme Nachtluft hinaus.
Draußen ist es stockdunkel. Der Mond wird von Gewitterwolken belagert. Regen prasselt auf das in dichten Nebel gehüllte Dorf herab und füllt ihre Nase mit dem Geruch von nasser Erde und Zypressen. Sie kann gerade noch das obere Ende der in silbernes Mondlicht getauchten Mauer erkennen, die das Dorf umschließt. Von irgendwoher schallen das entfernte Kreischen von Maschinen und der gleichmäßige Rhythmus zahlloser Schritte zu ihr herüber.
Sie bleibt vor der Tür stehen und lässt zu, dass ihre Haare und ihr Kleid vom warmen Regen durchnässt werden. »Ich wusste, dass es uns etwas kosten würde«, sagt sie mit erstickter Stimme. »Mir war nur nicht klar, dass der Preis so hoch sein würde.«
»Du kannst den Plan wieder verwerfen, es ist noch nicht zu spät«, sage ich. »Behalte deine Geheimnisse auch künftig für dich und lass die anderen ihr Leben ganz normal weiterführen, so wie sie es immer getan haben. Es muss niemand sterben.«
»Dann wird sich nichts ändern!«, entgegnet sie wütend. »Ich habe neunzig Jahre lang vergeblich versucht, die Menschheit von ihrer Selbstsucht, ihrer Gier und ihrem Hang zur Gewalt zu befreien. Und jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, wie mir genau das gelingen kann.«
Sie berührt Trost suchend das alte, stumpf gewordene Kreuz, das um ihren Hals hängt. »Wenn dieser Plan funktioniert, erschaffen wir eine Welt ohne Leid. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden alle vollkommen gleich sein. Ich kann das nicht aufgeben, nur weil ich nicht die Kraft habe, zu tun, was nötig ist.«
So wie Niema redet, klingt es, als wären ihre Träume Fische, die ihr bereitwillig ins Netz schwimmen. Aber die Gewässer, mit denen sie es zu tun hat, sind äußerst trüb und bergen sehr viel schlimmere Gefahren, als sie zu erkennen vermag.
Die Perspektive, die ich in ihrem Bewusstsein – und in dem aller anderen Personen auf der Insel – einnehme, ermöglicht es mir, die Zukunft mit einem hohen Maß an Genauigkeit vorherzusagen. Wenn man Zugang zu den Gedanken jedes Einzelnen hat, kann man aus einer Kombination von Psychologie und Wahrscheinlichkeitsrechnung die entsprechenden Schlüsse ziehen.
Jetzt, von diesem Moment an, spaltet sich die Zukunft in zahllose unterschiedliche Verlaufsformen auf, wie ein Fluss, der sich in verschiedene Ströme zerteilt. Jedes dieser Zukunftsszenarien wartet darauf, Wirklichkeit zu werden, indem es durch ein zufälliges Ereignis, einen beiläufig ausgesprochenen Satz, ein Missverständnis oder eine belauschte Unterhaltung heraufbeschworen wird.
Falls ein Violinkonzert nicht vollkommen fehlerlos vorgetragen wird, bekommt Niema ein Messer in den Bauch gerammt. Falls die falsche Person durch eine seit Langem geschlossene Tür tritt, wird ein riesiger Mann mit narbigem Gesicht sämtliche Erinnerungen preisgeben müssen, und eine junge Frau, die alles andere als jung ist, wird freiwillig in den Tod rennen. Wenn keines von diesen Dingen geschieht, wird die letzte noch auf der Erde verbleibende Insel vollständig vom Nebel verschluckt werden, und alles wird in dieser Finsternis den Tod finden.
»Mit ein wenig Vorsicht können wir diese Gefahren meiden«, sagt Niema, während sie den Blitzen zuschaut, die den Himmel zerreißen.
»Dir bleibt nicht genug Zeit, um vorsichtig zu sein«, insistiere ich. »Sobald du dich einmal für diesen Plan entschieden hast, werden Geheimnisse ans Licht kommen, alte Feindseligkeiten aufflammen, und Personen, die du liebst, werden das Ausmaß deines Verrats erkennen. Falls auch nur eines dieser Vorkommnisse die Ausführung deines Plans verhindert, wird die Menschheit in einhundertundsieben Stunden aussterben.«
Niemas Herz macht einen Satz, und ihr Puls beginnt zu rasen. Einen Moment lang zaudert sie, doch dann gewinnt ihre Arroganz wieder die Oberhand, und ihr Entschluss ist gefasst.
»Die größten Errungenschaften waren schon immer mit den größten Risiken verbunden«, sagt sie störrisch und betrachtet die Gestalten, die in einer langen Reihe mit steifen Beinen durch die Dunkelheit stapfen. »Beginne deinen Countdown, Abi. In vier Tagen haben wir entweder die Welt verändert oder sind bei dem Versuch zugrunde gegangen.«
107 Stunden bis zum Aussterben der Menschheit
1
Zwei Ruderboote treiben am Ende der Welt auf dem Wasser, zwischen ihnen eine straff gespannte Leine. In jedem der Boote sitzen drei Kinder mit ihren Schulheften und Bleistiften und hören Niemas Unterricht zu.
Sie selbst sitzt im Bug des rechten Bootes und gestikuliert gerade in Richtung einer schwarzen Nebelwand, die sich von der Meeresoberfläche aus zu einer Höhe von anderthalb Kilometern auftürmt. Die Strahlen der untergehenden Sonne schimmern durch die rußschwarze Düsternis, sodass es den Anschein erweckt, als stünde das Meer in Flammen.
Abermillionen von leuchtenden Insekten schwirren im Innern der Nebelwand umher.
»… sie werden von der Barriere abgehalten, die von den dreiundzwanzig an der Küste der Insel positionierten Emittern erzeugt wird …«
Seth hört Niemas Unterricht nicht zu. Er ist der Einzige, der ihr keine Aufmerksamkeit schenkt. Während die Kinder erst zwischen acht und zwölf Jahre alt sind, ist Seth bereits neunundvierzig, hat ein runzliges Gesicht und eingesunkene Augen. Seine Aufgabe ist es, Niema und ihre Schüler auf das Meer hinaus- und nach Ende des Unterrichts wieder zurückzurudern.
Er wirft einen prüfenden Blick über den Bootsrand und lässt seine Finger durch das Wasser gleiten. Der Ozean ist warm und klar, aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Es ist Oktober, und in diesem Monat kann man sich auf nichts verlassen. Herrlichster Sonnenschein wechselt sich mit plötzlichen Stürmen ab, die ihrerseits rasch wieder verebben, sich kleinlaut davonmachen und einen strahlend blauen Himmel zurücklassen.
»Die Emitter wurden dafür ausgelegt, Hunderte von Jahren zu funktionieren, es sei denn …« Niema verliert den Faden und verstummt.
Seth schaut zum Bug des Bootes hinüber und stellt fest, dass Niema ins Leere starrt. Seit er denken kann, hat sie jedes Jahr dieselbe Unterrichtsstunde erteilt, und er hat es noch kein einziges Mal erlebt, dass sie über eine Formulierung gestolpert wäre.
Irgendetwas stimmt nicht. Sie ist schon den ganzen Tag so, schaut durch Leute hindurch, hört nur halb zu. Das sieht ihr nicht ähnlich.
Eine Welle spült einen toten Fisch an die Oberfläche, er treibt an Seths Hand vorbei. Sein Leib ist zerfetzt, seine Augen sind weiß und leer. Weitere Fische folgen, prallen mit einem dumpfen Geräusch einer nach dem anderen gegen den Rumpf des Bootes. Es sind Dutzende, die aus dem schwarzen Nebel heraustreiben, alle genauso in Stücke gerissen wie der erste. Ihre kalten Schuppen streifen seine Haut, und er zieht rasch die Hand wieder ins Boot.
»Wie ihr sehen könnt, tötet der Nebel alles, was er berührt«, sagt Niema zu ihren Schülern und zeigt auf die Fische. »Unglücklicherweise bedeckt er die gesamte Erde – außer unserer Insel und einem etwa einen Kilometer breiten Ozeanstreifen, der sie umgibt.«
2
Magdalene sitzt im Schneidersitz am Ende der langgestreckten Mole aus Beton, die in das funkelnde Wasser der Bucht hinausragt. Sie hat ihren wirren roten Haarschopf notdürftig mit einem gelben Leinenfetzen zu einem Dutt zusammengebunden. So wie sie dort sitzt, ähnelt sie einer Galionsfigur aus alten Zeiten, die von ihrem Schiff herabgefallen ist.
Es ist früh am Abend, und in der Bucht tummeln sich Schwimmer, die ihre Runden drehen oder sich von den Felsen links von Magdalene ins Wasser stürzen, angespornt vom Echo ihres eigenen lauten Gelächters.
Magdalene starrt zu den entfernten Ruderbooten hinüber und fügt die Gestalten der Kinder mit einigen wenigen Strichen ihres Kohlestifts der Zeichnung hinzu, die auf ihrem Schoß liegt. Sie wirken so unendlich winzig vor dem Hintergrund der gewaltigen schwarzen Nebelwand.
Sie erschaudert.
Ihr elfjähriger Sohn Sherko ist eines der Kinder, die in diesen Booten sitzen. Sie hat noch nie verstehen können, warum Niema darauf beharrt, mit den Kindern den weiten Weg bis zum Ende der Welt zu rudern, um ihnen diese Unterrichtsstunde zu erteilen. Es wäre doch bestimmt ebenso gut möglich, ihnen die Geschichte des Nebels zu erklären, ohne dass sie sich in dessen Reichweite befinden.
Sie erinnert sich daran, wie sie selbst als kleines Mädchen dort draußen war und dieselbe Lektion von derselben Lehrerin gelernt hat. Sie hat während der gesamten Fahrt geweint und wäre beinahe über Bord gesprungen, um nach Hause zu schwimmen, als sie dort draußen Anker warfen.
»Die Kinder sind bei Niema sicher aufgehoben«, sage ich, um sie zu beruhigen.
Magdalene läuft erneut ein Schauer über den Rücken. Sie dachte, es würde ihre Angst ein wenig mindern, wenn sie diesen Moment zeichnet, aber sie erträgt es nicht länger, zuzusehen. Ihr Sohn wurde ihr erst vor drei Jahren gegeben, und sie glaubt fälschlicherweise immer noch, er sei über die Maßen zerbrechlich.
»Wie spät ist es, Abi?«
»17:43 Uhr.«
Sie notiert die Zeit zusammen mit dem Datum in einer Ecke ihrer Zeichnung und fixiert so für einen kurzen Moment den sich wild windenden Lauf der Geschichte.
Dann bläst sie den Kohlestaub von der Zeichnung, steht auf und dreht sich zum Dorf um. Früher diente es als Marinestützpunkt. Von ihrem gegenwärtigen Blickwinkel aus wirkt es sehr viel unwirtlicher, als es in Wirklichkeit ist, denn die Gebäude im Innern werden von einer hohen, mit uraltem Graffiti überzogenen Mauer geschützt, aus deren Rissen und Spalten überall das Unkraut sprießt. Kuppelförmige Dächer ragen über die Mauerkrone hinaus, Dachrinnen hängen lose herab, und die auf den Dächern angebrachten Solarmodule werden zu gleißenden Spiegeln, in denen sich der helle Sonnenschein bricht.
Magdalene folgt der asphaltierten Straße und durchquert ein verrostetes Eisentor. Die alten Wachtürme zu beiden Seiten des Tors sind derart von Pflanzen überwuchert, dass sie eher einer hohen Hecke ähneln.
Hinter den Türmen kann sie nun die Kaserne erkennen – ein n-förmiges, vier Stockwerke hohes Gebäude aus rissigen Betonblöcken. Die gesamte Außenmauer ist bemalt, mit Dschungelpflanzen, Blumen, Vögeln und Raubtieren, die durch das Unterholz schleichen. Es ist ein Fantasieland, ein Paradies, von einem Volk geschaffen, das mit dem Anblick ausgetrockneter Erde und kahler Felsen aufgewachsen ist.
Über wacklige Treppen und rostige Balkone gelangt man zu den Schlafräumen im Innern, von denen kein einziger über Türen oder Fensterscheiben verfügt, nur noch die leeren Rahmen sind übrig. Einige Dorfbewohner hängen gerade ihre Wäsche zum Trocknen über die Balkongeländer oder haben sich auf die Treppenstufen gesetzt, um jeden noch so kleinen Windhauch genießen zu können, der es über die Mauer schafft. Magdalenes Freunde begrüßen sie fröhlich und rufen sie zu sich, doch sie ist zu besorgt, um darauf zu antworten.
»Wo ist Emory?«, fragt sie, während ihr Blick unruhig über die vor ihr versammelten Gesichter schweift.
»Im Hof neben der Küche, zusammen mit ihrem Großvater.«
Magdalene geht in den Hof hinüber, der zwischen den beiden Flügeln der Kaserne liegt, und sieht sich nach ihrer besten Freundin um. Der Hof diente früher einmal als Truppenübungsplatz, doch drei Generationen von Dorfbewohnern haben ihn nach und nach in einen Park umgewandelt.
Entlang der Hausmauern sind Blumenbeete angelegt, und eine alte, herabgestürzte Radarschüssel wurde zusammengeflickt und in eine Vogeltränke umgewandelt. Vier verrostete Jeeps dienen als Hochbeete für Kräuter, und aus Granatenhülsen wachsen Zitronen- und Orangenbäume. Es gibt eine überdachte Bühne für musikalische Darbietungen und eine Küche im Freien mit sechs langen Tischen für die gemeinsamen Mahlzeiten. Jeden Abend versammeln sich hier sämtliche Dorfbewohner zum gemeinsamen Essen.
Es wohnen hundertzweiundzwanzig Personen im Dorf, und die meisten davon halten sich gerade in diesem Innenhof auf. Manche spielen Spiele, andere üben auf ihren Instrumenten, wieder andere schreiben Gedichte. Auf der Bühne werden Aufführungen geprobt. Ein paar sind damit beschäftigt, Essen zu kochen und neue Gerichte auszuprobieren.
Überall wird gelacht.
Die allgemein herrschende Freude ist so groß, dass Magdalenes Sorge für eine Sekunde ein wenig nachlässt. Sie sieht sich suchend nach Emory um, die nicht schwer zu finden ist. Der Großteil der Dorfbewohner ist gedrungen und breitschultrig, aber Emory ist zierlicher und kleiner als die meisten anderen, mit ovalen Augen und einem gewaltigen Schopf braungelockter Haare. Sie wäre selbst die Erste, die sagt, dass sie einer Pusteblume ähnelt, wenn auch einer recht merkwürdigen.
»Halt still!«, verlangt Matis, während er hinter der Skulptur hervorschaut, die er gerade von Emory anfertigt. »Ich bin gleich fertig.«
Matis ist fast sechzig und damit der älteste Mann im Dorf. Er hat kräftige Arme, einen grauen Schnurrbart und buschige Augenbrauen.
»Mich juckt’s«, beschwert sich Emory und versucht, sich an ihrer Schulter zu kratzen.
»Ich habe dir vor einer halben Stunde eine Pause zugestanden.«
»Für eine Viertelstunde!«, ruft sie. »Ich stehe hier seit sechs Stunden mit diesem dämlichen Apfel.«
»Kunst hat eben ihren Preis«, entgegnet er wichtigtuerisch.
Emory streckt ihm die Zunge raus, nimmt dann wieder ihre Pose ein und hält den glänzenden Apfel in die Höhe.
Matis brummt vor sich hin, während er sich wieder an die Arbeit macht und einen Splitter vom Kinn der Skulptur herunterschlägt. Er steht so dicht davor, dass seine Nase fast den Stein berührt. Während der letzten zehn Jahre hat sein Sehvermögen stark nachgelassen, aber es gibt nichts, was wir dagegen tun könnten. Und selbst wenn wir könnten, hätte es wenig Sinn. Morgen wird er tot sein.
3
Emory sieht Magdalene mit einem ihrer Skizzenbücher unter dem Arm auf sich zukommen. Sie geht mit steifen Schritten, als sei sie vor Angst wie verknotet.
Emory braucht gar nicht erst zu fragen, was los ist. Magdalene ist wie besessen von der Sorge um ihren Sohn. Sie glaubt, dass in jedem Grasbüschel eine giftige Schlange und unter jeder ruhigen Wasseroberfläche ein lebensgefährlicher Strudel lauert. Jeder Splitter zieht eine Blutvergiftung nach sich, und jede Krankheit ist tödlich. In Magdalenes Augen ist die Insel mit tausend Krallen bewaffnet, die sich allesamt drohend nach ihrem Kind ausstrecken.
Emory löst sich aus der Pose, die sie für ihren Großvater eingenommen hat, und umarmt ihre Freundin.
»Mach dir keine Sorgen, Mags, Sherko wird schon nichts passieren«, sagt sie tröstend. Magdalene hat den Kopf in Emorys Schulter vergraben und sagt mit erstickter Stimme: »Es braucht nur eine einzige Welle und –«
»Sie liegen vor Anker«, sagt Emory. »Niema fährt seit ewigen Zeiten mit den Kindern dort hinaus, schon lange bevor wir geboren wurden. Und dabei ist noch nie jemand zu Schaden gekommen.«
»Das schließt nicht aus, dass es heute passieren könnte.«
Emory schaut in den blauen Himmel. Die Sonne ist hinter dem Vulkan verschwunden, der das Dorf überragt, und der Mond steht bereits am Himmel. In einer Stunde wird alles in schwarze Schatten getaucht sein.
»Sie werden bald heimkommen«, sagt Emory tröstend. »Komm, wir decken den Tisch für die Begräbnisfeier, das wird dich ablenken.«
Ihr Blick huscht schuldbewusst zu Matis hinüber. Sie sollte diese letzten Stunden mit ihrem Großvater verbringen, aber er scheucht sie wortlos fort.
Vierzig Minuten später kommen die sechs Schulkinder durch das Eisentor gerannt. Das ganze Dorf jubelt. Magdalene schließt Sherko in die Arme, der sich kichernd windet. Auch alle anderen Kinder werden umarmt und geküsst. Man schiebt sie von einem Erwachsenen zum nächsten, bis sie schließlich lachend und mit verwuschelten Haaren bei ihren Eltern landen.
Ein freundliches Raunen geht durch die Menge, und sie teilt sich, um Niema durchzulassen. Es gibt drei Älteste im Dorf, und sie werden alle hochgeachtet, aber nur Niema wird geliebt. Die Dorfbewohner streichen ihr zärtlich über die Arme, während sie an ihnen vorbeigeht, und ihre Gesichter leuchten vor Verehrung.
Niema schenkt jedem von ihnen ein Lächeln und drückt ihnen die Hände. Die anderen beiden Ältesten, Hephaistos und Thea, bleiben für sich, doch Niema isst jeden Tag zusammen mit den Dorfbewohnern zu Abend, tanzt zur Musik der Band und singt aus vollem Halse ihre Lieder mit.
Jetzt legt sie die Hand tröstend auf Magdalenes Schulter und hebt ihr Kinn mit der Fingerspitze an. Niema ist einen Kopf größer als die meisten Dorfbewohner. Magdalene ist gezwungen, den Kopf in den Nacken zu legen, um ihr ins Gesicht sehen zu können.
»Ich weiß, was dir Sorgen macht, aber ich würde niemals auch nur ein einziges dieser Kinder einer Gefahr aussetzen«, sagt sie. Ihre Stimme ist tief und rau. »Es sind nur noch so wenige von uns übrig. Wir haben die Pflicht, jeden Einzelnen sorgfältig zu beschützen.«
Magdalene treten Tränen in die Augen. Ihr Gesicht ist zugleich von Ehrfurcht und Dankbarkeit erfüllt. Im Gegensatz zu Emory hat sie das leise Zögern, den kaum wahrnehmbaren Anflug von Zweifel in Niemas Stimme nicht bemerkt.
Nachdem Niema noch eine Weile mit den Dorfbewohnern geplaudert hat, löst sie sich aus der Menge, hakt sich mit einer graziösen Armbewegung bei Emory unter und geht mit ihr zusammen zur Kaserne zurück.
»Das sollte ihr für ein paar Tage reichen«, sagt sie, sobald sie außer Hörweite sind. »Komm mich das nächste Mal doch besser sofort holen, wenn sie anfängt, sich Sorgen zu machen. Ich hatte schon Angst, sie würde zu den Booten hinausschwimmen.«
»Ich versuche seit einer Stunde vergeblich, sie zu beruhigen«, sagt Emory, während sie Magdalenes verzückten Gesichtsausdruck betrachtet. »Wie hast du das gemacht?«
»Das ist bloß mein Alter«, antwortet Niema fröhlich. »Wenn junge Leute Runzeln sehen, glauben sie immer, das sei dasselbe wie Weisheit.« Sie senkt verschwörerisch die Stimme und klopft Emory auf die Hand. »Komm mit, ich habe ein neues Buch für dich.«
Emory hüpft das Herz vor Freude.
Arm in Arm durchschreiten sie in kameradschaftlichem Schweigen die feuchte Luft, in der mit einbrechender Dämmerung immer mehr Glühwürmchen schweben. Dies ist Emorys liebste Tageszeit. Der Himmel leuchtet rosa und violett, und die steinerne Mauer, die das Dorf umgibt, ist in ein warmes, rötliches Licht getaucht. Die glühende Hitze, die tagsüber geherrscht hat, ist einer angenehmen Wärme gewichen, alle sind wieder ins Dorf zurückgekehrt, und ihre Freude füllt jeden noch so kleinen Raum aus.
»Wie läuft es mit dem Schreinern?«, fragt Niema.
Sobald die Dorfbewohner mit fünfzehn Jahren die Schule abgeschlossen haben, steht es ihnen frei, unter den Beschäftigungen, die der Dorfgemeinschaft nützlich sind, eine auszuwählen. Doch Emory hangelt sich seit einem Jahrzehnt von einem Job zum nächsten, ohne dass es ihr gelungen wäre, auch nur in einem einzigen irgendwelche Fortschritte zu machen.
»Ich habe es aufgegeben«, gesteht sie.
»Oh? Warum?«
»Johannes hat mich geradezu angefleht, die Finger davon zu lassen«, antwortet Emory verlegen. »Offenbar bin ich nicht besonders gut darin, Holz zuzusägen, einen Balken zu hobeln oder eine Nut-Feder-Verbindung herzustellen. Und er fand, ein krummer Schrank sei es nicht wert, dass man deswegen einen Finger verliert.«
Niema lacht. »Wie steht es denn mit dem Kochen? Was ist da passiert?«
»Katia hat mir mitgeteilt, das Kleinhacken einer Zwiebel müsse den Anfang meiner Kochkünste bilden und dürfe nicht meine größte Errungenschaft bleiben«, erklärt Emory niedergeschlagen. »Davor hat Daniel mir gesagt, es sei vollkommen egal, auf welche Weise ich die Gitarre halte, weil alles, was ich ihr entlocke, gleichermaßen furchtbar klinge. Mags hat mir einen halben Tag lang ihre Farben geliehen und dann eine Woche lang nicht mehr mit dem Lachen aufgehört. Offenbar bin ich ein hoffnungsloser Fall. Ich bin zu nichts zu gebrauchen.«
»Du hast eine sehr gute Beobachtungsgabe«, bemerkt Niema behutsam.
»Was nützt das schon, wenn Abi ohnehin alles sieht, was wir tun«, entgegnet Emory traurig. »Ich möchte irgendetwas Nützliches für das Dorf tun, aber ich habe keine Ahnung, was das sein könnte.«
»Ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, ob du nicht vielleicht mit mir zusammen in der Schule arbeiten magst?«, fragt Niema vorsichtig. »Ich werde jemanden brauchen, der meinen Platz einnimmt, und ich denke, du würdest dich hervorragend dazu eignen.«
Emory runzelt die Stirn. Einen Moment lang ist das die einzige Reaktion, die sie auf diesen Vorschlag hin zustande bringt. Niema ist seit jeher die einzige Lehrerin im ganzen Dorf gewesen. Niemand kann sich daran erinnern, dass dies jemals anders gewesen wäre.
»Du willst aufhören?«, fragt Emory überrascht. »Warum?«
»Das Alter«, antwortet Niema, während sie zu ihrem Schlafraum hochsteigt. Die Stufen der rostigen Treppe scheppern bei jedem Schritt. »Kinder zu unterrichten ist großartig für die Seele, aber eine Qual für den Rücken. Ich habe ein langes Leben hinter mir, Emory, aber meine glücklichsten Erinnerungen stammen aus dem Schulzimmer. Es ist jedes Mal wieder beeindruckend, wenn man die Begeisterung auf dem Gesicht eines Kindes sieht, das endlich ein schwieriges Konzept begriffen hat.« Sie bleibt einen Moment lang stehen und dreht sich nach Emory um. »Ich bin davon überzeugt, dass dir diese Aufgabe sehr liegen würde. Ganz ehrlich.«
Emory ist äußerst begabt darin, eine Lüge als solche zu erkennen, und wegen Niemas veränderter Tonlage war diese hier besonders leicht zu durchschauen.
Die junge Frau kneift misstrauisch die Augen zusammen. »Und welche meiner charakterlichen Eigenschaften hat dich zu dieser Überzeugung gelangen lassen?«
Niemas Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen und klingt, als hätte sie sie eingeübt. »Du bist klug und wissbegierig, und du kannst gut mit Leuten umgehen.«
»Ich habe eher den Eindruck, dass die Leute genervt von mir sind«, entgegnet Emory. »Hast du etwa mit meinem Vater geredet?«
Niema gerät ins Stocken.
»Kann schon sein, dass er beiläufig erwähnte, dass du noch immer keine passende Tätigkeit gefunden hast«, gibt Niema schließlich zu. »Aber ich hätte dir das Angebot auch gemacht, wenn er nicht –«
»Sag ihm, dass ich gerade ein Theaterstück schreibe!«
Niema sieht sie von der Seite an. »Du schreibst schon seit einem Jahr an deinem Theaterstück.«
»Ich möchte nichts überstürzen.«
»Diese Gefahr scheint nicht zu bestehen«, murmelt Niema und schiebt das schmuddelige Laken vor ihrem Schlafraum beiseite. Das Laken ist eine Marotte von ihr. Keinem der anderen Dorfbewohner machen die leeren Türrahmen etwas aus. So etwas wie Privatsphäre ist bemerkenswert wenig wert, wenn man von Geburt an eine Stimme im Kopf hat, die alles hören kann, was man denkt.
Im Laufe der Jahre haben die Dorfbewohner ihr Möglichstes getan, um die Schlafsäle zu reparieren, aber bei einem derart alten Gebäude lässt sich nicht besonders viel ausrichten. Die Betonwände sind voller Spalten und Löcher, die grauen Bodenfliesen zerborsten, und die Balken, die das Dach stützen, sind morsch. Überall liegt der Geruch nach Schimmel in der Luft.
Ein derartiger Grad des Verfalls hat etwas äußerst Trostloses. Die Dorfbewohner wehren sich dagegen, indem sie die Räume mit Leben und bunten Farben füllen. Niema hat einen großen Teppich auf der Erde ausgebreitet und eine Vase mit frischen Schnittblumen auf das Fensterbrett gestellt. Die Wände sind mit zahllosen Gemälden vollgehängt, die von allen Künstlern stammen, die es jemals im Dorf gegeben hat. Die meisten davon sind nicht besonders gut. Emory fragt sich, warum sich Niema dazu entschieden hat, sie aufzuheben. Bei vielen dieser Werke sähe der nackte Beton, der darunterliegt, wesentlich besser aus.
Niema hat die Fensterläden geschlossen, um die Insekten fernzuhalten, und zündet deshalb eine kleine Kerze an, die auf dem wackligen Schreibtisch steht. Ihr flackerndes Licht fällt auf einen halbfertigen Brief, den Niema hastig in eine Schublade wirft.
»Wie viel von dem Theaterstück hast du denn schon geschrieben?«, fragt sie und hält schützend eine Hand vor die Flamme der Kerze, während sie sie zu einem überfüllten Bücherregal hinüberträgt, das neben einem eisernen Bettgestell steht.
»Vier Seiten«, gesteht Emory.
»Sind sie gut?«
»Nein«, antwortet Emory verzweifelt. »Wie sich herausgestellt hat, bin ich im Schreiben nicht besser als im Schustern, Tischlern oder Drachenbasteln. Meine einzige Begabung scheint darin zu bestehen, Dinge zu bemerken, die die Leute lieber verbergen wollen, und Fragen zu stellen, die die Leute lieber nicht beantworten wollen.«
»Oh, da würde ich mir mal keine Sorgen machen«, sagt Niema, während sie mit dem Finger auf der Suche nach einem bestimmten Band über die Buchrücken streicht. »Manche Leute werden mit dem Wissen geboren, wozu sie bestimmt sind. Andere brauchen etwas länger, um das herauszufinden. Ich bin hundertdreiundsiebzig Jahre alt, aber ich habe mit dem Unterrichten erst angefangen, als ich schon über achtzig war, und danach wollte ich nie wieder etwas anderes tun. Dir könnte es genauso gehen, wenn du es mal ausprobieren würdest.«
Emory verehrt Niema von ganzem Herzen, aber sie hat eine Art, derart achtlos über ihr Alter zu sprechen, dass es oft etwas Kränkendes hat. Keiner der Dorfbewohner wird jemals auch nur halb so lange leben, und man könnte den Umstand, dass Niema ihre Langlebigkeit so häufig erwähnt, schon fast als grausam bezeichnen. Heute, da ihr Großvater dem Tod so nahe ist, empfindet Emory das als besonders schmerzhaft.
»Aha!«, ruft Niema und zieht ein zerfleddertes altes Taschenbuch aus dem mittleren Regal. »Hier ist es! Es trägt den Titel Samuel Pipps und der Geisterturm. Hephaistos hat es vor ein paar Wochen in einem verlassenen Bahnwaggon gefunden.«
Als sie Emory das Buch in die Hand drückt, fällt ihr deren betroffener Gesichtsausdruck auf.
»Ich weiß, ich weiß, Sherlock Holmes wäre dir lieber«, sagt sie und klopft mit dem Finger auf das reißerische Buchcover. »Aber gib dem Buch hier mal eine Chance. Es wird dir gefallen. Es passieren drei Morde darin!«
Ihre Stimme hat sich fast zu einem Flüstern gesenkt. Sie weiß, dass ich es nicht gutheiße, wenn man sich im Dorf über Mord unterhält oder dieses Wort auch nur offen ausspricht.
Der letzte Mord hat sich vor über neunzig Jahren ereignet, kurz bevor die Welt endete. Zwei Freunde haben sich in einem Treppenhaus in Nairobi über eine Beförderung gestritten. In einem Anfall rasender Eifersucht hat der eine den anderen die Treppe hinuntergestoßen, und er hat sich das Genick gebrochen. Der Mörder hatte gerade genug Zeit, sich zu fragen, ob er ungestraft davonkommen würde, als der Nebel aus der Erde stieg. Er ist eine Sekunde später ums Leben gekommen, zusammen mit allen Menschen, die er jemals kannte, und dem Großteil der übrigen Menschheit, den er niemals kennengelernt hat. Seitdem ist kein weiterer Mord mehr geschehen. Dafür habe ich gesorgt.
Kein anderer im Dorf darf diese Bücher lesen. Für Emory habe ich jedoch eine Ausnahme gemacht, denn die darin enthaltenen Rätsel sind das Einzige, was ihre unstillbare Neugier für eine Weile in Schach halten kann.
»Denk daran, du darfst es niemandem sonst zeigen«, sagt Niema, als die beiden Frauen den Raum verlassen und auf den Balkon hinaustreten. »Es würde ihnen nur Angst einjagen.«
Emory hält das verbotene Buch eng an die Brust gepresst. »Danke, Niema.«
»Du kannst dich damit revanchieren, dass du morgen zur Schule kommst.«
Als sie sieht, wie sich Emorys Lippen schon zu einer ablehnenden Antwort formen, fügt sie hastig hinzu: »Nicht, weil dein Vater das möchte, sondern mir zuliebe. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja mit dem Nichtschreiben deines Theaterstücks weitermachen.«
Niemas Blick fällt auf etwas hinter Emory, und die jüngere Frau wendet sich um. Niemas Sohn Hephaistos kommt durch das eiserne Tor gestapft. Er hält den kahlrasierten Kopf gesenkt und die gewaltigen Schultern gebeugt, als würde die Last des Himmels ihn zu Boden drücken.
Hephaistos taucht immer nur dann auf, wenn etwas repariert oder neu gebaut werden muss. Die meiste Zeit über lebt er jedoch allein in der Wildnis – eine Vorstellung, die Emory so fremd ist, dass allein der Gedanke daran sie mit Unbehagen erfüllt.
»Was macht der denn hier?«, fragt sie sich unwillkürlich laut.
»Er will zu mir«, sagt Niema.
Emorys Blick wandert zu Niemas Gesicht zurück. Sie hatte geglaubt, sämtliche Gemütslagen ihrer Lehrerin zu kennen, aber jetzt huscht ein Ausdruck über deren Gesicht, den sie noch nie zuvor darin gesehen hat. Es könnte Unsicherheit sein, oder sogar Angst.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt Emory.
Niema begegnet ihrem Blick, aber es ist deutlich zu sehen, dass sie mit ihren Gedanken noch immer bei ihrem Sohn ist.
»Morgen Abend werde ich ein Experiment durchführen, das bei jedem Versuch bisher gescheitert ist«, sagt Niema und scheint sich dabei vorsichtig von Wort zu Wort zu hangeln. »Aber wenn es auch diesmal scheitert …« Sie verstummt und legt sich nervös die Hand auf den Bauch.
»Wenn es auch diesmal scheitert …«, hakt Emory nach.
»Werde ich etwas Unverzeihliches tun müssen«, sagt Niema und sieht zu, wie Hephaistos hinter der Küche verschwindet. »Und ich bin noch immer nicht sicher, ob ich die Kraft dazu haben werde.«
4
Adil späht durch sein Fernglas und sieht mit wild klopfendem Herzen zu, wie Emory und Niema sich auf dem Balkon vor der Kaserne unterhalten. Sein Beobachtungsposten befindet sich auf halber Höhe des östlichen Vulkanhangs. Auf dem Weg hierher musste er sich einen Weg durch die Lavahöhlen erkämpfen, von denen dieser Teil des Bergs durchlöchert ist. Der Boden ist mit Asche bedeckt, und die schwarzen Felsen haben messerscharfe Kanten. Es ist, als hätte er mit der zerstörerischen Kraft seiner Gedanken das umliegende Land versengt.
Adil befindet sich fast fünf Kilometer vom Dorf entfernt, aber er hat sich diesen Aussichtspunkt ausgesucht, weil man von hier aus eine direkte Sichtlinie über die Mauer hat. Er kann sehen, wie Emory Niema tröstet und liebevoll ihre Hand auf deren Arm legt. Jede Sekunde dieses Anblicks brennt ihm in der Seele und vergiftet das Blut in seinen Adern. Ich versuche gar nicht erst, ihn zur Güte oder Freundlichkeit zu ermahnen. Es würde nichts nützen. Während der letzten fünf Jahre hat er an nichts anderes als an Rache gedacht. Wenn ich ihn nicht immer wieder ans Essen erinnern würde, wäre er schon längst verhungert. Und wenn er sich dann widerstrebend auf Nahrungssuche begibt, geht er äußerst ungeduldig vor, zerrt Gemüse aus der Erde oder reißt einen Armvoll Obst von einem Baum.
Er ist achtundfünfzig, sieht jedoch mindestens zehn Jahre älter aus. Seine Haut spannt sich straff über die darunterliegenden Knochen. Sein Gesicht ist ausgezehrt, seine ursprünglich schwarzen Haare sind grau geworden, die braunen Augen trübe. Seine Haut ist blass und fleckig, und wenn er hustet, rasselt es in seiner Brust – ein deutliches Zeichen der Krankheit, die in seinem Körper wütet. Normalerweise würde ich ihn zurück ins Dorf beordern, damit man sich dort um ihn kümmern kann oder er wenigstens während der letzten ihm noch verbleibenden Tage nicht allein sein muss.
Unglücklicherweise ist das nicht möglich. Er ist der einzige Kriminelle auf dieser Insel und wurde für sein Verbrechen mit dem Exil bestraft.
»Sie glaubt, Niema wäre ihre beste Freundin«, murmelt er leise vor sich hin – eine Angewohnheit, die er sich seit seiner Verbannung angeeignet hat. »Sie hat keine Ahnung, was Niema ihr gestohlen hat.«
Nachdem Emory fortgeeilt ist, das Buch fest an die Brust gedrückt, schaut Niema zu dem Vulkan hoch. Sie kann Adil aus dieser Entfernung nicht sehen, aber sie weiß, dass er dort ist. Ich erstatte ihr stündlich einen genauen Bericht darüber, was er gerade so treibt. Er ist eine der wenigen gefährlichen Personen auf dieser Insel, und sie möchte zu jeder Zeit wissen, wo er sich aufhält.
Er holt tief Luft, starrt auf sein Messer herab und stellt sich vor, wie er es ihr in den Bauch rammt. Er will zusehen, wie ihrem Körper das Leben entweicht. Er wünscht sich das sehnlicher als irgendetwas sonst.
»Und welchen Nutzen wird dir die Rache bringen?«, frage ich. »Hast du mal darüber nachgedacht? Hast du dich gefragt, wie dein Leben aussehen wird, nachdem du jemanden getötet hast? Hast du dich gefragt, wie du dich dann fühlen wirst?«
»Ich werde mich so fühlen, als hätte ich nur die Hälfte meiner Aufgabe erfüllt«, antwortet er. »Niema ist zwar die Schlimmste von ihnen, aber ich werde keine Ruhe finden, bis man nicht auch Thea und Hephaistos in den Brennofen geschmissen hat. Solange die noch am Leben sind, werden wir niemals frei sein.«
»Du machst dich lächerlich«, sage ich. »Was auch immer du für einen Plan ausheckst – ich werde sie warnen. Du wirst nie auch nur in ihre Nähe kommen.«
Du kannst mich nicht ewig beobachten, denkt er.
Da irrt er sich. Ich bin seit dem Tag seiner Geburt in seinen Gedanken, und ich werde in seinen Gedanken sein, wenn er stirbt. Ich habe über seine Vorfahren gewacht und werde über seine Nachfahren wachen. Es sind nur noch so wenige Menschen übrig, dass jeder Einzelne von ihnen unbedingt beschützt werden muss. Und das Dorf ist der Schlüssel dazu. Seine Sicherheit muss gewährleistet werden. Um jeden Preis.
5
Die Dämmerung ist hereingebrochen. Die Sichel des Mondes schneidet ein Loch in den dunkelblauen Himmel.
Das Dorf wird vom Schein zahlreicher Kerzen erhellt, und überall sind Gelächter und Musik zu hören.
Die Band spielt ein Stück nach dem anderen, und die meisten Leute – zu denen auch Niema gehört – tanzen vor der Bühne. Matis’ Begräbnis ist vorbei. Es gibt keinen Grund mehr zur Trauer. Jetzt nicht mehr.
Die Reste des Abendessens stehen noch auf den langen Tischen, die von flackernden Kerzen und den darüber hängenden Trauerlaternen erleuchtet werden. Die Laternen sind aus buntem Reispapier und hängen an mehreren Seilen, die zwischen den beiden Flügeln der Kaserne aufgespannt wurden. Es gibt eine Laterne für jeden einzelnen Dorfbewohner, und jede von ihnen enthält ein Stück Papier, auf dem ein Liebesdienst oder ein Gefallen vermerkt ist, den Matis der jeweiligen Person erwiesen hat.
So ehren sie die Toten. Auf diese Weise soll daran erinnert werden, was die jeweilige Person der Welt gegeben hat und was nun alle anderen tun müssen, um die Lücke zu füllen. Es gibt keine Gebete, keine Gedanken an ein Leben nach dem Tod. Die Belohnung für ein gutgeführtes Leben besteht darin, dass man es gelebt hat.
Matis sitzt in der Mitte eines der langen Tische und ist von seinen engsten Freunden umgeben. Sie lachen, tauschen Erinnerungen aus und wissen, dass auch ihre eigenen Tage bald ein Ende finden werden. Alle sterben an ihrem sechzigsten Geburtstag, ganz gleich, wie gesund sie noch sind. Sie genießen die zu ihren Ehren veranstaltete Begräbnisfeier und schlafen danach ganz normal ein. Irgendwann in der Nacht hören ihre Herzen auf zu schlagen. Nach einem lebenslangen Dienst an der Gemeinschaft ist ein friedlicher, schmerzfreier Tod in ihrem eigenen Bett das Mindeste, was ich für sie tun kann.
Emory geht durch das eiserne Tor in der hohen Dorfmauer, tritt auf die Mole hinaus und lässt den Lärm der Feier hinter sich.
Tränen laufen ihr über die Wangen, aber sie möchte nicht, dass irgendjemand mitbekommt, wie egoistisch sie sich gerade verhält. Im Gegensatz zu vielen anderen Angehörigen seiner Generation hat es ihr Großvater tatsächlich bis zum Alter von sechzig Jahren geschafft. Er hat jeden einzelnen Tag seines Lebens dem Dienst der Gemeinschaft gewidmet und wird nun ohne jedes Bedauern aus der Welt scheiden.
Weil er über den genauen Zeitpunkt seines Todes Bescheid wusste, konnte er sich den Luxus leisten, sich ausgiebig zu verabschieden. Während der vergangenen Woche hat er mit jedem gesprochen, den er zu sprechen wünschte. Alle, die einen Platz in seinem Herzen haben, wissen, was er für sie empfindet, und er ist seinerseits mit dem Wissen um ihre Liebe gesegnet. Nichts ist ungesagt geblieben.
Emory kann nur hoffen, ebenso erfüllt zu sterben wie er, aber dennoch lastet die Trauer auf ihrer Brust, zerreißt ihr das Herz.
Ihre Mutter ist an einem Fieber gestorben, als sie zwölf Jahre alt war, und ihr Vater schien daraufhin auf gewisse Weise ebenfalls zu verschwinden. Ihre Großmutter war längst tot, und so war es Matis, der Emory am Abend Geschichten vorlas und ihr tagsüber kleine Aufgaben zuteilte – stumpfsinnige, undankbare Aufgaben, die nur dazu dienen sollten, sie vom sinnlosen Nachgrübeln über den Verlust ihrer Familie abzuhalten.
Selbst heute noch spendet es ihr Trost, wenn sie das Klirren seines Meißels auf einem Steinblock hört, und die Vorstellung, dass sie dieses Geräusch nun nie wieder hören wird, ist ihr unerträglich.
Aus der Richtung des Kiesstrandes in der Bucht zu ihrer Linken kommt ein rhythmisches Hämmern. Es ist viel zu dunkel, um die Ursache des Geräuschs auszumachen, aber sie hat da so eine Ahnung.
Sie folgt dem Geräusch und bahnt sich mit vorsichtigen Schritten einen Weg durch vier am Ufer vertäut liegende Boote. Dahinter findet sie Seth, der beim Licht einer kleinen Laterne den Rumpf von »Charons Barke« repariert. Es ist Flut, und die Wellen kitzeln spielerisch seine Fersen. Das Knirschen der Kiesel verrät ihm ihr Kommen, und er wirft ihr einen raschen, verärgerten Blick zu.
Er hat eine breite, tiefe Stirn, eine schiefe Nase und einen quadratischen Kiefer, der beim Essen laut knackt. Aus seinen breiten Schultern ragen zwei dicke Arme, die von dunklen, sich kräuselnden Haaren bedeckt und mit öligen Flecken übersät sind. Früher waren diese Arme einmal von großer Kraft erfüllt, doch nun geben die Muskeln allmählich nach, und die sich darüberspannende Haut beginnt schlaff zu werden.
Wenn man Seths Äußeres mit dem der übrigen Dorfbewohner vergleicht, könnte man den Eindruck gewinnen, als wäre er eine Art grober Entwurf gewesen – als hätte sich die Natur einen Klumpen Ton genommen, ein paar Augen hineingedrückt und das Ganze dann als gescheitert verworfen.
»Du arbeitest?«, fragt sie überrascht.
Sie ist in der Erwartung hierhergekommen, ihn in derselben Trauer vorzufinden, die auch sie selbst empfindet, doch jetzt wird ihr klar, dass diese Erwartung idiotisch war. Das Leben jedes Dorfbewohners ist ein Dienst an der Gemeinschaft. Ein jeder sorgt sich um das Wohl der anderen, bevor er sich um sein eigenes Wohl kümmert, und ihr Vater hat sich diesem Ideal mit ganzer Seele verschrieben. Er wird nicht weinen, bevor er nicht jedes Schlagloch gefüllt, jedes Dach geflickt, jedes Stück Obst und Gemüse geerntet und den Brennofen angefeuert hat, in dem sein Vater eingeäschert werden soll. Seiner Ansicht nach ist Trauer nichts als Egoismus – ein Gefühl, das eher Mitleid als Verachtung verdient.
»Das Boot hat ein Loch im Rumpf«, sagt er und beginnt aufs Neue, den Hammer zu schwingen.
»Möchtest du Matis denn nicht noch einmal sehen?«
»Wir haben uns heute früh gesehen«, antwortet er unwirsch.
»Er ist dein Vater.«
»Deshalb haben wir uns ja auch heute früh gesehen«, wiederholt er und setzt einen weiteren Nagel an.
Emory beißt sich auf die Lippe. Eine altbekannte Erschöpfung ergreift sie. Jedes Gespräch mit ihrem Vater verläuft so. Er ist ein Felsen, den man immer wieder den Hügel hinaufrollen muss.
»Niema hat mir heute einen Job angeboten.«
»Das hat sie mir erzählt«, antwortet er, während er den Nagel ins Holz schlägt. »Du solltest das Angebot annehmen. Es ist eine große Ehre, und alles andere hast du ja schon ausprobiert. Es ist höchste Zeit, dass du endlich einen Weg findest, wie du dem Dorf dienen kannst.«
Sie nimmt die Rüge schweigend hin und schaut zu, wie das schäumende Wasser über die Kiesel plätschert. Sie ist fast versucht, ein wenig hinauszuschwimmen, aber es ist zu kurz vor der Sperrstunde. Sie begnügt sich damit, ein paar Schritte ins Wasser hineinzugehen und ihre nur in Sandalen steckenden Füße von den Wellen umspielen zu lassen. Ihre Sandalen sind am Ende eines jeden Tages immer fürchterlich dreckig.
»Irgendetwas bereitet Niema Sorgen«, sagt sie, um das Thema zu wechseln. »Weißt du, was das sein könnte? Sie hat mir erzählt, sie müsse ein Experiment durchführen, aber mehr wollte sie mir nicht sagen. Es klang wichtig.«
»Keine Ahnung«, antwortet er und setzt den nächsten Nagel an. »Mir ist aufgefallen, dass sie in Gedanken versunken war, aber sie hat mir gegenüber nichts erwähnt.«
»Hast du sie danach gefragt?«
»Das steht mir nicht zu.«
»Ich wünschte, sie würde uns helfen lassen.«
»Genauso gut könntest du dir wünschen, einen Tag lang die Sonne auf deinen Schultern zu tragen.« Ein weiterer Nagel wird ins Holz getrieben. »Im Vergleich zu Niemas Belangen sind die unsrigen klein und nichtig. Wenn sie Hilfe braucht, wird sie einen der Ältesten fragen. Wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die wir auch kontrollieren können.«
Er legt eine bedeutungsschwangere Pause ein und kommt dann auf das Thema zu sprechen, das ihm schon eine Weile auf der Seele liegt. »Wie geht es Clara?«
Emorys Tochter wurde kürzlich dazu auserwählt, eine von Theas Lehrlingen zu werden, und hat als Teil ihrer Ausbildung die letzten drei Wochen damit verbracht, die Insel zu erkunden. Es ist eine gewaltige Ehre. Sie war eine von nur zwei Bewerbern, die das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen haben. Jetzt wird sie in Mathematik, in Ingenieurwesen, Biologie und Chemie ausgebildet und lernt Dinge, die den Horizont der meisten Dorfbewohner weit übersteigen.
»Ich habe ihr durch Abi ein paar Nachrichten zukommen lassen, aber sie hat auf keine davon geantwortet«, sagt Emory, während sie wie gebannt auf den schwarzen Ozean hinausstarrt. »Ich glaube, sie ist immer noch wütend.«
Seths Hammer schwankt in der Luft und saust dann auf einen Nagel herab. Er ist so angespannt, dass die Muskelstränge an seinem Hals hervortreten.
»Na los, rede es dir von der Seele!«, sagt Emory kurz angebunden. Ihr ist die Stimmung, in der er sich gerade befindet, nur zu bekannt.
»Es ist nichts«, brummt Seth.
»Sag’s doch einfach, Papa«, insistiert sie. »Du wirst dich besser fühlen, wenn du ein bisschen rumgebrüllt hast.«
»Es ist der Traum eines jeden Kindes, Theas Lehrling zu werden«, sagt er durch seine zusammengebissenen Zähne. »Kannst du dich nicht für Clara freuen? Kannst du nicht wenigstens so tun, als ob? Du bist nicht einmal zu ihrem Abschiedsessen gekommen.«
»Ich kann nicht etwas feiern, was ich mir niemals für sie gewünscht habe«, sagt Emory.
Sobald die Ausbildung ihrer neuen Lehrlinge beendet ist, setzt Thea sie bei den verschiedensten Arbeiten ein – bei Experimenten in ihrem Labor oder bei der Suche nach vielversprechenden Technologien, die sich noch auf der Insel befinden und die sich in irgendeiner Form nutzbar machen lassen. Es ist eine Position, die man ein Leben lang innehat, aber die meisten von Theas Lehrlingen überleben keine zehn Jahre. Das, was sie tun, ist überaus gefährlich, und Emory hat bereits ihren Ehemann und ihre Mutter an diese Arbeit verloren. Sie hat alles versucht, um ihre Tochter von einer Bewerbung abzuhalten – sehr zu Seths Empörung.
»Dieses Abschiedsessen war der glücklichste Tag in Claras Leben«, sagt er. Allmählich steigert er sich in eine heftige Wut hinein. »Ich habe sie nicht mehr so viel lächeln sehen, seit ihr Vater starb. Sie wollte ihre Mutter dort bei sich haben, damit sie mit ihr zusammen feiert, aber du hast dich irgendwo verkrochen und geschmollt.«
»Ich habe nicht geschmollt.«
»Was war es dann? Du bist der einzige Mensch, der jemals die Chance ausgeschlagen hat, bei Thea in die Lehre zu gehen. Du konntest von Clara wohl kaum verlangen, dass sie dasselbe tut.«
»Ich habe die Chance nicht ausgeschlagen«, entgegnet Emory und lässt sich in die wohlvertraute, tief eingekerbte Furche ihres immer gleichen Streits hineingleiten. »Ich habe es ausprobiert, und es hat mir nicht gefallen. Du weißt doch, wie dieses Leben aussieht. Man latscht über die Insel, stochert in Ruinen und stümpert an irgendwelchen Maschinen herum, deren Funktionsweise wir nicht im Geringsten verstehen. Wie viele von Theas Lehrlingen sind dabei verletzt worden? Wie viele von ihnen sind noch am Leben?«
»Also war es Feigheit?«, zischt er bitter.
»Es war gesunder Menschenverstand«, entgegnet sie entrüstet. »Mir ist aufgefallen, dass Thea nie auch nur in der Nähe der Maschinen steht, wenn sie explodieren.«
»Das ist eine der Ältesten, über die du da gerade redest«, brüllt er und schleudert seinen Hammer auf die Kiesel. »Etwas mehr Respekt, bitte!«
Emory starrt ihn wütend an. Vor lauter Zorn bringt sie kein Wort mehr heraus.
»Die Ältesten sind unsere letzte Verbindung zur alten Welt«, fährt Seth fort und bemüht sich, die Beherrschung wiederzuerlangen. »Sie verfügen über Kenntnisse, für deren Aneignung wir Hunderte von Jahren brauchen würden. Ohne sie wären wir gezwungen, ganz von vorn anzufangen. Glaubst du denn wirklich, dass auch nur ein einziges unserer Leben genauso viel wert ist wie ihres?«
Emory hat diese Geschichte schon so oft gehört, dass sie sie mit exakt der gleichen Tonlage wiedergeben könnte wie ihr Vater: Vor neunzig Jahren taten sich auf sämtlichen Kontinenten der Erde gewaltige Krater auf, die ganze Städte verschluckten. Aus dem Innern dieser Krater stieg ein seltsamer schwarzer Nebel auf, in dem es vor leuchtenden Insekten wimmelte, die alles, was sich ihnen in den Weg stellte, in Stücke rissen. Der Nebel breitete sich immer weiter aus, trotz aller Versuche, die die Nationen der Welt unternahmen, um ihn aufzuhalten.
Nach dem Verlauf eines Jahres bedeckte er die ganze Erde. Die menschlichen Gesellschaften brachen durch interne Machtkämpfe und Barbarei auseinander, lange bevor der Nebel sie zerstörte. Der einzige Hoffnungsschimmer war eine Funknachricht, die Niema abgesetzt hatte und die alle Überlebenden aufforderte, zu einer kleinen griechischen Insel zu kommen.
Sie war damals die leitende Wissenschaftlerin eines riesigen Labors namens Blackheath Institut. Diesem Institut war es gelungen, eine Barriere zu errichten, die den Nebel abwehren konnte. Niema versprach allen, die es schafften, sich zur Insel durchzukämpfen, eine sichere Zuflucht.
Am Ende gelang dies nur ein paar hundert durchnässten, zerlumpten Überlebenden. Doch das Erreichen der Insel war, wie sich herausstellte, erst der Beginn der Zerreißprobe. Die Flüchtlinge waren in einer Welt aufgewachsen, in der man sich die Nahrung aus den Regalen holte, in der man Medizin in Geschäften kaufte und in der das Überleben des Einzelnen von seinen finanziellen Mitteln abhing und nicht von seiner Geschicklichkeit. Sie hatten jede von ihnen benötigte Information von ihren Bildschirmen abgelesen, und als diese Bildschirme verschwanden, stand ihnen kein Wissen mehr zur Verfügung, auf das sie hätten zurückgreifen können. Sie wussten nicht, wie man das Land bewirtschaftet, wie man in der Wildnis nach Nahrung sucht oder wie man die baufälligen Häuser repariert, auf die sie für ihr Obdach angewiesen waren.
Es kamen und gingen harte Jahre, und die Zahl der Überlebenden schrumpfte in sich zusammen. Fast jeden Monat wurde jemand von herabfallendem Mauerwerk erschlagen oder kam bei einem Brand ums Leben. Die Menschen rissen sich aus Versehen mit rostigen Nägeln die Haut auf und starben schweißgebadet und schreiend vor Schmerzen. Sie verwechselten giftige mit essbaren Pilzen und gingen während der Monate schwimmen, in denen es im Meer vor Quallen und Haien wimmelte.
Überleben war schwer, und Sterben war leicht, und viele gaben den Kampf von ganz allein auf. Doch zum Glück für den Fortbestand der Menschheit hinterließen sie Kinder, und diesem Genpool entstammen die heutigen Dorfbewohner.
Die drei Ältesten sind die einzigen Personen, die von den einhundertsiebzehn Wissenschaftlern übrig geblieben sind, die sich in Blackheath aufhielten, als der Nebel auftauchte, und in dem Blut, das durch ihre Adern fließt, sind immer noch all die Impfungen, Verbesserungen und technologischen Errungenschaften enthalten, die es gab, bevor die Welt endete. Sie altern nur langsam, bleiben von allen Krankheiten verschont und werden von den Dorfbewohnern mit einer instinktiven Ehrfurcht behandelt, die – wenn man Emory fragt – außer Niema keiner von ihnen verdient hat.
»Warum musst du so –« Seth presst die Stirn gegen das raue Holz des Bootsrumpfes. Er ist immerhin noch so freundlich, seine Gedanken nicht klipp und klar auszusprechen, aber nicht freundlich genug, um nicht immer wieder auf sie anzuspielen.
»Anders sein?«, führt sie seinen Satz zu Ende.
Er wirft frustriert einen Arm hoch, in Richtung des Gelächters und der Musik, die durch das offenstehende Tor zu ihnen herüberschallen. »Alle anderen sind glücklich, Emory. Sie sind einfach nur glücklich. Es ist nicht kompliziert. Sie wissen, was wir haben, und sie sind dankbar dafür. Warum musst du immer alles hinterfragen?«
»Aber was haben wir denn, Papa?«, fragt Emory mit leiser Stimme. »Ein Dorf, das in Ruinen liegt. Eine Insel, die wir ohne Erlaubnis nicht erkunden dürfen.«
»Weil es zu gefährlich ist«, ruft er automatisch dazwischen.
»Warum bekommen denn dann nicht alle Kinder in der Schule Überlebenstraining? Ich liebe Niema, aber willst du wirklich ernsthaft behaupten, dass Thea oder Hephaistos genug zum Wohl des Dorfes beitragen, um von allen Regeln ausgenommen zu sein, die der Rest von uns befolgen muss? Wie kann es gerecht sein, dass sie nicht mit sechzig sterben wie wir Übrigen? Warum müssen sie nicht ihr eigenes Gemüse anbauen oder in der Küche mithelfen oder beim Säubern der –«
»Sie tragen ihr Wissen bei!«
Emory zuckt bei diesem wütenden Ausbruch zurück, wie die Dunkelheit am Rand einer Kerzenflamme. Dieser Streit ist sinnlos, und sie weiß das nur zu gut. Ihr Vater wird nie auch nur für eine Sekunde an den Ältesten zweifeln oder begreifen, warum sie das tut. Je mehr sie mit ihm diskutiert, desto mehr wächst die Abneigung, die er für sie empfindet. Und dieses Fass ist schon im Begriff überzulaufen. Sie gibt sich geschlagen.
»Ich gehe zur Begräbnisfeier zurück«, sagt sie. »Möchtest du, dass ich Matis etwas von dir ausrichte?«
»Ich habe heute früh mit ihm gesprochen«, sagt er ein drittes Mal und bückt sich, um seinen Hammer aufzuheben.
6
Die Nacht rückt näher. Die Sperrstundenglocke läutet durch das Dorf. Jetzt haben die Dorfbewohner noch eine Viertelstunde Zeit, um ins Bett zu gehen. Die meisten von ihnen sind bereits im Innern der Kaserne, putzen sich die Zähne und zünden Zitronengrashalme an, um die Mücken fernzuhalten. In ihren Fenstern stehen fröhlich flackernde Kerzen, die ihren Schein in die Dunkelheit des Abends hinausschicken.
Jeder Schlafraum bietet bis zu acht Personen Platz. Sie schlafen in denselben Eisenbetten wie die Soldaten, die früher einmal hier stationiert waren. Ihre Matratzen sind mit Stroh und ihre Kopfkissen mit Federn gefüllt. Sie brauchen keine Decken. Selbst im Winter ist es viel zu heiß dafür.
Draußen im Kasernenhof befinden sich nur noch die Dorfbewohner, die gerade für die Aufräum- und Säuberungsarbeiten eingeteilt sind. Shilpa löscht die Kerzen auf den Tischen, während Rebecca, Abbas, Johannes und Yovel noch die letzten, bereits abgewaschenen Teller in die Regale der Außenküche räumen.
Die Eltern, zu denen auch Magdalene gehört, rufen nach ihren Kindern, die sich unter den Tischen versteckt haben. Während der letzten zwanzig Minuten sind die Erwachsenen ihnen von einem Schatten zum nächsten hinterhergejagt.
Die kleinen Ausreißer verraten sich durch ihr Kichern.
Als Emory durch das Tor kommt, werden die zappelnden Kinder gerade von den Erwachsenen, die schnell genug waren, um sie zu erwischen, in ihre Betten getragen. Jedes Kind hat zwar mindestens ein Elternteil, aber diese Bezeichnung hat vor allem eine emotionale Bedeutung. Kinder werden grundsätzlich vom ganzen Dorf erzogen. Nur so lässt sich diese Aufgabe bewältigen.
»Ich kann mich nie entscheiden, wer von euch beiden sich lächerlicher verhält«, sagt eine Stimme aus der Dunkelheit.
Emory schaut über den Hof und sieht Matis im Dunkeln auf einer Bank sitzen. Er tunkt gerade eine Scheibe Focaccia in eine Schüssel mit gesalzenem Olivenöl. Ein hübscher grüner Edelstein hängt an einer Schnur um seinen Hals.
Alle Dorfbewohner vermachen mir vor ihrem Tod ihre Erinnerungen – gesetzt den Fall, sie sterben nicht vollkommen unerwartet. Wenn sie ihre letzten Atemzüge tun, sammle ich sämtliche Erfahrungen ein, die sie jemals gemacht haben – selbst diejenigen, an die sie sich selbst gar nicht mehr erinnern können –, und bewahre sie auf unbegrenzte Zeit in einem dieser Edelsteine auf. Auf diese Weise können die anderen, wenn sie möchten, die von den Verstorbenen gemachten Erfahrungen selbst durchleben. Leider tragen die Dorfbewohner diese Erinnerungssteine nur während der Begräbnisfeier, weshalb sie mit den Steinen etwas Düsteres verbinden.
Neben Matis sitzt Niema und hält seine Hand. Ihre blauen Augen sind gerötet. Offenbar hat sie vor Kurzem geweint.
»Wie gewöhnlich hast du mitten in einem Gedankengang eine Bemerkung gemacht«, antwortet Emory. Sie ist nach dem Streit mit ihrem Vater immer noch ein wenig gereizt.
»Sei nett zu mir, ich sterbe«, sagt er, während er sich ein Stück Brot in den Mund stopft.
Emory sucht in seinem Gesicht nach irgendwelchen Anzeichen für die Angst, die er empfinden muss, aber er kaut begeistert vor sich hin, so fröhlich wie eh und je. Es ist nicht fair, denkt sie selbstsüchtig. Er ist stark und gesund. Wenn er ein Ältester wäre, würde er morgen früh aufwachen, so wie an jedem anderen Tag, der vorangegangen ist.
Sie will mehr Zeit mit ihm haben.
Sie will, dass ihr Großvater verlässlich in der Mitte ihres Lebens verwurzelt bleibt – dort, wo er immer gewesen ist. Wo er immer sein sollte. Sie will mit ihm frühstücken können, sie will zusehen, wie er mit seinen dicken Fingern mühsam das Fruchtfleisch aus einer Kiwi kratzt. Sie will ihn auf der anderen Seite des Kasernenhofs laut lachen hören. Sie will wissen, warum ein so guter Mensch wie er, ein Mensch mit so viel Talent und Energie, sterben muss, damit einer Regel Genüge getan wird, die lange vor seiner Geburt aufgestellt wurde.
»Ich lasse euch zwei mal allein, damit ihr euch unterhalten könnt«, sagt Niema, steht auf und legt Matis liebevoll die Hand auf die Schulter. Sie schaut ihn einen Moment lang an, bückt sich, flüstert ihm etwas ins Ohr, küsst ihn schließlich auf die Wange und geht.
»Was hat sie gesagt?«, fragt Emory.
»Fünf fünf«, antwortet er und fährt fort, seine Focaccia zu kauen.
»Was bedeutet das?«
»Keine Ahnung«, antwortet er und zuckt mit den Schultern. »Das sagt sie schon seit Jahren zu mir, immer dann, wenn ich wegen irgendetwas aufgebracht oder niedergeschlagen bin. Irgendwann habe ich sie mal gefragt, was das zu bedeuten hat, und sie hat geantwortet, es sei eine Landkarte der Zukunft. Aber sie ist nie dazu gekommen, es mir zu erklären.«
»Aber möchtest du das denn gar nicht wissen?«, fragt Emory empört.
»Natürlich möchte ich das. Nur wenn sie es mir hätte sagen wollen, hätte sie das sicher längst getan.«
Er wischt sich das Olivenöl und die Brotkrümel von den Händen, steht auf und hakt sich bei Emory unter.
»Wie war der Streit mit deinem Vater?«, fragt er, das Thema wechselnd. »Hat dich das vom Traurigsein abgelenkt? Ich nehme an, das war der Grund, warum du zu ihm hinuntergegangen bist.«
Emory wirft einen Blick zu dem Lichtkegel hinüber, den die Laterne unten in der Bucht wirft, und lächelt ein wenig. Es hat keinen Zweck, es zu leugnen.
»Ja, ich fühle mich tatsächlich ein wenig besser«, gesteht sie.
»Deinem Vater geht es wahrscheinlich ähnlich. Du bist genau wie er. Du läufst auf die Dinge zu, die dir Angst einjagen, und von den Dingen weg, die du liebst.« Er klingt, als würde ihn das vor ein Rätsel stellen. »Komm mit, ich habe meine Skulptur fertiggestellt. Ich würde sie dir gern zeigen.«
Sie gehen zu der Stelle im Kasernenhof, wo Matis schon die ganze Woche an seinem Werk gearbeitet hat. Die Skulptur von Emory steht auf Zehenspitzen und hat gerade einen steinernen Apfel aus dem echten Apfelbaum gepflückt, dessen Zweige sich über ihr ausbreiten.
»Gefällt sie dir?«, fragt er. Sie legt ihr Kinn auf seine Schulter.
»Nein«, gesteht sie.
»Warum nicht?«
Er ist neugierig, aber nicht beleidigt. Kunst ist im Dorf nichts Heiliges. Es ist eine derbe, fröhliche, gemeinschaftliche Tätigkeit. Gedichte werden infrage gestellt, noch während sie vorgetragen werden, und Bands wechseln einfach mitten im Stück ihre Musiker aus, falls diese aus dem Takt geraten. Wenn ein Schauspieler während eines Theaterstücks den Faden verliert, ruft ihm das Publikum die richtigen Worte zu oder erfindet bessere. Hier und da kann es auch vorkommen, dass jemand die Rolle einfach selbst übernimmt. Emory hat miterlebt, wie der gesamte erste Akt eines Stücks von einem Komitee nach der Hälfte der Aufführung komplett neu geschrieben wurde.
»Weil diese Gestalt da nichts sieht und keine Fragen stellt und glücklich ist, einfach nur hier zu sein«, antwortet sie. »Die einzige Person im ganzen Dorf, mit der sie nicht die geringste Ähnlichkeit hat, bin ich.«
Matis schnaubt vor Lachen und klatscht sich auf den Oberschenkel. »Und es gibt keine einzige Person außer dir, die mir eine solche Antwort gegeben hätte«, sagt er begeistert.
Emory starrt zu den vom Kerzenschein erhellten Fenstern der Kaserne hinauf, schaut zu, wie die Silhouetten im Innern hin- und hergehen, sich ihre Haare kämmen und für das Bett vorbereiten.
»Ich liebe das Dorf, ganz ehrlich«, sagt sie leise. »Aber ich kann nicht … Es gibt Dinge, die für mich einfach keinen Sinn ergeben, und alle anderen verhalten sich so, als ergäben sie Sinn oder als wäre es nicht wichtig, ob sie das tun.«
Ihre Gedanken wandern zu ihrer Kindheit zurück, zu dem Moment, in dem sie entdeckt hat, dass die Ältesten über die Sperrstunde hinaus wach bleiben dürfen. Selbst als Kind wusste sie schon, dass das ungerecht war, aber es schien niemandem sonst etwas auszumachen.
Ich habe ihr damals erklärt, dass die Dorfbewohner mehr Schlaf brauchen als die Ältesten, aber diese Antwort hat sie nicht befriedigt, insbesondere, nachdem sie einmal mit einem Splitter in der Ferse aufgewacht ist, der noch nicht da war, als sie sich schlafen gelegt hatte. Ein paar Wochen später entdeckte sie eine frische Schramme an ihrem Bein und dann blaue Flecken auf ihrem Arm. Jedes Mal hatte sie keine Ahnung, wie diese Blessuren dort hingekommen waren.
Ich versuchte, ihr einzureden, dass sie sich irrte, aber Emory war viel zu scharfsinnig, um eine so unverhohlene Lüge zu glauben. Sie fragte ihren Vater, was mit den Dorfbewohnern geschieht, nachdem sie eingeschlafen sind, aber er prangerte es schon als Blasphemie an, eine solche Frage überhaupt zu stellen. Sie fragte ihre Mutter, die so tat, als wäre sie zu beschäftigt, um zu antworten. Sie fragte Matis, der lachte und ihr die Haare zerzauste. Schließlich hob sie in der Schule die Hand und fragte Niema, die sie daraufhin aufforderte, nach dem Unterricht noch zu bleiben.
»Manchmal wecken wir euch nach der Sperrstunde wieder auf«, gab sie der jungen Emory gegenüber zu, nachdem sie zunächst ihren Mut gelobt hatte, eine solche Frage gestellt zu haben.
»Warum?«
»Damit ihr uns bei unseren Aufgaben helft.«
»Was für Aufgaben?«
»Das kann ich dir nicht sagen.«
»Warum erinnern wir uns nicht daran?«
»Weil es besser ist, wenn ihr es nicht tut«, antwortete Niema ein wenig schuldbewusst.
Nachdem Emory das Klassenzimmer verlassen hatte, erzählte sie allen im Dorf, was sie gerade erfahren hatte. Sie war sowohl von Ehrfurcht darüber erfüllt, welche Macht eine Frage haben konnte, als auch von Bestürzung darüber, wie wenig befriedigend die Antwort gewesen war. Sie hatte geglaubt, alle würden diese Enthüllung mit großem Erstaunen zur Kenntnis nehmen, aber die meisten ihrer Freunde reagierten mit einem Schulterzucken oder empfanden es als peinlich, dass sie so unverschämt gewesen war zu fragen.
Seitdem hat sich nichts geändert.
Ein düsterer Schatten liegt über dem fröhlichen, sonnendurchfluteten Leben, das die Dorfbewohner führen, doch außer ihr scheint sich niemand dafür zu interessieren, was sich in der Dunkelheit verbirgt. Manchmal, wenn sie während des gemeinsamen Abendessens ihre Freunde betrachtet, beschleicht sie das Gefühl, als seien sie ihr genauso fremd wie es die Ältesten sind.